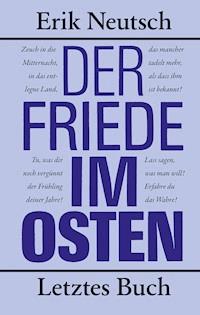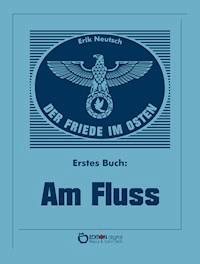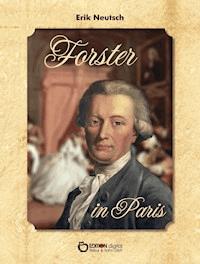7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser zweite Sammelband Erik Neutschs enthält Aufsätze und Reden, Interviews und Artikel, die er als „Ansichten zu Kunst und Literatur“ zusammengestellt hat. Erik Neutsch hat wie kaum ein anderer Schriftsteller, der mit und in der DDR gewachsen ist, zur jeweiligen aktuellen Situation in der Literaturszene Stellung genommen. Dabei hat er in den meisten Beiträgen aus konkreten Anlässen heraus vor allem die prinzipiellen ästhetischen Positionen der Arbeiterklasse — wie Parteilichkeit und Volksverbundenheit — gegen Angriffe, Schwankungen oder gar ein In-Frage-Stellen verteidigt. Auch was seinerzeit nur für den Tag geschrieben schien, wirkt heute aktuell, liest sich lebendig und interessant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Fast die Wahrheit
Ansichten zu Kunst und Literatur
ISBN 978-3-95655-012-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1979 im Verlag Tribüne Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2020 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Ein Feature über Willi Sitte: Wo es keine leeren Flächen gibt
Das Bild befand sich noch im Atelier, beherrschte, obwohl nicht viel größer als ein Quadratmeter Fläche, die gesamte Rückfront des Raumes. Ein Berg Farbe auf der Staffelei. Tonangebend, wenn ich mich recht erinnere, Olivgrün, Braun und warmes Gelb. Wuchtige Formen. Die Fläche teilend, ein spannungsvoller Bogen, breite, nach vorn gewölbte Schultern, dynamische Fortsetzung in der Armhaltung. Zwei Hände. Diese eine Tasse mit Kaffee führend, die andere, nahe im Vordergrund, mitten in der Bewegung, die unvermeidliche Zigarette zwischen den Fingern. Am merkwürdigsten aber war, der Mensch da hatte zwei Gesichter. Durchgestaltet, im Zentrum des Bildes, das eine, konzentriert, vital, offenbar einem Gespräch folgend und bereit, im nächsten Augenblick selber das Wort zu ergreifen. Dahinter, schon angeschnitten vom oberen Bildrand, das andere, das zweite Gesicht. Im Ausdruck jedoch deutlich zurückgenommen. Entspannt. Keine Spur mehr von der Ungeduld, von der – vielleicht sogar – Aggressivität des ersten. Still, blaß, empfindsam. Und das sollte ich sein? Beide Male ich? Streitbares Dickfell und Rührmichnichtan in einer Person? Kein Zweifel, die äußere Ähnlichkeit mit dem, was ich von mir aus Spiegeln und von Paßbildern kannte, war augenfällig.
Als Willi Sitte mich fragte, wie ich denn nun dazu stünde, wußte ich zunächst nichts zu antworten. Überraschung und noch mehr wohl Unsicherheit verschlugen mir die Sprache. So hatte ich mich noch nicht gesehen. Später einmal hing dann das Porträt im Foyer eines Theaters. Während der Pause blieben die Leute davor stehen. Ich drückte mich an ihnen vorbei. Wollte nicht erkannt werden. Ich fürchtete, sie müßten nun wissen, wie ich bin. Meine Gefühle waren ja da zur Schau gestellt. Sitte, empfand ich, hatte mich besser durchschaut als ich. Ich gab ihm die noch ausstehende Antwort: So, wie du mich gemalt hast, hätte ich gern, daß ich bin. Und noch später, heute, nachdem ich dem Bild nach sechs Jahren wiederbegegnet bin, in einer Ausstellung, glaube ich sagen zu können: Ja, zum Teufel, so bin ich.
Warum erzähle ich das? Doch nicht nur, wie leicht zu erraten, unserer Freundschaft wegen. Und natürlich weiß ich auch, daß man ein Bild, mit welchem Geschick auch immer, niemals beschreiben kann. Malerei ist nicht zu hören, und man wird sie, trotz aller diesbezüglichen Experimente von Physikern gegenwärtig, auch niemals hören können. Angesichts der Tatsache aber, daß mir eben hier nur Worte und Ätherwellen, die meine Worte übertragen, zur Verfügung stehen, habe ich dennoch den Versuch der Beschreibung gewagt, weil mir dieses erst nach Jahren abgerungene So-bin-ich symptomatisch für alle Sitte-Bilder der letzten Zeit zu sein scheint. Dort freilich wird es zum So-ist-es. „Leuna 69“, „Höllensturz in Vietnam“, „Ovid, die Liebe, Mensch, Ritter, Tod und Teufel“, all die hundertfachen Darstellungen unseres hiesigen Menschseins.
Wenn es eine Symbolfigur für Sittes Werk gibt, dann ist es der Rufer. Gewandelt in den Jahren. Doch stets gegenwärtig. Sitte ruft mit jedem Bild den Betrachter an. Anfangs, wie es auch mir erging, mag man die Sprache nicht gleich verstehen. Erst recht nicht beim flüchtigen Hinsehen. Beschäftigung wird verlangt, Auseinandersetzung, Anstrengung, Arbeit. Doch diese Arbeit ist bereits von jener Art, die Genuß bringt. Von seinen Bildern tritt man klüger zurück, als man vor sie hingetreten ist. Um dies zu zeigen, diente das obige Beispiel. Das Beispiel von einem, der sich selber betroffen sah.
Nicht immer stand man vor Sittes Bildern und nahm die Freude am Erkennen mit, genoß seine Malerei, indem man erkannte. Sich selber. Die Welt. Den Klassenfeind und die Klassenbrüder. Franz Josef Strauß und Angela Davis, den Gl in Vietnam und die vietnamesische Frau, die Notstandsritter und Emporkömmlinge und die Liebenden, Lachenden, Arbeitenden. Seit wann ist das so? Seit wann erhält er in Menge Briefe wie den folgenden?
Sehr geehrter Professor!
Ich sah heute in Halle Ihr Triptychon „Höllensturz in Vietnam“. Schon immer nach Besuchen in der Moritzburg und der Begegnung mit Ihrem Schaffen – ich denke dabei ebenso an den Frauenakt, der sich ein buntes Röckchen über den Kopf zieht, an das tanzende Liebespaar, an die Rufer-Bilder oder an das zutiefst erschütternde Werk, das Lidice gewidmet war – schon immer hatte ich vor, Ihnen einmal von meinem Affiziertsein zu sagen. Heute kann ich nicht umhin, sofort zum Stift zu greifen… Diese Kunst strahlt eine unsagbare Kraft aus. Emotionell und rationell ist sie gleich hinreißend. Die Leidenschaft (nicht zuletzt die parteiliche Leidenschaft) schlägt den Betrachter in Bann.
Mit den besten Wünschen für Ihr weiteres Schaffen
Jürgen Garbe
Der Brief ist hingeworfen, impulsiv geschrieben, so daß ich nicht einmal mit Sicherheit sagen kann, ob ich auch die Unterschrift des Mannes aus Leipzig richtig entziffert habe. Doch zurück zu der Frage: Seit wann erhält Willi Sitte solche Briefe, findet er Zustimmung bei der Mehrzahl seiner Betrachter?
Ein genaues Datum dafür zu nennen, wäre vermessen. Die Kunst und gar erst die Entwicklung eines Künstlers sind zu diffizil, als daß man sie schablonisieren könnte. Erfolg und Mißerfolg stehen oft dicht beieinander. Und trotzdem. Nach der ständigen Einsicht, die ich in den künstlerischen Werdegang Willi Sittes genommen habe, scheint mir, daß die Jahre 1963 bis 1965 für ihn von besonderer und entscheidender Bedeutung waren, daß er sich in dieser Zeit zu der Höhe aufschwang, auf der er sich heute befindet, die sich bei ihm in einer wahren Schaffensexplosion äußerte.
Das Werk „Die Überlebenden“ (1963) mag am Anfang der seither völlig eigenen, unverwechselbaren Malweise Sittes stehen. In den Jahren danach festigt sie sich und findet vielleicht in „Leuna 21“, 1965 und 66 gemalt, zur selben Zeit also, als auch das Porträt meines Namens entstand, ihre erste Abrundung. Von hier an nimmt Sittes Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, die ihn oftmals auch zu einer, wenngleich nicht unkritischen Übernahme modernistischer Formelemente verführte, einen eindeutig realistischen Weg, überwindet er das Starre, Statische vieler seiner vorangegangenen Bilder.
Dynamik und Vitalität prägen nunmehr den Charakter seiner Arbeiten, Intelligenz in der Farb- und Formgebung und das tiefe historische Erfassen eines jeden von ihm gestalteten, auch noch so unterschiedlichen Gegenstandes. Dynamik, Vitalität, Intelligenz und Geschichtsbewußtsein, sagte ich, die bestimmenden Charaktereigenschaften auch der sozialistischen Gesellschaft, der sich Sitte verpflichtet fühlt. Seine Kunst, finde ich, wird damit zum adäquaten Ausdruck des Sozialismus in der DDR. Sie konnte es werden, weil sich ihr Schöpfer zu Beginn der sechziger Jahre politisch und ideologisch mit der ihn umgebenden Gesellschaft und deren Führung vollauf identifizierte und weil ihn diese Identifizierung sowohl ästhetisch als dann auch künstlerisch befreite.
Das ist die Behauptung. Meine Behauptung. Doch hören wir dazu sogleich eine andere, völlig entgegengesetzte Meinung, zu lesen kürzlich in einer Zeitschrift, die sich für Politik und Kunst zuständig fühlt, geschrieben anläßlich der jüngsten Ausstellungen Sittes:
Sein merkwürdiger Stil zwingt Distanz auf… Was seine Kunst kennzeichnet, ist Intellektualität. In dieser Ausstellung wird man also nur selten schöne Malerei erleben können und gleich gar nicht große Zeichenkunst… Sollten da die Mittel zum Selbstzweck werden? Bei den Farbrinnsalen, diesen verschämt-unverschämten Tachismen, beginnt das ja schon. Sie tragen doch weder zur inhaltlichen Organisation des Bildes bei, noch bieten sie ästhetischen Genuß… Die Leser unserer Zeitschrift wissen, daß ich für Sitte schon zu einer Zeit eingetreten bin, da sein Werk nicht nur umstritten war, sondern heftig befehdet wurde…
Der Gerechtigkeit halber soll nicht unerwähnt bleiben, daß ich die hier zitierten Sätze dem Text unvollständig entnahm, und zwar nicht, um sie aus dem Zusammenhang zu reißen, sondern deshalb, um den eigentlichen Zusammenhang sichtbarer zu machen, die Tendenz dieser sogenannten Kritik. Denn die paar dem Willi Sitte auf die Schulter klopfenden Bemerkungen dazwischen würden die Substanz der Sache, um die es geht, nur verwässern.
Das also ist des Kritikers Kunststück: Er sei, sagt er, für Sitte schon zu einer Zeit eingetreten, als dessen Werk heftig befehdet wurde. An welche Zeit, fragt sich der Kenner sofort, ist wohl gedacht? Es kann sich doch nur um die Jahre vor 1958 handeln. Ja, damals wurde Sitte heftig kritisiert, „befehdet“. Doch wer übte die Kritik? Von wem wurde Willi Sitte kritisiert?
Man muß die Dinge beim Namen nennen und sie nicht zu mystifizieren versuchen. Die Partei setzte sich damals mit dem Maler auseinander, mit einem ihrer Genossen, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, mit der sich Sitte schon damals aufs längste und engste verbunden fühlte. Die Klasse, der er selber entstammt und in deren Auftrag er stets tätig sein wollte, die Arbeiterklasse sagte ihm ihre Meinung, nicht zu Unrecht, wie mir scheint, wenngleich auch nicht immer schon mit der gereiften Feinfühligkeit von heute. Das ist alles. Das ist auch in der Hinsicht alles, als sich Sitte, wie sein späteres Werk beweist, diese Kritik zu Herzen nahm. Ja, zeitweilig litt er darunter, was nur verständlicher macht, wie hoch er das Wort der Partei bis heute schätzte, arbeitete, zweifelte an sich und seinem Schaffen, war manchmal sogar am Verzweifeln. Aber schließlich, nach einem nahezu faustischen Ringen, brachte er sich mit seiner Klasse nicht nur politisch und ideologisch, sondern eben auch ästhetisch und konkret künstlerisch in volle Übereinstimmung.
Das Ergebnis liegt vor, gerade in Sittes letzten Ausstellungen. Es ist die schöpferisch erfolgte Lösung eines niemals antagonistisch gewesenen Konflikts im Schaffen eines Malers. Um Sittes Werk wurde nicht nur damals gestritten, sondern auch heute. Gestritten von den Menschen unserer Gesellschaft. Gestritten zumeist in dem Sinne, um zu neuen Denk- und Gefühlshöhen in Anbetracht seiner Bilder vorzudringen. Das ist produktiv, macht produktiv. Und insofern ist Sittes Werk natürlich nicht über jede Kritik erhaben. Es ist nur erhaben über jede Art destruktiver Kritik.
Distanzhaltung? Nein! Parteilichkeit zeichnet ihn aus. „Höllensturz in Vietnam“. „Leuna 69“. All die anderen Gemälde und Graphiken seit fast zehn Jahren. Wer in ihnen Distanz entdeckt, muß die falschen Bilder gesehen haben. Und Intellektualität? Ebenfalls nein! Intelligenz! Jene Intelligenz nämlich, die auch der echten Volkstümlichkeit innewohnt. Bleiben wir bei „Leuna 69“.
Es war nicht leicht, den reichen Ideengehalt dieses Werkes sofort voll zu erfassen, aber die erregende, aufwühlende Komposition ließ uns von Anfang an nicht los. Je länger wir davorstanden, um so eindringlicher empfanden wir: Das sind wir, wie wir anfingen und wie wir heute dastehen, wie wir lernten, unser Geschick in die eigenen Hände zu nehmen, zu planen und zu leiten.
So urteilt die Klasse, vertreten in diesem Falle durch die Brigade Rautenberg vom VEB Ausbau Berlin. Und das Kollektiv der Betriebsdirektion Methanol/Paraffine der Leunawerke sagt:
In alldem steckt eine schöpferische Unruhe, die uns heute schon in manchen Details noch zu ruhig ist. Wie leicht hätte es sich Sitte gemacht, wollte er sich ausgerechnet an dieser Dynamik vorbeimogeln und -malen… Unseres Erachtens unterstreicht Willi Sittes enormes Farbempfinden die Einheit eines großen und nicht weniger farbigen geistigen Prozesses in unserem Leben. Ist er da nicht ein willkommener Kampfgefährte an unserer Seite?
Und wenn einmal unter den Händen des Malers etwas weniger gelingt als dieses „Leuna 69“? Willi Sitte ist ehrlich genug, ist parteilich genug, zu bekennen:
Guttuso sagte einmal sinngemäß, er habe den Mut, auch schlechtere Kunst zu machen, aber er habe die Gewißheit, etwas sehr Nützliches zu tun. Ich finde, das ist genau meine Einstellung auch.
Vor allem diese Haltung, nicht in den Wolken von Farbe und Form zu schweben, sondern mit einem enormen Anspruch an das eigene Können stets Nützliches im Klassenkampf leisten zu wollen, mag mich veranlaßt haben, mit ihm, kaum daß ich von der Leipziger Universität nach Halle geschickt worden war, Verbindung zu suchen. Hinzu kam meinerseits eine beträchtliche Neugier auf das Phänomen Malerei, für mich eine Art Märchenland, eine schillernde, funkelnde, farbensprühende Welt, Reise in exotische Fernen, seit ich einmal als FDJ-Sekretär im Auftrage eines fortschrittlichen Direktors auch dafür hatte eintreten müssen, die Korridore unseres Realgymnasiums zur ständigen Kunstausstellung zu machen, ohne daß ich schon einen Dürer von einem Rembrandt hätte unterscheiden können.
Ich war zweiundzwanzig, als wir uns 1954 kennenlernten, Sitte zehn Jahre älter. Ich leitete die Kulturabteilung der Redaktion „Freiheit“ in Halle, und Sitte war gewonnen worden, die Kulturseiten zu illustrieren. Ich ging zum ersten Mal in sein Atelier, dasselbe, in dem ich seitdem ständiger Gast bin. Scheu war ich. Unsicher. Ich verteidigte den sozialistischen Realismus, wie ich’s gelernt hatte, mit allen Schablonen. Bis in die Nächte hinein dauerte dann unser Streit. Und ich lernte erneut, diesmal, die Kunst mit den Augen eines Malers zu sehen, daß nicht alles Gold war, was glänzte, und daß das Leben bunt, grau aber alle Theorie ist, wird sie nicht immerfort am Leben überprüft. Insofern ist Willi Sitte für mich auch ein Lehrer geworden. Ich hatte zu schreiben begonnen. Als Gegenleistung dafür, daß er mir seine Bilder zeigte – zu jener Zeit gerade die immense Menge von Zeichenstudien zu seinem Historiengemälde „Völkerschlacht bei Leipzig“ –, erzählte ich ihm von meinen literarischen Plänen und las ihm auch manchmal ein Manuskript vor. Unsere erste gemeinsame Arbeit übrigens veröffentlichten wir 1958. In der Zeitung. Er hatte eine Graphik gegen den Atomkrieg gebracht, protestierende Fäuste, dieselben Fäuste, die bis heute für ihn charakteristisch geblieben sind. Ich setzte einen Vierzeiler darunter und ließ mich dafür, noch einmal sei es erinnert, in Gemeinschaft mit ihm kritisieren.
Doch in den Nächten zuvor, während unserer Gespräche, hatte ich längst begriffen, woher Willi Sitte die oben zitierte Haltung nahm, Kunst als Waffe zu benutzen, etwas Nützliches zu tun. Ich erfuhr, daß er im zweiten Weltkrieg die faschistische Wehrmacht verlassen und sich auf die Seite der italienischen Partisanen geschlagen hatte. Eine mutige Entscheidung. Aber sie fiel nicht aus heiterem Himmel. Sie war längst vorbereitet. Er selber faßt sie als etwas völlig Normales in seinem Leben auf, sieht nichts Heroisches darin, nichts Sensationelles.
Da muß ich noch weiter zurückgehen. Mein Vater war ursprünglich Zimmermann auf dem Bau. Doch auch er war schon beeinflußt. Durch seinen Vater. Der war der erste sozialdemokratische Bürgermeister von Unterkratzau in Nordböhmen. Mein Großvater gehörte also zu den fortschrittlichen Leuten dort. Er war Landwirt und hatte auch viele Funktionen inne. Mein Vater und seine Geschwister sind in diesem Milieu großgeworden. Meine Mutter war eine Magd. Dienstmädchen bei Industriellen. Privat. Da haben sich beide kennengelernt. Und mein Vater hat dann den Beruf des Zimmermanns ergriffen. Das war ja damals ein Konjunkturberuf. Da wurde gebaut. Doch mit einem Male war’s aus. Zappenduster. Er kam zurück. Mit Bauen war nichts mehr. Das heißt, es war ’ne große Flaute nach dem Kriege, und er war arbeitslos. Und da sagte dann mein Großvater zu ihm: Da hast du ein Stück Land, du mußt es dir urbar machen. Und da hat er angefangen mit Gemüsebau. Auf einer ziemlich großen Fläche, doch sie war sauer. Sauerland war das. Er hat eine Drainage hineingelegt, hat entwässert und die Wiese urbar gemacht und sie dann bestellt. Und auf dieser großen Wiese hat er dann ein Haus gebaut, mit ein paar Bekannten, die Maurer waren.
Mein Vater gehörte mit zu den Begründern der KPC im Bezirk Kratzau. Auch er hatte viele Funktionen in der kommunistischen Partei. Wir unterhalten uns ja oft darüber. Er sagt: Du kriegst alles bezahlt. Du kriegst jede Fahrt bezahlt. Ich hab ein Fahrrad gehabt, und wenn ich zu einer Delegiertenkonferenz oder zu einer anderen Sitzung mußte, habe ich überlegt, nehm ich das Fahrrad oder den Zug. Es war überhaupt kein Problem, daß jeder, der eine Funktion hatte, seine Reisen auch selber bezahlte. Auch der Arbeitsausfall ging auf eigene Kosten. Mein Vater tat seine politische Arbeit mit Leidenschaft. Nun hat man ja immer so ein Erbteil davon, trägt man ja mit sich. So haben wir uns entwickelt. Meine Geschwister und ich. In diesem Milieu. Meine Mutter war ebenfalls in der KPC: Wenn ich zum Beispiel an Spanien denke. Wir wurden eben von unseren Eltern in dieser Richtung erzogen. Partei zu nehmen für die spanischen Klassengenossen. Für uns gab’s nichts anderes. Als die Faschisten nach Kratzau kamen, hatten die Eltern große Not mit uns Kindern. Daß wir keine Dummheiten machten. Wir wären ja geradezu anarchistisch veranlagt. Mit einem Haß fast gegen alles Deutsche. Meine Mutter ist Tschechin gewesen.
Dann haben sie mit der LPG in Thüringen angefangen… Mein Bruder batte dort bereits gesiedelt… Mit nichts angefangen. Da war keine Maschine, kein Pflug – nichts ist da gewesen. Sie kamen, wie ich sie gemalt habe. Meine Eltern auf der LPG. Und diese LPG war ein ausgeräuberter, ehemaliger Gutsbesitz gewesen, wo nichts anderes mehr da war, kein Draht, kein Nagel, nichts. Und auch das muß ich sagen: Wir sind damals losgezogen und haben uns so manches von den Feldern geklaut. Von den Großbauern. Die Räder vom Pflug oder sonstwas. Die hatten sich vorher ja auch bereichert. Wir haben also geholfen zu klauen. Dazu mußte man ja auch die Leute haben, die nichts verrieten. Das konnte man nur zusammen. Wir waren ja ein paar Geschwister, und so wurde das organisiert.
Mein Vater baute dann Pflüge, Wagen. Nach siebenundvierzig etwa. Eine Jauchepumpe, die kaputt war, verrostet, hat er wieder instand gesetzt. Wir hatten eine Hobelbank mitgebracht. Als Antifaschisten hatten wir aus der Tschechoslowakei Werkzeuge mitbringen können. Wir gehörten ja zu denen, die im Rahmen der Shukow-Aktion als Antifaschisten aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt wurden. Ich war mit auf dem letzten Transport. Ich leitete auch den letzten Transport aus dem Bezirk Kratzau in die sowjetisch besetzte Zone damals. Da nahmen wir auch die Werkzeuge meines Vaters mit. Und mit denen hat er dann gebaut. Er hat Ställe gebaut, Türen, alles, was es so gab, besser: nicht gab. Fenster, Handwagen. Es war unbeschreiblich, was er gemacht hat. Und dabei hat er auch noch uns geholfen. Zu bauen und zu zimmern. Das sind so die Leute, die alles können.
Plebejisch, proletarisch ist Sittes Antwort, plebejisch und proletarisch wie seine Herkunft und seine Erziehung. Kunst ist für ihn wie Arbeit. Sie soll nützlich sein. Diese Einstellung hatten ihm schon die Eltern vorgelebt. Wurde der Vater als Zimmermann arbeitslos, machte er eine Wiese urbar. Konnte er keine Häuser mehr bauen, baute er eben Gemüse. Die Ausbeuter besiegten ihn nicht, weder ideologisch noch sozial. Und als es hieß, in der neuen Heimat eine Gesellschaft zu errichten, in der endlich mit der Ausbeutung ein für allemal aufgeräumt wurde, tat er es wiederum praktisch. Aus dem Nichts schuf er Fenster und Türen, Pflüge und Wagen für die Leute, die seinesgleichen waren und dasselbe wollten wie er: zum ersten Mal in der deutschen Geschichte menschenwürdige Verhältnisse. Und als das Werk dann gelungen war, da hatte er die Ausbeuter besiegt.
Gewisse Ästheten jedoch begreifen nicht, woher ein Künstler der Arbeiterklasse seine Kraft nimmt, aus welchem Born er ständig schöpft. Sie stehen womöglich vor den Elternbildnissen Sittes, rügen hier einen Pinselstrich und dort ein Farbrinnsal. Aber den breiten Strom der Dankbarkeit eines Sohnes zu Vater und Mutter, der tiefen Achtung eines Sozialisten von heute vor einem in Sorgen, doch zugleich in revolutionärer Unbeugsamkeit geführten Leben, diesen Strom, der heiß aus den Bildern überfließt, den bemerken sie gar nicht.
Ich jedenfalls könnte sagen: So sehe ich auch meine Eltern. So sehe ich meine Herkunft.
Und noch ein anderes berührt mich angesichts der in solch schöner Schlichtheit dargestellten beiden Greise. Es sind die Fragen, die mich selber betreffen. Wo liegen die Wurzeln unserer Begabung? Wie entfaltete sich unser Talent?
Was Sitte angeht, hoffe ich im folgenden darauf noch näher eingehen zu können. Bündig jedoch sei vorerst geantwortet: Es ist und bleibt die Parteilichkeit, die unsereins schöpferisch macht, die Parteinahme für das schaffende Volk, die Gewißheit, selbst vom Volke zu sein.
Willi Sitte, noch einmal eine Diskussion mit skeptischen jungen Leuten in Westdeutschland rekapitulierend, formulierte das so:
Künstler ist ja nicht einer, der außerhalb steht. Sondern er ist mitverantwortlich. Unsere Genossen, die Partei und die Arbeiter- und-Bauern-Macht nehmen uns beim Wort und sagen so: Also wenn es Dinge gibt, die auch in eurem Bereich, überhaupt im Bereich der Kultur, nicht in Ordnung sind, dann können wir nicht irgend jemand verteufeln, sondern müssen selbst dafür Sorge tragen, die Verhältnisse zu verändern, die Zustände, also das, was nicht in Ordnung ist, zu verbessern. Das bedeutet, daß man nachdenken und überlegen muß. Und dann kommt man eben zu solchen Überlegungen, daß man sich verantwortlich fühlt für das Ganze. Weil man sich Kenntnisse über alle anderen Bereiche erwerben muß und vor allem darüber, wie unser demokratisches Prinzip von Grund auf funktioniert, wie unsere Leitungspyramide aussieht, ja, und wie unser Demokratismus funktioniert. Damit muß man sich beschäftigen, wenn man Erfolg haben will bei uns.
Das ist der Geist, mit dem Sitte heute seine Bilder malt, der Geist, der aus all seinen Bildern heute spricht. Die Liebe zur Republik und zu ihren Menschen, das Tätigsein für sie, das Sich-verantwortlich-Fühlen fürs Ganze. Nicht zufällig entstanden die drei Doppelbildnisse seiner Eltern innerhalb von nur vier Jahren, 1962, 1963 und 1966, die einen am Anfang, das andere am Ende jenes für seine Kunst so entscheidenden Zeitraums, in welchem er endgültig mit allem, was ihn von diesem Geist noch fortlocken wollte, gebrochen hat. Aus diesen vier Jahren, die zwischen den Bildern seiner Eltern liegen, dem Vertrautesten, was er bis dahin malen konnte, ging er geläutert hervor, tauchten Form und Farbe bei ihm wie Phönix aus der Asche.
Da sein Talent beizeiten entdeckt wurde, es für seine Ausbildung jedoch keine andere Möglichkeit gab, standen am Anfang seines Weges der Besuch der Kunstschule des Gewerbemuseums in Reichenberg und das Studium an der mit der Nazitheorie vom Entarteten vollgepfropften Meisterschule Malerei in Kronburg (Eifel). 1944 lief er zu den italienischen Partisanen über, kehrte die Waffen gegen die deutschen Faschisten und half seiner Neigung weiter, indem er auf billigstem Papier, zum Teil auf den Innenseiten von Zigarettenschachteln zeichnete. Nach dem Kriege arbeitete er in Mailand, Vicenza und Venedig. Dürer und Rembrandt und alle großen Meister standen ihm da wohl Pate. 1947 siedelte er nach Halle über, wenige Jahre später berief ihn die Burg Giebichenstein als Dozenten.
Sein Suchen ging weiter, bald nahm es Gestalt an, verdichtete sich in einer immer tieferen Auslotung von Inhalt und Form. Er stieß zunächst für sich in neue Bereiche vor. Ansätze zeigten sich bereits in solchen Bildern wie dem „Gruß zum Weltjugendtreffen“ (1950), für mich eines der klarsten und schönsten aus dieser Zeit, auch in den „Harpyien“, deren farbenprächtigste, wie ich meine, noch heute über meinem Schreibtisch hängt. Ausgeprägter erschienen dann seine Neuentdeckungen später in den Gemälden um die „Hochwasserkatastrophe am Po“ (1954). Zumindest hatte er da eine neuartige Sicht auf eins seiner ihn ständig begleitenden Themen gefunden: Die all ihrer Leiden zum Trotz das Schicksal besiegende, Geschichte machende Menschheit. Auch wenn er im selben Atemzug die etwa in der „Bergung I“ errungene Position mit dem breit angelegten, recht akademisch anmutenden Historiengemälde „Völkerschlacht bei Leipzig“ fast wieder zurücknahm, so war auch die Arbeit daran für ihn ein notwendiger Schritt.
Es war die Zeit, als wir uns kennenlernten. Ich sah, wie er sich mit unzähligen Skizzen, Studien und Zeichnungen an seinen Gegenstand herantastete. Sein Atelier hing voller Kartons. Heute verwarf er, was er erst gestern zu Papier gebracht hatte. Und ich begriff, daß er sich mit diesen Arbeiten zu einem Zeichner von Format entwickelte.
Danach geriet er dann mehr und mehr in den Bann von Malern, die in ihrer Kunst zwar einmalig, aber eben einmalig nur unter den Bedingungen des Kapitalismus waren, dieser von Grund auf menschenfeindlichen Gesellschaft, was sie selber zwar klar erkannten, ihrer Umwelt gemäß jedoch in eine spätbürgerliche Formensprache faßten. Picasso, glaube ich, war in dieser Beziehung lange Zeit sein Vorbild. Es geschah, was einer seiner mir bekannten besten Kritiker einmal „Im Licht und im Schatten von Guernica“ nannte. Unverkennbar: Wie Sitte schon früher Anleihen bei Max Ernst genommen hatte, so entlehnte er jetzt bei Picasso und Leger, bei den Mexikanern und den italienischen Neorealisten. War das sein vermeidbarer Umweg? War das gar sein künstlerischer Irrtum?
Neutsch: Was wir bei Picasso, Léger und, wenn du so willst, natürlich auch – in der Literatur ist das ja ganz ähnlich – sagen wir mal bei Eluard, Aragon und so, was man da beim einzelnen ungeheuer brisant findet…
Sitte: Ja, die habe ich auch sehr geschätzt.
Neutsch: Worauf ich hinaus will, mit diesem Jahr, ich sage mal: vierundsechzig, obwohl, man kann’s nicht mit einem Datum, auch nicht mit einem Jahr fassen… Das Problem ist doch, daß sie in einer Lage sind, in der wir nicht sind. Wir sind ja in einer völlig umgekehrten Situation der Kunst. Mit ihren Mitteln, mit ihren Formen, mit ihren Möglichkeiten ist das durchaus machbar, diese menschenfeindliche, kapitalistische, imperialistische Gesellschaft anzugreifen. Es ist dagegen nicht möglich, glaube ich, mit diesen Mitteln der Kunst, mit diesen Formen, mit dieser Ästhetik eine neue Gesellschaft auszudrücken.
Sitte: Ich würde da etwas differenzieren, Erik. Und zwar ist es so, daß zum Beispiel Léger versucht hat, in seinem späteren Werk Arbeiter darzustellen. Es gibt eine Fülle von Zeichnungen und Bildern von ihm. Ich denke, seine vielen Bauarbeiter, die… Er war ja nun mal sehr eng mit der Architektur verbunden…
Neutsch: Aber was für Arbeiter! Ich meine: das Thema Arbeiter, der Unterdrückte, Kämpfende, ja.
Sitte: Das war der neutrale Arbeiter. Und zwar… Er hat ja in Frankreich gelebt. Und er lebte im Kapitalismus. Und für ihn bedeutete das einen ungeheuren, auch qualitativen Sprung erkenntnismäßig, sich auf einen Gegenstand zu orientieren, den es für ihn früher nicht gab.
Neutsch: Ja, das ist richtig.
Sitte: Bloß das ist ja mittlerweile auch Geschichte. Das ist Historie, nicht? Und wir haben mittlerweile auch ein Stück Geschichte angefügt. Wir haben sie mitgestaltet, mitgeformt, diese Geschichte und die Menschen. Die Arbeiter, die sich in der sozialistischen Gesellschaftsordnung entwickeln, entwickeln sich natürlich unter völlig anderen Bedingungen als die in Frankreich. Und deswegen haben wir heute eine andere Auffassung vom Menschenbild, als Sozialisten, die die sozialistische Gesellschaft mitgestalten helfen. Neutsch: Diese Parteinahme für die Arbeiterklasse im Kapitalismus, im Imperialismus, das ist möglich. Aber ich glaube ganz sicher, es ist keine… Es ist nicht möglich…
Sitte: Picasso hat ja nie Arbeiter gemalt.
Neutsch: Und selbst, wenn, meine ich. Mag ein Künstler auch noch so groß sein, meine ich … Wir wissen, was wir von Picasso zu halten haben. Das ist gar keine Frage…
Sitte: Ein ganz Großer. Eine säkulare Erscheinung.
Neutsch: Aber weder auf dem Gebiet der Literatur noch auf allen anderen Kunstgebieten, eben auch nicht in der Malerei ein Maler, der unter diesen Bedingungen des Kapitalismus lebt, glaube ich, daß der eine Kunst oder eine Ästhetik oder eine Umsetzung der Ästhetik in Bilder, in Literatur entwickeln kann, die der neuen, dieser neuen historischen Dimension der befreiten Arbeiterklasse, der herrschenden Arbeiterklasse gerecht werden kann. Woher soll er das nehmen?
Sitte: Das muß nicht bedeuten, daß unsere Kunst, die wir heute machen, besser sein muß als die von Picasso. Das bedeutet das nicht.
Neutsch: Wir müssen mit unserer Kunst von uns ausgehen.
Sitte: So ist es.
Was heißt denn das wirklich: Von uns ausgehen! Doch wohl von den Menschen in diesem Lande, den gesellschaftstragenden Kräften. Wie denken und fühlen sie? Wie arbeiten sie, wie leben sie? Was ist anders geworden an dem Menschen, der sich von Ausbeutung und Unterdrückung befreit hat, der sein Schicksal in die eigenen Hände nahm? Von uns ausgehen, das bedeutet, ausgehen von dem, was uns täglich umgibt, was aber mit jedem neuen Tag mehr in die Zukunft der Menschheit weist.
Kunst ist nicht für die Vitrine da, unter Ausschluß der Öffentlichkeit, und auch nicht zur reinen Gotteserbauung. Kunst soll, wie alles in der Welt, der politischen, sozialen und geistigen Befreiung des Menschen dienen. Und weder Stilleben noch Naturgedicht, mögen sie formal auch noch so gut gemeistert sein, bringen den Menschen Kunde von der inzwischen bei uns real existierenden Welt des sozialistischen Humanismus, sondern Bilder und Bücher, die sich dem großen Thema der revolutionären Umgestaltung unseres Landes stellen. Und hat man sich erst einmal zu diesem Standpunkt durchgerungen, was liegt dann näher, als bei denen in die Schule zu gehen, die den geschichtlich bestimmenden Anteil an diesem Entwicklungsprozeß haben, die den Reichtum und die Schönheit unserer Republik täglich mit ihrer Hände und ihres Kopfes Arbeit produzieren? Erst wenn das getan ist, werden auch ein schöner Anblick und ein zierliches Naturgedicht ihre Existenzberechtigung haben. Willi Sitte sagt:
Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, daß ich ja schon seit siebenundvierzig in die Betriebe gelatscht bin, eine Fülle von Zeichnungen entstanden sind, einfach nur registrierende. Ich habe gedacht, du gehst dahin, zeichnest viel, und dann wird schon irgend etwas daraus werden. Doch hinterher ist so gut wie gar nichts entstanden. Ich habe emotionale Beziehungen zu den Arbeitern gehabt. Aber mir fehlten die Mittel. Außerdem wußte ich ja im Grunde genommen gar nicht richtig, was ich dort überhaupt wollte. Das ist bei mir einfach nur ein emotionales Element gewesen, daß ich mir sagte: Du gehörst irgendwie dahin, du mußt da hingehen und zeigen, ich gehöre zu euch. Ja, ich bin da.
Ein solches Bekenntnis, finde ich, ist Gold wert. Ihm fehlten die Mittel, um das, was er entdeckt hatte, künstlerisch zu erschließen und sichtbar werden zu lassen. Ihm fehlte vor allem die Einsicht in das, was er eigentlich tat. So entstand (1950) die „Ziegelputzmaschine“, ein Ding, kennt man die Bilder Sittes von heute, das gar lustig anzuschauen ist. Hätte er nicht nach einem solchen mageren Ergebnis entmutigt sein können? Vielleicht war er es auch. Doch er gab nicht auf.
Die Partei sagte, er solle weiter in die Betriebe gehen, und Sitte ging, weil die Partei nicht lockerließ. Waggonbau Ammendorf, Chemiewerke Buna und Leuna.
Als er sich dann bereits auf einer höheren Stufe mit der Welt des Arbeiters, mit der Arbeitswelt auseinandersetzte, hatte ich ihn inzwischen kennengelernt und schrieb an einem Roman. „Spur der Steine“. Meine Leser werden sich erinnern, daß in ihm auch ein Maler namens Voss auftaucht.
„Kunst ist Arbeit“, sagte Voss, „gleichgültig, auf welcher Seite eines Bildes man steht. Hinter ihm, indem man es gleichsam als sein Gesicht ausgibt, oder vor ihm, hinschauend. Ob einer selbst schöpferisch tätig ist oder ob er sich nur als Betrachter fühlt. So scharf übrigens sind die beiden Standpunkte nicht voneinander zu trennen. Kunsterlebnis benötigt das eine und das andere.“
Kati antwortete: „Kunst ist Vergnügen.“
Voss sagte: „Das sind keine Gegensätze: Kunst und Vergnügen. Das eine ist nur der Beginn, das andere die Folge. Arbeit, schon im Prozeß, bereitet Vergnügen.“
Abgesehen davon, daß ich auch beim heutigen Lesen dieser Stelle nicht ein Wort zurücknehmen möchte, will ich vor allem sagen, daß ich diesen Voss nicht hätte erfinden können, wenn ich nicht Willi Sitte aus dieser Zeit gekannt hätte. Das muß seine Theorie gewesen sein. Und ich finde, sie ist bis heute stichhaltig.
Bei dieser Gelegenheit will ich, da ich oft gefragt wurde, ob Voss denn Sitte sei, richtigstellen: Nein, Voss ist nicht Sitte, Sitte nicht Voss. Manches von ihm, gewiß, ist in die literarische Figur eingegangen, aus seinem Leben, von seiner Kunstauffassung und von seiner Art zu malen damals. Anderes dagegen, vieles andere nicht.
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ich ihn mit meinem Schaffen beeinflußt habe. Was allerdings mich betrifft, weiß ich genau, daß ohne Sitte kaum eine meiner literarischen Arbeiten so entstanden wäre, wie sie vorliegt. Er illustrierte bereits, wie erwähnt, die Kulturseiten der „Freiheit“, für die ich verantwortlich zeichnete und auf denen auch manchmal eine Reportage von mir abgedruckt war. Er illustrierte meinen Band Erzählungen „Die anderen und ich“ und meinen Roman „Auf der Suche nach Gatt“. Gemeinsam mit Dieter Rex schuf er die Bühnenbilder zu meinem Schauspiel „Haut oder Hemd“ und zu der Oper „Karin Lenz“, deren Libretto ich schrieb. Was mich mit Sitte jedoch stets am meisten verband, ist wohl das uns beiden gemeinsame Bemühen, die Welt der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Führung künstlerisch gültig zu gestalten. Ich literarisch, er malerisch.
Zu Beginn der sechziger Jahre also war er in diesem Bestreben einen beträchtlichen Schritt vorangekommen. Das Triptychon „Arbeiter“, das Polyptychon „Unsere Jugend“. Sie mögen für vieles andere aus dieser Zeit stehen. Doch in ihnen war die Arbeiterwelt noch sehr statisch erfaßt. Schön, herkömmlichen Sinnes, in den Formen, noch schöner, ohne Zweifel, in den Farben, aber von einer eigenartigen Glätte, starr zum Beispiel, nicht tanzend, wenn man das Tanzpaar nimmt, nahezu idealisiert bis zur Gleichförmigkeit der Gesichter, flächig, wie im Spektrum gegeneinandergestellt die Farben, weit noch entfernt also alles von der Bewegtheit dialektischer Beziehungen.
Sitte: Der große Eindruck, das Erlebnis war, daß ich mich einfach nur mit dem Gegenstand beschäftigen sollte. Und zwar ganz groß. Um zu überprüfen: Wo stehst du eigentlich. Und dann sagten manche: Warum so groß? Weil diese Größe mir liegt. Da war nichts in Auftrag gegeben. Ich habe mich damit abgequält und hinterher festgestellt, daß es natürlich in der ganzen Größe auch alle Fehler, Mängel, Unvollkommenheiten, falschen Denkweisen enthielt.
Neutsch: War doch völlig notwendig.
Sitte: Für mich war es notwendig.
Ja. Es gehörte zu dem gigantischen Ringen um neue Standpunkte und neue künstlerische Ausdrucksmittel, dem er sich unterzog. Wenig später, in jenem nach meiner Ansicht für ihn so entscheidenden Jahr 1964, malt er dann die Karbidarbeiter, die Männer im Wasser und unter der Dusche, den Rufer II und die Wassersprünge. Die Bewegung zieht in seine Bilder. Er nimmt Verbindung mit der Brigade Heinicke aus den Bunawerken auf. Die Kollegen sitzen in seinem Atelier. Gegenseitig befruchtende Diskussionen. Das Bild „Brigade Heinicke“ entsteht. Und schließlich malt er „Leuna 69“, erreicht damit eine Höhe, wie sie vorher in unserer Malerei nicht anzutreffen war. Siehe oben: Dynamik und Vitalität, Intelligenz und Geschichtsbewußtsein. Sitte ist spätestens mit diesem Bild zum Maler der befreiten, herrschenden Arbeiterklasse in unserer Republik geworden.
Darüber, was er während seiner Studien zu diesem Bild in Leuna II dachte und empfand, kann authentischer wohl niemand als er selber Auskunft geben. 1967, noch in der ersten Arbeitsphase steckend, schrieb er:
Regiepult. Vielleicht ist noch eine junge Frau da, die etwas in ein Buch einträgt. Vielleicht auch zwei Männer mit weißen Schutzhelmen, die nicht sehr laut miteinander sprechen. Der eine schaut dabei vom Steuerraum aus zu den Kracktürmen der Benzinspaltanlage. Der Mann am Regiepult – in seinem Gesicht glaube ich abwechselnd Gelassenheit und höchste Konzentration beobachten zu können. Nicht wesentlich verschieden von dem eines Busfahrers oder dem eines diagnostizierenden Arztes… Der Raum, in dem scheinbar nichts passiert, außer daß abwechselnd farbige Lichtpunkte auf Schalttafelwänden aufleuchten und ab und zu Knöpfe durch den Mann betätigt werden, ist eine hochwichtige Zelle, vielleicht überhaupt das Gehirn eines sozialistisch gelenkten Chemiegiganten … Wo bleibt der Augenschmaus des Künstlers? Adolph Menzel wäre enttäuscht. Er müßte angesichts dieser veränderten Situation die Pinsel strecken, wollte er nicht die langweiligsten Bilder malen… Umfassende Erfahrungen und optimales Wissen sind notwendig, um die geschilderte Situation in eine neue optische Qualität, in eine neue Realität, sozusagen in eine künstlerische Wirklichkeit gebündelt, zu transportieren. Das ist leicht gesagt. Unsere von Grund auf veränderte Umwelt verlangt auch in der Kunst neue Ausdrucks- und Darstellungsmittel, neue Methoden, bisher unbekannt, um ihr in voller Verantwortung gerecht zu werden, um auf sie zurückwirken zu können. Der konventionelle Sehschlitz ist für den Sozialismus zu eng geworden.
Da haben wir Sittes künstlerisches Programm. Welch eine Entwicklung auf dem langen Weg des Künstlers von der politischen Übereinstimmung mit seiner Klasse bis zu einer ihr angemessenen Ästhetik, die zugleich Sittes Talent und Temperament entspricht.
Ich habe emotionale Beziehungen zu den Arbeitern gehabt. Aber mir fehlten die Mittel. Außerdem wußte ich ja im Grunde genommen gar nicht richtig, was ich dort überhaupt wollte…
So Willi Sitte 1947. Und etwa zehn Jahre später:
Der große Eindruck, das Erlebnis war, daß ich mich einfach nur mit dem Gegenstand beschäftigen wollte. Um zu überprüfen: Wo stehst du eigentlich…
Schließlich schreibt er 1967:
Der konventionelle Sehschlitz ist für den Sozialismus zu eng geworden.
Stets das Ganze zu wollen und keine Halbheiten zu dulden, auch als Mensch, als Kommunist, politischer Funktionär im Verband Bildender Künstler und Erzieher an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung, stets die ganze Welt in seine Bilder zu holen, nicht nur einen Ausschnitt, das ist sein Anliegen, und es war, scheint mir, bereits zu erkennen, als er „Lidice“ malte (1956) und den „Kampf der Thälmannbrigade“ (1958). Triptychen, Polyptychen werden für ihn charakteristisch, und selbst dort, wo er das normale Format wählt, scheinen seine Bilder den Rahmen sprengen zu wollen. Der Zyklus „Im Geiste Lenins“ (1969) ist dafür ein beredtes, einmalig gelungenes Zeugnis. Weite und Tiefe, Vielfalt und Größe, die Erkenntnisse des wissenschaftlichen Sozialismus und die Erfahrungen des Klassenkampfes seit mehr als hundert Jahren vereinigen sich dort. Nicht nur, möchte ich behaupten, in jenen Bildern, die sich ausgesprochen geschichtlichen Themen aus Vergangenheit und Gegenwart zuwenden, „Höllensturz in Vietnam“, „Leuna 2“, „Son My“, sondern eben auch in den intimeren Arbeiten, den Rufern, Duschenden und Badenden, den Lachenden und Arbeitenden, in seinen Persönlichkeitsporträts, die er noch viel zu selten malt, bei den „Spielenden im Wasser“ genauso wie beim „Gestürzten Mars“, beim „Gekreuzigten“ wie bei den „Mädchen mit Fahne“, in jeder Liebesszene und in jedem Akt.
Er schmeichelt dem Volk nicht, nein, denn er hat es nicht nötig, da er selbst aus dem Volk kommt. Er läßt uns teilnehmen an uns, wie wir sind, an unserer Welt, wie sie ist. Er tut es mit Leidenschaft und eben gar nicht mehr mit Distanz. Er ist ein Realist und kein Hippy. Seine Menschen schwitzen auch, manche stinken. Und ob da ein Mann ein Mädchen liebt oder mit einer Flasche Bier seinen Durst stillt, ob uns Lenin anschaut oder die Familie am Meer, die kanonenrohrstarrende Freiheitsgöttin oder Angela Davis, stets sind sie gesehen mit den Augen der Arbeiterklasse, die einen ironisch, die anderen mit Verachtung, die einen mit Augenzwinkern, die anderen mit Bewunderung, die einen mit ergreifendem Pathos und die anderen mit nicht minder ergreifendem Abscheu, jeder, wie er’s verdient im Sinne des Geschichtsbewußtseins und des Lebensgefühls der befreiten Arbeiterklasse, eingesetzt in dem Bestreben, die Welt wie das Schicksal des einzelnen zum Guten zu verändern.
Sein Werk, scheint mir, mit einem Wort gekennzeichnet, ist das Werk der Übergangsperiode. Eine ganze historische Epoche, vom Kriegsende bis zur sozialistischen Gegenwart, findet darin ihren Niederschlag. Manchmal, sitze ich ihm in seinem Atelier gegenüber, wundere ich mich, daß er es sein soll, der das alles geschaffen und geschafft hat. Wie kann ein Mensch wie er, frage ich mich, von dem so etwas wie Stille, Bescheidenheit, fast Zurückhaltung ausgeht, sich derart vital in seinen Werken äußern?
Die Antwort darauf habe ich im vorliegenden Text zu geben versucht. Neue Antworten, dessen bin ich mir sicher, werden noch gefunden werden müssen. Sitte malt ja weiter.
Mai 1972
Aufsätze
Literatur als Parteiarbeit
Kürzlich sollte ich in einem unserer großen Chemiebetriebe aus der „Regengeschichte“ lesen. Bereits einige Stunden vor dem vereinbarten Termin suchte ich die Abteilung auf, um mich in ihr ein bißchen umzusehen. Die Bibliothekarin hatte mich, in guter Absicht sicherlich, als Schriftsteller angekündigt. Die Ahnungslose, sie wußte ja nicht, was sie damit angerichtet hatte. Überall begegnete ich zwar äußerst höflichen, aber nicht ungezwungenen, ja, beinahe ehrfürchtigen Frauen und Männern. Der junge Meister, nicht älter als ich, der mich durch die Werkhalle begleitete, redete mich fortwährend mit „Herr Schriftsteller“ an und benahm sich auch sonst völlig verdreht. Mir wurde das zuviel, und ich sagte: „Hören Sie zu. Ich bin gar nicht der, für den Sie mich halten. Ich bin Redakteur bei der FREIHEIT (der Zeitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Bezirk Halle).“
Der Meister mißtraute mir, verlangte meinen Presseausweis. Ich zeigte ihn, und sofort merkte ich, wie eine wärmende Märzsonne die Kaltwetterperiode auf seinem Gesicht durchbrach. Ich hatte zwar von meinem Nimbus eingebüßt, aber mein Begleiter redete mich auf einmal wohltuend mit „Genosse“ an, sprach wieder menschlich und versuchte auch nicht mehr, mir ein Bild von seinem Betrieb vorzugaukeln, an das er wohl selbst nicht glaubte, sondern berichtete mir von vielen Freuden und Sorgen.
Ähnliches ist mir oft widerfahren, und ich fragte mich stets, warum denn das Mitgliedsbuch des Schriftstellerverbandes nicht die gleiche Wirkung hervorzurufen vermag wie der Ausweis einer allgemein geachteten Redaktion. Es liegt an dem Unterschied, meine ich, den die meisten Menschen in unserer Republik noch immer zwischen einem Schriftsteller und einem Redakteur der Parteipresse machen, dem Unterschied in der praktisch-politischen Haltung, der zwischen beiden eigentlich nicht mehr bestehen sollte.
Der Parteijournalist ist für viele von ihnen längst zum politischen Aktivisten geworden, dem man sich anvertrauen kann, nicht aber der Schriftsteller. Schuld daran sind sicherlich nicht die Arbeiter, die Bauern, all die anderen.
Wir Schriftsteller verlangen oftmals oder wünschen zumindest, daß die Helden, die wir bereits gestaltet haben, den Lesern als Vorbilder dienen mögen. Wir selber sollten uns aber auch die Helden unter unseren Lesern, die noch immer unserer Gestaltung harren, zum Vorbild nehmen. Es sind der Parteisekretär, der Gruppenorganisator, der Gewerkschaftsvorsitzende, der Vertrauensmann, alle diejenigen Genossen, die den Sozialismus im Herzen tragen und ihn gern auch in andere Herzen tragen möchten, die unermüdlich gegen Schwierigkeiten kämpfen und dabei selbst große Schwierigkeiten haben, die noch Fehler machen und schon das Richtige tun. So wie sie sollte der Schriftsteller bereit sein, überall, wo er auftritt, zu verändern und sich selbst verändern zu lassen.
Vor eineinhalb Jahren etwa gab es auf den Chemiebaustellen unseres Bezirkes Planrückstände, die Kummer bereiteten. Die Redaktion beauftragte mich, den anstrengenden Kampf, den die gesamte Bezirksparteiorganisation damals gegen diesen Mißstand führte, in der Zeitung wirksam zu unterstützen. Damals wurde auf einer der bedeutendsten Baustellen eine Methode entwickelt, die bald als komplexe und industrielle Bauweise in der gesamten Republik bekannt wurde. Ich widmete mich intensiv dieser Neuerung und versuchte, sie mit Hilfe der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit auf andere Baustellen zu übertragen. Dabei stieß ich auf zähe Hindernisse, oftmals organisatorischer, meist aber ideologischer Art. Ich war gezwungen, Meinungen zu widerlegen, die vom althergebrachten Zunftgeist bis zum Unverständnis gegenüber den Grundfragen unserer Politik reichten. Ich mußte mithelfen, das Denken auf den Baustellen zu verändern.
Doch wir wollen hier offen reden. Ich hatte den Auftrag der Redaktion nur mit Unlust und sogar mit einem gewissen Widerwillen angenommen. Vorher war ich noch nie länger als eine Rauchpause auf einer solchen Riesenbaustelle gewesen, hatte mich vielmehr sehr stark mit den Chemiebetrieben angefreundet. Ich verzweifelte nicht nur einmal, wenn ich neuerdings von einer dieser Baustellen, denen ich meine Zuneigung nicht schenkte, zurückkehrte und kaum einen Erfolg sah. Mehr als einmal wollte ich vor der Aufgabe, die mir die Partei übertragen hatte, kapitulieren. Bis ich schließlich eines Tages einen Weg durch den Wirrwarr fand, der mich bisher kopflos gemacht hatte. Ich ging diesen Weg, tastete ihn mit jedem Meter ab und entdeckte bald, daß ich Erfahrungen sammelte. Da freute ich mich plötzlich und war froh, nicht kapituliert zu haben. Wenn ich daran zurückdenke, so fühle ich mich selbst durch den Kampf auf den Baustellen erzogen, verändert.
Von einigen Schriftstellern wurde mir gesagt, das sei nicht die Aufgabe des Schriftstellers, was ich mir auf den Baustellen geleistet hätte, sondern die der Parteifunktionäre. Vielleicht haben sie recht, wenn sie den Umfang solcher Bemühungen meinen. Aber ich frage, worüber der Schriftsteller heute mit Bauarbeitern diskutieren will, wenn nicht über den Objektlohn, über die sozialistische Gemeinschaftsarbeit, über die Probleme des Krieges und des Friedens, kurz: über die Politik von Partei und Regierung, an deren Für und Wider vor allem die menschlichen Konflikte beim Aufbau des Sozialismus sichtbar werden? Ich jedenfalls war nach solchen Diskussionen stets klüger als vorher, und gegenwärtig, da ich einen Roman über das Leben der Bauarbeiter konzipiere, bilden sie für mich die wertvollsten Vorstudien.
Manchem Schriftsteller bin ich begegnet, der einen Betrieb durchwanderte, als besichtige er einen zoologischen Garten, einmal hin, einmal her, die Arbeiter betrachtet wie Schaustücke. Danach gaben sich diese Schriftsteller dann meist enttäuscht, weil sie entweder Menschen vorgefunden hatten, die sich mit tausend Alltagssorgen herumschlugen und somit nicht den Kenntnissen über den Homo sapiens laboriosus aus den Lehrbüchern entsprachen, oder statt ihrer widerspruchslose Schemen, die mit ihnen, da sie sie nur nach dem Wetter befragt hatten, völlig einer Meinung gewesen waren (Was hätten sie denn sonst auch tun sollen!). Das eine wie das andere kann nur dazu führen, sobald es literarischen Niederschlag findet, die Wirklichkeit übel zu verzerren.
Ich möchte an einen Rat Goethes erinnern, den er jungen Schriftstellern gab. In seiner Schrift „Noch ein Wort für junge Dichter“ heißt es: „Man halte sich ans fortschreitende Leben und prüfe sich bei Gelegenheiten; denn da beweist sich’s im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig waren.“ Besonders wir Jungen, die wir uns mit unserer Feder dem Aufbau des Sozialismus ohne jegliches lähmende Ressentiment verschworen haben, täten gut daran, uns nach diesen Worten zu richten und eigentlich dem nachzustreben, was uns unsere heutigen Lehrmeister vorgelebt haben: Willi Bredel, Anna Seghers, Hans Marchwitza, Otto Gotsche, viele andere und natürlich auch die sowjetischen Schriftsteller, allen voran Scholochow. Sich ans fortschreitende Leben zu halten, bedeutet, so glaube ich, nicht als ein peinlich auf Distanz bedachter Beobachter, sondern als leidenschaftlich Wirkender am sozialistischen Leben teilzunehmen. Sich bei Gelegenheiten zu prüfen, das kann nicht geschehen, wenn man hin und wieder einmal einen Arbeiter betrachtet, sondern wenn man sich zu jeder Stunde vielfältig und mit tausend Fäden mit jener Klasse verbunden weiß, die im Mittelpunkt unserer Epoche steht, der Arbeiterklasse, wenn man ihre Ideologie vertritt und sich im täglichen Meinungsstreit stählt. Alles andere ist, will man sozialistisch schreiben, Schaumschlägerei.
Es ist mittlerweile fast schon zu einer Gepflogenheit geworden, daß Schriftsteller mit Betrieben, Brigaden oder landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften feste Freundschaft schließen. Ich selbst bin Mitglied einer „Brigade der sozialistischen Arbeit“ aus dem Chlorbetrieb III des Elektrochemischen Kombinats Bitterfeld, habe dort körperlich mitgearbeitet, das Kollektiv festigen geholfen und mit den Angehörigen der Intelligenz und den Arbeitern meine Erzählungen beraten. Für den literarischen Schaffensprozeß des sozialistischen Schriftstellers halte ich eine solche Praxis für unumgänglich, für notwendig. Doch es besteht dabei auch die Gefahr, daß solcherlei Praxis leicht zum Praktizismus führt und in nachfolgenden literarischen Äußerungen eine Art Tyrannei der Erfahrungswerte errichtet wird. Notwendiger, unumgänglich ist deshalb für den sozialistischen Schriftsteller, daß er sich die Fähigkeit aneignet, den menschlichen Konflikt, der ihn zu künstlerischer Gestaltung reizt, als eine gesellschaftliche Erscheinung, als den besonderen Teil eines allgemeinen Ganzen, das heißt parteilich zu erkennen und darzustellen. Das jedoch ist nach meiner Meinung nur möglich, wenn der Schriftsteller zum politischen Aktivisten wird, wenn er sich in den Kampf der marxistisch-leninistischen Arbeiterpartei einordnet, wenn er die Literatur als Parteiarbeit auffaßt.
Ich gehöre zu den Schriftstellern, die unmittelbar durch die Bitterfelder Konferenz ermutigt wurden, Bücher zu schreiben. Sofort nach Abschluß der Beratungen im Kulturpalast des Elektrochemischen Kombinats hatte ich mich hingesetzt und die „Regengeschichte“ entworfen, meine erste größere Erzählung.
Ich griff dabei auf Geschehnisse zurück, die sich tatsächlich im Chlorbetrieb III ereignet haben. Sicherlich aber wäre mir die „Regengeschichte“ weit weniger gelungen, hätte ich nicht durch meine Tätigkeit in der Parteipresse die Möglichkeit gehabt, die Ereignisse im Chlorbetrieb vergleichend einzuschätzen. Dr. Bellmanns Schicksal war ich vorher in ähnlicher Weise bei mindestens zehn anderen jungen Chemikern begegnet. Den Weg von der Beobachtung des Regens bis zum Verbesserungsvorschlag, den ging von meinen Bekannten nicht nur Josef Urbanczyk. Und so besitzt auch die „Regengeschichte“ eigentlich nur noch sehr entfernte Ähnlichkeit mit den Vorfällen im Chlorbetrieb, nicht zu ihrem Schaden, hoffe ich.
Ich möchte bitten, nicht mißverstanden zu werden. Meines Erachtens ist schriftstellerisches Schaffen, empfunden und ausgeübt als „literarischer Teil der Parteiarbeit“, wie es Lenin in seiner Schrift „Parteiorganisation und Parteiliteratur“ formuliert, sicherlich keine Garantie, aber doch unbedingte Voraussetzung dafür, daß erregende und nachwirkende, daß meisterliche, sozialistische Bücher entstehen. Und deshalb sollten wir Jungen uns täglich bemühen, Parteischriftsteller zu werden.
Februar 1961
An meine Freunde von der technischen Intelligenz
Auf der Fahrt von Halle nach Berlin, im Windschatten der Autobahndämme, kurz hinter Dessau, erheben sich heute zwei mächtige Fabrikberge, das Kraftwerk Vockerode‘und das Gipsschwefelsäurewerk Coswig. Die Begegnung mit beiden Betrieben erinnert mich jedesmal an ein Gespräch, das ich vor vier oder fünf Jahren führte, als ich noch nicht ahnte, daß es mich einmal über etwa achthundert Seiten eines Romans hinweg beschäftigen würde.
Damals wurden wohl in Vockerode gerade die ersten Turbinen angelassen, in Coswig dagegen hatten die Mauern noch die weißrosa Farbe der Baustellen. Überall roch es dort nach frischem Mörtel und nach zersägtem Holz. Ein blauer Tag im März, und in der klaren Ferne ragten hinter den Wäldern an der Elbe die vier Schornsteine von Vockerode auf. Ein Zimmerbrigadier, dessen Name mir bis heute nicht entfallen ist und dessen Gesicht mich verfolgt, wenn ich schreibe, nickte in die Richtung der Schlote und sagte: „Jetzt produziert es, Licht, Wärme… Ich komm von dort. Aber man hält es nicht für möglich … Der Bauplan wurde bis heute nicht erfüllt. So unvernünftig ist der Staat.“
Unsinn. Einem Unsinn muß man widersprechen. Doch der Brigadier rechtfertigte sich kurz so: Am Anfang eines jeden Bauvorhabens steht eine vorher sorgsam festgesetzte Kostensumme. Später wird die Steigerung der Arbeitsproduktivität vor allem danach berechnet, ob das veranschlagte Geld ausgeschöpft wurde oder nicht. Wird während des Bauverlaufs eingespart, baut man, aus welchen Gründen auch immer, billiger, wird man dafür bestraft. Denn ohne zu fragen, ob trotz der Einsparungen die geforderte Qualität erreicht wurde, gilt der Plan als nicht erfüllt. Das Kraftwerk Vockerode also begann zwar soeben zu produzieren, war jedoch, richtete man sich nach diesem seltsamen Berechnungssystem, noch gar nicht aufgebaut.
Wenig später übertrug mir die Redaktion, in der ich damals tätig war, das Arbeitsgebiet der Industriebaustellen. Ich reiste von einer zur anderen, nistete mich oft tagelang auf einer ein und lernte im Bezirk Halle fast alle kennen: Coswig, Buna, Leuna, Lützkendorf, Bitterfeld. Neben vielem anderen stieß ich dabei immer wieder auf jenes Problem, auf das mich der Brigadier bereits früher hingewiesen hatte, auf die völlig überholte Berechnung der Arbeitsproduktivität. Es machte mich, ich gestehe es offen, sogar kopfscheu; alle meine Kenntnisse, die die politische Ökonomie betrafen und für die ich einst mit guten Hochschulzensuren bedacht worden war, gerieten ins Schwanken.