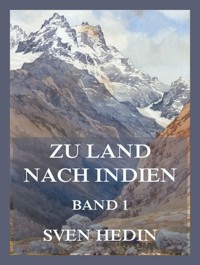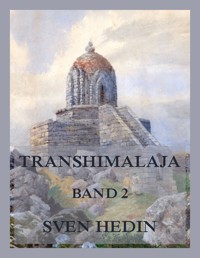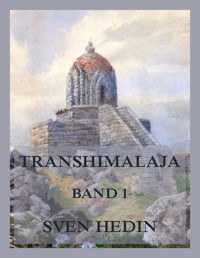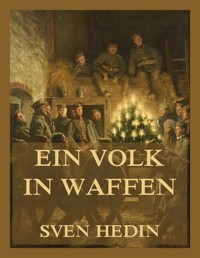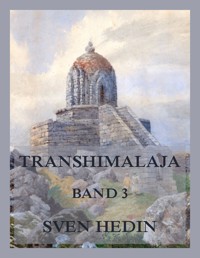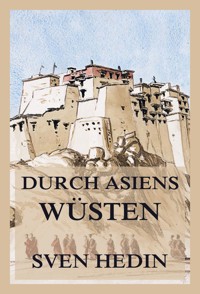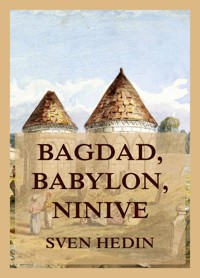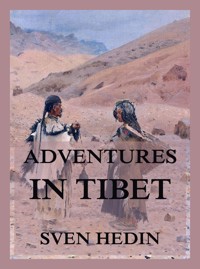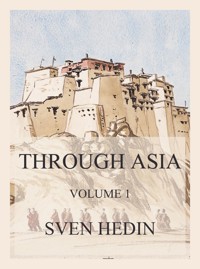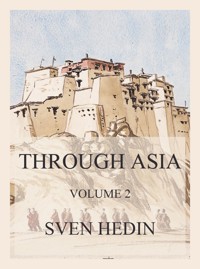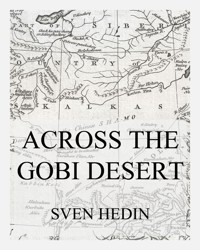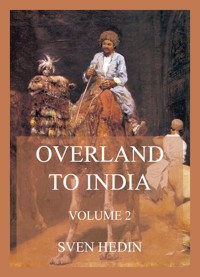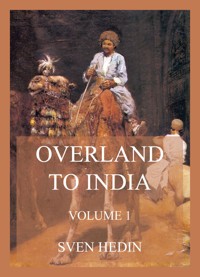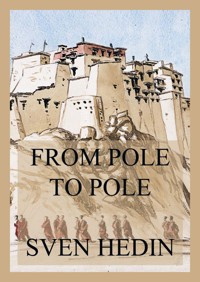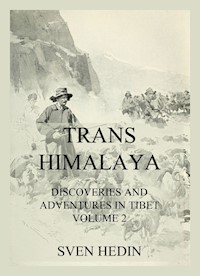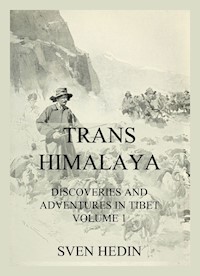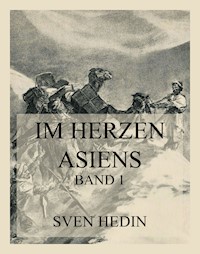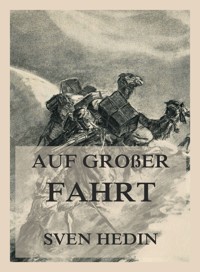
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk des wohl berühmtesten aller Forschungsreisenden behandelt den ersten Abschnitt jener umfassenden Expedition, die Hedin 1927/28 durch die Wüste Gobi unternahm. Mit nicht weniger als sechzig Teilnehmern und einem Tross von dreihundert Kamelen zog er aus. Es war damals die umfassendste wissenschaftliche Unternehmung, die je zu einer derartigen Entdeckerfahrt aufgebrochen ist. Dank Hedins Fähigkeiten als Führer und seiner hervorragenden Kunst in der Menschenbehandlung wurde sie trotz des chinesischen Bürgerkrieges ein Erfolg, wenn auch mit etlichen daraus erwachsenden besonderen Schwierigkeiten durchsetzt. Die Kunst der Reiseschilderung Hedins liegt nach wie vor in ihrer Frische, dramatischen Steigerung und menschlichen Wärme, ebenso aber in der Schärfe und Viel seitigkeit seiner Beobachtungen. Wer nicht eine der schnell und oft ohne eigenes Erleben zusammengeschriebenen Tagesdarstellungen, sondern ein gediegenes, vielseitiges und dabei farbenreiches Reisewerk sucht, darf gerne zu diesem wertvollen Buch greifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Auf großer Fahrt
Meine Expedition mit Schweden, Deutschen und Chinesen durch die Wüste Gobi 1927-28
SVEN HEDIN
Auf großer Fahrt, Sven Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682178
Druck: Bookwire GmbH, Voltastr. 1, 60486 Frankfurt/M.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Auf großer Fahrt.1
1. Endlich unterwegs!4
2. Durchs gelobte Land der Räuberbanden.14
3. Unsere Karawanen vereinigen sich in der Mongolei.25
4. Die Stadt der Nationen.32
5. Eine Hauptaufgabe unserer Expedition: meteorologische Beobachtungen.42
6. Wir teilen uns in drei Kolonnen.51
7. Die letzten Tage am Hutjertu-gol.58
8. Kamelrevolte.75
9. Kriegsrat im Lager XIII.90
10. Zum Kloster Schande-miao.109
11. Auf der Leidensstraße der Kamele.121
12. Eine Diebesjagd in der Wüste.129
13. Über die „Märcheninsel" nach der „Schwarzen Stadt".137
14. Ein idyllisches Lager.145
15. Ein chinesisches Fest und ein deutscher Kurier.154
16. Im Kanu auf dem Edsin-gol.165
17. Über den Socho-nor zum Gaschun-nor.177
18. Die feste Station Nr. I.186
19. Wüstenmärsche und Landstürme.197
20. Der Winter wird hart.205
21. Schwere Tage.212
22. Weihnachten in der Gobi.223
23. Sin-kiang will nichts von uns wissen.232
24. Endlich in Hami.242
25. Über Pitschang und Turfan nach Urumtschi.256
26. Marschall Yang, der Gouverneur von Sin-kiang.269
Auf großer Fahrt.
Wieder in Asien — nach jahrelanger, unfreiwilliger Pause!
Und diesmal nicht allein, denn die Aufgabe, die ich mir für diese größte Expedition meines Lebens gestellt habe, greift so weit auf die verschiedensten Wissensgebiete über, dass sich die Mitnahme jüngerer Fachleute für Sondergebiete von selbst ergab.
Die Expedition sollte mit dem ganzen Rüstzeug moderner Forschung arbeiten — so reifte in mir der Plan, unzugängliche Wüstengegenden zu überstiegen. Hier hoffte ich, dass Deutschland helfen würde. Ich wandte mich an Professor Hugo Junkers, bei dem ich lebhaftester Anteilnahme begegnete. Später erklärte sich die Deutsche Luft Hansa bereit, die Verbindung mit den deutschen Fliegerkreisen weiter zu pflegen. So kamen acht weitere Deutsche mit, die alle theoretische und praktische Flugerfahrung besaßen.
Aber in Urumtschi bissen wir auf Eisen: der mächtige Gouverneur der Provinz Sin-kiang, Yang Tseng Hsin, verbot das Fliegen in seinem Gebiet. Daraufhin kehrten die deutschen Flieger zunächst in die Heimat zurück und auch ich fuhr im Juni nach Europa, vor allem, um weitere Mittel für die Fortführung der Expedition für mehrere Jahre zu beschaffen, und zwar bat ich den schwedischen Staat um Beihilfe.
Wie die chinesischen Gelehrten und Studenten zur Expedition kamen, wird im Buch eingehend erzählt, hier will ich nur vorweg sagen, wie unentbehrlich und wertvoll ihre Mitarbeit mir von Monat zu Monat wurde.
*
Der erste Abschnitt der großen Asienfahrt liegt hinter uns, der Marsch von Paoko nach Urumtschi durch die Wüste Gobi während des Winters 1927/28 — jetzt besteige ich das Schiff, das mich wieder zu den Kameraden bringen soll, die diese Sommermonate hindurch ihre wissenschaftlichen Arbeiten nicht haben ruhen lassen. Neue Aufgaben locken!
Ich habe geschwankt, ob ich schon seht etwas über die Reise veröffentlichen sollte, denn meine umfangreichen täglichen Aufzeichnungen zu einem Buch zusammenzufassen, dazu fehlt mir augenblicklich die Zeit. So habe ich dies meinem deutschen Verleger und langjährigen Freund allein überlassen, ebenso die Auswahl der Abbildungen aus den vielen hundert Aufnahmen unseres fleißigen deutschen Fotografen Paul Lieberenz, der auch den Film dieser Reise „Mit Sven Hedin durch Asiens Wüsten" gedreht hat. Einen Fehler hat das Buch, an dem aber Brockhaus so unschuldig ist wie ich selbst: das gesamte Kartenmaterial befindet sich noch in Asien — so muss der Leser sich fürs erste mit der Route begnügen, die in einen der üblichen Atlanten eingezeichnet wurde.
*
Ich kann nicht schließen, ohne die Dankesschuld gegen alle die abzutragen, die mir geholfen haben, meinen lange gehegten Wunsch zu verwirklichen, nach Asien zurückzukehren, noch dazu an der Spitze einer so großen Expedition.
So vor allem den Deutschen. Nie werde ich die Ritterlichkeit und das Entgegenkommen vergessen, die mir von deutscher Seite erwiesen worden sind. Diese Zeit ist mir wie ein Märchen und ein Traum und wird immer zu meinen teuersten und liebsten Erinnerungen zählen. Die Zusammenarbeit mit den leitenden Männern der Lufthansa hat jederzeit das Gepräge aufrichtigen Vertrauens und besten Einvernehmens getragen.
In aller Kürze möchte ich auch meinen warmen Dank aussprechen dem schwedischen Gesandten Oskar Ewerlöf und Baron Carl Leijonhufvud, die mir während meines Aufenthalts in Peking und später während meiner Reise unschätzbare Dienste leisteten; Professor I. G. Andersson, der mein unermüdlicher Berater war und dabei mit vollen Händen aus dem reichen Schatz seiner chinesischen Erfahrungen schöpfte; dem Leiter der Geologischen Landesaufnahme von China, l)r. Wong, Professor Dr. A. Grabau und dem großen Forschungsreisenden Roy Chapman Andrews für das Wohlwollen und die Hilfe, die sie mir zuteilwerden ließen, und schließlich der „Opposition" in Peking, den chinesischen Gelehrten, die aus meinen Gegnern meine Freunde und Mitarbeiter wurden.
Meinen aufrichtigen und herzlichen Dank sage ich auch jedem einzelnen Mitglied meines Stabes, in dem jeder Mann seine Pflicht tat, alle Reibungen mit dem Bann belegt waren und nur gute Kameradschaft herrschte. Mit solchen Männern wie meinen Schweden, Deutschen und Chinesen kann man mit der Zeit gewaltige Gebiete von Innerasien wissenschaftlich erschließen. Die wohlwollende und freundliche Zusammenarbeit zwischen Europäern und Chinesen war mir eine Quelle wahrer Freude und ich halte es für einen Gewinn, mit Vertretern des größten und in vielen Hinsichten interessantesten Volkes der Erde in so enge Berührung gekommen zu sein.
Mit besonderer Dankbarkeit gedenke ich meines alten guten Freundes Fred Löwenadler, der mir schon 1912 einen freigebigen Beitrag für meine „nächste Reise" zur Verfügung stellte.
Ein Dank an meine Diener wird diese vermutlich nie erreichen. Vortreffliche Dienste leisteten uns die drei archäologischen Sammler Chuang, Pai und Chin, die Professor Andersson mir überließ. Mongolen und Chinesen, die in unserem Dienst standen, erfüllten alle getreulich ihre Obliegenheiten und die Ausnahmen waren selten.
Zum Schluss gedenke ich mit Wehmut der treuen Kamele, die, ohne zu klagen, uns und unsere Lasten über die endlosen Weiten trugen, und von denen so viele auf dem langen, schweren Weg durch die Wüste Gobi für immer liegenblieben.
Stockholm, den 7. August 1928.
Sven Hedin.
1. Endlich unterwegs!
Eine wunderbare Zeit lag hinter mir, eine gärende Übergangszeit in der Geschichte Chinas. Aus der Ferne hatte ich dem Tumult in Hankou, Schanghai und Nanking gelauscht. Von meinem friedlichen Zimmer im Gesandtschaftsviertel von Peking hatte ich Tag für Tag die Szenenwechsel in dem wirren Durcheinander der Kämpfe und Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Generalen verfolgt. Ich selbst hatte mich mitten in einem kleinen Sturmzentrum befunden, dessen Angriff gegen meine Expedition gerichtet war und meine Pläne zu vereiteln drohte.
Endlich war mein letzter Tag in Peking gekommen. Ich hatte nur noch ein einziges Mitglied meines Stabes bei mir, den Arzt der Expedition, Dr. David Hummel. Ich weiß nicht, wer von uns beiden am 8. Mai mehr zu tun hatte. Wir packten, und ich fuhr herum und gab in den Gesandtschaften, die mir im Lauf des Winters und Frühjahrs so großartige Gastfreundschaft erwiesen hatten, der englischen, amerikanischen und deutschen, dänischen und norwegischen, meine Karte ab, verabschiedete mich von Dr. Ting, Dr. Wong und Dr. Grabau, von denen der letztgenannte versprochen hatte, während meiner Abwesenheit meine Interessen in Peking wahrzunehmen, und verbrachte schließlich noch eine angenehme Stunde bei dem berühmten Erforscher der Mongolei, Roy Chapman Andrews, der mir wertvolle Dienste geleistet hatte, nicht zum wenigsten, indem er mir fünfundsechzig erprobte Kamele verkaufte, die er nicht länger brauchte; infolge der unsicheren Lage hatte er beschlossen, im kommenden Sommer keine Forschungsreise in die Mongolei zu unternehmen. Mein unermüdlicher Berater im vergangenen Winter, Professor I. G. Andersson, war am Tag vorher nach Schweden heimgekehrt.
Den letzten Abend verbrachten Dr. Hummel und ich bei dem schwedischen Gesandten Oskar Ewerlöf. Mit Kraft, Einsicht und Takt hatte er mir von Anfang an beigestanden, als es galt, die Erlaubnis der chinesischen Regierung zu erwirken, in diesen unruhigen Zeiten eine große Expedition zu unternehmen, und in den letzten Wochen hatte er mir mit der gleichen Geschicklichkeit und Treue geholfen, unser Unternehmen durch eine Reihe gefährlicher Blindschären zu lotsen, die uns Vernichtung drohten. Aber jetzt hatten wir gesiegt, feierten den Abend mit schäumendem Sekt und leerten unsere Gläser auf das Wohl der Expedition und aller ihrer Teilnehmer.
Die Stunde der Befreiung naht! Am Morgen des 9. Mai wird unser Gepäck auf den Bürgersteig vor dem Hotel Wagon Lits hinuntergeschafft; es soll auf das Auto geladen werden, das von der Bank kommt und uns einen beträchtlichen Teil unserer Reisekasse in Silber bringt. Das Auto lässt auf sich warten. Der Zug geht um 11.50 Uhr ab. Wir haben also nur noch drei Viertelstunden Zeit. Das Auto rollt vor, und das Gepäck wird aufgeladen. Es ist zu schwer. Eine Feder springt. Andere Kraftwagen werden durch Fernsprecher bestellt. Ich sause voraus zum Bahnhof am Hsi-tschimen, dem nordwestlichen Stadttor von Peking. Hier wimmelt es von Chinesen; die fünf Gelehrten und fünf Studenten, die an unserer friedlichen Heerfahrt durch Asien teilnehmen sollen, die meisten Professoren der Nationaluniversität und verschiedene Mitglieder des „Board of Directors", des Ausschusses, der dazu eingesetzt ist, während unserer Forschungsreise unser Fürsprech und offizieller Beschützer zu sein.
Eine spannende halbe Stunde folgt. Der Zug rollt ein, und der Wagen, der uns zur Verfügung gestellt worden ist, füllt sich mit unsern Chinesen und ihrem Gepäck. Der Bahnhofsvorsteher erklärt, dass er nur noch zehn Minuten warten kann. Es ist bereits ½ 1 Uhr, und das Silber, unsere Reisekasse, ist immer noch nicht da. Ich kann nicht Hummel allein die Verantwortung für all dies Geld überlasten, ich muss hierbleiben und den Zug abfahren lassen. Aber auch dieser Gedanke widerstrebt mir. Dann würden die Pekinger Zeitungen schreiben, unübersteigbare Hindernisse hätten sich mir im letzten Augenblick in den Weg gestellt. Einige meiner Freunde versprechen mir, die Gewähr für die Beförderung des Silbers zu übernehmen. Ich bin also bereit, ohne Gepäck abzureisen.
Eine Staubwolke wirbelt über den offenen Platz vor dem Bahnhof, und drei, vier Kraftwagen kommen angesaust — „Hummel!", ruft der schwedische Gesandte. Es sind wirklich unsere Autos mit dem Silber und dem Gepäck. Der prächtige Doktor hat die Lage gerettet. Eine Schar Kulis fasst an und schleppt die schweren Kisten in unsern Wagen. Als alles fertig ist, sagen wir Ewerlöf und unsern übrigen Freunden Lebewohl, und der Zug seht sich in Bewegung. Gesegnet sei diese Stunde! denke ich, jetzt beginnt die Fahrt durch das große Asien!
Peking verschwindet hinter uns. Die Berge, die vorher einer matt graublauen Bühnenhinterwand glichen, treten in deutlicheren Farbtönen hervor. Zu beiden Seiten der Bahnlinie breitet sich das weite Alluvialland aus mit Dörfern, Hütten und grauen Mauern, grünenden Feldern, braungrauen Ackerparzellen, schattigen Hainen von Pappeln und Weiden. Am Nankoupass öffnet sich eine natürliche Pforte und führt ins Gebirge hinein. Zur Rechten geht der Weg zu dem geheiligten Boden der Minggräber, wo Kaiser Jung Lo seit fünfhundert Jahren unter seinem majestätischen Grabhügel schlummert.
Plötzlich fegt ein Staubsturm über das Tal und hüllt die ganze Umgebung in einen Nebel. Die alte Mauer, die sich auf den Höhen dahinschlängelt, verschwindet, und in unserm Wagen überzieht sich alles mit gelbem Staub. Doch das tut unserer festlichen Stimmung keinen Eintrag. Alle, nicht zuletzt die Chinesen, freuen sich, unterwegs zu sein. Was macht das, dass der Güterwagen, den die Regierung uns zur Verfügung gestellt hat, ein früherer Viehwagen ist, an besten Langseiten und in dessen Mitte man schmale Bänke befestigt und in dessen Wände man viereckige Löcher geschnitten hat? Niemals ist mir ein Schlafwagen erster Klasse in Europa oder Amerika lockender erschienen als dieser schmutzige, staubige Kasten. Hummel und ich haben uns in seinem vorderen Teil niedergelassen, wo wir unsern Tee kochen und unser Frühstück auftischen. Unsere nächsten Nachbarn sind „die drei Schipper", Professor Anderssons gut geschulte archäologische Sammler, die ich von ihrem früheren Herrn übernommen habe und die bald ihre Kunst zeigen sollen, vorgeschichtliche Wohnstätten aufzuspüren.
In einer anderen Gruppe sitzt Professor Siu Ping Ch'ang und unterhält sich mit zwei seiner Kollegen, während die Studenten ihre Reisetaschen öffnen und ihren Proviant hervorholen und der junge Fotograf Kung den vergeblichen Versuch macht, ein geeignetes Stück der Verzweigungen der Großen Mauer im engen Nankoutal auf seine Platte zu bannen.
Nicht weit von uns sitzt ein Mann mit stark europäisierten Zügen, in abendländischer Kleidung. Er heißt Li und ist Professor der Geologie. Er hat darum gebeten, mit fünf seiner Studenten in unserm Sonderwagen nach Paoto reisen zu dürfen, und wir sind recht froh, ihn bei uns zu haben; denn er ist fein und liebenswürdig und erklärt seinen Schülern und uns den geologischen Bau des Tales. Siu, der Leiter des chinesischen Expeditionsstabes, und Li sind uns willkommene Gäste an unserm Frühstücksund Mittagstisch.
Wir fahren durch Gegenden, die ich schon früher durchquert hatte, und erreichen am nächsten Tag Kwei-hwa-kschöng, die Hauptstadt des Bezirks Sui-juang, wo wir zwanzig Minuten halten und die Freude haben, Dr. Erik Norin, unsern Geologen, zu treffen, der hier für unsere Chinesen chinesische Lebensmittel einkauft. Dann geht es weiter, und Stunde um Stunde verrinnt. Einförmig und öde erstreckt sich die Ebene nach Süden, wo der Gelbe Fluss, der gewaltige Hoang-Ho, in ein paar Krümmungen aufblitzt. Blühende Obstgärten verleihen grauen Dörfern Farbe und Reiz. Im Norden ziehen sich die niedrigen Erhebungen des IJn-schan nach Westen, soweit das Auge reicht. Durch die Fensteröffnungen sendet die Sonne ihre Glut zu uns herein, die Chinesen schlafen, rauchen oder trinken ihren ewigen Tee, und wir zwei Schweden unter siebzehn Söhnen des Reiches der Mitte sprechen über die dunkle Zukunft und unsere großen Pläne.
Die Sonne sinkt. In der Ferne taucht Paoto auf, der Endpunkt der nördlichsten Bahnlinie Chinas — wenn man von der mandschurischen Eisenbahn absieht. Um 7:30 Uhr hält der Zug. Am Bahnhof erwarten uns acht Mann meines deutschen Stabes, unter ihnen Major Hempel, den ich zum Stabschef ernannt habe, und Dr. Haude, der die meteorologischen Beobachtungen und die drahtlosen Empfangsapparate unter sich hat, sowie unser schwedischer Archäologe Folke Bergman und der Dolmetscher H. Eze, der mit einer Deutschen verheiratet ist und die Muttersprache seiner Frau fließend spricht. Zwei Polizisten verlangen unsere Ausweise zu sehen. Hummel und einige der anderen Herren geben den Ochsenkarren das Geleit, die unsern Silberschah nach unserm schon im vergangenen Winter gemieteten Gehöft bringen. Die übrigen besteigen unsere großen, schönen Kamele und reiten in die Stadt voraus. In einer knappen Viertelstunde erreichen wir das südliche Stadttor und haben dann innerhalb der Stadtmauer noch ebenso weit bis zu unserm Hof. Es dämmert, und in den Verkaufsständen an den Basarstraßen leuchten vereinzelte Lampen auf. Die staubigen Straßen sind noch belebt und wimmeln von Soldaten, Angehörigen der Garnison, die Yen Schi Schan, der Gouverneur der Provinz Schansi, in die Stadt gelegt hat. Trompeten schmettern; der ganze Ort ist voller Soldaten. Im Tor unseres Gehöftes steht breitbeinig und gebieterisch Larson, heißt mich willkommen und beglückwünscht mich zu dem schließlichen Sieg. Ich begrüße unsere Diener, Chinesen und Mongolen, und mache unter der Führung Larsons und des Freiherrn von Massenbach einen Rundgang in unserm ersten Hauptquartier auf dem Weg nach Innerasien. Ein schmaler Gang zur Linken zwischen der Küchenabteilung und einem größeren Raum, in dem unsere chinesischen Studenten wohnen sollen, führt zu einem kleinen Hof, wo Larson sein Zelt aufgeschlagen hat, an dessen vorderer Stange die schwedische Flagge weht. Auf diesen Hof gehen drei Zimmer: ein kleineres, das für mich bestimmt ist, und zwei größere, die als Kasino und Speisesaal dienen.
An einem zweiten größeren Hof liegen die Zimmer all der anderen Herren. Hier türmen sich Hunderte von Proviant- und Vorratskisten zu kleinen Bergen auf. Dieses riesige Gepäck in zwei Güterwagen nach Paoto zu schaffen, war keine Kunst; aber es schwindelt einem, wenn man daran denkt, dass diese vierzig Tonnen von Kamelen durch den Wüstengürtel ganz Innerasitens getragen und Tag für Tag aufgeladen und abgeladen werden sollen.
Einen kleinen Hügel hinan steigend, erreichen wir den dritten Hof, auf dem unsere bisher eingekauften Kamele untergebracht sind und ihr Futter erhalten. Zwischen diesen beiden Höfen hat Dr. Haude sein meteorologisches Observatorium mit all den feinen Instrumenten, die sich auf die Launen des Wetters und der Winde verstehen.
Während wir noch auf unserm Rundgang sind, ist das Knarren unserer Silberkarren zu hören, und die Ochsen ziehen ihre schweren Lasten in den Hof hinein.
Erst um 10 Uhr geht ein Küchenjunge mit einer Klingel durch die Höfe, und wir versammeln uns im Speisesaal zum späten Abendessen. Es gibt Suppe, Huhn und Reis. Wir sitzen an zwei Tischen. Trotzdem es keinen Alkohol gibt, ist die Stimmung froh und gehoben. Denen, die seit dem 2-4. März hier auf Dr. Hummel und mich gewartet hatten, war die Zeit recht lang geworden. Sechs Wochen hatten sie hier wie in einem Gefängnis zugebracht. Zwar hatten sie vom Präfekten und vom Bürgermeister die Erlaubnis erhalten, kürzere Ausflüge in der nächsten Umgebung von Paoto zu machen, aber für längere Streifzüge hatten die Behörden nicht die Verantwortung übernehmen wollen, da es in der ganzen Gegend von Räuberbanden wimmelte. Schlimmer als alles andere war ihnen jedoch die Ungewissheit gewesen, ob es mir gelingen würde, den Widerstand in Peking zu überwinden. Doch nun war es geglückt, und unsere Heerfahrt gegen die Wüste war nicht länger ein lockendes Gaukelbild, sondern versprach wunderbare und dramatische Wirklichkeit zu werden. Kein Wunder, dass alle freudig gestimmt waren.
Noch fehlten einige der Unsrigen. Norin, bekannt durch seine Forschungsreisen in China und im westlichen Himalaja, befand sich, wie ich schon erwähnte, in Kwei-Hwa-Lschöng, von wo er, unterstützt von Major Walz und Freiherr Marschall von Bieberstein, auf sechzig Kamelen neu eingekaufte chinesische Lebensmittel an den vereinbarten Treffpunkt bei dem Kloster Beli-miao in der Inneren Mongolei schaffen sollte. Dort sollten sich auch noch zwei andere Expeditionsmitglieder mit der Hauptkarawane vereinigen: der Däne Haslund-Christensen, den ich in Peking in meinen Dienst genommen hatte und der Larsons Gehilfe werden sollte, und unser deutscher Filmfotograf Lieberenz. Diese beiden hatten den Auftrag erhalten, sich nach der schwedischen Missionsstation Hallun-ussu, 160 Kilometer nördlich von Kalgan, zu begeben, um die fünfundsechzig Kamele zu übernehmen, die ich von Andrews gekauft hatte.
Doch an unseren Tischen waren wir gleichwohl zahlreich genug, und Professor Li war unser Ehrengast. Alle bedauerten, dass er uns nicht begleiten konnte. Beim Kaffee klopfte ich an meine Taste und hielt eine Rede, der Chinesen wegen in englischer Sprache. Ich sprach von den Aufgaben, die unser warteten, und davon, wie eigenartig es sei, dass wir mitten im Bürgerkrieg und in gärender Unruhe im Begriff ständen, nach den entlegenen Provinzen Chinas aufzubrechen, während alle anderen Europäer das Land verließen und sich an die Küste begäben. Mit Besorgnis und Skepsis hätten alle meine weißen Freunde in Peking das Zusammenarbeiten mit den chinesischen Gelehrten betrachtet. Wir würden beweisen, dass Weiße und Gelbe sehr gut zusammen leben und zusammen arbeiten können und dass die Wissenschaft über den politischen Grenzscheiden und den Vorurteilen der verschiedenen Rassen steht. Störende Zwistigkeiten oder kurzsichtigen Nationalismus beabsichtigte ich nicht zu dulden. In meiner Karawane würden alle Freunde sein und die Chinesen dieselben Rechte genießen wie die Europäer. Die Chinesen seien überdies hier daheim in ihrem eigenen Land, wir dagegen Gäste. Ich erwartete daher, dass jeder seine Pflicht erfüllen werde; denn wenn alle Mitglieder der Expedition ihr Bestes täten, würden die Ergebnisse, die wir gewönnen, auch der Menschheit zum Nutzen gereichen. Zum Schluss hieß ich alle Anwesenden willkommen und wünschte uns allen eine glückliche und erfolgreiche Reise.
Professor Siu Ping Ch'ang erhob sich unmittelbar darauf und sprach im Namen der Chinesen in demselben Geiß. Und dann saßen wir noch lange beisammen.
Mitternacht war längst vorüber, als ich zur Ruhe ging. Ich lag noch eine Zeitlang wach und hing meinen Gedanken nach. War es wirklich wahr, dass ich an der Spitze der größten wissenschaftlichen Expedition stand, die jemals in das Herz des größten Kontinents der Erde gezogen war?
Neun Tage mussten wir noch in Paoto liegenbleiben, diesem scheußlichen Nest mit 60000 Einwohnern und zur Zeit einer Besatzung von etwa 30000 Mann, dieser kleinen Stadt am nördlichen Ufer des Gelben Flusses. Hier hatte ich im Februar 1897, lange vor der Zeit der Eisenbahn, einige unvergessliche Tage bei der liebenswürdigen Missionarsfamilie Helleberg aus Stockholm verlebt, die dann gleich so vielen anderen schwedischen Missionaren während des Boxeraufstandes ermordet wurde. Neun volle Tage! Doch es blieb uns nichts anderes übrig. Bevor nicht die Verhandlungen in Peking zu einem guten Ergebnis geführt hatten, konnte ich Larson nicht den Auftrag geben, die zweihundertfünfzig Kamele zu kaufen, die wir brauchten. Und bis zu diesem Kauf mussten wir uns mit gemieteten Kamelen begnügen. Aber diese weideten vier Tagereisen von Paoto entfernt auf den Berghängen und konnten erst am 18. Mai zu unserer Verfügung stehen. So mussten wir uns denn wiederum mit Geduld wappnen.
Wir hatten jedoch genug zu tun, und die Tage wurden uns daher nicht lang. Zum Leiter einer Karawane von sechzig Mann und ungefähr dreihundert Kamelen kommen alle mit ihren Berichten, Wünschen und Klagen. Tausend und aber tausend Dinge müssen besprochen und geregelt werden, damit alles wie von selbst läuft und die wandernde Stadt ein organisches und harmonisches Ganzes bildet. Nichts darf vergessen werden. Ich muss alle Rechnungen prüfen und gutheißen, die Herr Mühlenweg mir vorlegt, unser Zahlmeister, der Kassenverwaltung und Rechnungswesen unter sich hat. Schon jetzt sehe ich, dass wir mehr Geld brauchen. Es wird in Peking angefordert und soll dem Missionar Svensson in Paoto anvertraut werden. Der Dolmetscher Sze ist nicht mehr nötig und wird durch den Missionarssohn Söderbom ersetzt, der hier geboren ist und Chinesisch mindestens ebenso gut wie Schwedisch spricht und dazu Mongolisch.
Der Proviant wird umgepackt, und zwar so, dass, wenn wir lagern, in einer bestimmten Kiste sich alles befindet, was man braucht, und uns die Mühe erspart bleibt, mehrere Kisten zu öffnen. Auch die Mitglieder des Stabes verstauen ihre Sachen. Major Zimmermann, der schon seit dem Herbst auf dem Weg durch Sibirien und die Mandschurei mein Adjutant gewesen ist, ist dabei meine rechte Hand und weiß genau, wo alles zu finden ist.
Auf dem großen Hofe wie in allen Räumen unseres Anwesens wird also eifrig gearbeitet. Mitunter sorgen kleine Zwischenfälle für Abwechslung. So konnten wir einmal von unserm Dach aus zuschauen, wie etwa zwanzig Soldaten ein nahe gelegenes Haus umzingelten und durchsuchten und einen Dieb festnahmen und banden, über dessen Schicksal man kaum im Zweifel zu sein brauchte angesichts der abgeschnittenen Menschenköpfe, die, in kleinen Holzkästen ausgestellt, die Straßen von Paoto schmückten.
Von diesem Dach aus konnten wir den Hoang-Ho sehen, der, von Odontala im nordöstlichen Tibet kommend, Kansu und die nördlichen Provinzen durchströmt und in einem gewaltigen Bogen die Wüste Ordos umkreist, in der ich einst nahe daran war, zu erfrieren.
Eines Tages unterbrach ein klatschender Platzregen, der bald in Hagel überging, alle Arbeiten auf dem Hof. Sogar die Kamele, die im Freien standen, wurden unruhig. Die Hagelkörner waren so groß wie Haselnüsse, zur Hälfte kegelförmig, zur Hälfte halbkugelig. Es wurde eisig kalt, nachdem wir vorher 28 Grad Wärme gehabt hatten. Als das Unwetter vorüber war und der Hof weiß dalag, vergnügten sich ein paar jüngere Mitglieder der Expedition damit, Schneeball zu werfen, und wählten als Zielscheibe ihrer Schießübungen die Fenster ihrer Gefährten, die aus Holzgittern und darüber geklebtem Papier bestanden. Aus dem Innern der Räume ertönte wildes Geheul des Ärgers und der Wut und weckte die grenzenlose Freude der Schützen wie der Zuschauer. Doch es war ja unser Haus, und was tat es, dass einige papierene Fensterscheiben eingeschlagen wurden — wir wollten das Gehöft ja bald verlassen, das für die meisten von uns so lange ein Gefängnis gewesen war. Niemand würde es vermissen und noch weniger die Heerscharen blutdürstiger Wanzen, die es beherbergte.
Unser mit Kisten, Säcken, Wasserbehältern, Zeltbündeln und anderem Kram vollgepackter Hof war zu eng, als dass wir hier Hunderte von Kamelen hätten beladen können. Wir mieteten daher eine Gastwirtschaft vor dem nordwestlichen Stadttor und begannen am 16. Mai die über vierhundert Packlisten und die ganze übrige Ausrüstung hinüberzuschaffen. Am 18. Mai langten die zweihundertzwanzig Kamele an, die uns 1650 Dollar an Miete kosteten, und an demselben Tage gingen die letzten Fuhren zur Karawanserei hinaus, zuallerletzt die schweren Silberkisten. Don unserm Arzt begleitet, machte ich der freundlichen und hilfsbereiten Missionarsfamilie Svensson meinen Abschiedsbesuch und begab mich in der Dämmerung zur Karawanserei, auf deren Hof unsere Zelte für die Nacht aufgeschlagen waren. Auf einem angrenzenden Hof waren unsere zweihundertzweiunddreißig Kamele untergebracht.
Am Tag darauf werden bei glühender Sonne doppelte Taue um alle Lasten geschlungen. Dann braucht man nur noch einen Stock durch zwei Schlingen zu ziehen, damit die Kisten fest in den Packsätteln liegen. Ein buntes, bewegtes Leben erfüllt den Hof. Da streichen Polizisten in schwarzen Uniformen, Infanteristen in graublauen Uniformen und Knaben in Lumpen zwischen unsern chinesischen und mongolischen Karawanenleuten und Dienern umher. Der „Zahlmeister", Herr Mühlenweg, macht die letzten Auszahlungen, die Herren des Stabes schreiben Karten an ihre Angehörigen, Zelte werden abgebrochen und gleich den Schlafsäcken zu länglichen Bündeln zusammengerollt, die Kamele werden zur Tränke geführt. Wir haben die Absicht aufzubrechen, sobald die Hitze des Tages sich gelegt hat. Um 3 Uhr ertönt das Glockenzeichen, das zum Essen ruft. Rührei, Schweinefleisch, Butter, Brot und Tee wird auf den Kisten aufgetischt. Wir speisen in verschiedenen Gruppen und tun an meinem „Tisch", als säßen wir auf der Opernterrasse in Stockholm. Es weht ein heftiger Nordwest, und der Staub wirbelt um uns herum. Dann suchen wir den spärlichen Schatten auf, der zu finden ist, geben uns dem Nichtstun hin und warten und sehen uns schließlich gezwungen, noch eine Nacht hierzubleiben.
Als ich am Morgen des 20. Mai, um 5 Uhr von Larson geweckt, ins Freie hinaustrat, bot sich mir ein lebhaftes, wunderbares Schauspiel dar. Die Sonne war gerade aufgegangen. In Strängen von fünf oder zehn Tieren wurden die Kamele zu den langen Reihen der Lasten geführt, leicht und schnell beladen und dann auf den freien Platz östlich der Karawanserei gebracht, wo die Karawane zu einer gewaltigen Heerschar anwuchs. Ein Kamel, das die Instrumentenausrüstung einer der festen Stationen trug, die wir in Innerasien errichten wollten, warf im Torgang des Gasthauses seine wertvolle Bürde ab, doch zum Glück wurde nichts zerstört. Draußen warten auch die dreißig berittenen Infanteristen, die der Befehlshaber von Paoto uns als Schutzwache gestellt hat. Sie tragen rotweiße Binden am linken Arm, sind mit Gewehren bewaffnet und reiten kleine zottige Pferde. Für sie ist diese Abkommandierung eine lustige und willkommene Abwechslung, und ihr Scherzen und Lachen und ihre Lieder verraten, dass sie in der besten Stimmung sind.
Das Beladen der Kamele nimmt gar kein Ende. Ein Strang nach dem anderen wird hinausgeführt. Die meisten Tiere sind braun, das eine oder andere schwarz. Gerade jetzt sind sie im Begriff, ihre Wolle zu verlieren. Sie hängt ihnen in zottigen Strähnen und Büscheln um Kopf, Flanken, Hals und Beine und stottert im Winde. Kleidsam ist dieses Frühjahrskostüm wirklich nicht. Aber das wird bald besser, wenn die Wärme einsetzt und die Kamele ihre Winterpelze vollständig verloren haben.
Nun kommen die Reitkamele der Schweden und Deutschen in einer langen Reihe heraus. Gewehrhalfter, Ferngläser und Fotoapparate in Lederfutteralen, Satteltaschen aus gelbem Leder, die Wärmflaschen, leichten Proviant, Notizbücher, Pistolen und Munition und anderes mehr enthalten, schlagen und klappern an amerikanischen und mexikanischen Ledersätteln, die haltbar und prächtig und leuchtend blank sind.
Ich streife zwischen den wachsenden Kolonnen umher. Jetzt kann es genug sein, denke ich und kehre zur Karawanserei zurück, wo ich noch eine ganze Anzahl von Kisten finde. Zwischen ihnen gehen schwarze Schweine mit hängendem Bauch und wühlen den Boden auf, und auf ihren entstellten Geißfüßen trippelt die Opium rauchende Wirtin umher und sammelt Kamelmist in einen Korb, umschwärmt von einigen schreienden, halbnackten Kindern. Die acht schweren Silberkisten werden gerade vier starken Kamelen aufgeladen, und dann kommen endlich die achtunddreißig Wasserstoffgaszylinder dran, die fünfzehn Kamele erfordern und gut in Filz- und Strohmatten eingenäht sind, damit sie in der Wärme nicht explodieren.
Man kann kaum von einer Karawane sprechen. Es ist eine ganze Reihe von Karawanen von zehn oder fünf Kamelen, die nebeneinander angepflockt werden. Während all der Jahre, die ich in Asien zugebracht habe, habe ich unzählige Karawanen gesehen: meine eigenen; die der Kaufleute aus Arabien und Mesopotamien, die nach Kansu und der Mongolei gingen; die der Pilger, die zu den heiligen Gräbern wallfahrten; die des Schahs von Persien im Elburs und im Weltkrieg die türkischen und bayrischen Dromedarkarawanen zwischen den Hügeln von Judäa und in der Wüste Sinai. Aber diese meine Karawane ist doch die stolzeste, die meine Augen je geschaut haben. Es ist ein prachtvoller Anblick — ein Heereszug, bunt, mächtig und schwer. Die Sonne ist inzwischen über die Berge gestiegen und gibt dem Bild Farbe, aber die Schatten liegen noch lang und unscharf auf dem Boden, der ins Grüne spielt.
Larson meldet, dass der Hof leer und alle Kamele und Lasten draußen auf der Ebene sind. Alles ist klar, wir sitzen auf, und die Karawane setzt sich in Bewegung. Unsere gelehrten Chinesen benutzen keine Sättel, sondern thronen auf ihren Packlasten. Ich selbst, der ich durch Kompass, Uhr, Zeichenbrett und Notizbuch ständig in Anspruch genommen bin, habe mir, wie früher, mein Reitkamel in einer besonders bequemen und behaglichen Weise auftakeln lassen. Es trägt an den Seiten mein zusammengerolltes Zelt und mein Bettbündel. Zwischen diesen und den Höckern sind Teppiche, Decken und Pelze ausgebreitet, und ich sittze in der kleinen Vertiefung wie in einem Vogelnest und kann meine Stellung ändern und meine Beine ausstrecken, wie ich will. Und damit ich durch den Gang meines Reittieres nicht im Geringsten in meiner Arbeit gestört werde, laste ich es von dem Mongolen Mento führen, der zuverlässig ist und selbst ein großes Kamel reitet.
Die Leibgarde der dreißig Reiter wirbelt in einer Wolke von Staub um uns herum. Mit geräuschlosen, schleichenden Schritten schreiten die Kamele in endlosem Zuge langsam zu der ersten Passschwelle in den nördlichen Hügeln hinauf. Das vorderste Kamel der ersten Abteilung trägt eine schwedische Flagge. Hinter uns verschwindet Paoto, die zweite Stadt unseres Wartens und unserer Prüfungen.
Mein Traum während langer Jahre ist endlich Wirklichkeit geworden. Wir sind auf dem Wege nach Innerasien, zu dem Wüstengürtel, der sich wie ein ungeheures ausgetrocknetes Flussbett durch die ganze Alte Welt hinzieht. Wir sind auf dem Wege zu großen Aufgaben und dunklen Schicksalen.
2. Durchs gelobte Land der Räuberbanden.
Wir sind wirklich unterwegs. Wir haben den ersten Tagesmarsch auf unserm endlosen Auge durch das große Asien angetreten. Ich habe meine erste Visierlinie genommen und auf das Kartenblatt Nr. 1 übertragen. Viele Lausend andere werden ihr folgen, bevor die lange Route mit allen ihren Krümmungen, Geländewellen, Hügeln, Bächen, Hohlwegen und Lagerplätzen gezeichnet und mit Hilfe der astronomischen Ortsbestimmungen, die wir ausführen werden, in dem Gradnetz festgelegt ist. Wir haben eine erste Standlinie von 150 Meter gemacht, um die Länge der Schritte meines Reitkamels zu messen. Durch sie erhalte ich die Länge des Weges. Kein Instrument kann sicherer sein. Mein prächtiges Kamel ist sich der wichtigen Rolle nicht bewusst, die es bei der Aufnahme der Marschroute spielt.
Als zehn Abteilungen von zusammen hundertfünfzig Kamelen an mir vorübergezogen sind, zur ersten Passschwelle hinauf, folge ich mit Mento ihrer Spur. In der graugelben, einförmigen Landschaft, wo der Boden hier und da vom jungen Gras des Sommers und einzelner Steppenhügel grün schimmert, mitunter aber beinahe völlig unfruchtbar ist, gewährt die lange, sich schlängelnde Karawane einen prachtvollen, überwältigenden Anblick. Die vordersten Kamele, die fast in der Ferne verschwinden, nehmen sich wie eine feine schwarze Perlenkette aus; die nächsten wiegen in sicherem Schritt ihre schweren Bürden. Zu beiden Seiten, singend und plaudernd, reiten die Soldaten. Wenn ich mich umwende, sehe ich kaum ein Ende des gewaltigen Zuges, der die ganze Gegend erfüllt. Die Kamele hört man nicht; ihre Schritte sind schleichend leise wie die der Katzen in dem weichen Staubboden. Die einzigen Laute, die man hört, sind das Knarren der Holzkisten, die sich an den Stangen der Packsättel reiben, das Schlagen und Klappern von Handgriffen und Schlössern an den eisenbeschlagenen Kasten, das Gebrüll eines Kamels, das sich losgerissen hat, und schließlich das Gespräch der Soldaten, der Mongolen und der Herren des Stabes und das Brausen des Nordwindes. Doch keine Karawanenglocken ertönen! Vielleicht findet man es klüger, so leise wie nur irgend möglich durch das gelobte Land der Räuberbanden zu ziehen. Aber wenn wir erst unsere eigenen Kamele haben, dann sollen unsere Bronzeglocken ihre uralten und doch ewig jungen Weisen in der Wüste erklingen lassen!
Eine Visierlinie reiht sich an die andere, und der zurückgelegte Weg wächst langsam auf dem Kartenblatt. Zur Rechten und vor uns haben wir niedrige Hügel. Wir bewegen uns nach Nordwesten und folgen dem Weg, der nach Pakse-bulung und Wu-yuan führt und auf dem Feng Yü Hsiang, der „christliche General", im Auto gefahren ist. Bis dorthin, das heißt noch ein paar Tage, leistet uns die Telegraphenlinie Gesellschaft. Ein Gefühl von wirklicher Einöde hat man erst, wenn man die letzte Telegraphenstange hinter sich verschwinden sah.
Von Zeit zu Zeit ziehen wir an einem elenden Dorf mit grauen verfallenen Lehmhütten und eingestürzten Mauern vorüber. Einige scheinen unbewohnt zu sein, nachdem die unglücklichen Einwohner von Soldaten und Räubern vertrieben wurden. In anderen steht man Männer und Kinder in Lumpen, und manchmal erblicken wir einen Bauer, der mit einem von zwei Pferden oder schwarzen Ochsen gezogenen eisernen Pflug seinen Acker pflügt.
Wie graubraune Gespenster kommen Staubtromben über die Steppe gestrichen. In wirbelnder Fahrt wird der Staub in sie hineingezogen und hinausgeschraubt, während die kleinen Zyklone sich langsam vorwärtsbewegen.
Um 12 Uhr schreitet unser endloser Zug durch das Dorf Gunhuduk, dessen Bewohner vor ihren Hütten stehen und sich das ungewöhnliche Schauspiel ansehen. Mitten auf der Dorfstraße liegen die Motoren zweier verunglückter Flugzeuge, stumme Zeugen von General Fengs Kriegszug. Es ist ein eigentümlicher Anblick, und man kann es den Kamelen nicht verdenken, dass sie scheuen und sogar störrisch werden. Dettmanns Kamel macht so wilde Sprünge, dass sein Reiter kopfüber zu Boden stürzt und einen ordentlichen Puff in den Rücken erhält. Heyder hat alle Mühe, sein Reittier zu bändigen, und reißt sich an dem Nasenstrick die Hände blutig. Aber Dr. Hummel hat in einer besonderen Tasche alles Nötige zur Hand und verbindet sogleich alle, die sich verletzt haben.
Wir nähern uns dem Fuß des Gebirges im Nordwesten. In einiger Entfernung zur Anken verrät sich ein Bewässerungskanal durch eine Reihe junger Weiden, denen seine Fluten Wasser und Leben spenden. Im Westen wird das Kloster Kundulung-sume mit seinen weißen Fassaden sichtbar — ein Märchenschloss in der Einöde. Nur wenige seiner zahlreichen Lamas sind jetzt daheim, die anderen wirken als Seelsorger bei den Nomaden im Norden.
Vor dem Tor einer viereckigen Lehmmauer, eines Karawanenhofs, sind unsere Leibtrabanten abgesessen und haben ihre Pferde angepflockt. Hier ist der erste Lagerplatz, erklären sie und raten uns, unser Silber in den sicheren Schutz der Mauer zu bringen. Aber wir ziehen es vor, unsere Zelte draußen auf der Ebene aufzuschlagen, wo wir unser Hab und Gut übersehen und bewachen können.
Es ist wirklich bewundernswert, mit welcher Schnelligkeit und Leichtigkeit die gemieteten Chinesen ihre Kamele von unseren Lasten befreien. Der Reihe nach, wie sie ankommen, werden die verschiedenen Abteilungen vorgeführt, die Tiere gezwungen, sich hinzulegen, die Stöcke aus den beiden Schleifen herausgezogen, und im Handumdrehen stehen die beiden Kisten auf dem Boden — bereit, am nächsten Morgen nach einem neuen, ebenso einfachen Handgriff ihren früheren Platz auf dem Rücken des Kamels wieder einzunehmen. In einer halben Stunde sind alle zweihundertzweiunddreißig Kamele abgeladen. Die Kisten sind in einem Viereck ausgestellt und bilden eine Miniaturstadt von Häusern und Straßen vor den Zelten, die unterdessen von den Herren des Stabes aufgeschlagen werden. Mento und Matte Lama bauen meine luftige Behausung auf und stakten sie mit den Kisten und Taschen, die ich täglich brauche, dem Teppich und dem Bett aus. Jedes Mitglied des Stabes hat sein leichtes, zusammenlegbares eisernes Bett. Ich selbst warf jedoch schon hier im ersten Lager dies Gestell hinaus. Während all meiner Jahre in Asien hab ich nur ein einziges Mal ein Zeltbett aus Holz benutzt, und das wanderte nach einigen Tagereisen ins Lagerfeuer. Es sind vielleicht nur alte Asiaten, die Gefallen daran finden, in möglichst enge Berührung mit der asiatischen Erde zu kommen. Auch Larson, der „Herzog der Mongolei", liegt am liebsten auf dem Boden. Dr. Hummel ist unserm Beispiel gefolgt, und ich glaube, wir werden eine ganze Anzahl dieser Zeltbetten hinter uns zurücklassen, noch ehe wir 500 Li (i Li — 442 Meter) nach Westen vorgedrungen sind „Da haben die Kamele weniger zu schleppen", pflegte Larson zu sagen, wenn wieder etwas weggeworfen oder verzehrt wird.
Hier im Lager bei Kundulung-sume erhob sich zum ersten Mal die stolze Reihe unserer blauen mongolischen Zelte mit ihren weißen Schnörkeln und Symbolen, die langes Leben und Unsterblichkeit bedeuten sollen. Wie schon gesagt, fehlten noch sechs Mann des Stabes, trotzdem hatten wir sechzehn Zelte aufgeschlagen. In der Mitte der Zeltflucht, alle anderen überragend, prangte hellgrün unser Kasinozelk. Es ist englischer Herkunft und doppelt, indem das eigentliche Zelt von einem gewaltigen Sonnendach überschattet wird, das nicht bis zum Boden reicht und an der Vorderseite eine Art Veranda bildet. In seinem Innern wurde aus gewöhnlichen Brettern und Böcken ein Tisch aufgebaut, und ringsherum wurden die zusammenklappbaren Zeltstühle gesetzt.
Um 5 Uhr läutete die Glocke des Kasinos und rief uns zum Tee. Das Kasinozelt wurde eingeweiht und von allen gepriesen. Man fand, dass es die 200 mexikanischen Dollar wert sei, die Larson dafür gezahlt hatte. Alle waren hoch- und frohgestimmt. Eine chinesische Handelskarawane zog heran und lagerte auf dem Hof der Karawanserei. Sie war der Sicherheit wegen uns auf den Fersen gefolgt. Von Westen, wahrscheinlich aus Uljassukar, steuerte eine zweite Karawane aus uns zu. So weit war sie glücklich gekommen, und nun hatte sie nur noch einen Tagemarsch bis Paoto. Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen sie sich ihrem Ziel nähert, nachdem sie vier oder fünf Monate durch die Einöde gezogen ist.
Wir waren kaum in unsere Zelte zurückgekehrt, als eine Sturmbö vor: Mordwesten aufzog und wie ein Schlag über das Lager hinfuhr. Die Luvseite meines Zeltes war wie ein Trommelfell gespannt, und die übrige Leinwand flatterte und schlug mit äußerster Heftigkeit. Ich sprang auf und ergriff die vorderste Zeltstange, da Stage und Taue zu reißen drohten. Aber hinauszugehen, um das Schauspiel zu betrachten, erwies sich als unmöglich. Man konnte in diesem Sturm nicht aufrecht stehen, und von der Umgebung war nicht eine Spur zu sehen, nicht einmal die allernächsten Zelte. Die Luft war voller Sand und Staub, die Zelttücher klatschten, und das feine Mehl drang überall ein und bedeckte alles, was offen dalag. Leichtere Sachen, Papier und Karten, mussten schleunigst in die Kisten geworfen werden, damit sie nicht davonflogen. Bergmans Tropenhelm verschwand im Nebel — „er ist nach Paoto zurückgeflogen", meinte Larson; doch er fand sich später zwischen den Packkisten wieder. Nach einigen Minuten war die heftige Sturmbö vorüber. Sie hörte ebenso plötzlich auf, wie sie hereingebrochen war, und nun konnten wir uns die Schäden besehen, die sie angerichtet hatte. Vier von den sechzehn Zelten lagen umgeworfen auf der Erde. Unter ihnen das Kasino, dessen äußeres Sonnendach völlig zerrissen war und gleich einer zerfetzten Fahne im Wind flatterte. Ein lustiger Einschlag in diesen Gräueln der Verwüstung war das Bild, das die hilflosen Bewohner der umgewehten Zelte darboten. Aus den Ruinen seiner Behausung ragte die stattliche Gestalt des „Herzogs der Mongolei" empor, wie er philosophierend auf einer Kiste saß und darüber nachdachte, an welchem Ende er mit dem Wiederaufbau anfangen sollte. Auf den beiden anderen Unfallstätten standen die Betten mit Staub und Sand bedeckt, und die Besitzer suchten ihre zerstreuten Habseligkeiten zusammen.
Nach einem leichten Regen in der Dämmerung wurden die Kamele zu ihren Lasten geführt und sollten hier liegen und die ganze Nacht wiederkäuen. Die Kamele werden stets des Abends ins Lager gebracht, nicht aus Furcht vor Dieben, die sie stehlen könnten, sondern weil sie, im Gegensatz zu Pferden, nicht sehen können, wenn sie im Dunkeln weiden.
Die letzte Pflicht des Tages war, die Nachtwachen zu verteilen. Zwei Europäer und vier Mann der Leibgarde wurden dazu ausersehen. Die Soldaten baten uns, uns nicht vom Lager zu entfernen; denn dann könnte man weggeschnappt oder auch bei der Rückkehr erschossen werden. Es erging daher der Befehl, dass niemand sich während der Nacht außerhalb der Grenzen des Lagers aufhalten dürfe.
Wenn man weiß, dass man in aller Frühe wieder geweckt wird, hat man nichts dagegen, sich schon um 5 Uhr schlafen zu legen. Zu meiner eigenen Verwunderung spürte ich nicht die geringste Müdigkeit nach diesem ersten Tagemarsch auf unserm weiten Weg nach Westen. Ich lag noch eine ganze Weile wach und dachte an das Eigenartige meines Schicksals. Nach einer Pause von neunzehn Jahren war ich wieder auf einer Expedition in Asien. Früher war ich stets allein auf Abenteuer ausgezogen. Jetzt war ich der Leiter eines Stabes von achtundzwanzig Europäern und Chinesen. Alle waren Gelehrte oder wenigstens gebildete Männer. Die meisten hatten meine Bücher gelesen. Nun führten sie selbst Tagebuch und würden allmählich Gelegenheit haben festzustellen, ob meine Schilderungen mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Keiner von ihnen, nicht einmal Larson, Norin und Juan, die am weitesten herumgekommen waren, waren jemals im Herzen von Asien gewesen, wo ich mehrere meiner besten Jahre verbracht habe. Von den Europäern hatten die meisten nie vorher Astens Boden betreten, und die Chinesen waren nur innerhalb der Grenzen des eigentlichen Chinas gereist. Der Weg über den Gaschun-nor und Haust nach Urumkschi war uns allen unbekannt. Ich hatte mit Absicht einen Weg und eine Gegend gewählt, die ich noch nicht kannte. Schon der erste Tagemarsch gab uns einen Vorgeschmack der kommenden Tage und Monate. Auf jedem neuen Tagemarsch würden wir nach Westen über die endlosen Weiten spähen, wo alles neu für uns war und ziemlich dunkel für die ganze übrige Welt. Wir würden unsere Augen gut offenhalten, wenn wir die 2100 Kilometer zurücklegten, die uns von der Hauptstadt der Provinz Sin-kiang, Urumtschi, trennten.
Der Wunsch und Traum, der mir so viele Jahre hindurch vorgeschwebt hatte, war endlich in Erfüllung gegangen. Ich lag auf asiatischer Erde, ich hörte die Schritte der Wachtposten um unsere Zelte und lauschte dem Brausen des Nachtwindes über unserm Lager. Es war nicht länger ein Traum, es war Wirklichkeit, und ich hatte die ersten Schritte getan, um die größte Aufgabe zu lösen, die ich je ersonnen, die ich mir je gestellt habe.
Als ich am Morgen des zweiten Marschtages um ½ 5 Uhr geweckt wurde, musste ich mir erst die Augen reiben, um zu fasten, dass ich wirklich wieder auf der Reise durch mein altes Asien war und dass der ganze Erdteil vor mir und meinen Begleitern offen dalag. Ein stolzes und herrliches Gefühl! Die Nacht war kühl gewesen; noch um 5 Uhr hatten wir nur 8,8 Grad über Null. Von der Müdigkeit, auf die ich gefasst gewesen war, merkte ich nichts. Vielleicht war mein Rücken etwas steif; aber der wird mit der Zeit schon geschmeidig werden.
An allen Ecken und Enden wird gerufen, geschrien und kommandiert — in schwedischer, deutscher, chinesischer und mongolischer Sprache. Larson schreitet wie ein Feldmarschall umher und überwacht das Ganze. Die Kamele brüllen ärgerlich und spucken, als ihnen die Lasten auf die Packsättel gelegt und sie gezwungen werden, sich zu einem neuen Tagemarsch zu erheben. Die Zelte werden abgebaut, die Betten zusammengerollt, die Küche in ihre Kisten verstaut, und wieder genießen wir das prächtige Schauspiel, wie die gewaltige Karawane sich in Bewegung setzt und auf naheliegende Hügel zustrebt.
Unser Weg führt das Tal des Kundulung-gol hinauf, wo wir, behaglich plätschernd, den murmelnden Bach durchschreiten. In geschützten Schluchten wachsen gelbe wilde Rosen und blaue Schwertlilien und andere eben erwachte Blumen, und hier und da, wo sich das Tal weitet, ziehen wir über Wiesen und begegnen Ochsenkarren mit knarrenden Rädern. Es ist frisch und kühl, und bei dem schneidenden Wind freut man sich seiner Lederweste. Professor Siu Ping Ch'ang hat sich in seinen Ulster eingehüllt — alle Chinesen tragen europäische Sportkleidung. Ein paar von ihnen thronen in aller Seelenruhe auf ihren Packlasten und lesen. Wir halten an einer Biegung und lassen den endlosen Zug an uns vorbeimarschieren. Ein Herr des Stabes reitet am Schluss der Karawane und ist dafür verantwortlich, dass nichts verlorengeht.
Bei dem Dorf Sabasa rasten eine Anzahl Ochsenkarren und zwei der hübschen und praktischen Fuhrwerke, die gewöhnlich Pekingkarren heißen und hier als Beförderungsmittel benutzt werden. Der obere Teil von Sabasa lag in Trümmern und war verlassen. Hier standen mitten auf der Dorfstraße drei Schrapnelle als Andenken an Fengs leichte Feldartillerie. Noch immer begleitet uns die Telegraphenlinie nach Wu-yuan. Sie besteht aus drei Drähten. Der unterste hing an einer Stelle so niedrig, dass wir ihn mit einer Stange in die Höhe heben mussten, damit er nicht beschädigt wurde. Zwei geplünderte Autowracks legen gleichfalls beredtes Zeugnis ab von Marschall Fengs Heerfahrt in diesen Gegenden. Einige Dörfer sind völlig verlassen und verfallen, aber trotzdem sieht man überall die Spuren der Pflugschar. Andere wirken reizvoll in dem Grün von Weiden und Ulmen, in das sie eingebettet sind.
Das Tal ist jetzt weit und offen. Wir ziehen auf der linken Talseite entlang, wo in langen, langen Quelltümpeln, Erweiterungen des kleinen Baches, Algen üppig wuchern. Hier breiten sich weiche, duftende Wiesen aus — welch herrlicher Platz für ein Lager! Ein Paradies in diesem dürren, gelbgrauen, öden Land! Aber die Vorhut marschiert weiter über unfruchtbare Geländewellen, und das Paradies verschwindet wie ein Traumbild.
Ein Stück weiter erreichten wir das Dorf Wu-funkse. Hier wollten wir übernachten, die Soldaten konnten sich verschaffen, was sie brauchten, und vor allem sollten wir hier unsere Begleitmannschaft wechseln. Die Kamele wurden abgeladen, und auf einem Acker vor dem Dorf wuchs in kurzer Zeit unsere Zeltstadt empor. Sobald der Herd zu rauchen begann und der Filtrierapparat in Betrieb gesetzt war, versammelten sich um dieses merkwürdige Schauspiel die Dorfbewohner, in dunkelblaue oder rote Lumpen gehüllt. Unser Oberhofmeister, von Kaull, wühlte in den Küchenkisten herum und holte die Konserven heraus, die fürs Abendessen gebraucht wurden, dazu Butter, Keks, Käse und englische Marmelade.
Im Schein der schon im Westen stehenden Sonne wurden die dreißig Soldaten fotografiert, die von hier nach Paoto zurückkehren sollten. Der neue, zwanzig Mann starke Trupp mit rotgelber Fahne und rotgelben Binden am linken Arm war bereits zur Stelle. Auf Vorschlag der Chinesen wurde ungeordnet, dass beide Abteilungen sich an dem nächtlichen Wachtdienst beteiligten, die alte am Lager, die neue weiter draußen nach dem Kranz von Hügeln zu, der uns umgibt; man erklärte mir unumwunden, die rotweißen und die rotgelben Kriegsleute müssten verschiedene Aufgaben haben, damit sie sich nicht in die Haare gerieten und einander die Gewehre stöhlen. Ein kleiner Bürgerkrieg mitten in unserm Lager — das wäre fürwahr reizend gewesen! Die Soldaten, die dienstfrei waren, ritten ins Dorf, um dort die Nacht zuzubringen.
Ich sprach mit unsern Chinesen über den Nachtdienst, und sie fanden es ganz natürlich und selbstverständlich, dass auch sie hierbei ihre Pflicht taten. Sie wünschten nur, einen bewaffneten Europäer bei sich zu haben, der sie nötigenfalls gegen die Gefahren der Nacht und der Dunkelheit beschützen konnte. Alle vier Studenten wollten sogleich ihre Wachsamkeit prüfen und erhielten ihre Stunden zugeteilt. In den folgenden Nächten traten dann die chinesischen Gelehrten ihren Wachtdienst an, und sogar ihr Führer, Professor Siu Ping Ch'ang, bestand darauf, dass er nicht Übergängen wurde. Von den Europäern sind nur Larson und ich unseres Alters wegen vom Nachtdienst befreit. Ich wollte auch Dr. Hummel und Dr. Haude verschonen, die den ganzen Tag hindurch angestrengt zu arbeiten haben, aber sie wollten den anderen nichts voraushaben.
Es dämmert, und die Schatten der Nacht senken sich auf die Erde herab. Die Kamele kommen von der Weide, der nächtliche Wachtdienst beginnt. Aus halbgeöffneten Zelten dringt freundlicher Lichtschein hervor. Überall hört man Sprechen und Lachen. Eine Mandoline lässt muntere Weisen erklingen. Ringsum herrscht tiefster Friede. Wer könnte glauben, dass wir gerade einen der schlimmsten Räuberdistrikte des nördlichen Chinas betreten haben und dass wir uns in einer Gegend befinden, wo der Bürgerkrieg jederzeit von neuem aufflammen kann?
Am nächsten Morgen hatte ich mich kaum angezogen, als mir gemeldet wurde, dass die alte Begleitmannschaft darauf wartete, von mir entlassen zu werden. Die Soldaten waren aufgesessen und hatten sich in einem Glied aufgestellt, und vor ihnen hielt, ebenfalls zu Pferde, ihr Anführer. Begleitet von den meisten Herren des Stabes, die sich zum Teil mit Apparaten bewaffnet hatten, begab ich mich vor die Front, dankte ihnen in chinesischer Sprache für ihre Wachsamkeit und wünschte ihnen eine glückliche Heimkehr. Nachdem sie ihre Vergütung von 60 Dollar erhalten hatten, machten sie auf ihren kleinen Pferden eine Schwenkung und sprengten in der Richtung nach Paoto davon.
Der neue Trupp von zwanzig Reitern trat nun in unsern Dienst. Sie hatten blaugraue helle Uniformen wie die früheren, aber statt Militärmützen gewöhnliche runde Seidenkäppchen. Einer von ihnen trug die rotgelbe Flagge an seiner Lanze. Alle hatten ihre Gewehre mit der Mündung nach unten am Sattelknopf befestigt. Ihre kleinen Pferde waren nicht besonders, aber gleichwohl taten die Leute alles, was sie konnten, um unsere Kamele tödlich zu erschrecken, als sie mit Lärm und Getöse, klappernden Gewehren und Taschen, munteren Liedern oder wildem Geheul an unser Lager herangaloppiert kamen.
Wir brechen auf. Zwei Soldaten reiten voran und in ihrer Gesellschaft Dr. Haude, der eigenhändig das philosophisch ruhige Kamel führt, dem zwei besonders kostbare und empfindliche Kisten anvertraut sind. Die eine enthält unsere Chronometer, die andere die täglich notwendigen Instrumente des meteorologischen Observatoriums. Zur Abwechslung reite auch ich mit Larson, Hummel, Bergman und Dettmann an der Spitze. Wir bilden eine lebhaft plaudernde Gruppe. Das heißt, es sind die anderen Herren, die sich unterhalten und scherzen; ich selbst muss ja ständig meine Aufmerksamkeit dem Weg und der Karte widmen und alle Beobachtungen in meine Kladde eintragen. Wir befinden uns auf einer weiten Ebene, die einem Längstal zwischen zwei sehr flachen Bergketten gleicht. Fast überall ist der Boden mit Hafer, Senf, Opium bebaut oder wenigstens bis vor kurzem bebaut gewesen. Vor gar nicht so langer Zeit war dies Land rein mongolisch, aber chinesische Ansiedler haben sich zu geringem Preis Land gekauft und entlocken dem Boden seine Ernte. Einige Mongolen sind zwar wohnen geblieben; aber sie unterliegen gewöhnlich in dem Wettkampf mit den zähen, emsigen und mit den Geheimnissen des Ackerbaus vertrauten Chinesen. Diese gewinnen Gelände, während die Mongolen, die Nomaden sind, unaufhaltsam nach Norden zurückgedrängt werden, auf die Südgrenze der Äußeren Mongolei zu. So geht hier eine anhaltende Völkerwanderung vor sich von ganz derselben Art, wie ich sie 1923 auf meiner Autofahrt durch die Mongolei weiter im Osten beobachtet habe. Aber in der Gegend, die wir jetzt durchqueren, ist die friedliche Arbeit durch Bürgerkrieg und plündernde Räuberbanden gehemmt oder ganz unterbunden worden. Auf den Äckern des Dorfes San-funtse schreitet ein einsamer Bauer hinter seinem Pflug und seinen schwarzen Ochsen, und aus den verfallenen Gehöften von Sadjaju gähnt nur Armut und Not. Nicht ein Huhn ist zu sehen, selten ein schwarzes Schwein, nur einige magere, hungrige, zerlumpte Gestalten. Doch sie betteln nicht, sie betrachten uns nur verwundert und verstehen nicht, warum wir in solcher Zahl durch das verheerte Land ziehen.
Noch mehrere solcher verödeter kleiner Dörfer liegen an unserm Weg, der doch Spuren eines recht lebhaften Verkehrs trägt. Die Felder von Örtenigo werden durch kleine Kanäle bewässert, deren Ufer mit Ulmen bepflanzt sind. In ihren Kronen haben Elstern ihre Nester. Es wirkt erfrischend, grünende Bäume und Wasser zu sehen.
Gegen Mittag setzte heftiger Nordwind ein. An dem hellblauen Himmel vor uns im Norden schwebte eine höchst eigenartige milchweiße Wolkenbildung, eine gewölbte Brücke über das ganze Firmament von Westen nach Osten, einem bogenförmigen Nordlicht ähnlich, ein symbolischer Triumphbogen, durch den wir in dieses Land hineinziehen wollten, das anderen Weißen so gut wie verschlossen war.
Wir ritten jetzt in der Mitte der Karawane, die sich anschickte, auf einem Brachfeld jenseits des Dorfes Örtenigo haltzumachen. Einige Lasten waren schon abgeladen. Doch wider Erwarten setzte sich die Spitze von neuem in Marsch, und alle Kolonnen folgten, nun bei hartem Nordwest. Wir hatten auf beiden Seiten niedrige Berge, und es war unmöglich zu erkennen, nach welcher Richtung das Gelände abfiel. Nur die nächsten Hügel traten aus der diesigen Luft hervor. Wir marschierten noch zwei Stunden weiter; zwei Stunden, die wir nicht so bald vergaßen. Der Wind nahm an Stärke zu und wurde unangenehm. Pelze, Decken und anderes, was lose auf den Kamelen lag, flatterte und klatschte, und ich hatte meine liebe Mühe, Karte, Tasche und Kompass daran zu hindern, mir davonzustiegen. Mein Kamel ist jetzt das allerletzte der ganzen Karawane. Larson und Bergman gehen zu Fuß neben mir. Vor uns auf der in Dunst gehüllten Steppe schlängelt sich der dunkle Zug in immer undeutlicheren Tönen, die sich schließlich im wirbelnden Staub völlig verwischen. Die vordersten Kolonnen sind überhaupt nicht zu sehen. Aber schön ist das Schauspiel auch bei dieser Beleuchtung. Die Luftgeister rollen sich gegen uns zusammen, aber wir gehen trotzdem weiter, ein Heereszug, ein wandernder Stamm, eine unübersehbare Schar von Männern und Tieren auf dem Weg nach einem fremden Land. Es pfeift und heult um die Lasten, und an den Kamelen und Pferden hängen dichte Staubwolken wie graue Kometenschweife. Wir reiten wie durch einen brausenden Fluss wirbelnden Staubes und Sandes. Aber hier und da sieht man örtliche Wirbelwinde, Tromben, die über die Steppe einhergetanzt kommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals früher nahe daran gewesen bin, von dem Kamel, das ich ritt, herabgeworfen oder heruntergefegt zu werden. Aber jetzt fehlte nicht viel. Von Nordwesten schraubte sich eine gelbgraue Staubhose, an der Basis dunkelbraun und zusammengeschnürt, schnell heran, ein kleiner wütender Taifun oder Tornado in verkleinerten: Maßstab. Die anderen Tromben zogen an uns vorüber, teils vor uns, teils im Kielwasser der Karawane. Doch diese schien es auf uns abgesehen zu haben und trieb mit unaufhaltsamer Gewalt gerade auf das Ende des Zuges zu.
„Halt deinen Hut fest!" rief Larson mir zu und warf sich gleichzeitig zu Boden.
In demselben Augenblick ging die Windhose über mein Kamel und die vier nächsten vor mir hin. Ich warf mich mit aller Gewalt nach Luv und klammerte mich an den Stricken der Last fest. Wie ein Schlag traf uns der Wirbel. Wenn ich mich nicht festgehalten hätte, wäre ich unfehlbar hinuntergefegt worden. Die ganze Kamellast wackelte und war nahe daran, sich zu drehen, denn das Tier, die Ladung und ich bildeten einen tüchtigen Windfang. Es fehlte nicht viel, dass die ganze Herrlichkeit über Bord ging. Das Kamel taumelte, scheute und machte wie seine Kameraden einen Bogen nach Lee. Kleine Steine und Sand hagelten auf meinen Tropenhelm und meine Hände, dass es schmerzte. Aber nach ein paar Sekunden war alles vorbei. Die Trombe setzte ihre rätselhafte Wanderung über die Steppe fort. Sie mochte 15 Meter im Durchmesser betragen haben. Ein eigenartiges, merkwürdiges Schauspiel! Man muss jedoch einen solchen Racker am eigenen Leibe verspürt haben, um vor ihm und seinesgleichen die richtige Achtung zu bekommen. Die anderen Mitglieder der Karawane hatten nicht das geringste gemerkt.
Es ist gerade kein Vergnügen, bei solchem Wetter zu reiten, und alles andere als leicht, dabei auf dem Rücken eines wiegenden Kamels eine Kartenroute aufzunehmen. Aber als wir um den nächsten Bergvorsprung herumbogen, sahen wir zu unserer Freude, dass die Kolonnen eine nach der anderen haltmachten und das Lager ganz in der Nähe des Dörfchens Nobo-deen aufschlugen, das sich an Einwohnerzahl keineswegs mit unserer wandernden Stadt messen konnte. Sobald mein Zelt aufgebaut war, kamen die Schweden zu mir herein und taten sich an Tee, Keks, Butter und Marmelade gütlich. Wir lachten und plauderten und fühlten uns äußerst wohl, während der Sturm draußen tobte und heulte. Die Windstärke betrug 18 Sekundenmeter, und die Temperatur war um 6 Uhr nur 12 Grad über Null. Die Sonne sah man nur als eine matte Scheibe.
Nach dem Abendessen kamen Major Hempel und Professor Siu, um mit mir wegen der Nachtwache zu sprechen. Die Chinesen hatten lange Beratungen gehabt, wie sie sich bei einem Überfall verhalten sollten. Einige von ihnen waren dafür gewesen, sie sollten sich, da sie nicht bewaffnet seien und somit sich an der Verteidigung nicht beteiligen könnten, aus ihren Zelten schleichen und auf der Erde liegenbleiben; denn eine etwaige Räuberbande würde sicher die Zelte als Zielscheiben nehmen. Hempel riet ihnen, ruhig in ihren Zelten zu bleiben und nicht hinauszueilen, da sie im Dunkel und Durcheinander leicht aus Versehen erschossen werden könnten.
Unsere Leibgarde hatte sich bei Professor Siu beklagt, sie hätte zu wenig Munition, und hatte darum gebeten, von uns Patronen zu erhalten. Siu hielt es jedoch für vorteilhafter, wenn die Soldaten möglichst wenig Munition hatten, und hatte ihnen daher geantwortet, unsere Patronen seien zu groß für ihre Gewehre.
Die vier Studenten sollten heut wieder Wache halten sowie sechs Mann unserer Bedeckung, einer an jeder Ecke der Lagerstadt und zwei, die die Runde machten. Alle zwei Stunden sollten die Posten abgelöst werden. Wir beschlossen auch, dass zwei von den Deutschen sich am Wachtdienst beteiligten. Sie waren im Kriege gewesen, die Wachsamkeit lag ihnen im Blut, und sie konnten bei einem plötzlichen Überfall die Lage weit sicherer beurteilen als die Chinesen. Wir waren also recht stark behütet und bewacht.
Aber die Nacht verfloss — beim Heulen des Sturmes und dem vielstimmigen Chor der Winde — ohne jeden Zwischenfall, und als die Sonne aufging und den umher fliegenden Staub rot färbte, vermissten wir weder Leute noch Sachen, und unsere Zelte waren von keinen Kugeln durchbohrt worden.
3. Unsere Karawanen vereinigen sich in der Mongolei.
Das Dorf Nobo-deen hat zwar eine eigene Kohlengrube, aber die Kohle ist weniger gut, und als wir am 23. Mai weiterzogen, eilten die Dorfbewohner mit Körben und Säcken herbei, um den Kameldung zu sammeln und die Kamelwolle, die sie zu Schnüren und Stricken zusammendrehen.
Wieder erlebten wir das großartige Schauspiel, wie die gewaltige Karawane aus der Lagerstadt hervorwuchs, die gleichzeitig vom Erdboden verschwand. An Schein der ausgehenden Sonne standen die stattlichen Kamele beladen in geschlossenen Gruppen. Ein herrliches Bild, wie eine gewaltige Steinplastik hoben sich die auf der einen Seite grell beleuchteten Körper gegen ihre Schatten ab.
Der lange Zug bewegt sich in nordwestlicher Richtung auf die nächsten Anhöhen zu. Wir ziehen in diese niedrigen Berge hinein und steigen in einer schmalen, sich schlängelnden Talschlucht aufwärts, einem Sandbett zwischen steinigen Hügeln, wo kristallinischer Schiefer und Granit hier und da zutage treten. Die Soldaten an der Spitze der Karawane sind der Ansicht, dass dieser Hohlweg wie geschaffen für einen Überfall und gefährlich ist, und bitten darum, dass ein paar unserer Schützen voranreiten. Unsere Leute lassen sich jedoch in ihrer Ruhe nicht stören. Unser Waschjunge liegt auf seinem Kamel und schläft, und zwei unserer Studenten werden auf dem schaukelnden Rücken ihrer Tiere auch bald einnicken.
Der Himmel ist herrlich blau, der Wind beinahe kalt. An einer Biegung des Tales steht ein Brunnen mit einem Steintrog für durstige Tiere. Auf der Nordseite eines kleinen Passes ist auf den Hügeln zur Linken des Weges eine verfallene Steinmauer zu sehen, die sich recht weit hinzieht — ein Verteidigungswerk aus alten Zeiten. Auf der Passschwelle erhebt sich ein kleiner Steinhaufen; fromme Wanderer legen hier einen Stein nieder für die Geister des Berges, als Dankopfer, dass man wohlbehalten so weit gekommen ist. Ein zweiter Pass, den wir überschreiten, ist 1700 Meter hoch, und dann geht der Weg zum Gasthof Nsu-tschang-wang hinunter. Der Name „Krümmung des Kuhdarmes" ist nicht übel; das Tal verengert sich hier und ist ein paarmal von steilen Bergwänden begrenzt. Die Erosionsterrassen sind 3 Meter hoch. Zwischen den Hügeln hört man Felstauben gurren und Rebhühner gackern, ein mit Häuten beladener Ochsenkarren, dem wir begegnen, singt sein knarrendes Lied.
Das Tal weitet sich wieder, und das Land wird flach und offen. Am Fuß der letzten Berge liegt das Dorf Jagar-tschigo oder Jagarin-gol. Bei dem Dorf Hung-watse-gung-jung schlagen wir das Lager auf. Es geht mit jedem Tage schneller, denn alle wissen, was sie zu tun haben.
Jeden Morgen kurz nach 4 Uhr weckt uns Larsons lauter Ruf „Antreten!". Die Chinesen wissen zwar nicht, was das Work bedeutet, aber alle lachen sich eins, wenn sie das Kommando des „Herzogs" hören. Doch Larson ist unbarmherzig. Man muss sofort aufstehen, um zum Frühstück fertig zu sein. Darauf folgt eine lange Pause, während die Zelte abgebaut und alle Sachen gepackt werden. Hat man da Lust, kann man an einem geeigneten Platz schnell noch ein kleines Schläfchen machen. Aber was mich selbst betrifft, kann ich versichern, dass ich inzwischen bei dem Tumult lärmender Mongolen und Chinesen und brüllender Kamele, der mich auf allen Seiten umgibt, völlig wach geworden bin. Daheim in Stockholm gehe ich um 4 Uhr morgens zu Bett. Hier stehe ich zu dieser Zeit auf. Doch alles geht, wenn man sich nur daran gewöhnt, und hier lege ich mich überdies um 9 Uhr abends schlafen.
Das Gelände, das wir jetzt durchqueren, ist leicht gewellt. Aber wie flach die Bodenwellen auch sind, so hat man doch von ihren Kämmen aus eine schier unendliche Fernsicht. Es ist natürlich immer die Karawane, die das Bild beherrscht. Ich reite wieder in der Mitte. Von meinem hohen Beobachtungspunkt steht es aus, als hätte ich die Hauptmasse meiner Heeresmacht vor mir, und doch zähle ich noch acht lange Kolonnen hinter mir, abgesehen von einzelnen Kamelreitern und den zu beiden Seiten reitenden Soldaten auf braunen oder schwarzen Pferden.
Nachdem wir noch einige flache Geländewogen überschritten haben, wird das Land fast völlig eben. Spuren des Pfluges sind noch häufig zu sehen und hier und da ein kleines Dorf. Bei einem von ihnen fleht ein recht einfacher Votivaltar mit einem kaum ½ Meter hohen Buddhastandbild. Dann nähern wir uns einem Dorf mit runden Türmen und Zinnen, das einer Festung ähnelt. Die Mongolen nennen es Hatscho, die Chinesen Hadschao-tang. Wir marschieren jedoch weiter und machen erst eine Weile später bei dem Dörfchen Bajin-buluk, „Die reiche Quelle", halt, wo wir auf einer einladenden Wiese das Lager aufschlagen.
Wir befinden uns hier 1585 Meter über dem Meeresspiegel. Chinesische Ansiedler gibt es in dieser Gegend schon seit sechs Jahrzehnten, und die Mongolen haben sich nach Norden zurückgezogen. Der Anbau von Opium ist am lohnendsten. Hunderte von Hektar sind diesem verderblichen Gift gewidmet. Überall, wo Bewässerung möglich ist, werden die Leute gezwungen, Opium anzubauen. Der übrige Boden ist dann für Getreide gut genug. In den Ertrag teilt sich der Bauer mit den Soldaten. Jetzt im Vorsommer gilt die Gegend als verhältnismäßig ruhig, denn es gibt nichts zu plündern. Aber in zwei Monaten, wenn die Opiumernte reif ist und die Schafe sich an dem frischen Gras rund und fett gefressen haben, lohnt es sich schon eher, auf Raub auszugehen. In dem Bezirk Gu-jan wird auf einem Gebiet von 2000 Tschin, 12000 Hektar, Opium angebaut. Ein Tschin zerfällt in 160 Mou, und aus einem Mou lässt sich ein Ertragswert bis zu 100 Dollar herauswirtschaften, wenn die Qualität gut ist. Der Unterpräfekt von Gu-jan nimmt bis zu 20 Dollar Steuer für den Mou. Es lohnt sich also, es handelt sich um ungeheure Summen! Aber das Volk hungert. Von dem Gewinn hat es nicht viel; der fließt in die Taschen der Machthaber. Dem Gesetz nach ist es verboten, Opium anzubauen, und tut man es trotzdem, so wird die Ernte beschlagnahmt und der Boden enteignet. So lautet das Gesetz. Aber niemand kümmert sich darum. Alle bauen und ernten die verbotene Frucht, und der erste Hüter des Gesetzes in dem Bezirk, der Unterpräfekt von Gu-jan, heimst seinen schweren Gewinn an Steuern ein.
Am 25. Mai näherten wir uns den nördlichsten Grenzen des Kulturlandes, das von den chinesischen Ansiedlern erobert worden ist. Jenseits dieser Grenze breiten sich die unübersehbaren Weiten der Mongolei aus. Larson und seine Mongolen sehnen sich danach, aber auch wir anderen freuen uns auf die Stunde, wo wir die letzten Furchen chinesischer Pflüge hinter uns lassen und in die wilde, unberührte Ödmark hinauskommen, die Heimat der Nomaden und der Antilopen.
Der Boden ist jetzt wieder mehr durchfurcht. Auf dem Kamm eines Hügelrückens, über den unser Weg führt, sind Larson und ein paar der anderen stehengeblieben. Am Norden ist eine weite Ebene zu sehen, die ganz hinten in der Ferne von niedrigen Erhebungen begrenzt wird. „Der Herzog der Mongolei" nimmt seinen Hut ab und ruft: „Das ist mein Land!" Ja, dort kennt er sich aus!
An einem kleinen wasserarmen Rinnsal, Abogajin-gol, schlugen wir das Lager auf. Es war noch früh am Tage. Einige machten ein kleines Schläfchen, um die Zeit bis zum Mittagessen auszufüllen, andere hatten eine Herde von dreißig Antilopen entdeckt und gingen auf die Jagd.
In der Dämmerung, als wir beim Abendessen saßen, kamen die Kamele von der Weide; wie schattenhafte Gespenster schlichen sie mit leisen Tritten zu ihren Lasten. Bergman, auf einer Kiste thronend, sang alte schwedische Lieder zur Laute in die lauschende Steppe hinaus, auf der in alten Zeiten Dschingis Khan mit seinen Reiterscharen einherzog. Hummel und von Kaull haben heute Nacht Wache. Sie sind mit Pistolen und starken elektrischen Lampen bewaffnet, die auf unsere Leibgarde größeren Eindruck gemacht haben als unsere Waffen, da man sie für Zauberkräfte hält.
In der Frühe des nächsten Morgens erhielt unsere Begleitmannschaft den Rest ihres Soldes ausgezahlt und ein Trinkgeld zum Abschied. Sie schwangen sich auf ihre Pferde und stellten sich in Reih' und Glied auf, und ich entließ sie wie ihre Vorgänger mit einem einfachen: „Sie, sie, i lou ping an! Danke, danke, viel Frieden unterwegs!" Sie grüßten, warfen ihre kleinen Pferde herum und trabten davon.
Matte Lama, den Larson ausgeschickt hatte, nach Norin und seiner Karawane Ausschau zu halten, war noch nicht zurückgekehrt.
Um 7 Uhr brachen wir auf und zogen über angenehm weichen, mit kurzem Gras bedeckten Boden. An einer trockenen Erosionsfurche strichen zwei Wölfe entlang und beäugten uns. Larson pirschte sich heran und legte an — keiner von uns glaubte, dass er treffen würde; denn die Entfernung war viel zu groß. Der Schuss knallte, und der