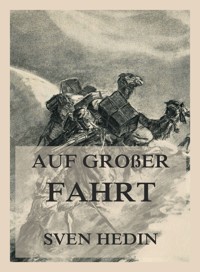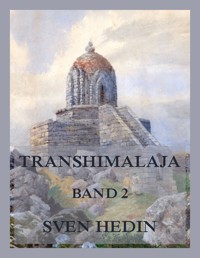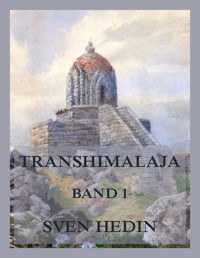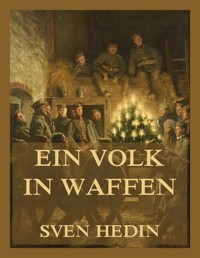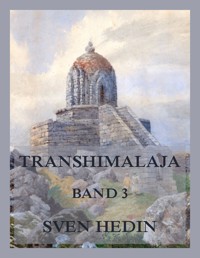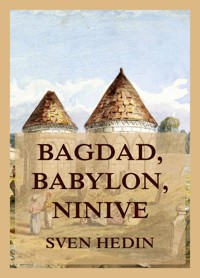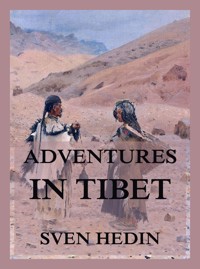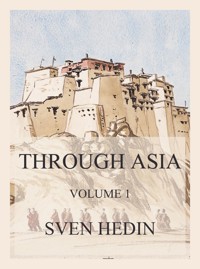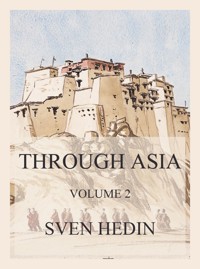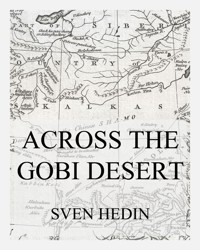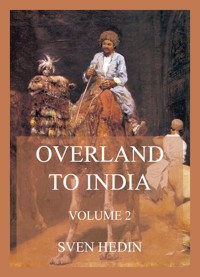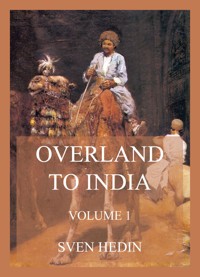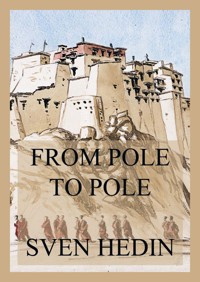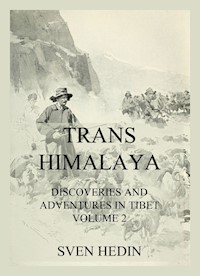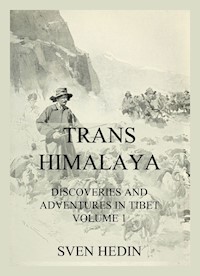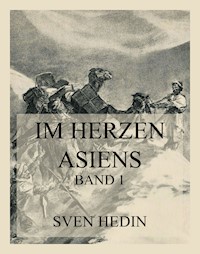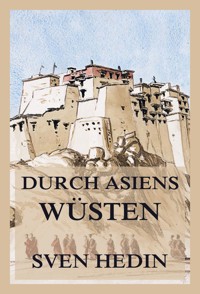
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sven Hedins Beschreibung seiner dreijährigen Reisen quer durch Asien verdient eine der ersten Stellen unter den Reiseerzählungen. Durch die Kirgisensteppen begab sich der Forscher nach dem Pamirplateau, wo damals die Russen einen militärischen Posten angelegt haben, um ihre Ansprüche gegen China, England und Afghanistan aufrecht zu halten. Von dort versuchte Hedin den 7300 m hohen Mustagata, den "Vater der Eisberge" zu ersteigen, ohne freilich dessen Spitze zu erreichen. Weiter ging es in die Sandwüsten des chinesischen Turkestans, wo endlose Qualen durch das Labyrinth der vom Wind haushoch aufgetürmten Dünen sowie schreckliche Strapazen warteten. Nach Aufstellung einer neuen Karawane drang der unerschrockene Mann nochmals in den menschenmordenden Sand ein und entdeckte zwei untergegangene, einst volkreiche Städte. Nachdem sich Hedin in der großen chinesischen Stadt Kaschgar von den Anstrengungen und Aufregungen der Wüstenreise erholt hatte, brach er nach Osten auf, um den Lop-nor zu untersuchen, um sich schließlich mit einer Karawane nach Süden zu wenden, um das höchste Bergland der Erde, Tibet, zu durchqueren. Sven Hedins Reise durch Asien war und ist eine Leistung ersten Ranges; sein Bericht, der sich an das große Publikum wendet, ist in hohem Grade anziehend und mannigfaltig, ein Spiegelbild der an Gegensätzen so reichen Natur Asiens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Durch Asiens Wüsten
SVEN HEDIN
Durch Asiens Wüsten, S. Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681287
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort des Herausgebers. 1
Band 1. 2
Vorwort.2
Erstes Kapitel. Zum Dach der Welt.6
Zweites Kapitel. Eine Winterfahrt über Pamir.15
Drittes Kapitel. Geographische Übersicht von Pamir. Pamlrskij Post.32
Viertes Kapitel. Zum Vater der Eisberge.40
Fünftes Kapitel. Erinnerungen an Kaschgar.51
Sechstes Kapitel. Bei den Kirgisen des Mus tag ata.60
Siebtes Kapitel. Wanderungen am Kleinen Kara kul.74
Achtes Kapitel. Auf den Gletschern des Mus-tag ata.81
Neuntes Kapitel. Auf dem Vater der Eisberge.86
Zehntes Kapitel. Eine Mondscheinnacht 6300 Meter über dem Meer.97
Elftes Kapitel. Eine neue Fahrt quer durch Pamir.104
Zwölftes Kapitel. Segelfahrten und Tiefenlotungen auf dem kleinen Kara kul.112
Dreizehntes Kapitel. Das Leben der Kirgisen. Rückreise nach Kaschgar.118
Vierzehntes Kapitel. Der Wüste entgegen.125
Fünfzehntes Kapitel. Eine Wallfahrt135
Sechzehntes Kapitel. Auf der Schwelle der Wüste.145
Siebzehntes Kapitel. Ein irdisches Paradies.157
Achtzehntes Kapitel. Die Heimat der Grabesstille.164
Neunzehntes Kapitel. Kein Wasser!175
Zwanzigstes Kapitel. Der Untergang der Karawane.184
Einundzwanzigstes Kapitel. Gerettet!195
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Rettung Islam Bais.210
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Rückkehr aus der Wüste.221
Band 2. 229
Erstes Kapitel. Ein halsbrecherischer Pass.229
Zweites Kapitel. Unter Russen und Engländern auf Pamir.235
Drittes Kapitel. Über vier Bergketten.241
Viertes Kapitel. Abschied von Kaschgar.247
Fünftes Kapitel. Aus einer alten Stadt Innerasiens.254
Sechstes Kapitel. Funde in Borasan.258
Siebtes Kapitel. Ein Pompeji der Wüste.266
Achtes Kapitel. Ein unbekannter Hirtenstamm.274
Neuntes Kapitel. Durch das Heimatland des wilden Kamels.281
Zehntes Kapitel. Durch die Urwälder des Tarim.291
Elftes Kapitel. Der alte Cop-nor.303
Zwölftes Kapitel. Eine Bootsfahrt.310
Dreizehntes Kapitel. Eine glückliche Begegnung«. 318
Vierzehntes Kapitel. Ein Kriminalroman.324
Fünfzehntes Kapitel. Meine neuen Aufgaben.329
Sechzehntes Kapitel. Zum nördlichen Fuß des Kven-lun.339
Siebzehntes Kapitel. Die ersten Tagesmärsche in Nordtibet.346
Achtzehntes Kapitel. Zum Arka-Tag.353
Neunzehntes Kapitel. Der erste Salzsee.361
Zwanzigstes Kapitel. Der Wildesel und der wilde Jak.368
Einundzwanzigstes Kapitel. Das höchste Bergland der Erde.376
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die ersten Mongolen.385
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Unter den Zaidammongolen.394
Vierundzwanzigstes Kapitel. Räuber!401
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Das Land der Chara-Tanguten. Der Koko-nor.409
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Besuch im Tempel der 10000 Bilder.415
Siebenundzwanzigstes Kapitel. In Si-ning-ku. Der Dunganenaufstand.423
Achtundzwanzigstes Kapitel. Noch einmal durch die Wüste.431
Neunundzwanzigstes Kapitel. Nach Peking und heimwärts!438
Vorwort des Herausgebers
Sehr geehrter Leser,
wir, der Herausgeber dieses Buches, halten das Gesamtwerk Sven Hedins, das lange Zeit nur kaum, schwer oder gar nicht erhältlich war, für unverzichtbar für das kulturelle Erbe Deutschlands und der Welt.
Aus diesem Grund haben wir unter anderem dieses Ihnen hier vorliegende Werk zusammengesetzt aus Scans des in den 1890er Jahren erschienen Originals –– eine spannende, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe, da selbst den allerbesten Adleraugen der eine oder andere Druck- oder grammatikalische Fehler entgeht.
Deswegen geschätzter Leser, seien Sie nachsichtig, wenn Sie über etwas stolpern, das so ganz offensichtlich dort nicht hingehört. Teilen Sie uns auch gerne Ihre Funde mit, wir werden die entsprechenden Stellen schnellstens berichtigen.
In diesem Sinne, sehr viel Freude beim Lesen,
Ihr Jazzybee Verlag
(Jürgen Beck)
Band 1
Vorwort.
Diese Arbeit, die hiermit der Öffentlichkeit übergeben wird, erhebt keinen anderen Anspruch, als in großen Zügen eine Darstellung der Reise durch Asien zu geben, die ich in den Jahren 1893—97 ausgeführt habe. Das Werk ist für die große Allgemeinheit geschrieben und bietet nur eine Schilderung der Reise selbst und ihrer wichtigsten Erlebnisse, aber nicht aller.
Ein glücklicher Gedanke war, dass ich meine Reise in mehrere Abschnitte teilte. Nach jeder Exkursion konnte ich von den Strapazen ausruhen und die notwendigen Kräfte zur nächsten Kampagne sammeln; ich konnte die gewonnenen Resultate provisorisch bearbeiten und mich auf diejenigen Arbeiten vorbereiten, die auf dem nächsten Ausfluge meiner warteten; ich brach folglich jedes Mal mit neuen Interessen und neuen Gesichtspunkten auf.
Im letzten Augenblick hatte ich mich entschlossen, allein zu reisen, teils um mich besser nach der mir zur Verfügung stehenden Summe einrichten zu können, teils um bei Gefahren und Strapazen, die ich selbst ertragen zu können glaubte, für die aber ein Kamerad vielleicht sein Leben nicht hätte riskieren wollen, nicht in meinen Bewegungen gehemmt zu sein.
Ich will die wissenschaftlichen Arbeiten, die meine Tätigkeit hauptsächlich in Anspruch genommen haben, hier nur erwähnen: die Aufnahme geologischer Profile durch das östliche meridionale Randgebirge von Pamir und durch die Bergketten des Kven-lun-Systems, anthropologische Messungen einer Anzahl Kirgisen, Studium der Wanderungen der Nomaden in den verschiedenen Jahreszeiten, Untersuchungen über die Etymologie der geographischen Namen, Messung der Wassermenge eines jeden Flusses, den wir passierten, Tiefenlotungen in den Seen, Sammlung von Pflanzen, insbesondere von Algen, in den hochalpinen Regionen von Pamir und Tibet, Führung eines meteorologischen Journals dreimal im Tage, Sammlung eines reichhaltigen Materials in betreff der geographischen Ausdehnung und des Charakters der Wüste Gobi und des Flusssystems des Tarim. Ich hatte Gelegenheit, die Eigenheiten des letzteren an mehreren ganz verschiedenen Punkten von den Hochländern von Pamir und Tibet bis zu seinem fernen Ende, dem Lop-nor, zu untersuchen, zu beobachten, wie im Sommer in den Flussbetten riesige Wassermassen niederströmen, während sie im Winter zu unbedeutenden Rinnsalen zusammenschrumpfen, und wie diese Erscheinung jährlich wiederholt wird mit derselben Regelmäßigkeit, mit der das Blut durch die Adern pulsiert.
Die astronomischen Arbeiten, die ich zur Kontrolle des Itinerars ausführte, bestehen aus an 17 Plätzen vorgenommenen Bestimmungen der Polhöhe und der Zeit.
Die topographischen Arbeiten begann ich, nachdem ich die bekannten Gebiete im russischen Pamir hinter mir gelassen hatte, im Sommer 1894. Mit Diopter, Messtisch und Schrittzähler nahm ich das Gebiet um den Kleinen Kara-kul auf, von wo ich ausging, um die Gletscher des Mustag-ata kartographisch aufzunehmen.
Dann nahm ich jeden Weg auf, den ich während der Jahre 1894, 1895, 1896 und Anfang 1897 zurückgelegt habe. An keinem einzigen Tage habe ich diese wichtige Arbeit versäumt. Nicht eine Lücke ist in der langen gekrümmten Linie durch Asien, die erst ihr Ende fand, als ich am 2. März 1897 in Peking einritt und das 552. Kartenblatt gezeichnet hatte.
Die Wegelänge, die während des Marsches kartographisch ausgenommen wurde, beträgt 10498 Kilometer. Es ist dies einundeinhalbmal so viel als die Entfernung zwischen Kairo und Kapstadt, also ebenso viel wie ein Viertel des Erdumfangs. Fügt man dazu die 13000 Kilometer, die ich auf dem Kontinent in bekannten Gebieten im Wagen oder in der Eisenbahn zurückgelegt habe, so erhalten wir für die ganze Reise eine Strecke von über 23000 Kilometer, also mehr als die Entfernung des Nordpols vom Südpol. Während der ganzen Karawanenreise wurden in der Stunde im Durchschnitt 4 ½ Kilometer zurückgelegt.
Von den aufgenommenen 10498 Kilometern führten 3250 durch bis dahin absolut unbekannte Gebiete. Aber auch die übrigen 7248 Kilometer, auf denen ich der zweite, dritte oder höchstens der vierte war, bezeichnen keine verlorenen Wege. Denn der Umstand, dass ich die dschag-gatai-türkische Sprache beherrschte und infolgedessen von mehr oder weniger spitzbübischen Dolmetschern unabhängig war, setzte mich instand, selbst in früher besuchten Gegenden manche wichtigen Nachrichten zu erhalten. Unter anderem konnte ich auf meinen Karten eine sehr große Anzahl geographischer Namen eintragen, die bis dahin auf allen Karten gefehlt hatten.
Als Kuriosität möchte ich erwähnen, dass die auf den 552 Kartenblättern enthaltene, während der Reise gezeichnete Route 111 Meter lang ist, wobei die Weglinien auf den Karten der Mus-tag-ata-Gletscher noch nicht eingerechnet sind!
Die Kosten der Reise waren auf 33000 Mark veranschlagt gewesen. Dank der hohen Protektion und des großen Beitrages Seiner Majestät des Königs war es nicht schwer, diese aufzubringen. Mehr als die Hälfte wurde vom König, der Familie Nobel und Göteborger Mäzenen gezeichnet. Ich sage allen hiermit meinen herzlichen Dank.
Bei der Ankunft in Peking hatte ich jedoch eine Anleihe von 4400 Mark machen müssen, so dass sich die Kosten für die ganze Reise, Instrumente und Ausrüstung inbegriffen, auf 37400 Mark belaufen haben.
Mein Gepäck war, als ich Stockholm verließ, nicht groß, denn die massigere Ausrüstung wurde erst auf asiatischem Boden angeschafft. Ich hatte folgende Instrumente: einen Prismenkreis mit zwei Horizonten, zwei Chronometer, drei Aneroide, eine große Anzahl Thermometer und andere meteorologische Instrumente (darunter auch Insulationsthermometer, Psychrometer, Quellenthermometer, Maximum- und Minimumthermometer, einen Hypsometer mit drei Thermometern); ferner einen Messtisch mit Stativ und Diopter zum Kartenaufnehmen, sowie Kompasse; zwei photographische Apparate mit vollständiger Ausrüstung an Platten., Films, Chemikalien und sonstigem Zubehör; ferner zwei gewöhnliche Uhren, einen Feldstecher und ein kleineres Fernrohr von Aluminium; ungefähr 40 Brillen und Schneebrillen; schließlich geologische Hämmer, Messbänder, Malkasten, Zeichenmaterialien, Skizzen- und Notizbücher in Menge usw.
Das Arsenal bestand während der ganzen Reise aus drei Gewehren, einem schwedischen Offiziersrevolver und einem halben Dutzend anderer Revolver, sowie zwei Kisten Munition.
Die Bibliothek war natürlich so sehr wie möglich reduziert und bestand nur aus einigen wichtigen wissenschaftlichen Nachschlagebüchern, einer vollständigen Sammlung von Itineraren der letzten Jahrzehnte in Innerasien, russischer und englischer Übersichtskarten von Pamir, der Wüste Gobi und Tibet und aus der Bibel. —
* * *
Der großen Mängel voll bewusst, die meiner Reise und meinem Buche anhaften, und überzeugt, dass die eingeheimste Ernte für eine kräftigere, kundigere Hand in den goldenen Ähren Korn von höherer Reife gezeitigt haben würde, bin ich trotzdem zufrieden und dankbar, dass ich das Beste vollbringen konnte, was ich mit meinen schwachen Kräften vermocht habe. —
Zum Schluss nur ein Wort über die Ausstattung des Werkes. Die beiden großen Karten sind unter Aufsicht des Leutnants H. Byström in der Lithographischen Anstalt des Generalstabs in Stockholm ausgeführt worden, hauptsächlich auf Grundlage der Karten von Curzon über Pamir und von Pjewzoff über Zentralasien; auf ihnen sind die neuen Entdeckungen eingetragen worden. Sie dienen nur zur Übersicht über die Reise und erheben keinen Anspruch auf minutiöse Genauigkeit.
Um den spannenderen, charakteristischeren Situationen mehr Leben zu verleihen, konnte ich das Werk mit einer Anzahl Bilder schmücken, die von schwedischen Künstlern ausgeführt wurden. Diese Bilder dürfen keineswegs als Phantasiegebilde betrachtet werden. Für jedes einzelne derselben habe ich ein reiches Material an Skizzen und Photographien, und wo diese fehlten, an ausführlichen Beschreibungen den Zeichnern an die Hand gegeben. Ich habe mit einem Wort die Ausführung eines jeden einzelnen Bildes überwacht.
Ganz besonders freut es mich, jetzt eine Gelegenheit erhalten zu haben, öffentlich meine tiefe Dankbarkeit der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin auszusprechen für den ehrenvollen Empfang, der mir am 6. November 1897 bereitet wurde, eine Auszeichnung, die ich umso höher schätze, als ich unter der tatkräftigen und anregenden Leitung des Vorsitzenden dieser Gesellschaft, des Herrn Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Freiherrn von Richthofen an der Universität zu Berlin meine geographischen Studien betrieben hatte.
Schöne Erinnerungen bewahre ich auch den Geographischen Gesellschaften zu Wien, Leipzig, Frankfurt a. M., Hamburg, Halle a. S., Straßburg i. E., Gießen und der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, wo ich überall in der ehrendsten Weise empfangen wurde. Die leider sehr kurze Zeit, die ich bei Herrn Professor Dr. Alfred Kirchhoff in Halle a. S. studierte, gehört zu meinen schönsten Erinnerungen aus Deutschland.
Es darf also nicht wundernehmen, dass ich mit besonderer Vorliebe an Deutschland und Österreich denke, da ich von meinen Lehrern, von den Vorsitzenden und Mitgliedern der Geographischen Gesellschaften, von meinen Kameraden des Richthofenschen Kolloquiums, aus welchem so viele berühmte Reisende und Forscher hervorgegangen sind, und, last but not least, von meinem vortrefflichen Verleger, Herrn F. A. Brockhaus, der keine Opfer gescheut hat, um dem Werke eine schöne Ausstattung zu verleihen — mit einem Wort von allen, mit denen ich in Deutschland und Österreich das Glück hatte, in Berührung zu kommen, wie ein Kamerad und Freund behandelt worden bin. Ich wage zu hoffen, dass dieselbe freundliche Nachsicht auch den Schilderungen meiner langen Wanderjahre geschenkt werden möge.
Stockholm, im Mai 1899.
Dr. Sven Hedin.
Erstes Kapitel. Zum Dach der Welt.
In der Geschichte geographischer Entdeckungen gehen wir einer neuen Epoche entgegen, in der die Pioniere ihre Rolle bald ausgespielt haben und in der die weißen Flecke auf den Karten der Kontinente zusammenschrumpfen werden. Wo einst die Pioniere sich unter beständigem Kampfe mit Gefahren und Schwierigkeiten Wege gebahnt haben, die sie dann in großen Zügen schilderten, dort werden die Entdeckungsreisenden des neuen Jahrhunderts eindringen und das überall auf der Erdoberfläche rastlos pulsierende Leben in seinen Einzelheiten untersuchen. Beständig werden sie neue Lücken finden, die auszufüllen, unzählige Probleme, die zu lösen sind.
Besonders das innerste Asien ist lange vernachlässigt worden: ungeheure Strecken der schwer zugänglichen Wüste Gobi, endlose Flächen des Hochlands von Tibet sind heute noch ebenso wenig bekannt wie die Polarregionen.
Es würde mich zu weit führen, wenn ich versuchen wollte, Bericht über die großartigen Probleme zu erstatten, die im Innern Asiens noch ihrer Lösung harren: die Entdeckung neuer Gebirgsketten, Seen und Flüsse, die Auffindung von Spuren einer alten Kultur und von Altertümern, die über die Völkerwanderungen durch Asien Licht verbreiten können, das Identifizieren alter, jetzt verlassener Karawanenwege und schließlich die kartographische Aufnahme einer vollständig unbekannten Gegend: alles dieses zieht den Forscher mit unwiderstehlicher Macht nach diesen fernen Ländern hin.
Eine Reise durch den Weltteil, wo die Wiege der arischen Völker gestanden hat, aus dessen dunklem Innern heraus die Mongolen ganz Vorderasien und einen Teil von Europa überschwemmt haben, gehört zu den großartigsten Aufgaben, die in das Gebiet der Forschungsreisen fallen.
Um auch meinerseits zur Erweiterung der Kenntnis der Geographie von Zentral- und Hochasien beizutragen, unternahm ich die Reise, über die ich hier berichte. Mein Plan ging dahin, ganz Asien von Westen nach Osten, vom Kaspischen Meere bis Peking, zu durchqueren und dabei besonders die am wenigsten bekannten Gegenden zu berühren.
Jahre hindurch hatte ich mich in der Studierstube darauf vorbereitet, und ich wusste genau, welche Aufgaben noch zu lösen sind. Im Jahre 1890—91 hatte ich eine Rekognoszierungsreise nach dem russischen Turkestan und nach Kaschgar, der Hauptstadt von Chinesisch-Turkestan, unternommen, um zu untersuchen, ob diese Gegenden sich zur Operationsbasis für ein beschleunigtes Vordringen durch die unbekannten Gebiete eigneten.
Nach der Heimkehr von Kaschgar galt es, das Unternehmen finanziell sicher zu stellen. Deshalb reichte ich bei Sr. Majestät dem König von Schweden einen Reiseplan ein mit der Bitte um Unterstützung desselben. Darin waren die wichtigsten Probleme, die ihrer Lösung harren, aufgeführt.
Ich habe die Erinnerungen und Eindrücke zu schildern versucht, die ich von meinen langen, einsamen Wanderungen im dunkelsten Asien bewahrt habe. Es ist klar, dass die Resultate einer Reise, die dreieinhalb Jahre in Anspruch genommen, zu weitläufig sind, um alle in einem Buche Platz zu finden, und ich habe deshalb recht zu handeln geglaubt, das Wissenschaftliche von dem zu trennen, was mehr von allgemeinem Interesse ist, d. h. eine Schilderung des eigentlichen Verlaufes der Reise, der Länder, die ich durchwandert, der Völker, mit denen ich in Berührung gekommen, und der Abenteuer, die ich und meine Leute in unbewohnten und unbekannten Gegenden erlebt haben, zu geben. Die wissenschaftlichen Resultate, deren Ausarbeitung längere Zeit erfordert und die von mehr speziellem Interesse sind, sollen später für sich herausgegeben werden.
Mit den notwendigsten Instrumenten und einigen Waffen ausgerüstet und mit einem chinesischen Paffe versehen, verließ ich in der Nacht des 16. Oktober 1893 mein altes, trautes Heim in Stockholm. Ich fuhr einem unbekannten Geschick entgegen.
Es war ein kalter, finsterer Herbstabend, den ich nie vergessen werde. Schwere Regenwolken schwebten über der Stadt Stockholm, deren Laternen und Lichter bald außer Sicht kamen. Mehr als tausend und eine Nacht voll Einsamkeit und Sehnsucht lagen vor mir, und hinter mir lag alles, was mir auf Erden am teuersten war. Diese erste Nacht war die bitterste von allen, und nie hat mich das Heimweh so sehr gequält wie damals! Die Gefühle, die ein solches Losreißen hervorruft, kann nur der begreifen, der sein Vaterland auf längere Zeit verlässt, ein ungewisses Schicksal vor sich. Aber die ganze Welt lag offen vor mir, und ich hatte fest beschlossen, alles zu tun, was in meiner Macht stand, um die Aufgabe, die ich mir gestellt, zu lösen.
* * *
Eine ununterbrochene Eisenbahnfahrt von 2258 Kilometer, welche Entfernung Orenburg von Petersburg trennt, ist kein ungemischtes Vergnügen. Die rund viermal vierundzwanzig Stunden, die draufgehen, um auf dieser Linie das europäische Russland zu durchfahren, sind jedoch weder lang noch ermüdend.
Endlose Steppen, Felder, bärtige Bauern mit Pelzmütze und Kaftan, weiße Kirchen mit grünen, zwiebelähnlichen Kuppeln, von ländlichen Häusern umgeben, das ist es, was man hauptsächlich vom Coupéfenster aus erblickt. So eilt man ostwärts, bis man schließlich bei Sysran an den größten Fluss Europas, die Wolga, gelangt, die auf einer der längsten Brücken der Welt, 1484 Meter lang, überschritten wird.
Wieder werden wir in die öde Steppe hineingeführt. Je weiter man nach Osten kommt, desto öder wird die Landschaft. Der Himmel ist grau und trüb, und der Boden "hat von dem verwelkten Gras eine gelbliche Färbung. Dies ist die Gegend, wo Europa am Festlande von Asien wurzelt.
Nach vier Tagen kam ich, gehörig durchgerüttelt und windelweich geschüttelt, in der Gouvernementshauptstadt Orenburg an.
Die Stadt ist wenig interessant. Am Rande der Stadt kann man sich jedoch rein asiatischer Bilder erfreuen, denn dort haben die Tataren und Kirgisen ihre Marktplätze unter freiem Himmel oder in niedrigen Holzschuppen.
* * *
Die Entfernung zwischen Orenburg und Taschkent, meinem nächsten Ziele, beträgt 2080 Kilometer. Ich sollte zu Wagen also beinahe ebenso weit fahren, wie ich mit der Bahn in vier Tagen gereist — zweitausend Kilometer im Tarantas, im Monat November, auf steinharten oder durchweichten oder schneebedeckten Wegen, durch Steppen und Wüsten! Mir graute ein wenig vor diesem Wege, der ebenso lang ist wie die Luftlinie von Berlin bis Algier.
Man kann, wenn man will, mit der Post fahren, muss dann aber auf jeder der 96 Stationen den Wagen wechseln. Man kauft sich deshalb am besten bei Beginn der Reise einen eigenen Tarantas, bringt darin ein für alle Mal sein Gepäck unter, belegt den Boden mit Heu, Filzdecken und Matten, macht ihn mittels Kissen und Pelzen so bequem und weich wie möglich — denn ein Tarantas hat weder Sitze noch Federn — und hat dann auf den Stationen nur die Pferde zu wechseln. Vor der Reise muss man sich mit allerlei notwendigen Artikeln versehen, vor allem mit Proviant, denn auf den Stationen findet man in den allermeisten Fällen nichts Essbares.
Mein Tarantas war groß und fest und mit dicken eisernen Radreifen versehen; ich erstand ihn für 160 Mark. Als ich ihn später in Margelan wieder verkaufte, war er immer noch über 100 Mark wert. Mit Leichtigkeit konnte ich mich und mein Gepäck (ungefähr 300 Kilo) darin unterbringen. 19 Tage und Nächte sollte er ohne Unterbrechung meine Wohnung sein!
Am 14. November tobte der erste Buran (Schneesturm) des Winters, und das Thermometer zeigte mittags —6 Grad; da aber alles in Ordnung war, wollte ich die Abreise nicht aufschieben.
Erst in der Dämmerung war alles fertig. Der schwere Wagen rollte durchs Hoftor. Munter hallte das Schellengeläute in den Straßen wider. Als es dunkel wurde, waren wir schon draußen in der Einöde. Der Sturm heulte und pfiff um das Wagenverdeck und trieb uns dichte Wolken feinen Schnees entgegen. Allmählich legte sich der Wind, und die Sterne beleuchteten die dünne Schneedecke, die überall ausgebreitet lag.
Bei der Abreise von Orenburg lässt man buchstäblich alle Zivilisation hinter sich zurück; man dringt in immer ödere Gegenden und ist ganz sich selbst überlassen.
Nichts als Steppe! Nur in der Ferne gewahrt man Berge. Der Weg führt am zugefrorenen, schneebedeckten Uralfluss hin; dann und wann taucht eine kirgisische Jurte (Zelt) auf, aber die Landschaft bleibt öde.
Zwischen dem Uralfluss, dem Kaspischen Meer, dem Aralsee, dem Sir- darja und dem Irtysch breitet die gewaltige Kirgisensteppe ihre ebene Fläche aus. Von kirgisischen Nomaden spärlich bevölkert, ist diese Steppe nur die Heimat einer kleinen Zahl von Tier- und Pflanzenarten. Wölfe, Füchse, Antilopen, Hasen usw. streifen in der endlosen Einöde umher, und stachelige Steppenpflanzen kämpfen mit einer ungütigen Natur. Wo der Boden feucht ist, wuchert Kamisch (Schilfrohr, Lasiagrostis sp.) in undurchdringlichem Dickicht; selbst in den trockensten Sandwüsten wächst der Saksaul (Anabasis ammodendron) in struppigen Büschen, die nicht selten einige Meter hoch werden. Seine knochenharten Wurzeln, die außerordentlich lang sind, bilden das Hauptbrennmaterial der Kirgisen und werden deshalb im Herbst für den Winterbedarf gesammelt.
Hier und da wird die Steppe von Wasserläufen durchzogen, die in dieser Jahreszeit gewöhnlich ausgetrocknet sind. Sie ergießen sich in kleine Salzseen, an deren Ufern im Frühling und Herbst unzählige Zugvögel rasten. An den Büschen schlagen die Kirgisen ihre Aule (Zeltdörfer) auf, die aus schwarzen Filzzelten und Schuppen von Kamisch bestehen. Ihre Winterlager setzen sich gewöhnlich aus Lehm- oder Erdhütten zusammen. Im Sommer ziehen sie mit ihren großen Viehherden nach Norden, um der drückenden Hitze zu entgehen und Weiden aufzusuchen, die nicht von der Sonne versengt werden. Viele besitzen bis zu 3000 Schafen und 500 Pferden und gelten dann für sehr reich.
Im Winter herrscht in Nordturgai schneidende Kälte, im Januar und Februar toben unausgesetzt Schneestürme. Die Kirgisen suchen dann ihre
alten Winterlager auf und schützen die Schafe durch Hürden und Rohrgehege. Das Klima ist mit einem Wort typisch kontinental.
Die Kirgisen, unter denen ich einen großen Teil der nächsten Jahre verbringen sollte, sind ein halbwildes, aber tüchtiges, gesundes und gutmütiges Volk. Sie nennen sich gern "Kaisak", d. h. tapferer, streitbarer Mann. Zufrieden mit ihrem einsamen Leben in der Steppe, schwärmen sie für die Freiheit, dulden keine Obrigkeit über sich und verachten diejenigen, die in Städten wohnen oder vom Ackerbau leben. Im Kampfe ums Dasein haben sie einen harten Strauß auszufechten. Ihr hauptsächlichstes Existenzmittel bilden die Herden, durch die sie mit Nahrung und Kleidung versehen werden.
Mit Begeisterung lieben sie die öde Steppe, wo ihre Vorfahren ihr Leben zugebracht; sie finden sie schön und voller Abwechslung. Und doch sucht der Fremdling hier vergebens einen Gegenstand, auf dem er seine Blicke ruhen lassen könnte. Es ist wahr, die Steppe ist, ebenso wie das Meer, großartig und imponierend; aber sie ist auch äußerst einförmig und melancholisch.
Schon mit Rücksicht auf die sie umgebende Natur muss man erwarten, dass der Orts- und Gesichtssinn der Kirgisen zu großer Schärfe und Feinheit ausgebildet ist.
Wo dem Fremden auf tagelangen Reisen die Erde soeben wie ein Fußboden erscheint und wo es keine Spur von Weg gibt, findet sich der Kirgise sogar nachts mit staunenerregender Sicherheit zurecht. Es sind nicht die Himmelskörper, die ihm als Führer dienen — er kennt jede Pflanze, jeden Stein wieder, er merkt sich die Stellen, wo die Rasenbüschel dünner oder dichter als gewöhnlich stehen, und erkennt Bodenunebenheiten, die ein Europäer ohne Instrument nicht wahrnehmen kann. —
Nachdem in Orsk das Gepäck noch einmal gründlich umgestaut und das Fuhrwerk geschmiert worden war, kroch ich wieder in mein rollendes Haus, der Jämschtschik (Postillon) stieß einen gellenden Pfiff aus, und die Troika sprengte mit Windeseile nach Süden — adieu, Europa!
Der erste russische Ort, den man auf asiatischem Boden passiert, ist Kara-butak, ein kleines Dorf, wie Rom auf sieben Hügeln und um diese herum gelegen, an Umfang aber etwas kleiner als jene Stadt. Es besteht aus 33 Häusern, in denen einige dreißig Russen und gegen hundert Tataren samt einigen Kirgisen wohnen. Die einzige Bedeutung von Kara- butak liegt darin, dass es ein kleines Fort ist, das vor 25 Jahren von General Obrutscheff angelegt worden war, um die Kirgisen in Schach zu halten, die damals die russische Grenze beunruhigten.
Noch ein paar Stationen, und man ist in der Festung Irgis angelangt, die auf einer kleinen Anhöhe am Fluss gleichen Namens liegt.
Wieder sausen wir im Galopp dahin. Gegen fünf Uhr geht die Sonne unter. Ein matter Purpurschimmer ergießt sich über die Steppe, wenn das Tagesgestirn, feurig gleich einer glühenden Kanonenkugel, einen Augenblick am fernen Horizont zögernd verweilt. Die eigentümlichsten Lichteffekte entstehen beim Sonnenuntergang. Man lässt sich in Bezug auf Entfernung und Größe die lächerlichsten Irrtümer zuschulden kommen, da man nichts hat, womit man die Gegenstände vergleichen kann. Ein paar unschuldige Krähen, die sich eine kleine Strecke abseits von der Straße miteinander unterhalten, erscheinen groß wie Kamele, und ein kaum fußhohes Steppenkraut schwillt zu einem schattigen Baum an.
Wir betreten die Wüste Kara-kum. Die Vegetation wird immer spärlicher, und in kurzem sind wir von nichts als Sand umgeben. Es ist eine Gegend, die früher von den Wassermassen des Aralo-kaspischen Meeres bespült worden ist. Davon zeugt das reichliche Vorkommen versteinerter Muscheln (Cardium und Mytilus), deren Schalen man mitten in der Wüste findet.
In einer mondhellen Nacht kam ich auf der mitten im Sandmeer gelegenen kleinen Station Konstantinowskaja an, wo der "Wartesaal" für die Reisenden aus einem kirgisischen Zelte bestand, das bei dieser Jahreszeit wenig einladend war. Von hier an bis Kamischlibasch, eine Strecke von 120 Kilometer, werden baktrische Kamele genommen, weil Pferde zu schwach sind, um das schwere Fuhrwerk durch den Sand, der oft kleine Barchane oder Dünen bildet, ziehen zu können.
Zwischen den Stationen Alti-kuduk und Ak-dschulpas geht der Weg am Ufer des Aralsees entlang, oft nur eine Wagenlänge davon entfernt.
Der Aralsee liegt 48 Meter über dem Meeresspiegel; er hat eine Fläche von 70000 Quadratkilometer, ist also nicht viel kleiner als das Königreich Bayern. Die Ufer sind kahl und öde; die Tiefe ist unbedeutend und das Wasser so salzig, dass es sich nur an den Flussmündungen trinken lässt; auch ziemlich weit draußen auf dem See soll es Süßwassergürtel geben.
Wenn ein Sturm aus Südwesten kommt, wird das Wasser in die Bucht hineingetrieben, überschwemmt große Uferstrecken und sammelt sich in Vertiefungen, wo man nachher Störe und andere Fische mit den Händen fangen kann. Jetzt war die ganze Bucht zugefroren. Mehrere Kilometer vom Ufer entfernt sah man eine Karawane über das spiegelglatte Eis ziehen. Auch im Sommer suchen sie sich solche Wege, denn das Wasser ist hier sehr seicht und hat in der Bucht eine Tiefe von höchstens 2 Meter, gewöhnlich jedoch nur von einem oder einem halben Meter. —
So eigentümlich es auch gewesen, mit Kamelen zu fahren, überkam mich doch ein gewisses Gefühl der Beruhigung, als ich wieder drei Rappen vor den Tarantas spannen sah. Die Freude war jedoch kurz, denn noch hatten wir nicht den halben Weg bis zur nächsten Station zurückgelegt, als der Wagen auch schon in einem Salzsumpfe stecken blieb und sich weder vorwärts noch rückwärts herausziehen ließ. Der Kutscher schrie und klatschte mit der Peitsche, die Pferde schlugen hinten aus, bäumten sich und zerrissen die Stränge. Das Ende vom Liede war, dass der Mann sich auf eins von ihnen setzen und nach der Station zurückreiten musste, um Hilfe zu holen. Nachdem ich ein paar Stunden in Regen, Wind und rabenschwarzer Finsternis gewartet und darüber nachgegrübelt hatte, ob die Wölfe der Gegend mir nicht einen Besuch machen würden, kamen zwei Kirgisen mit zwei frischen Pferden, die vor die Troika gespannt wurden und sie jetzt in eine Pätschorka oder Fünfgespann verwandelten. Mit vereinten Kräften gelang es den Pferden, den Wagen aus dem Schlamme zu ziehen.
Am rechten Ufer des Sir-darja liegt, in einer Entfernung von 181 Kilometer Flussweg und 85 Kilometer Landweg vom Aralsee, die Stadt Kasalinsk mit 3500 Einwohnern, von denen 1000 Uralkosaken sind. Diese haben auf dem Fluss die Fischerei inne, die hauptsächlich an der Mündung betrieben wird; im Jahre 1892 erbeuteten sie 14000 Störe.
Von Fort Perowsk an, das ebenfalls am Sir-darja liegt, bis zur Station Tschumen-arik ist die Vegetation sehr reich und besteht aus Schilfrohr, Saksaul und stacheligem Gestrüpp, das dichte Hecken bildet, echte Tigerverstecke, zwischen denen der Weg sich oft wie in einem schmalen Gange hindurchwindet. Hier haben Tiger, Wildschweine und Gazellen ihren Lieblingsaufenthalt, und Gänse, wilde Enten und vor allem Fasane kommen in ungeheurer Menge vor.
Endlich zeichnen sich die Gärten von Turkestan mit ihren hohen Pappeln, ihren langen grauen, teilweise neuen, meist aber alten, in Ruinen liegenden Lehmmauern und ihrem imposanten Heiligengrabe aus der Zeit Timurs gegen den Himmel ab, und jetzt fahren wir durch die heute (1. Dezember), einem Freitag, dem mohammedanischen Sonntage, leeren, verlassenen Basare nach dem Posthause.
Turkestan ist eine verfallene, uninteressante Stadt. Das Einzige, was einen mehrstündigen Aufenthalt entschuldigt, ist die kolossale Grabmoschee, die 1397 von Timur erbaut worden ist. Ihr Pischtak oder gewölbtes Portal ist außerordentlich hoch und von zwei pittoresken Türmen flankiert; die Moschee selbst wird von mehreren melonenförmigen Kuppeln geschmückt.
Einige sartische Jungen führten mich durch labyrinthähnliche enge Gänge und auf kalten, dunkeln Treppen in den einen Turm hinauf, von dessen schwindelnder Höhe man bei gutem Wetter eine prachtvolle Aussicht über Turkestan und Umgebung hat. Der im Orient gewöhnliche melancholische Eindruck ergreift uns auch hier: die alten architektonischen Denkmäler blenden uns durch ihre Pracht und imponieren uns durch ihre Größe, während die modernen Häuser erbärmliche Lehmhütten mit baufälligen Dächern sind, die durch enge, winklige Gassen voneinander getrennt werden.
Endlich nahten wir uns Taschkent, der Residenz des Generalgouverneurs. Noch ein paar schwere Poststrecken mit fußtiefem Kot, dann bleibt uns nur noch die letzte. Sie kam mir unendlich lang vor, obgleich der Weg hier sehr gut war; aber ich hatte vom Fahren im Tarantas übergenug, und mit behaglichem Gefühl fuhr ich am 4. Dezember 1893 gleich nach Mitternacht in die Straßen von Taschkent ein.
Ein paar Zahlen! In 19 Tagen und Nächten hatte ich 2080 Kilometer zurückgelegt und 11 ½ Breitengrade, 96 Stationen und 30000 Telegraphenstangen passiert, während jedes der Vorderräder des Tarantas sich 983000 mal um die Achse gedreht hatte. Ich war von 111 Jämschtschiks gefahren und von 317 Pferden und 21 Kamelen gezogen worden und hatte beobachten können, wie die Tage immer länger wurden, obgleich die Wintersonnenwende herannahte. Ich hatte eine Gegend verlassen, die von Schneestürmen heimgesucht wurde und in der vollständiger Winter herrschte, hatte zu Anfang der Fahrt 20 Grad Kälte gehabt, und war jetzt in einem Lande angekommen, wo der Frühling schon seinen Einzug zu halten schien, wo laue, herrliche Luft den Aufenthalt im Freien zu einem Genuss machte und wo das Thermometer 10 bis 12 Grad Wärme zeigte. —
In Taschkent blieb ich beinahe sieben Wochen. Während der ganzen Zeit war ich eifrig mit den Vorbereitungen zur Reise beschäftigt. Alle meine Instrumente waren im besten Stande, ausgenommen das Quecksilberbarometer, das auf dem Wege von Orenburg zerbrochen war und von dem deutschen Mechaniker der Sternwarte repariert werden musste.
Das Einzige, was sonst noch durch das ewige Stoßen des Tarantas gelitten hatte, war die Munition. Als ich die beiden Kisten öffnete, bot sich meinen Augen ein entsetzlicher Anblick. Einige Hundert Papphülsen der Schrotpatronen waren zerrieben, und die Blechschachteln, in denen sie verpackt gewesen, wie Papier zusammengeknittert. Dass keine der vielen scharfen Ecken auf die Idee gekommen, gegen ein Zündhütchen zu stoßen und dadurch eine Explosion hervorzubringen, erschien mir wie ein Wunder. Dann hätte meine Reise einen schnelleren Verlauf und ein anderes Ziel bekommen. Es war das erste Mal auf dieser Reise, dass mein Leben in so großer Gefahr geschwebt.
Schließlich hatte ich in Taschkent große Einkäufe zu machen. Ich versah mich auf längere Zeit mit Proviant, und kaufte einen großen Vorrat von allerlei Kleinigkeiten, wie Revolver mit Patronen, Uhren, Spieluhren, Kompasse, Fernrohre, Kaleidoskope, Mikroskope, Silberbecher, Schmucksachen usw., alles zu Geschenken an Kirgisen, Chinesen und Mongolen bestimmt. Im Inneren von Asien ist Zeug beinahe gangbare Münze; für einige Meter einfachen Kattuns kann man ein Pferd oder Proviant für mehrere Tage für die ganze Karawane kaufen.
Als alles getan war, was getan werden musste, nahm ich von meinen Freunden in Taschkent Abschied und verließ die stolze Stadt am 25. Januar 1894 morgens 3 Uhr. —
Es war wieder kalt geworden, und um 9 Uhr morgens zeigte das Thermometer —11 Grad. Die Landschaft war überall schneebedeckt, aber der Weg war so hart und holperig, dass der Wagen wie ein Folterwerkzeug stieß.
Das Dorf Biskent ist für die neuere Geschichte Zentralasiens von gewissem Interesse, denn hier wurde um das Jahr 1825 Jakub Bek geboren, der 1865 ganz Kaschgar eroberte, einer der merkwürdigsten Herrscher, die es gegeben und dessen Andenken in ganz Innerasien, wo er gewöhnlich "Bedaulet", der Glückliche, genannt wird, schwerlich erlöschen wird. Nachdem er 1877 in Korla ermordet worden, entstand im Lande allgemeine Verwirrung; sein Sohn Hak Kuli Bek zog mit dem Heer des Vaters, das gegen die Chinesen gekämpft, nach Kaschgar, wurde aber ebenfalls ermordet, und zwar, wie man sagt, von seinem Bruder Bek Kuli Bek. Letzterer wohnt noch heute in Biskent, wo er mehrere Häuser und Höfe besitzt und eine russische Pension erhält. Er ist ein ebenmäßig und kräftig gebauter, gegen 50 Jahre alter Mann mit kohlschwarzem Barte und harten Zügen. Inmitten seiner acht Söhne wartet er voll Ungeduld auf einen Aufruhr in Kaschgar, wohin er sich dann sofort zu begeben beabsichtigt, um womöglich von dem Thron seines Vaters Besitz zu ergreifen. So sagte er wenigstens selbst. Armer Mann! Er mag ja in dieser Hoffnung leben, aber er weiß nicht, welche großen politischen Veränderungen seit Jakub Beks Tagen in Ostturkestan vorgegangen sind! —
Nach mehreren, durch den Mangel an Pferden verursachten Unterbrechungen kam ich am 27. Januar in Chodschent an und traf am 29. in Kokan ein.
Die Stadt Kokan hat zirka 60000 Einwohner, darunter eine russische Garnison von 1400 Mann.
Ich besuchte ein paar "Hammam" oder Badestuben, natürlich ohne sie zu benutzen, denn sie sind das Gegenteil von dem, was wir unter Bädern verstehen, und sind eher Herde zur Verbreitung von Hautkrankheiten. Man tritt in einen großen Saal mit teppichbedeckten Terrassen und Holzfäulen ein: dies ist der Entkleidungsraum. Von dort begibt man sich durch labyrinthische enge Gänge in dunkle dampferfüllte Gewölbe von verschiedener Temperatur. In der Mitte erhebt sich ein Terrassenabsatz, auf dem der Badende von einem nackten Diener massiert und gewaschen wird. Mystische Dämmerung herrscht in diesen kellerartigen Räumen, und aus den Wasserdämpfen schimmern nackte Gestalten mit langen schwarzen oder grauen Bärten hervor. Die Mohammedaner bringen oft den halben Tag im Bade zu, wo sie rauchen, Tee trinken und manchmal auch zu Mittag essen. —
Am 4. Februar erreichte ich die Hauptstadt von Fergana, Margelan, wo mich der Gouverneur, General Pawalo-Schweikowskij, mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit empfing, mich während der 20 Tage, die ich in seinem Hause zubrachte, aufs Beste bewirtete und mir viele sehr nützliche Ratschläge gab.
Zweites Kapitel. Eine Winterfahrt über Pamir.
Auf der Grenze zwischen Ost- und Westturkestan, Buchara, Afghanistan und Indien erhebt sich ein gewaltiges Hochland, ein gigantischer Gebirgsknoten, von dem nach Osten und Südosten die beiden höchsten Bergketten der Erde, der Kven-lun und der Himalaja, nach Nordosten der Tienschan und nach. Südwesten der Hindu-kusch ausstrahlen, während sich der Kara-korum zwischen den beiden erstgenannten Ketten nach Tibet hineinzieht. Hier lebten, nach manchen Forschern, die ersten Menschen, und uralte Sagen erzählen, dass die vier großen, in der Bibel erwähnten Flüsse des Paradieses hier ihre Quellen hatten. Die Völker Hochasiens geben Pamir noch heute den Ehrennamen "Dach der Welt". Von ihm schauen himmelhohe Bergriesen auf die übrige Erde hinab.
In politischer Hinsicht stand Pamir in neueren Zeiten unter den Khanen von Kokan. Als dessen letztem Herrscher, Chodier Khan, von seinem mächtigen Nachbarn im Norden Macht und Reich geraubt wurden, machte Russland auf die Herrschaft über Pamir Anspruch. Man schenkte jedoch dem unzugänglichen, fast unbewohnten Lande wenig Aufmerksamkeit. Dies ermutigte seine anderen Nachbarn, angrenzende Stücke des ehemaligen Khanats zu annektieren. Die Afghanen besetzten ganz Badakschan und Schugnan und zeigten sich auch in Roschan und Wachan, wo sie am Pändschfluss befestigte Posten anlegten. Die Chinesen besetzten die östlichen Grenzgebiete von Pamir, und die Engländer nahmen sich später Tschitral und Kandschut.
Diesen Operationen sahen die Russen auf die Dauer nicht gleichgültig zu. Im Jahre 1891 zog der Oberst Jonnoff mit einer Truppe von beinahe 1000 Kosaken über ganz Pamir bis an den Hindu-kusch, wo er in der Nähe des Barogilpasses mit einem kleinen afghanischen Vorposten ein Scharmützel hatte. Bald darauf wurde am Fluss Murghab der Posten Schah-dschan angelegt, der später in Pamirskij Post umgetauft wurde. Hier lagen stets ein paar Hundert Kosaken, um die russischen Interessen zu wahren.
So entstand die Pamirfrage, über die in den letzten Jahren so viel gesprochen und geschrieben worden ist. Das Land, das im Herzen von Asien, in arktische Kälte gehüllt, beinahe vergessen dagelegen, wurde der Gegenstand des lebhaftesten Interesses und wichtiger, vielleicht schicksalsschwerer politischer und strategischer Maßnahmen. Gewisse Gebiete von Pamir waren noch herrenlos, und die wenigen Kirgisen, die dort mit der Kälte kämpften, hatten keine Obrigkeit und bezahlten keine Steuern; nun aber erhoben alle Nachbarn Anspruch darauf, alle hatten befestigte Posten in der Nähe. Keiner wollte den "ersten Schritt tun, aber alle waren bereit, Feuer zu geben. —
Während meines Aufenthalts bei Baron Wrewskij, dem Generalgouverneur von Turkestan, sprachen wir oft von Pamir. Ich kam dabei auf den Gedanken, den Weg nach Kaschgar durch dieses Land zu nehmen. Als ich meinen Entschluss gefasst hatte, rieten mir fast alle davon ab, und Offiziere, die an Jonnoffs Expedition teilgenommen hatten, prophezeiten mir eine gefährliche Reise und gaben mir den Rat, noch zwei oder drei Monate zu warten.
Ein Hauptmann, der am Murghab überwintert hatte, versicherte mir, dass ich mich den größten Gefahren und den kritischsten Situationen aussetzen würde. Sogar im Sommer tobe nicht selten der Schneesturm bei —10 Grad. Im Winter 1892/93 sei die Temperatur Ende Januar bis auf —43 Grad gesunken, und Schneestürme gehörten zu den gewöhnlichen Erscheinungen. Der Buran komme unvermutet, oft aus eben noch heiterem Himmel. Der Weg sei dann im Augenblick verschneit, die Luft fülle sich mit feinem Schneestaub, man könnte nicht zwei Schritte weit sehen, müsse sofort stehenbleiben und sich in seinen Pelz hüllen und könne Gott danken, wenn man mit dem Leben davonkomme. Der Hauptmann riet mir, mich während des Marsches nie von meiner Karawane zu entfernen.
Zwei Männer gab es jedoch, die das Unternehmen in nicht so dunkeln Farben sahen, sondern mich aufmunterten und alles zu tun versprachen, um es zu ermöglichen und zu erleichtern. Es waren Baron Wrewskij und der Gouverneur von Fergana, General Pawalo - Schweikowskij. Auf Baron Wrewskijs Initiative sandte der Gouverneur von Fergana schon eine Woche vor meiner Abreise von Margelan durch Dschigiten (sartische Kuriere) an die im Alaitale überwinternden Kirgisen den Befehl, mich überall aufzunehmen und an bestimmtem Tage und Orte eine Jurte bereit zu halten, mich mit Schaffleisch und Brennmaterial zu versehen, Leute vorauszuschicken, um einen Weg durch den Schnee zu bahnen und Stufen in die schmalen, lebensgefährlichen vereisten Gebirgspfade der Alaiberge zu hauen, beim Beladen und Begleiten der Kamele zu helfen usw. Nach dem Murghab wurden ebenfalls reitende Boten gesandt. Ich erhielt ein Schreiben an den Kommandanten von Pamirskij Post und eins an den chinesischen Kommandanten am Bulun-kul in der Nähe der Grenze.
Die im voraus bestimmte Route führte über das Alaigebirge über den Pass Tengis-bai und durch das Alaital, über den Pass Kisil-art an den See Kara-kul und über den Ak-baital-Pass nach Pamirskij Post am Murghab, wohin ich 490 Kilometer hatte, die sich auf 18 kurze Tagemärsche und 5 Rasttage verteilten.
Ein alter sartischer Kaufmann stellte die Pferde. Ich mietete ein Reitpferd und sieben Packpferde; für jedes von ihnen hatte ich 2 Mark pro Tag zu zahlen. Zwei Leute und drei Furagepferde kamen gratis mit. Ein kleiner lebhafter, wetterharter, weitgereister Dschigit, Rehim Bai, der überdies ein vorzüglicher Koch war und russisch sprach, wurde als mein erster Diener angestellt. Er erhielt monatlich 50 Mark, dazu Verpflegung und freie "Wohnung", musste sich sein Pferd und warme Kleidung aber selbst beschaffen. Er wäre auf dieser Reise beinahe ums Leben gekommen und begleitete mich nur bis Kaschgar.
Der eine der beiden Pferdeknechte war um so zäher und füllte Rehim Bais Platz glänzend aus, als dieser krank wurde. Er hieß Islam Bai und hatte sein Heim in Osch; auf der ganzen langen Reise war er mein bester Diener. Eigentlich sollte er schon hier seine Anerkennung erhalten, aber auf späteren Blättern wird der Leser selbst finden, dass ich bei diesem Manne, der mir treu durch alle Wetter, alle Gefahren folgte, in großer Dankesschuld stehe. Er kannte mich nicht, als wir uns zuerst trafen, und hatte keine Ahnung, wohin es ging; aber er verließ sein stilles Heim und seine Familie in Osch, um ohne Furcht alle die wechselnden Schicksale, die im innersten Asien unser warteten, mit mir zu teilen.
Wir wanderten zusammen durch die Sandstürme der Wüste Gobi, wir waren beide nahe daran, vor Durst zu verschmachten, und er war es, der meine Karten und Aufzeichnungen rettete, als die anderen zusammenbrachen. Stets war er der erste, wenn wir die hohen Schneeberge bestiegen. Er führte meine Karawanen mit sicherer Hand durch brausende Flüsse, und treu war er auf seinem Wachtposten, als die tibetischen Räuber uns überfallen wollten. Die Dienste, die er mir geleistet, sind unzählig, und ohne ihn hätte meine Reise nicht so glücklich geendet, wie sie es tat. Er trägt nun mit Ehren und Stolz die goldene Medaille, die König Oskar ihm verliehen hat. —
In Margelan ließ ich allerlei überflüssige Sachen zurück, unter anderem den alten, getreuen, orenburgischen Tarantas und die europäischen Koffer, und kaufte mir statt ihrer sartische Jachtane, mit Leder bezogene Holzkisten, die von den Pferden mit Leichtigkeit paarweise getragen werden können.
Wir sollten oft auf schneebedecktem Boden unser Zelt aufschlagen, deshalb wurden zwei stählerne Spaten mitgenommen; wir sollten auf steilen, mit Glatteis bedeckten Pfaden dahinziehen, darum nahmen wir Äxte und Picken mit; wir sollten über das Eis des Kara-kul reiten, wo ich Lotungen vorzunehmen beabsichtigte, daher wurden 500 Meter starkes Segelgarn, das alle 10 Meter mit Knoten abgeteilt war, sowie Lote mitgenommen.
Am 22. Februar zog die Karawane mit den Dschigiten nach Utsch- kurgan. Ein Pferd trug die ganze photographische Ausrüstung in zwei Jachtanen, ein zweites die Instrument-, Bücher- und Arzneikisten, das vierte und fünfte den Proviant, das sechste und siebente die Waffen und die übrigen Gegenstände. Den Zug schlossen die drei Furagepferde mit Futter- und Kornsäcken; das eine von ihnen verschwand fast unter zwei kolossalen Strohsäcken.
Die beiden Karawanenführer gingen zu Fuß und trieben die Tiere an, die Dschigiten ritten. Das Ganze bildete eine lange, stattliche Karawane, und mit Stolz betrachtete ich ihren Aufbruch vom Hofe des Gouverneurpalastes. Ich selbst blieb die Nacht über in Margelan und durfte also der europäischen Zivilisation noch ein letztes Lebewohl sagen, denn die ganze vornehme Welt von Margelan war an diesem Abend beim Gouverneur versammelt.
Welcher Unterschied für mich gegen die folgenden Abende! Nach einem herzlichen Abschied von dem gastfreien Gouverneur und seiner liebenswürdigen Familie verließ ich am 23. Februar am frühen Morgen Margelan und vereinigte mich in Utsch-kurgan mit den Meinigen.
Der Weg führte teilweise durch den Talgrund des Jsfairan-flusses selbst, der sich tief in grobkörnige Konglomeratbänke eingegraben hat, manchmal an steilen Abhängen entlang.
In der Eile des Aufbruchs von Margelan hatte ich ganz vergessen, mir einen Hund anzuschaffen, der vor der Jurte Wache halten sollte; diesem Mangel wurde auf unerwartete Weise abgeholfen.
Als wir am 25. Februar den Weg nach Lang ar zurücklegten, gesellte sich ein großer, gelber, langhaariger kirgisischer Hund unaufgefordert zu unserem Zuge. Er folgte uns getreulich auf dem ganzen Wege bis nach Kaschgar und hielt die schärfste Karaul (Wache) vor dem Zelt. Er bekam den Namen Jotttschi, der unterwegs Gefundene.
Die parallel laufenden Kämme des Alaigebirges, die das Quertal des Jsfairan durchschneidet, sind imponierende Felsmassen. Hohe Schuttkegel fallen steil zum Talgrunde ab, wo an den Ufern des Jsfairan spärliche Bäume und Büsche wachsen. An den Abhängen hängt manch alter, knorriger Artscha (asiatischer Wacholder) seine zottelköpfige Krone über einen gähnenden Abgrund.
Ein über das andere Mal wird der Fluss auf kleinen, schwankenden Holzbrücken passiert. Eine von ihnen trug den bezeichnenden Namen "die tiefe Brücke". Sie sieht von der Felswand, an deren Rand der Saumpfad hinzieht, tief unten in der hier außerordentlich engen Talschlucht wie ein dünnes Stöckchen aus.
Die Pferde mühen sich ab und keuchen und bleiben alle zehn Schritte stehen, um Atem zu holen. Das Gepäck muss unaufhörlich in Ordnung gebracht werden, da es nach vorn oder hinten rutscht. Langsam und vorsichtig schreitet der Zug auf dem fußbreiten, lebensgefährlichen Wege dahin. Das erste Pferd, das die beiden Strohsäcke und mein Feldbett trug, wurde vorsichtig von einem des Weges kundigen Kirgisen geführt. Trotz alledem stolperte es, versuchte vergeblich, wieder festen Fuß zu fassen, glitt den Abhang hinunter, schlug in der Luft ein paar Saltos, stürzte auf den beinahe senkrecht stehenden Schiefer im Talgrunde und geriet schließlich in den Fluss, nachdem die Säcke zerrissen und das Stroh zwischen den Steinen verstreut worden war.
Lautes Geschrei durchtönte die Luft; der Zug blieb stehen, und alle stürmten wir auf Umwegen hinunter. Ein Kirgise fischte mein Feldbett auf, das den Fluss hinuntertanzte; die anderen versuchten das Pferd herauszulocken, das, den Kops gegen einen Stein gelehnt, im Wasser lag. Da es nicht dazu vermocht werden konnte, selbst herauszugehen, zogen die Kirgisen Schuhe und Strümpfe aus, stiegen ins Wasser und holten es ans Ufer.
Das Pferd starb jedoch. Es hatte sich das Rückgrat gebrochen, und nach einer Weile glitt es unter krampfhaften Todeszuckungen wieder in den Fluss, wo wir es liegen ließen. Nun wurde die gefährliche Stelle mit Spaten und Äxten bearbeitet und mit Sand bestreut. Jedes Pferd führte ein Mann; dass ich zu Fuß ging, brauche ich wohl nicht hinzuzufügen.
Die Dämmerung überraschte uns schnell. Nächtliche Schatten hüllten das enge Tal mit düsterem Schleier ein, und nur die lebhaft funkelnden Sterne erhellten mit ihrem bleichen Lichte unseren Weg. Ich hatte in Asien schon viele Abenteuer erlebt, aber die drei Stunden, die wir noch bis Langar hatten, waren vielleicht die schwersten, die ich je durchgemacht hatte.
Die erste vereiste Straße war jedoch nur ein Vorgeschmack dessen, was kommen sollte. Wir schritten, krochen und tappten an den auf Beute wartenden Abgründen dahin. Unaufhörlich entstand Aufenthalt; Stufen mussten ins Eis gehauen und mit Sand bestreut werden. Jedes Pferd wurde jetzt von zwei Leuten geführt, der eine hielt es am Zügel, der andere am Schwanz. Mehrere Pferde fielen, kamen aber wieder auf die Beine. Hunderte von Metern weit kroch ich auf allen Vieren; ein Kirgise war hinter mir und hielt mich fest, wenn schwere Stellen zu passieren waren.
Ein Sturz in die Tiefe würde aller Wahrscheinlichkeit nach den Tod herbeigeführt haben. Kurz, er war ein verzweifelter Marsch; dazu war es unheimlich dunkel und kalt. Das Schweigen wurde nur von Zeit zu Zeit durch das durchdringende Geschrei der Leute unterbrochen, wenn ein Pferd gefallen war, oder von ihren Warnungsrufen, wenn eine lebensgefährliche Passage kam, sowie von dem Rauschen des weißschäumenden, in Wirbeln dahinfließenden Flusses. Über zwölf Stunden waren wir durch den Schnee gewandert, als wir müde, durchfroren und hungrig endlich in Lang ar anlangten, wo uns zwei schöne Jurten mit flammendem Feuer erwarteten.
Wir nahten uns jetzt in beinahe südlicher Richtung dem Passe Tengis -bai. Die fünf wichtigsten Pässe, die Fergana über die Alaiberge mit dem Alaital verbinden, sind, von Osten nach Westen gerechnet: Talldik (3537 Meter), Dschipptik (4146 Meter), Sarik-mogal (4300 Meter), Tengis-bai (3850 Meter) und Kara-kasik (4360 Meter). Diese Zahlen geben uns für die Alaikette eine mittlere Passhöhe von rund 4000 Meter. Sie wird von Osten nach Westen immer bedeutender, obgleich der Boden des Ferganatales in derselben Richtung sinkt.
Von den angeführten Pässen ist der Talldik am leichtesten zu passieren; er ist aber einen großen Teil des Winters durch Schnee gesperrt.
Der Februar ist die Zeit der Lawinen und der Schneestürme, und ist das Wetter nicht ganz klar und still, so hütet sich selbst der mutigste Kirgise davor, sich zum Pass hinaufzubegeben. Es vergeht jedoch selten ein Winter ohne Unglücksfälle, und im Sommer können viele Skelette von Pferden und auch von Menschen als Wegweiser dienen.
In der Nacht auf den 26. Februar schickten wir acht Kirgisen mit Spaten, Picken und Beilen voraus, um uns einen Weg zum Passe hinauf zu bahnen; früh am Morgen folgte ihnen die Karawane.
Die kleinen Gebirgspferde, von denen jedes ungefähr 80 Kilo trägt, sind bewundernswert. Sie gleiten und rutschen lange Strecken an den Abhängen hinab, erklettern gewandt wie Katzen abschüssige Wände und balancieren mit unglaublicher Sicherheit auf schmalen, schlüpfrigen, oft vereisten und neben Abgründen hinlaufenden Pfaden.
Das Tal verengert sich; sein Grund steigt ungeheuer steil an und verschmilzt allmählich mit den Bergabhängen. Die relativen Höhen nehmen in demselben Maße ab, wie die absoluten zunehmen. Das letzte Stück des Weges war endlos; es führte uns über einen Lawinenkegel nach dem andern. Der letzte Kegel machte uns so viel Schwierigkeiten, dass ein großer Teil des Gepäcks von den Kirgisen nach dem nächstgelegenen Rabat (Karawanserei) getragen werden musste.
Wir waren hier in einer Höhe von 2850 Meter. In der Nacht fing die Bergkrankheit an, sich fühlbar zu machen, um sich den ganzen nächsten Tag in entsetzlichem Kopfweh und Herzklopfen zu äußern. Diese Symptome, die jedoch nach ein paar Tagen spurlos verschwinden, werden durch den plötzlichen Höhenwechsel verursacht.
In ernster Stimmung zogen wir zu dem Passe hinauf, der jetzt überall mit tiefem Schnee bedeckt war. Nach unerhörten Mühen und Anstrengungen erreichten wir einen muldenartigen Einschnitt, der nur langsam anstieg, wo der Schnee jedoch gegen 2 Meter hoch lag. Ein schmaler, tiefer Steig war durch die Schneekruste getreten worden; sein fester Grund ruhte auf dem Schnee wie ein schwankender Steg in einem Moore. Ein Schritt seitwärts, und das Pferd versank ganz im Schnee und musste unter großem Zeitverlust mit. vereinten Kräften wieder auf den "Steg" hinausgezogen werden.
In Hunderten von Krümmungen schlängelt sich der Weg noch einen letzten Kamm hinauf. Nachdem die Kräfte der Pferde hier auf die entsetzlichste Prybe gestellt worden, kamen wir endlich mit heiler Haut auf dem gefürchteten, Tengis-bai-Passe an.
Der Punkt, auf dem wir uns befanden, war auf allen Seiten von schneebedeckten Kämmen umgeben, und nur hier und da guckten nackte Felsspitzen aus dem Schnee empor.
Im Norden sehen wir das Jsfairantal, das wir nach so großen Anstrengungen jetzt endlich hinter und unter uns haben. Im Südosten öffnet sich ein großartiges Panorama. Hinter den scharf markierten Kämmen des Alaigebirges erscheint in der Ferne, jenseits des Alaitales, das Bergsystem des Transalai in den schönsten blauen und weißen Tönen mit Gipfeln, die in den Wolken verschwinden, und Schneefeldern, die in blendender Klarheit leuchten.
Nachdem wir in der hohen dünnen Luft der gewaltigen Wasserscheide aufgeatmet hatten, verließen wir das Flussgebiet des Sir-darja und zogen langsam nach den Gegenden hinab, deren Wasser vom Amu-darja gesammelt werden.
Der Abstieg war hier ebenso steil wie auf der nördlichen Seite; ein Lawinenkegel nach dem anderen wurde passiert. Einige von ihnen hatten Erde und Geröll mitgerissen und wurden erst dann als Lawinenschnee erkannt, als die Pferde in dem trügerischen Boden bis an den Bauch einsanken. Die Kirgisen sagten, wir könnten uns glücklich preisen, den Lawinen entronnen zu sein. Wenn die Lawine mit überwältigender Kraft und Schwere ins Tal hinabstürzt, verwandeln sich ihre untersten Schichten durch den Druck zu Eis, und die Unglücklichen, die darunter begraben werden, frieren förmlich ein in eine glasharte Eismasse, aus der keine Rettung möglich ist. Sie kommen wahrscheinlich gar nicht zur Besinnung, bevor sie, vom Stoße betäubt, erfrieren.
Der Weg führte weiter hinunter durch das Tal des Baches von Daraut-kurgan. Mindestens alle zehn Minuten wateten wir durch den Bach, der an einigen Stellen unter Gewölben und Brücken von Schnee plätscherte. Vom Lawinenrande mussten sich die Pferde sozusagen kopfüber ins Wasser stürzen, um auf der entgegengesetzten Seite einen gewaltigen Sprung aufs Trockne zu machen. Ich schwebte jedes Mal in der größten Unruhe um die Photographie- und Munitionspferde; es lief jedoch alles gut ab. Nur einmal stürzte eins der Proviantpferde vom Kamme eines Schneekegels in den Bach hinunter. Es wurde abgeladen, die Jachtane wurden mit einem Strick durch den Schnee aufgeheißt, das Pferd wieder bepackt, und der Zug langsam durch die Schneewehen fortgesetzt, bis der nächste Fall uns von neuem aufhielt. In diesem Stil ging es weiter!
Unser Tal mündete in das große Alaital aus, wo Chodier-Khans Festung Dar aut-kurgan ihre niedrigen Lehmmauern mit Türmen an den Ecken erhebt. Bald darauf langten wir an dem kirgisischen Winteraul gleichen Namens an, der sich aus 20 Jurten zusammensetzt und unter der Herrschaft des gastfreien Häuptlings Tasch Mohammed Emin steht.
Am 2. März wanderten wir nach dem Winterdorfe Gundi. Hier traf uns ein Missgeschick. Wir waren gerade im Kischlak (Dorfe) angekommen, wo die Jurte aufgestellt und mit dem Bette, den Jachtanen und dem empfindlicheren Teil des Gepäckes möbliert wurde, als Rehim Bai so heftig gegen das Quecksilberbarometer stieß, dass die Glasröhre zerbrach und die flinken Silberperlen über den Teppich liefen. Das kostbare, empfindliche Instrument, das ich gewissenhaft dreimal am Tage abgelesen und wie ein Wickelkind gehütet hatte, war nun ganz wertlos und hätte ebenso gut im Schnee liegen bleiben können. Rehim Bai war sehr bestürzt; er konnte aber nicht für das beklagenswerte Ereignis verantwortlich gemacht werden und erhielt darum nur eine gelinde Zurechtweisung.
Um mich zu trösten, arrangierten die Leute am Abend eine musikalische Soiree. Ein Kirgise kam in mein Zelt, ließ sich dort nieder und spielte auf dem Komus, einem dreisaitigen Instrument, das mit den Fingern gespielt wird. Es ist ein ziemlich eintöniges, melancholisches Spiel, wirkt aber asiatisch stimmungsvoll. Gern hörte ich ihm zu, umso mehr, als die Musik von dem Sausen des abnehmenden Sturmes und dem Knistern des Feuers begleitet wurde. Wie manches Mal sollte ich während dieser langen Jahre noch den Tönen dieses primitiven Saitenspieles lauschen, wie mancher dunkle, einsame Winterabend mir durch dieses bescheidene Instrument verkürzt werden!
Am 4. März schneite es den ganzen Tag, und ein dichter Nebel breitete sich über die Landschaft aus. Alles war weiß; Erde und Himmel verschmolzen ineinander. Der einzige Ruhepunkt für das Auge war die Karawane, eine dunkle Lime, die nach der Spitze hin schmutziggrau erschien und im Nebel verschwand. Vor uns her wurden jetzt zwei Kamele geritten. Ihre Reiter suchten die wenigst tiefen Stellen aus und ritten deshalb in allen möglichen Bogen über die Erhöhungen des Bodens. Der Schnee war jedoch so tief, dass die Kamele oft ganz unvermutet fast vollständig darin versanken und eine andere Richtung eingeschlagen werden musste.
Die Pferde waten in der Spur der Kamele. Still und ernst schreitet der Zug durch den Schnee dahin. Endlich erscheint eine Jurte auf einem Hügel, einem schwarzen Punkte gleich in dem ewigen Weiß, und man ist damit beschäftigt, eine zweite aufzuschlagen. Wir hatten nur 150 Meter dorthin, aber diese führten über eine Rinne, in welcher sich der Schnee zwei bis drei Meter hoch angehäuft hatte, und mehr als eine Stunde mühten wir uns ab, die Packpferde glücklich hinüberzubringen. Schließlich verfielen die Kirgisen auf einen Ausweg. Sie breiteten die Filzstücke der Jurte über den Schnee, und auf diesen wurden die Pferde in einer langen Reihe hinübergeführt. Eins nach dem anderen wurden die hintersten Filzstücke wieder vorn hingelegt, und nach vielen Widerwärtigkeiten gelang es uns, die ganze Karawane wieder auf festen Boden zu bringen. Die Gegend heißt Dschipptik.
Die Nacht war kalt, das Minimumthermometer zeigte —20,5 Grad. Am Morgen war alles im Zelt gefroren: Konserven, Milchextrakt und Tinte, und im Freien standen die Pferde, ließen den Kopf hängen und scharrten mit den Hufen im Schnee.
Das Wetter war still. Gegen elf Uhr kam die Sonne zum Vorschein, und aus dem Nebel traten die majestätischen Gipfel des Transalai hervor, um die hier und da noch leichte, durchsichtige Schleier schwebten. Von Zeit zu Zeit sah man auch den Pik Kauffmann (7000 Meter), eine silberglänzende Pyramide, die indessen ihre Nachbarn nur wenig an Höhe zu übertreffen schien.
Wir erwarteten eine Partie kirgisischer Reiter, die von Artscha- bulak kommen sollten, um uns einen Weg zu bahnen. Als sie nichts von sich hören ließen, machte sich unser Freund Emin auf, um sie aufzuspüren und das Terrain zu untersuchen. Nach mehrstündiger Abwesenheit kehrte er mit der Nachricht zurück, dass an ein Weiterkommen nicht zu denken sei. Der Schnee sei metertief, und sein Pferd mehrmals gefallen.
Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, dass Emin und Rehim Bai sich nach Dschipptik begeben sollten, um von dort Hilfe zu holen. Endlich erschien ein langer Zug von Reitern, Pferden und Kamelen, die uns Heu für die Pferde und Brennmaterial brachten.
Am Morgen des 6. März rüsteten wir uns wie zu einem Feldzuge. Die Kirgisen erzählten, dass die Schneeverhältnisse viel ungünstiger sein können, als sie diesen Winter waren. Manchmal häuft sich der Schnee so hoch wie die Zelte an, und zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den Aulen gebraucht man dann die Jaks (Grunzochsen), die so dressiert sind, dass sie als Schneepflüge Dienste leisten, da sie mit dem Kopfe und den Hufen förmliche Tunnels durch die Schneemassen stoßen, in denen die Kirgisen ihnen folgen.
Jetzt galt es, den Kisil-su-Fluss zu passieren, was nicht leicht war. Er war größtenteils mit Eis bedeckt, und nur eine zehn Meter breite Rinne in der Mitte zeigte Stromwirbel. Es ist ein höchst unbehagliches Gefühl, wenn das Pferd auf dem Eisrand stehen bleibt und seine Kraft zum Sprunge in den Fluss sammelt. Es kann leicht ausgleiten oder hin- einstürzen, und man hat alle Aussicht auf ein gründliches Bad, das bei dieser Temperatur an und für sich unangenehm wäre, aber geradezu gefährlich ist, wenn man in dicken, schweren Pelzen steckt, die die Bewegung hindern. Und ist man einmal im Wasser, so wird man beinahe schwindlig, denn es braust und siedet um das Pferd herum, und folgt man nicht genau der Furt, sondern weicht seitwärts ab, so kann es vorkommen, dass man in zu tiefes Wasser gerät, wo das Pferd von der Strömung fortgerissen wird.
Wir ließen den Kisil-su links liegen und zogen mitten durch das Tal auf die Abhänge des Transalai zu. Nach zehnstündigem Marsch machten wir Halt in diesem Reich der Kälte und des Todes, wo kein Grashalm, kein lebendes Wesen zu sehen war. Die Leute schaufelten den Schnee von einem niedrigen Hügel fort, und das Gepäck wurde dort aufgestapelt.
Lange dauerte es, bis wir an jenem Abend zur Ruhe kamen, und erst nachts um 1 Uhr war es still im Lager; das Thermometer zeigte —32 Grad. Ich pflegte in meiner Jurte allein zu schlafen, denn es ist nicht angenehm, die Kirgisen gar zu dicht auf dem Leibe zu haben, da sie in ihren Pelzen selten allein wohnen. Doch die Kälte ist ein gutes Schutzmittel gegen das Übel, auf das ich anspiele, und in dieser Nacht konnte ich die Leute nicht mit gutem Gewissen draußen liegen lassen. So viele im Zelt Platz fanden, durften sich auf den Teppichen ausstrecken, wo sie wie die Heringe in der Tonne dicht gepackt lagen.
Am 7. März brachen wir erst gegen 11 Uhr auf, denn wir warteten alle auf die wärmende Sonne.
Langsam schreitet der Zug vorwärts durch die Schneewehen, die immer tiefer zu werden scheinen. Im Osten sehen wir das Ende des Alaitales, wo die Ausläufer des Alai und des Transalai muldenartig miteinander verschmelzen. Die letztere Bergkette tritt jetzt immer deutlicher hervor, wird aber immer weniger imposant, da die relative Höhe allmählich abnimmt; doch ihr schneeumhüllter Kamm glänzt in blendendem Weiß und Blau, und darüber wölbt sich jetzt ein reiner, türkisblauer Himmel.
Die Pferde waten durch den Schnee, und die Männer müssen aufpassen, wenn das Gepäck sich verschiebt; oft müssen alle Mann zugreifen, und an schwierigeren Übergängen hört man ihren charakteristischen Ruf "Bissmillah!" (In Gottes Namen) oder "Haidah!" (Vorwärts).
Unser Hund Jolltschi freut sich seines Daseins. Wie ein Delphin taucht er in die Schneewehen und wälzt sich mit seinem üppigen Pelz im Schnee. Bald nimmt er aus Spaß das ganze Maul voll Schnee, bald schießt er wie ein Pfeil der Karawane voran. Der Hund war übrigens von Anfang an halb wild, und es gelang mir nie, ihn richtig zu zähmen. Unter Kirgisen aufgewachsen, war er nicht dazu zu bringen, in mein Zelt zu kommen, denn die Mohammedaner betrachten den Hund als ein unreines Tier und glauben, mit dein Staub an seinen Füßen besudle er das Innere des Zeltes. Ich wollte Jolltschi dieses dumme Vorurteil abgewöhnen, aber er ließ sich weder im Guten noch im Bösen dazu bringen, meine Schwelle zu überschreiten. Er war nie in einem Zelt gewesen und hatte entschieden das Bewusstsein, dass er dort nichts zu schassen habe.
Da die Packpferde gar zu langsam vorwärtskamen und wir bis zum Lager noch ein paar Stunden hatten, verließ ich, von einem Kirgisen begleitet, die Karawane, und ging in der Dunkelheit auf unwegsamer Straße dahin. Der Kirgise ritt voraus, hinter ihm kam ich in die Furche, die sein Pferd pflügte: ein ermüdender Ritt. Aber die Stunden gingen hin, und hätte es in der kleinen, einsamen Herberge zu Bor-doba einen Gastwirt gegeben, so wäre er sicherlich verwundert gewesen, zu so später Stunde zwei beschneite Reiter vor das Haus reiten, ihre Pferde draußen anbinden, sich den Schnee abklopfen und in die Stube treten zu sehen.
Damit sich der Leser von dieser Herberge keine übertriebenen Vorstellungen mache, will ich gleich sagen, dass sie eine kleine Erdhütte war, deren Balken- und Bretterdach durch unbehauene Baumstämme gestützt wurde, und dass eine in der Mitte des Fußbodens befindliche viereckige Terrasse den Reisenden als Lager diente. An einigen Punkten sind auf Befehl des Gouverneurs von Fergana solche Hütten errichtet worden, um die Postverbindung zwischen Margelan und Pamirskij Post zu erleichtern.
Auf dem Wege nach Bor-doba hatten wir die Spuren von acht Wölfen gesehen.
Der Wolf ist in diesen Gegenden sehr häufig. Der Hund wittert den Wolf schon in einer Entfernung von ein bis zwei Kilometer, wird aber von diesem, der der Herde wochenlang auflauert und eine passende Gelegenheit abwartet, nicht selten überlistet. Der Wolf ist außerordentlich blutdürstig, und wenn er eine unbewachte Schafherde trifft, zerreißt er alle Schafe. Doch wehe dem Wolfe, der von einem Kirgisen weidwund geschossen wird und dann lebendig in die Hände seines Feindes fällt! Man steckt ihm quer in den aufgesperrten Rachen einen kurzen, dicken Stock, an dem ihm die Kiefer fest zusammengeschnürt werden. Ein zweites Holzstück wird ihm an ein Bein gebunden, um ihn am Ausreißen zu hindern; dann wird er gemartert, solange noch ein Funken von Leben in ihm ist.
Wenn im Alaital die großen Winterschneefälle stattfinden, geht der Wolf nach Pamir hinauf und streift die Ufer des Kara-kul ab, wo er hauptsächlich von den stattlichen Archaris (Kaschgarschafen, Ovis Poli), Kijiks (Wildziegen) und Hasen lebt.
Die Archarijagd betreibt der Wolf auf schlaue Weise. Auf eine weidende Herde wird ein Treiben angestellt, und eines oder ein paar der schnellfüßigen Tiere werden von vorher ausgestellten Posten gezwungen, Zuflucht auf einem vorspringenden Felsen zu suchen, der nun von den Wölfen umzingelt wird. Da die Wölfe nicht auf den Vorsprung hinaufklettern können, warten sie geduldig, bis dem Archari die dünnen Beine vor Erschöpfung einschlafen und der unglückliche Gefangene kopfüber in die Klauen seiner hungrigen Verfolger stürzt.
Den Kirgisen zufolge sind zwei Wölfe für einen einzelnen Mann gefährlich. Sie erzählten mir schauerliche Wolfsgeschichten aus diesen Gegenden. So wurde ein alleingehender Kirgise vor einigen Jahren im Talldikpass von Wölfen überfallen, und als man ein paar Tage darauf seine Leiche fand, waren nur noch der Kopf und das Gerippe von ihm übrig.
Am Morgen des 9. März fielen alle Kirgisen im Schnee auf die Knie und baten Allah um eine glückliche Reise über den gefürchteten Kisil- art-Pass, wo verderbenbringende Burane oft aus eben noch wolkenlosem Himmel kommen. Ich hatte mich auf eine gräuliche Wanderung gefasst gemacht, fand jedoch, dass der Kistl-art viel leichter zu überschreiten war als der Tengis-bai.
Glücklich erreichten wir den Kamm (4271 Meter), wo ein eisiger, Pelze und Filzstiefel durchdringender Nordwind wehte. Auf der eigentlichen Passhöhe erhebt sich das Grabmal des heiligen Kisil-art, eine Steinpyramide mit zahlreichen Tughs, d. h. mit Lumpen, Zeugflicken und Antilopenhörnern besetzten Stangen, den Opfergaben frommer Kirgisen.
Nach achtstündigem Marsch erreichten wir die kleine Herberge Kok-sai. Ich erinnere mich dieser besonders gut, weil ich dort den niedrigsten Temperaturgrad auf meiner ganzen Reise durch Asien beobachtete; das Quecksilber fiel auf —38,2 Grad, war also nicht weit von seinem Gefrierpunkte entfernt.
Südlich vom Kisil-art bekommt die Landschaft einen ganz anderen Charakter. Die Schneemenge ist unbedeutend, der Boden streckenweit nackt und mit Geröll und Sand bedeckt. Die Bergformen sind mehr abgerundet; die relativen Höhen nehmen ab, und die Bergkämme werden durch langsam abfallende, breite, muldenförmige Täler voneinander getrennt. Zwischen dem Kisil-art und dem Ak-baital-Passe umschließt den See Kara-kul ein Gebiet, das keinen Abfluss nach dem Amu-darja hat, und wo die Verwitterungsprodukte des Gebirges liegen bleiben, um zum Nivellieren des Terrains beizutragen.
Am 10. März erreichten wir nach vierstündigem Marsche den kleinen Pass Ui-bulak. Tief unter uns erschien der nordöstliche Teil des Großen Kara-kul, zugefroren, verschneit und von gewaltigen Bergen umkränzt, die vom Gipfel bis zum Fuße mit zusammenhängenden Schneefeldern bedeckt waren.
Dann ging es wieder abwärts über die breite Steppe, die vom Fuße des Gebirges ganz unmerklich nach dem nördlichen Seeufer abfällt und jetzt mit einer nicht vollständig zusammenhängenden Schneedecke bedeckt war. Die Steppe ist dünn mit Teresken bewachsen, einem holzigen, verkrüppelten, trocknen Strauche, der vorzügliches Brennmaterial liefert.
Um 6 Uhr ging die Sonne unter. Die Schatten der westlichen Berge huschten so schnell über die Ebene, dass man ihnen mit den Augen kaum folgen konnte. Langsam kletterten sie an den Abhängen der östlichen Berge empor, und nur noch die höchsten Gipfelpyramiden wurden von der Sonne beleuchtet. Nach einer Viertelstunde lag die ganze Landschaft im Dämmerscheine.
In einer kleinen Erdhütte nicht weit vom Ufer des Kara-kul machten wir Nast und hatten es dort während der Nacht angenehm warm.
Mit einer kleinen, auserwählten Karawane, bestehend aus zwei sartischen Dschigiten, zwei abgehärteten Kirgisen, fünf Reitpferden und zwei Packpferden, zog ich am 11. März in südwestlicher Richtung auf das Eis des Kara-kul hinaus.
Auf einem Areal von 300—400 Quadratkilometer breitet der Kara-kul seine salzige Wassermasse zwischen bedeutenden Bergketten aus, die jedoch im Norden, Osten und Südosten einer einige Kilometer breiten Ufersteppe Raum geben. Der Name, den ihm die Kirgisen gegeben haben und der "schwarzer See" bedeutet, ist recht passend gewählt, weil der See im Sommer gegen die auch dann nicht selten mit Schnee bedeckten Berge schwarz erscheint. Seine größte Länge beträgt 22, seine größte Breite 16 Kilometer. Durch eine von Süden vorspringende Halbinsel und eine nördlich davon gelegene Insel wird der See in zwei Becken geteilt, von denen das östliche sehr flach, das westliche groß und tief ist. Das östliche Becken war Gegenstand der Untersuchungen des ersten Tages.
Nachdem wir vier Kilometer auf dem Eise zurückgelegt, machten wir halt; Beile, Picken und Spaten wurden sofort in Tätigkeit gesetzt, und nach einer Arbeit von einer guten Stunde hatten wir die Eisdecke durchgebrochen, deren Dicke hier 91 Zentimeter betrug. Das Eis war glashart und klar. Der letzte Hieb öffnete ein schwarzgrünes Loch, durch das kristallhelles, bitteres Wasser mit zischendem Tone in die Eisgrube stieg und sie bis auf einige Zentimeter füllte. Die Lotleine, die alle 10 Meter durch Knoten abgeteilt war, tauchte jetzt in die Tiefe, aber nur der erste Knoten lief durch meine Hände, und das Metermaß stellte 12,5? Meter Tiefe fest. In der Öffnung hatte das Wasser eine Temperatur von —0,4 Grad, auf dem Seegrunde von 4-1,2 Grad.
Sobald die Öffnung fertig war, begann es im Eise zu knacken und zu knallen, und eigentümliche Töne, die von unten, heraufzukommen schienen, folgten einander.