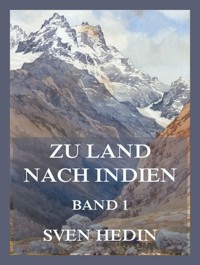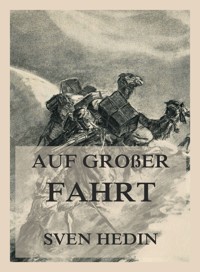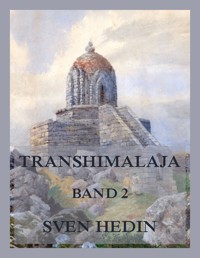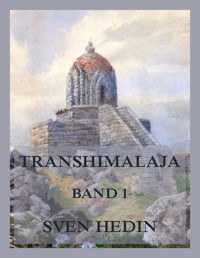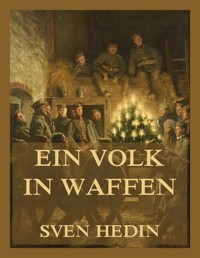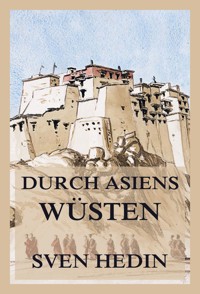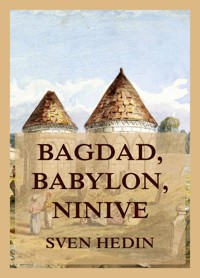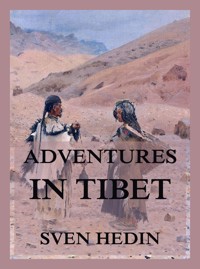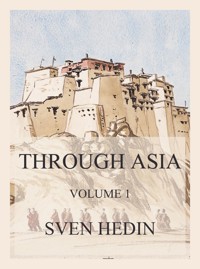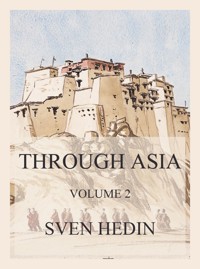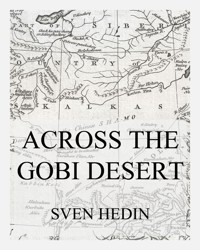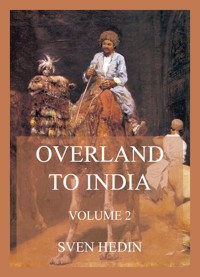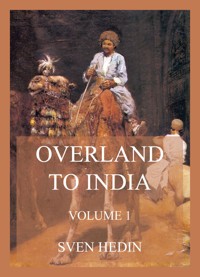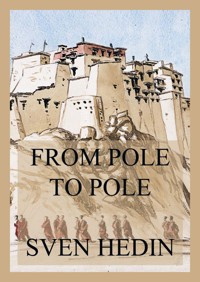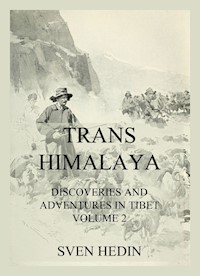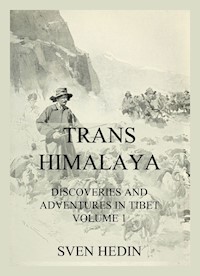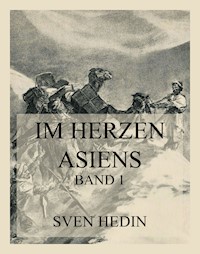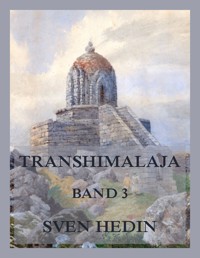
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines der bedeutendsten je geschriebenen Reisebücher ist die Geschichte von Dr. Sven Hedins Entdeckungen und Abenteuern in Tibet, die er in drei Bänden unter dem allgemeinen Titel "Transhimalaja" veröffentlicht hat. Dieses Werk ist nicht nur ein engmaschiger, sorgfältig ausgearbeiteter Bericht über die Leistungen eines wissenschaftlichen Entdeckers, Geographen und Ethnologen, sondern auch eine unterhaltsam erzählte Geschichte über verblüffende Erlebnisse, aufregende Abenteuer und wirklich bemerkenswerte Leistungen auf dem Gebiet der Erforschung. Die Expedition des schwedischen Entdeckers startete im August 1905 und betrat das Verbotene Land von Nordwesten her. Er erforschte die Region gründlich und drang mit Hilfe seiner siebenunddreißig asiatischen Gefolgsleute in Gebiete vor, die nicht nur noch nie ein westlicher Mensch betreten hatte, sondern in denen sogar die Existenz Europas unbekannt war. So zeigt Dr. Hedins Beschreibung seiner Begegnung mit dem Tashi Lama , dass dieses Oberhaupt der buddhistischen Kirche keine Gottheit in Menschengestalt ist, sondern ein Mensch, der in Herzensgüte, Unschuld und Reinheit der Vollkommenheit so nahe wie möglich kommt. Dies ist der dritte von drei Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Transhimalaja
Band 3
SVEN HEDIN
Transhimalaja Band 3, S. Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681706
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
Erstes Kapitel. Von der Indusquelle durch unbekanntes Land.3
Zweites Kapitel. Neue Bekanntschaften.12
Drittes Kapitel. Noch einmal über den Indus.19
Viertes Kapitel. Über den Transhimalaja nach Gartok.27
Fünftes Kapitel. Die Vereinigung der beiden Indusarme.35
Sechstes Kapitel. Im Dunkel dumpfer Klostermauern.42
Siebtes Kapitel. Die letzten Tage am Löwenfluss.49
Achtes Kapitel. Zum letzten Mal in Ladakh.56
Neuntes Kapitel. Ein mächtiger Häuptling und ein vorsichtiger Prior.62
Zehntes Kapitel. Die Modelle von Kjangjang.81
Elftes Kapitel. Zum letzten Mal über den Transhimalaja!88
Zwölftes Kapitel. Der Transhimalaja im Altertum und im Mittelalter. - Die katholischen Missionare.95
Dreizehntes Kapitel. Die Jesuiten. — D'Anville. — Die ersten Engländer. — Ritter, Humboldt und Huc.109
Vierzehntes Kapitel. Der Transhimalaja von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.120
Fünfzehntes Kapitel. Eine gespannte Situation!137
Sechzehntes Kapitel. Zum Kloster der „heiligen Sau“.146
Siebzehntes Kapitel. Der Manasarovar in alter und neuerer Zeit.156
Achtzehntes Kapitel. Die ersten Engländer am heiligen See.172
Neunzehntes Kapitel. Die letzten Pulsschläge.185
Zwanzigstes Kapitel. Ein schwindelerregender Übergang über den Satledsch.198
Einundzwanzigstes Kapitel. Die Schluchten des Satledsch.211
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Ein malerisches Kloster.221
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Im Heiligtum des Klosters Mangnang.231
Vierundzwanzigstes Kapitel. Seine Exzellenz der Grobian.239
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Der erste Jesuit in Tibet.251
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Lamaismus und Katholizismus.261
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Durch die Labyrinthe der Nebenflüsse.279
Achtundzwanzigstes Kapitel. Im Höllenloch des Ngari-tsangpo.288
Neunundzwanzigstes Kapitel. Zum Satledsch hinunter.298
Dreißigstes Kapitel. Abschied von Tibet.306
Einunddreißigstes Kapitel. Zwischen Himmel und Wasser.313
Zweiunddreißigstes Kapitel. Ein gelehrter Lama aus Ungarn.322
Dreiunddreißigstes Kapitel. Meine Amazonengarde.337
Vierunddreißigstes Kapitel. Das letzte Kapitel.346
Vorwort.
Mit diesem dritten Band des „Transhimalaja“ erfülle ich ein Versprechen, das ich vor drei Jahren im Vorwort des ersten Bandes gegeben habe.
Damals stellte ich in Aussicht, auch meine Erinnerungen an Japan, Korea und die Mandschurei zu schildern, und es war meine Absicht, das Ganze mit einer Beschreibung meiner Heimreise durch Sibirien abzuschließen. Dann begann ich mich in meine Tagebücher über die Indusquelle, das westtibetische Hochland und das Satledschtal zu vertiefen. Bald sah ich ein, dass der dritte Band denselben Umfang wie die beiden ersten erhalten würde und dass für den äußersten Osten doch kein Platz mehr bliebe, wenn ich das Material mit der verdienten Ausführlichkeit behandelte! So fehlen denn auch jetzt Japan, Korea und die Mandschurei. Aber weshalb sollte ich durch Berichte über Länder, die alljährlich von unzähligen Touristen besucht werden, den knapp genug zugemessenen Raum noch beschränken, wenn ich dem Leser Eindrücke aus Gegenden bieten konnte, die noch nie der Fuß eines Weißen betreten hat oder wo ich wenigstens nicht einen einzigen Mitbewerber hatte! Überdies habe ich in meinem der Jugend gewidmeten Buche „Von Pol zu Pol“ einige Bilder aus dem großen Osten entrollt.
In drei Kapiteln gebe ich diesmal eine kurzgefasste geschichtliche Übersicht über alle die Entdeckungsreisen, welche die Ränder der zentralen Ketten des Transhimalaja berührt haben, und zeige daran unter anderem, wie gewaltig die Gebiete dieses Gebirgssystems waren, die vor meiner Reise völlig unbekannt gewesen sind.
Drei weitere Kapitel enthalten eine Übersicht derjenigen Reisen, deren Ziel der heilige See Manasarovar und die Quellengebiete der großen indischen Flüsse war. Hier liefere ich den Beweis, dass noch nie ein Europäer, ja nicht einmal ein bekannter Asiate, vor mir bis an die wahren Quellen des Indus und des Satledsch vorgedrungen ist und dass die Lage der Brahmaputraquelle niemals vorher festgestellt worden ist, auch wenn man hat ahnen können, wo der erste Quellbach des Flusses dem Rande der Gletscher entquillt. Ein polemischer Ton ist umso weniger notwendig gewesen, als ernstzunehmende gegenteilige Behauptungen nicht aufgestellt worden sind. Ich lasse die Tatsachen sprechen; sie sind, wie immer, sehr beredt.
In den populärwissenschaftlichen Kapiteln habe ich ermüdendes Zitieren vermieden. Ich behandle dieselben Fragen ausführlich in dem wissenschaftlichen Werk, das in kurzer Zeit erscheinen wird und worin alle Quellen genau angegeben sind.
Für die Ausrechnung der absoluten Höhen bin ich Herrn Dr. Nils Ekholm zu Dank verpflichtet, für die Bestimmung der Gesteinsarten Herrn Professor Anders Hennig in Lund und für die Übersichtskarten Herrn Leutnant C. J. Otto Kjellström.
Stockholm, im Oktober 1912.
Sven Hedin.
Erstes Kapitel. Von der Indusquelle durch unbekanntes Land.
Nun weiden meine Pferde und Maulesel im Lager 236 in dem spärlichen Grase, das an der Indusquelle wächst. Der Steinmann, den ich an dieser bedeutungsvollen Stelle errichtet hatte, stand auf einer Terrasse von weißem, porösem Kalkstein. Rechts unterhalb der Terrasse entspringen mehrere Wasseradern, die den Quellarm des Indus bilden.
Klangvoll lallt der neugeborene Fluss zwischen den Steinen seines Bettes, und ich höre ihn vor meinem Zelte wie die Orgeltöne einer klassischen Frühmesse. In steigendem Rhythmus wird sein Gesang auf dem Wege durch den Himalaja zu dröhnendem Donner anschwellen, aber immer bleibt es dieselbe Melodie. Bei den Tönen der Wellen des Indus siegten einst die Mazedonier über die Völker des Ostens!
Mit seinen eisernen Pflöcken ist mein Zelt in einem Boden verankert, auf den noch nie ein Europäer seinen Fuß gesetzt hat. Ich bin stolz darauf, der erste an der Indusquelle zu sein, aber auch demütig dankbar. Von diesem Punkte aus, wo der Fluss dem Schosse der Erde entspringt, eilen die wachsenden Wassermassen ihren Weg nach dem Meer hinab. Die Höhe ist #schwindelerregend. Ich raste 5165 Meter über dem Spiegel des Ozeans. Ein Eiffelturm auf dem Gipfel des Montblanc! Nicht allein der ewige Fluss — nein, nahezu die ganze Erde liegt zu meinen Füßen. Zum vierten Mal habe ich nun den Transhimalaja überschritten, und endlich ist es mir gelungen, an das erwünschte Ziel vorzudringen.
Über die Indusquelle wussten die Geographen des Altertums, Griechen und Römer, und auch die Araber nichts. Das Mittelalter kümmerte sich wenig darum. Der erste Europäer, der Indien besuchte, hatte recht verschwommene Vorstellungen über die Herkunft des Flusses. Seit dem Tage, an welchem der britische Löwe zuerst das Land der Hindus mit seinen Krallen packte, ist die Wiege des Indus friedlos bald hierhin, bald dorthin zwischen den Bergen verlegt worden. Schließlich sandten englische Offiziere eingeborene Späher aus, um sie auszukundschaften. Diese fanden den Quellarm, aber nicht die Quelle. Und jetzt lauschte ich ihrem eintönigen Rauschen!
Ich hatte nur fünf meiner besten Leute aus Ladakh bei mir. Sie hatten mich auf dem an Stürmen reichen Zuge durch ganz Tibet begleitet, sie hatten einen schneidend kalten Winter ertragen und den Transhimalaja auf unbekannten Pässen besiegt; sie waren von Andacht ergriffen gewesen, als der Tempelgesang in den Klosterhöfen von Taschi-lunpo widerhallte, und sie hatten die Ufer des heiligen Sees besucht und hatten auf dem Gipfel des Kailas ihre Blicke zu dem Paradiese Siwas emporgesandt.
Ich sprach mit meinen Leuten dschaggatai-türkisch, im Tibetischen war Rabsang mein Dolmetscher. Tundup Sonam hatte unsere Flinten in seiner Obhut, und Adul rührte in den Töpfen, die über dem Küchenfeuer brodelten.
Ein glückliches Geschick hatte mir einen tibetischen Nomaden namens Pema Tense in den Weg geführt. Angelockt durch die verführerische Vergütung, die in blanken Rupien in meiner Hand klimperte, hatte er seine Kameraden laufen lassen und mir seine Dienste auf dem Wege nach Nordosten durch unbekanntes Land angeboten. Von ihm mietete ich acht Schafe, deren Gerstenlasten ich kaufte. So würden unsere eigenen Lasttiere nicht über Gebühr beladen werden und konnten doch hin und wieder eine gute Mahlzeit erhalten, in einem Lande, das nackt und kahl ist wie nach der Sündflut.
Am Morgen des 11. September 1907 brachen wir auf, und wieder klapperten die Hufe auf dem hartgefrorenen Boden. Die Temperatur war während der Nacht auf 11,5 Grad Kälte heruntergegangen. In Tibet ist der Winter ein Gast, der frühzeitig einkehrt und lange bleibt. Der Himmel war rein und hellblau; die Regenzeit, die wir kaum verspürt hatten, war jetzt vorüber. Aber dennoch heulten und klagten die Winde des Südwestmonsuns über dem Hochland, und da, wo der Boden locker war, wirbelte der Staub hinter den Hufen der Pferde auf.
Flach und offen liegt das Land vor uns da. Es ist die „Nordebene“, das Tschang-tang der Tibeter, das Hochplateau mit seinen flachen Bodenformen. Hinter uns erhebt sich der Transhimalaja mit wilden, schroffen Felsen. Das Tal, dem wir folgen, ist breit und zwischen hohen, ungleichmäßigen Bergen eingeschlossen. Der Bokar-tsangpo, einer der Quellbäche des Indus, gleitet lautlos zwischen seinen eisumsäumten Ufern hin. Sein Wasser ist kalt und kristallklar; man sieht ihm an, dass es aus Schneefeldern und Quellen und nicht von Gletschern stammt.
In einer Erweiterung zwischen den Bergen zur Linken unseres Weges glänzen weiße Salzringe um den kleinen sterbenden See Dschekung-tso herum. Seinen Namen trägt auch die Passschwelle, zu der der Weg in einer Schlucht zwischen nackten, verwitterten Felsen hinaufführt. Der Bokar-tsangpo ist hinter uns zurückgeblieben, aber in Ostsüdosten sehen wir die bläulichen Höhen, deren dünne Schneefelder der Bach zu seinen Ahnen zählt.
Auch jenseits des Passes befinden wir uns noch immer im Flussgebiet des Indus; denn das Bächlein, das sich zwischen schmalen Wülsten gelbgewordenen Grases das Lamo-latse-Tal hinabschlängelt, vereinigt sich mit dem Bokar-tsangpo.
Pfeifend und singend watschelt Pema Tense hinter seinen acht Schafen her und ist immer bereit, mir die Aufklärungen zu geben, die ich von ihm verlange.
„Wie heißt dieser Platz?“ frage ich an einem Punkte, wo sich eine mit Manisteinen bedeckte Reihe Steinmale über den Weg hinzieht.
„Schantse gong“, antwortet er. „Hier begrüßen die Pilger die Götter des Kang-rinpotsche, denn von hier aus sieht man zuerst die eigentliche Spitze des heiligen Berges.“ Diese Geschichte hatte sich Pema offenbar von jemand aufbinden lassen; nicht ein Schimmer des Berges ist von den Steinmalen aus zu sehen!
Durch das gelbe Moos, die einzige Vegetation, die wir sehen, rieseln noch einige Rinnsale dem Lamo-latse-Bach zu. Ich erwähne ihrer nur, weil das östlichste Rinnsal vielleicht als die eigentliche Quelle des Indus anzusehen ist.
Wieder stellt sich uns ein Hindernis in den Weg, und steil führt der Pfad zu dem in einen Kamm aus Quarzporphyr eingesenkten Passe Lamo-latse hinauf. Hier ist die Wasserscheide des Indus. Im Osten dehnt sich das Hochland aus, das keinen Abfluss nach dem Meere hin hat. Wir befinden uns jetzt in 5426 Meter Höhe. Die Passhöhe zieren zwei Steinmale, die mit Yakhörnern und Lumpen bedeckt sind, den Opfergaben frommer, abergläubischer Pilger. Die heiligen sechs Silben sind mit schwarzer Farbe auf bunte Wimpel gezeichnet, und wenn der peitschende Wind sie flattern und klatschen lässt, glaubt man ein vielstimmiges „Om mani padme hum“ zu hören, das der Wind über das öde Hochland hinträgt, damit es den Scharen der Pilger Segen und Wohlfahrt bringe.
Ja, hier droben sauste der Sturmwind tüchtig. Man musste sich mit dem Rücken nach dem Wind stellen, um nicht beim Ablesen der Instrumente weggeweht zu werden. Und welche Aussicht nach Ostnordosten hin! Aber man glaube ja nicht, dass sie schön sei! Verzweifelt öde ist sie, beinahe unheimlich! Ich fühle mich so vereinsamt und verloren wie inmitten des Meeres, eines versteinerten Meeres, dessen glockenförmige Dünungen in meiner Nähe schwarz und rot schillern und in weiterer Entfernung in Gelb, Grün und Violett übergehen. Ich selbst glaube auf einem Wellenkamme zu stehen, von dessen Höhe mein Blick alle die anderen Bodenwellen bestreicht. Ein Bild der Unendlichkeit! Jahr und Tag müsste ich hier umherziehen, um alle diese Einzelheiten auf meinen Kartenblättern wiedergeben zu können! Hier beherrscht man eine unendlich große Scholle der Erdrinde mit einem einzigen Blick. Oh wie öde, kalt und einsam! Keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen! Aber die Sonne leuchtet über der Erde, und der Wind klagt zwischen den Felsen. Kein anderes Zeichen des Lebens gibt es hier.
Es ist schön, nach einem solchen Tage zu lagern (Lager 237). Man kann die Zelte nicht schnell genug aufschlagen und darin Schutz vor dem Sturme suchen, der draußen wie ein scharfer Besen über den Boden fegt. Die Luft ist trotzdem klar. Denn von diesem Boden, den der Wind Millionen von Jahren hindurch poliert hat, gibt es nichts Loses wegzufegen. Vergeblich spähen wir nach einer gelblichgrünen Schattierung aus, die Weidegrund sein könnte. Dafür wird eines der Schafe von seiner Gerstenlast befreit.
Wenn man schon um 2 Uhr Lager schlägt, wird der Nachmittag lang, und die Stunden der Einsamkeit wollen gar kein Ende nehmen. Ich trage die Beschreibung des Stückchens Erde, das ich seit dem Aufgang der Sonne kennen gelernt habe, in mein Tagebuch ein. Die Gesteinsproben, die ich mit dem Geologenhammer aus den Bergen genommen habe, werden mit Nummern versehen und in Papier eingewickelt. Und dann muss mir Pema Tense eine Weile Gesellschaft leisten.
„Wie heißt dieses Tal?“ frage ich ihn.
„Es heißt Lamo-latse-lungpe-do und mündet nach drei Tagereisen in eine große Ebene.“
„Wo ist deine Heimat, Pema?“
„Mein Zelt steht in Gertse, Herr.“
„Wie weit ist es dorthin?“
„Oh, wohl fünfzehn Tagemärsche. Wir rechnen von Jumba-matsen nach Gertse elf Tagereisen.“
„Gibt es in Gertse viele Nomaden?“
„Meine Stammesgenossen lagern in zwei- bis dreihundert schwarzen Zelten, und wir besitzen große Schafherden; sie sind unser einziger Reichtum.“
„Erzähle mir ein wenig von dem Ertrag, den ihr von eueren Schafen erzielt.“
„Nun, sehen Sie, einige Nomaden scheren selber ihre Schafe in Gertse und befördern die Wolle dreizehn Tagereisen weit auf Yaks nach Tokdschalung, wo sich Kaufleute aus Ladakh und Hindostan zur Handelsmesse einstellen. Andere lassen die Schafe ihre Wolle zu Markte tragen und sie dort von den Käufern scheren. Am besten stehen sich jedoch die Nomaden, die Salz aus dem Bette ausgetrockneter Seen brechen, ihre Schafe mit den Salzstücken beladen und im Hochsommer den weiten Weg auf die Messe in Gyanima und nach dem Ufer des Tso-mavang wandern, wo die Schafe geschoren werden. Denn sie verdienen sowohl an dem Salz wie an der Wolle. Und wenn sie dann wieder heimwandern, sind die Schafe mit der Gerste beladen, welche die Nomaden sich eingetauscht haben. Eine solche Handelsreise hin und zurück nimmt den größten Teil des Sommers in Anspruch. Die Schafe grasen unterwegs, und wir Nomaden aus Gertse schonen unser eigenes Gras für den Winter.“
Das Goldfeld Tok-dschalung ist mit seinen 4980 Meter Höhe einer der höchsten ständig bewohnten Plätze der Erde. Pema Tense war oft dort gewesen und er erzählte mir, dass um die Gruben herum zur Sommerszeit dreihundert Zelte aus der Erde zu wachsen pflegten, weil dann Goldgräber aus Lhasa und anderen Orten dorthin kämen. Während des Winters ständen dort nur einige dreißig Zelte. Es sei schneidend kalt, und manchmal sause ein Schneetreiben mit feinem Pulverschnee über die weiten Flächen hin.
Pema Tense guckte durch die Zeltöffnung ins Freie. Als er sah, dass die Dämmerung sich auf die Erde senkte, stand er auf und ging hinaus, um seine Schafe zu suchen und sie für die Nacht bei den Zelten anzubinden. Nachdem er am Lagerfeuer der Ladakhis noch eine Stunde verplaudert hatte, rollte er sich in seinem Pelze wie ein Igel zusammen und versank in festen Schlaf. Er hatte mir ein für alle Mal gesagt, dass er spurlos zu verschwinden gedenke, sobald uns Wanderer begegneten oder wir ein Zelt erblickten. Denn erwische man ihn dabei, dass er mit Fremdlingen umherziehe und ihnen den Weg in das verbotene Land zeige, so werde er so gewiss, wie zwei mal zwei vier sei, enthauptet werden. Daher müsse er jeden Abend seine Rupien ausgezahlt erhalten; er bekam sie auch stets ohne jeden Abzug.
Der Sturm leistete uns die ganze Nacht Gesellschaft. Er ist recht lästig, dieser ewige Wind, der nach Pema Tenses Behauptung noch volle acht Monate anhalten wird! Das dünne Zelttuch klatscht und schlägt wie ein Segel, es pfeift und ächzt in seinen Tauen, und kalte Zugluft zieht auf dem Boden hin, wo ich liege, in Pelze und Filzdecken eingewickelt. Die Temperatur sank auf 7,7 Grad Kälte, aber schon um 7 Uhr hatten wir 4,6 Grad Wärme.
Ich schlüpfe schnell in die Kleider. Kaum bin ich fertig, tritt Adul mit dem Frühstück herein, das aus zwei Rückenwirbeln des zuletzt erlegten Wildschafes, frischem Brot und Tee besteht. Draußen beschlagen die Ladakhis mein weißes Reitpferd, das treue Tier, das mich viele tausend Kilometer weit durch das öde Tibet getragen hat. In diesem schwierigen Gelände, das aus feinem, dicht gepacktem Schutt besteht, werden die Pferde hufkrank und müssen sorgfältig behandelt werden.
Man sehnt sich aus einer Gegend fort, die nichts anderes als Wasser und Wind zu bieten hat. Der Pfad schlängelt sich deutlich erkennbar wie ein helleres Band hin. Zahllose Menschen und Tiere haben ihn ausgetreten und in den Boden eingestampft. Aus Gertse, Senkor, Jumba-matsen und anderen Gegenden im Herzen Tibets sind die Pilger nach dem heiligen Berge und dem wundertätigen See gewandert. Hier und dort sieht man Spuren ihrer Lager, eine vom Feuer geschwärzte Felsplatte und drei Steine, zwischen denen blaue Flammen über Yakdung geflackert und das Wasser in einem Kessel zum Kochen gebracht haben.
Eine Stunde nach der anderen schreitet unsere kleine Gesellschaft vorwärts. Selten erregt etwas Ungewöhnliches unsere Aufmerksamkeit. Dort liegt der gebleichte Schädel eines Wildschafes, des Ovis Ammon, mit seinen schweren, schöngewundenen Hörnern. Das Tal mündet in eine Ebene aus, und wir wenden uns von dem Bache ab, der im Norden verschwindet. Sein Wasser rieselte melodisch unter einer dünnen Eishaut. Eine kleine Herde von Wildeseln oder Kiangs tummelte sich auf der Ebene, räumte aber das Feld, als wir unsere Zelte im Lager 238 an einer richtigen Mauer aus trocknem Yakdung aufschlugen. Die Nomaden, die dieses Feuerungsmaterial gesammelt hatten und nun in irgendeiner anderen Gegend ihre Herden weideten, werden bei ihrer Rückkehr sicherlich sehr verwundert sein, zu finden, dass ihr Feuerungsvorrat zum größten Teil verschwunden war. Denn wenn wir hier kein anderes Vergnügen haben konnten, so wollten wir uns wenigstens am Abend an großen lodernden Feuern erfreuen.
Der folgende Tagemarsch führt über einen kleinen Porphyrpass; auf seiner anderen Seite geleitet uns Pema Tense durch ein tief eingeschnittenes Tal zwischen wilden, verwitterten Felswänden, dessen Boden eine hohe Schicht scharfkantigen Schuttes bedeckt. Gelegentlich zeigt sich ein kleiner Fleck gelben Grases, dessen Halme hart und spitz sind wie Nähnadeln. In zwei geschützten Schluchten kämpften einige behaarte, zottige Brennnesseln um ihr Dasein. Im Übrigen ist das Land überall grauenhaft steril, ausgedörrt und wüst.
Jenseits einer zweiten Schwelle, die aus Kalkstein bestand, begegneten wir endlich einem einsamen Wanderer.
„Woher kommst du?“ fragte ihn Rabsang.
„Aus Jumba-matsen“, erwiderte er kurz, seine Schritte beschleunigend.
„Wohin gehst du?“
„Nach einem Zelt nicht weit von hier.“
„Was hast du da zu tun?“
„Ich habe dort meinen einen Stiefel vergessen“, antwortete er und eilte so schnell wie möglich weiter. Entschieden ein zerstreuter Herr! Pema Tense glaubte, dass der Mann zu einer Räuberbande gehöre.
Ein langsam ansteigender Pfad führt zu dem Passe Tsalamngopta-la (5078 Meter) hinauf, den zwei Steinmale und die gewöhnlichen Gebete zieren. Die Aussicht zeigt rings um den Horizont nirgends etwas Neues. Noch immer nach allen Seiten hin dasselbe öde Land. Keine schwarzen Zelte, keine Herden. Sechs Tage sind wir nun nordostwärts gezogen, und nur ein einziger Wanderer ist uns begegnet.
Hier laufen wir wenigstens nicht Gefahr, durch gebieterische Gouverneure und Milizaufgebot angehalten zu werden. Wir fühlen uns selbst als die Herren des Landes. Hätte ich nur eine stärkere Karawane, mehr Leute und mehr Lebensmittel, so könnte ich ungehindert noch sehr weit nach Osten ziehen. Es liegt ein seltsamer Reiz in den verbotenen Wegen mit ihren Abenteuern und ihrer Spannung. Doch das Ziel dieses Ausfluges, die Indusquelle, ist erreicht, und die Hauptkarawane erwartet uns in Gartok. Nun gut, mag sie warten! Noch zwei Tagereisen weit wollen wir, da alles so gut geht, nach Nordosten vorzudringen versuchen. Gemächlich ziehen wir die steilen Abhänge des Passes hinunter und bereiten uns in der Gegend Gjambotsche im Lager 239 auf die kommende Nacht vor.
Beim Aufbruch am 14. September machte ich mir klar, dass es meine nächste Aufgabe sein müsse, das Zelt des Häuptlings von Jumba-matsen aufzusuchen, der nach Pema Tenses Ansicht ganz in der Nähe weilte. Jeder Hügel, der eine weite Aussicht zu bieten schien, wurde von einem unserer Gesellschaft bestiegen. Manchmal glaubten wir, fern im Nordosten schwarze Zelte zu erblicken. Doch das Fernglas verwandelte sie schnell wieder in Schutthaufen oder Ringmauern, welche die Nomaden als Schafhürden benutzen. Das Einzige, was wir entdeckten, war der kleine See Njanda-nakbo-tso.
Seltsames Land! Die Gebirge bilden keine fortlaufenden Ketten, sie erheben sich in Gestalt runder Wecken aus Verwitterungsschutt oder als steile Höcker aus anstehendem Gestein, scheinbar ohne irgendwelche Ordnung. Sie schillern gelb und rot, violett, grau und schwarz. Die Erdoberfläche ist bunt, aber die Farben sind gedämpft und vornehm.
Die Bevölkerung des Landes scheint vor uns geflohen zu sein. Aber gerade heute zeigen sich doch menschliche Spuren. Der Weg zieht an zwölf Manimauern vorbei, deren Steine ihr ewiges „Oom mani padme hum“ rufen. Um einen offenen Tümpel herum sind vier solcher Opfermale errichtet. Auch das Tierleben kündet glücklichere Gegenden an. In dem Gerölle eines Abhangs rief ein Rebhühnervolk, und fünf von den Tieren wurden eine willkommene Verstärkung unseres Proviants. Sie wurden sofort gerupft, und ihre Daunen und Federn wirbelten davon wie vom Wind fortgetragener Rauch. Die Eingeweide wurden während des Marsches herausgenommen, und die zusammengebundenen Vögel auf dem Rücken des weißen Maulesels befestigt, wo schon der Kopf eines an der Indusquelle geschossenen Wildschafes thronte, der bei jedem Schritt des Maulesels nickte. Auch Wildesel traten jetzt häufiger auf als bisher.
Wieder wird die Aussicht nach vorn durch einen kleinen Landrücken versperrt, an dessen Fuß das Gras um eine Quelle herum üppiger steht, als wir es bisher gesehen haben. Eine lange, gut erhaltene Manimauer zieht sich den Abhang hinauf; nicht weit davon zeigen sich wohl ein Dutzend Steinmale, die in einer Reihe stehen. Hier muss es Menschen geben! In gespannter Erwartung eilen wir zum Kamme hinauf, auf dessen anderer Seite wir schwarze Zelte zu erblicken hoffen. Aber nicht einmal das Fernglas konnte einen einzigen Tibeter entdecken. Nur Wildesel irrten auf der Ebene umher, an einem Abhang liefen zwei Hasen, und einige blauschwarze Raben kreisten gemächlich über unseren Häuptern. Im Übrigen breitete sich, soweit der Blick reichte, die Wüste des Hochlandes schweigend und öde vor uns aus, und im Hintergrund erglänzte der kleine See.
Enttäuscht ziehen wir wieder abwärts. Wir nähern uns dem Seebecken, die Luft wird milder; wenn nicht ein so gräulicher Wind wehte, könnten wir uns hier noch eines letzten Abschiedsgrußes des entschwundenen Sommers erfreuen.
Nach einer Weile wird die Wüstenei durch 500 Schafe belebt, die in derselben Richtung wie wir weit vor uns trippeln. Aha, das sind unsere Freunde von Singi-buk, Pema Tenses Kameraden, und ihre Karawane. Sie sind eine andere Straße gezogen als wir, und nun folgen wir ihrer Spur. Gertse ist ihr Ziel. Die Schafe tragen kleine Gerstenlasten, welche die Hirten gegen das billige Salzgeld eingetauscht haben, das sie dem Boden entnommen hatten.
Jetzt sind wir an der Ufersteppe des Sees angelangt, wo Heuschrecken knarrend die Luft durchschneiden und Eidechsen lautlos über den Sand huschen. An einem Abhang am anderen Ufer erblicken wir 15 Manimauern. Erstaunt darüber, sie so weit von der Straße aufgestapelt zu sehen, frage ich Pema Tense, was sie bedeuteten, und er behauptet, es seien Grabmäler toter Tibeter.
Hinter einem kleinen freistehenden Kalksteinhügel zeigte sich jetzt ein zweiter See. Dorthin lenkten wir unsere Schritte. Das Wasser ließ sich trinken, wenn man es nicht zu genau nahm. Aber wir brauchten unsere Magen nicht auf die Probe zu stellen, denn Ische, einer unserer Ladakhis, hatte am Ostufer eine Süßwasserquelle entdeckt. Dort möblierten wir uns die Wüstenei so, dass sie uns über Nacht als Heim dienen konnte (Lager 240). Die Einrichtung hatten zum guten Teil schon die Nomaden besorgt, die hin und wieder ihre Zelte am Seeufer aufschlagen und ihre Yaks und Schafe auf der guten Weide ernähren. Hier erhebt sich eine steile Wand aus phyllitartigem Schiefer, der sich leicht in Tafeln spalten lässt. Mehrere kleine Manimauern sind daraus hergestellt worden. Zuoberst auf der einen thronte ein Yakschädel mit gewaltigen Hörnern; in seine weiße Stirn waren die heiligen sechs Silben eingeschnitten und mit Ocker ausgefüllt, so dass sie rot wie Blut leuchteten. Ein alter Pelz und eine Unterjacke waren zwischen den Steinen liegen geblieben.
Draußen auf dem See schnatterte eine Entenschar, und in der Dämmerung ließen sich 20 Wildgänse auf das seichte Wasser hinab. Da krachte ein Schuss, und mit ihrem Frieden war es vorbei. Drei der weitgereisten Gäste landeten in unserer Küche. Als sich das nächtliche Dunkel auf die Erde herabsenkte, hörte ich wieder eine eifrige Unterhaltung zwischen wohl 60 Wildgänsen, die teils im Wasser plätscherten, teils sausend ihre Flügel über dem Wasser schlugen. Sie kamen aus Südwesten und brachen am nächsten Morgen früher auf als wir. Bald wird die Kälte eine Eishaut über den Bodenschlamm ziehen und die Wildgänse zur Rückkehr in tieferliegende, wärmere Gegenden zwingen.
Als die Sonne untergegangen war, stiegen im Osten grellviolette Schatten auf, der Zenit erstrahlte noch eine Weile in der Farbe der Türkisen, und über dem westlichen Horizont loderten schwefelgelbe Flammen. Sie verblassten und erloschen bald, und die Lagerfeuer brannten nun umso heller. Draußen in dem See, dessen Boden sich vom Ufer aus sehr langsam senkte, hörte man platschende Schritte. Tundup Sonam war es, der mit seiner Beute zurückkehrte. Am Fuße des Schieferfelsens standen die Hunde und bellten ihr eigenes Echo an. Kurz und gellend durchdrang ihr Lärm die sonst so stille Nacht.
Zweites Kapitel. Neue Bekanntschaften.
Die Nachtkälte sank auf nur 6,2 Grad unter Null, und eine dünne Eishaut hatte ihre glasklare Scheibe über den alten See gespannt. Wir waren nicht die einzigen Gäste, die an seinem Ufer rasteten. Eine Karawane aus Gyanima war in aller Frühe in drei Abteilungen herangezogen, und ein Mitglied der Gesellschaft näherte sich vorsichtig unserm Lager, um auszukundschaften, was für Leute wir seien. Rabsang ließ sich mit dem Manne in ein Gespräch ein und fragte ihn, ob er irgendetwas Essbares zu verkaufen habe. Ja wohl, ein wenig Butter und Reis könne er entbehren. Er werde sofort hingehen, um etwas zu holen. Kaum hatte er jedoch Zeit gehabt, einige Worte mit den Seinen zu wechseln, so beluden sie schleunigst ihre Yaks und Schafe und verschwanden in dem nordwärts nach Gertse führenden Tale. Hielten sie uns für Wegelagerer?
Wir schlagen die Zelte ab und beladen unsere Tiere, ich schwinge mich in den Sattel, und weiter geht die Reise durch dieses hoffnungslos öde Land. Auf der Uferebene laufen die Wildesel herdenweise umher. Sie sind scheu. Am Tso-mavang kann man sich ihnen nach Belieben nähern. Keiner schickt in Sehweite des Götterberges dem Kiang eine Kugel nach, und die Tiere wissen, dass der heilige See und seine Ufer eine Freistatt sind. Hier aber, wo es keine Heiligtümer gibt, ist es den Wildeseln ganz genau bekannt, dass der Wolf nicht ihr einziger Feind ist.
Dem bloßen Auge unmerklich hebt sich die Ebene in der Richtung nach der Talmündung Gjekung-scherma. Wo sind die Nomaden in diesem von Gott vergessenen Lande? Eine Berglehne im Süden ist schwarz getüpfelt. Sollten es grasende Yaks sein? Nein, das Fernglas klärt uns darüber auf, dass es nur Feuerungshaufen und kleine Steinmale sind. Bis ins Unendliche unbewohnt kann die Gegend wohl nicht sein, wir haben ja schon so viele Spuren alter Lager erblickt.
Heute geht kein Wind. In dem Tale, dessen Kalksteinfelsen die Sonne erhitzt hat, ist es ordentlich heiß. Das Tal ist kurz und wird im Hintergrund von einem flachen Passe begrenzt. Endlich! Dort kommt eine Schar schwarzer Yaks den Abhang heruntergetrippelt! Sind es umziehende Stammgäste aus Jumba-matsen oder ist es wieder eine Karawane aus Gertse, die unsern Kurs wie ein Schiff auf dem Meer kreuzt, ohne uns auch nur einen Gruß über die Wellen zu senden? Jedenfalls wollten wir diese Freibeuter nicht entwischen lassen. Um jeden Preis mussten sie uns Lebensmittel und Transportmittel verschaffen, und wenn sie sich weigerten, dann wollten wir ihnen in asiatischer Weise den Text so lesen, als seien wir aus Tamerlans Tagen auf diese Welt zurückgekehrt.
Meine Leute sehnten sich nach Menschen, welcher Art sie auch seien. Nur Pema Tense war in Verzweiflung.
„Es ist gewiss der Häuptling von Jumba, der umzieht,“ sagte er, „erwischt er mich, so prügelt er mich erst windelweich und dann nimmt er mir die 96 Rupien, die ich von euch erhalten habe.“
„Dann wird es wohl das beste sein, du packst deine Sachen und verschwindest, Pema.“
„Ja, aber lässt mich noch eine Weile hier bleiben, während Rabsang talaufwärts geht und Ausschau hält.“
Rabsang ging und kehrte nach einer Stunde zurück. Es waren ganz richtig Nomaden aus Jumba-matsen, die im Begriff waren, umzuziehen. Drei Zelte waren bereits aufgeschlagen. Die Yaks sollten eine Weile grasen, dann würden sie wieder über den Pass zurückgetrieben werden, um weiteren Vorrat von der beweglichen Habe ihrer Herren zu holen. Ein ganzer Haufe der verschiedensten Säcke und Bündel, die Fleisch, Gerste und Tsamba enthielten, lag schon auf dem neuen Lagerplatze aufgestapelt.
Nun war die Sache klar. Die noch übrige Gerste wurde einem unserer Pferde aufgeladen, wir sagten Pema Tense Lebewohl, wünschten ihm auf seinem langen Wege nach Gertse alles Gute und zogen talaufwärts weiter. Wir sahen den Verlassenen sich in den Schutt setzen, wo er gelassen seine Pfeife anzündete. Dort saß er eine Weile und schaute uns nach. Schließlich aber trieb er seine Schafe zusammen und wanderte nach dem See hinab. Er würde seine Kameraden bald einholen und in ihrer Gesellschaft nach Hause ziehen.
Wir aber gingen neuen Bekanntschaften entgegen. Zwei Tibeter kamen uns mit verlegenem Gruße entgegen, als wir uns ihren Zelten näherten. Sogleich wurde ihnen alle ihre Kenntnisse in der Geographie der Gegend abgefragt; sie teilten mit, dass Jumba-matsen der Name eines Gebietes sei, das im Ostnordosten des Passes liege. Dort ständen 45 Zelte unter dem Befehl des „Gova“, des Häuptlings. Ihre Herden weideten im Sommer in einer weiter nordostwärts gelegenen Gegend. Ende Oktober zögen sie zum Mugusee hinunter und blieben dort während der kältesten Wintermonate. Sobald der Lenz dem Winter die Spitze abgebrochen habe, kehrten sie langsam nach Jumba-matsen zurück.
Auf diese Weise beschreiben die Nomaden mit dem Wechsel der Jahreszeiten einen Kreis von einer Gegend zur anderen. Im Sommer findet man sie in dem einen Tale, im Herbst in einem anderen. Wenn der Winterfrost in der Eisdecke des Mugusees klingt, dann wissen die Wildesel, dass ihre Zeit zum Abziehen gekommen ist. So ist es seit dem grauesten Altertum vom Vater auf den Sohn gewesen. Die Erfahrungen, welche die Nomaden unserer Zeit besitzen, sind das Erbe unzähliger dahingegangener Generationen. Sie haben gefunden, dass die Weideplätze in Jumba-matsen sich am besten zur Sommerweide eignen und dass die Wiesen um den See herum für den Winterbedarf ausreichen. Wenn die Winterweide zu Ende ist, kehren sie schrittweise nach ihren Sommerwohnplätzen zurück. Ein Volk, dessen ganzes Dasein auf Schafzucht beruht, entwickelt gerade die Seiten seines Beobachtungsvermögens, die der Aufzucht der Herden zugutekommen. Sie kennen jede Quelle, jede Höhle in ihrer Heimat, sie wissen, wo giftige Pflanzen die Weide gefährlich machen. Rechtzeitig trennen sie die Lämmer von den Mutterschafen und sorgfältig gewöhnen sie die Schafe an das Tragen kleiner Lasten. Vor den Wölfen der Wildnis ist der Nomade immer auf seiner Hut, und in allen Wechselfällen des Lebens geht er mit seinem Erbteil sorgsam um.
Der Häuptling von Jumba-matsen besitzt 500 Schafe, seine ganze Zeltgenossenschaft 8000. 200 Yaks und 15 Pferde gehören auch zu seinen Untertanen. Mitte August werden die Schafe geschoren und die Wolle an Händler verkauft, die aus Ladakh und von der indischen Grenze herkommen. Ein großes Schaf bringt eine halbe Rupie ein. Am Tso-mavang ist die Wolle teurer, aber dort fällt für den Abnehmer auch ein großer Teil der Beförderungskosten weg.
Unsere tibetischen Nachbarn waren im Dienst des Jumbahäuptlings angestellt und konnten uns ohne die Erlaubnis ihres Herrn nicht helfen. Ich schickte daher einen von ihnen über den Pass zurück, um den Jumba-matsen-tschigep, wie der Titel des Häuptlings lautete, zu bitten, dass er in eigener Person zu mir komme. Doch jetzt war es Abend, und früher als am folgenden Morgen konnten wir ihn nicht erwarten.
Der Abend im Lager 241 war kalt und windstill. Schon um 9 Uhr hatten wir 2 Grad unter Null und während der Nacht 13 Grad. Der blaugraue Rauch des Feuers ringelte sich wie ein Elfenreigen talwärts, durch den schwachen Lufthauch vom Passe her getrieben. Dunkelblau und klar spannte sich der Himmelsbogen über die Erde, die Sterne leuchteten wie funkelnde Edelsteine, der Bergeskranz bildete einen geschweiften, rabenschwarzen Rahmen um das Lager, und über einem Grat stieg der Mond gleich einem Silberschild auf.
Ich liege noch eine Weile wach und lausche diesem geheimnisvollen Schweigen. Das Mondlicht fällt gedämpft durch das Zelttuch, und hier und dort glänzt ein Strahlenbündel durch ein Loch in der Decke. Bald schlafen wir alle fest in diesem seltsamen, geheimnisvollen Tibet.
Als ich am Morgen ins Freie trat, saßen zwei wohlhabende Nomaden plaudernd bei meinen Leuten. Sie trugen schwarze, bauschige Pelze, weiche Filzstiefel mit roten Bandösen und um das lange, zottige Haar turbanartige rote Binden.
Sie erhoben sich, kratzten sich den Kopf und steckten nach Landessitte die Zunge heraus. Dass sie ein bisschen verlegen waren, war kein Wunder, sie hatten noch niemals einen Europäer gesehen. Aber kaum hatte die Unterhandlung begonnen, so verschwand auch ihre Schüchternheit.
„Welcher von euch ist der Jumba-matsen-tschigep?“ fragte ich.
„Keiner! Der Häuptling hat nicht selber kommen können, aber er hat uns geschickt und lässt grüßen. Woher kommt Ihr, Herr, und wohin reist Ihr?“
„Ich komme vom Kang-rinpotsche und bin jetzt auf dem Wege nach Gartok.“
„Weshalb aber zieht Ihr dann nordostwärts, Gartok liegt ja im Südwesten.“
„Ich bin hierhergekommen, um Proviant zu kaufen und Lasttiere zu mieten. Morgen müssen fünf Pferde und ebenso viele Yaks marschbereit vor meinem Zelte stehen.“
„Darauf kann Euch nur der Häuptling Bescheid geben. Wenn der Serpun, der Goldkontrolleur, durch unsere Gegend reist, dann ist er berechtigt, die Lasttiere der Nomaden ohne Entschädigung zu benutzen. Ihr aber habt keinen ‚Lamik‘ (Pass). Nicht einmal ein ‚Dschaik‘ (Botschaftstock) hat uns von Eurer Ankunft unterrichtet. Daher wird der Häuptling Euer Verlangen nicht gewähren können.“
„Schön, dann schicke ich zwei meiner Leute nach Gartok und bleibe während der Zeit hier. Treibt ihr aber die Lasttiere, deren ich bedarf, selber auf, dann gebe ich täglich zwei Rupien für jedes Pferd und eine Rupie für jeden Yak und dazu den Führern, die ich brauche, eine anständige Vergütung. Geht ihr darauf ein?“
„Morgen sollen die Pferde und die Yaks marschbereit vor Eurem Zelte stehen“, antworteten sie, nachdem ich ihnen das Geld für den ersten Tag ausgezahlt hatte. Nun wurden sie gefügig und gemütlich und machten sich aus allen Verboten, die aus Lhasa ergangen waren, auch nicht das geringste. Auf die Verschwiegenheit ihrer Stammesgenossen konnten sie bauen, und die Wildgänse plaudern nichts aus.
„Erzählt mir, was ihr von dem Lande im Osten wisst“, bat ich sie. Und sie erzählten allerlei; aber ihr Horizont war eng. Sie kannten den Lakkor-tso, den ich 1901 besucht hatte, hatten vom Dangra-jum-tso gehört, den ich kürzlich aus der Ferne gesehen hatte, und waren oft nach Selipuk und dem Nganglaring-tso, wohin ich nach einem Jahre kommen sollte, geritten, bald auf einer nördlichen Straße über ein Goldfeld, bald auf einer südlichen, welche die Quelle des Aong-tsangpo streifte, eines Flusses, der sich in den Nganglaring-tso ergießt. Beide Wege nehmen vier Tage in Anspruch; um den See herum haben Nomaden des Rundorstammes ihre Zelte.
Nach einer kalten Nacht brach der 17. September an. Schwer und langsam schritten vierzig vollbeladene Yaks talabwärts. Es war eine neue, aus vier Zeltgemeinschaften bestehende Genossenschaft, die aus Jumba-matsen nach der Mündung eines weiter abwärts liegenden Nebentales übersiedelte. Jede Zeltgenossenschaft hat ihren eigenen Lagerplatz, und da, wo man sich unverbrüchlich dem alten Herkommen fügt, kommt es nicht zu Weidestreitigkeiten.
Die bestellten Lasttiere wurden rechtzeitig herangeführt. Die Pferde waren klein und zottig, aber dafür, dass sie in einer solchen Wüstenei aufgewachsen waren, merkwürdig feist und wohlgenährt. Wenn die Jagd ergiebig gewesen ist, füttert man sie mit gedörrtem Fleisch, was vielleicht dazu beiträgt, sie so gesund und glänzend aussehen zu machen. Nur zu längeren Ritten beschlagen die Tibeter ihre Pferde und dann auch gewöhnlich nur die Vorderhufe.
Jetzt sollten meine eigenen Lasttiere unbeladen gehen, denn die Yaks übernahmen alle Lasten. Meine Leute, die sich auf einem Wege von 180 Kilometer die Sohlen durchgelaufen hatten, sollten reiten. Unsere neuen Führer gingen zu Fuß, wie gewöhnlich rufend und pfeifend; ihr rechter Arm und die nackte rechte Schulter glänzten in der Sonne wie polierte Bronze.
So sagten wir denn den freundlichen Nomaden des Gijekungtals Lebewohl und zogen auf dem Wege, den wir gekommen waren, wieder talabwärts. Bei den Seen aber schwenkten wir nach Westen ab und ließen unsere alte Straße links hinter uns zurück. In der Verlängerung der kleinen Seen dehnt sich die Mugu-täläp, eine Salzsteppe, aus. Hier machten die Tibeter an einem Süßwassertümpel halt und rieten uns, während der Nacht hier zu lagern, weil die nächste Quelle weit entfernt liege. Einige Kiangs, Pantholopsantilopen und Wildgänse hatten bei unserm Herannahen das Feld geräumt. Um die Mittagszeit erhob sich ein Sturm aus Westen, und das feine, weiße Salzpulver der Ebene von Mugu-täläp wirbelte wie Dampfwolken über die Seen hin.
Das Lager 242 war größer und lebhafter als gewöhnlich. Wir waren acht Männer mit fünfzehn Lasttieren und drei Hunden. Die Tibeter taten ihr Bestes; sie sammelten Yakdung zu den Feuern, trugen Wasser, führten die Tiere auf gute Weide und unterhielten uns nachher mit allerlei Geschichten. Dennoch wurde mir der Tag lang. Es stellt die Geduld auf die Probe, gleichsam vor Anker zu liegen, während man Meilen zurücklegen und beständig vorwärtseilen möchte — neuen Schicksalen entgegen.
Am Abend kamen fünfzehn Wildgänse, die schreiend über dem Tümpel kreisten. Da sie aber den Platz schon besetzt fanden, zogen die Leitgänse mit ihrer Schar nach den Seen hin. Die Sonne war gerade unter dem Horizont versunken, und die ganze Ebene lag im Schatten. Aber die Pilger der Luft mit ihren Schwingen wurden noch von unten herauf durch die Sonne beleuchtet und hoben sich blendend weiß gegen das blaue Himmelsfeld ab. Wären sie eine Minute später gekommen, so wären sie im Erdschatten verschwunden.
Vor dem Hereinbrechen der Dämmerung zeigten sich auf einer entfernten Anhöhe einige Reiter. Unsere Tibeter meinten, sie seien ausgezogen, um nach einer Schafherde auszuspähen, die vor einigen Tagen mitten am hellen Tage verschwunden war, als der Hirte gerade geschlafen hatte. Wahrscheinlich hatten einige die Gelegenheit wahrnehmende Banditen sich der Schafe bemächtigt. Um die Glut des Lagerfeuers herum erschallten die alten Ladakhilieder, weich und melodisch wie in alten Zeiten. Ich hatte sie an den langen Winterabenden auf Tschang-tang unzählige Male gehört, wurde aber nie ihrer sehnsuchtsvollen Klänge überdrüssig.
Achtzehn Grad Kälte in der Nacht auf den 18. September! Das ist schlimm, so früh im Herbst! Hat man sich nicht in Verteidigungszustand gesetzt, wenn man ins Bett gekrochen ist, so wird man bald durch die schleichende Bodenkälte daran erinnert, dass es nötig ist, sich mit den Pelzen zuzudecken. Der Tümpel war mit spiegelblankem Eise überzogen. Die Luft war klar und windstill, und die Sonne ging strahlend auf. Schon um 7 Uhr hatten wir 3,4 Grad über Null und um 1 Uhr 18,2 Grad Wärme. Also ein Temperaturunterschied von 36 Grad zwischen Nacht und Tag!
Unser Weg führt nach Nordwesten an zwei langgestreckten Salzseen namens Tso-longtschu vorüber, wo es von Wildgänsen wimmelt. Die Sonne brennt, es geht kein Wind. Nur gelegentlich hört man in der Nähe einen sausenden Ton; man dreht sich im Sattel um und sieht eine Staubtrombe herankommen; den Staub aufsaugend, dreht sie sich in Schraubenwindungen und saust wie ein helles Gespenst über die Ebene hin. In Wirbeln eilt sie an uns vorüber, sie wird dünner und verschwindet in der Ferne; bald folgt ihr eine neue.
Sigu-ragling-la ist eine kleine flache Passschwelle, die unser Weg quert und deren quarzitischer Kalksteinrücken über die Hochebene ragt. Dieses Land ist eine Wüste, die an gewisse Gegenden Ostpersiens erinnert. In bedeutender Entfernung erblickt man kleine hügelige Bergrücken, die in rosigen, hellbraunen oder rötlichen Farbentönen schillern; zwischen ihnen dehnt sich die Ebene aus, die so schwach gewellt ist, dass man ihre Unebenheiten gar nicht bemerken würde, wenn nicht die weit vorausgehende Karawane dann und wann in einer Vertiefung verschwände, um nach einer Weile wieder auf einer Bodenerhebung aufzutauchen. Der Weg ist vorzüglich, spärlicher, feiner Grus auf festem, gelbem Lehmboden, aber nirgends entdeckt man einen Grashalm. Diese Straße führt uns nordwestwärts, also nicht in der Richtung nach Gartok. Ich frage einen unserer Führer nach dem Grunde. Er antwortet, dass wir durch die Seltenheit der Quellen zu einem Umweg gezwungen seien.
Im Norden zeigen sich zwei kleine Seen, der Tso-kar-tso oder der weiße See und der Pul-tso oder Salzsee. Die Ringmauern an ihren Ufern zeugen von winterlichen Besuchen.
Die Stunden vergehen, aber die Landschaft bleibt immer gleich einförmig. Wir passieren einen schwarzen Schieferhügel, an dessen Fuße eine Quelle entspringt, dann geht es auf der in leichten, rosigen Wüstentönen zitternden Ebene weiter. Ein Land wie dieses ist selten in Westtibet, wo die Bergketten gewöhnlich in unzählige Falten zusammengepresst daliegen.
Ungefähr 150 Wildesel tummeln sich in einiger Entfernung auf der Südseite unserer Route. Dort muss es Weide geben. Bald lagern sie in Herden, bald grasen sie paarweise oder einzeln. Aber immer sind sie entzückend anzusehen, wie sie gleich Schiffen auf dem Meer der Wüste treiben. Wenn die Tromben über die Herde hinziehen, sieht es aus wie der Rauch brennender Schiffe.
Endlich zeigen sich Zelte. Sie sind in 4614 Meter Höhe zwischen den Süßwassertümpeln von Luma-ringmo aufgeschlagen. Es ist, als ob man auf einer Wasserstraße inmitten eines Archipels ankere. Wie Holme tauchen auf allen Seiten flache Bergrücken auf. Dank der Luftspiegelung scheinen sie ein wenig über der Erdoberfläche zu schweben.
Drittes Kapitel. Noch einmal über den Indus.
Gerade nach Westen führt aus Lager 243 am 19. September unser Tagemarsch.
„Was ist das für eine sonderbare Stelle?“ frage ich den stets neben mir gehenden Führer, als wir in der Nähe eines verlassenen Zeltplatzes an zwölf meterhohen, aufrechtgestellten Steinen vorüberritten. Man brauchte kein Archäologe zu sein, um zu erkennen, dass sie von Menschenhand errichtet worden waren.
Der Tibeter wendete den Kopf und antwortete mir: „Es gibt in unserer Gegend niemand, der wüsste, was sie bedeuten.“
Vermutlich stehen sie dort schon seit Menschengedenken und sind Denksteine aus der Zeit vor der Einführung des Buddhismus in Tibet. Dort hatte wohl irgendein mächtiger Häuptling sein Zelt gehabt, oder es waren zwischen jenen Steinen den gefürchteten Geistermächten, die in Bergen und Seen wohnten, Menschenopfer dargebracht worden.
Eine Unterbrechung der Einförmigkeit tritt ein, als wir an zwei vorspringenden schwarzen Felsen aus Porphyrit und vulkanischem Tuff vorüberreiten. Ich hielt in der Linken eine zusammenlegbare Pappe zum Schutze der losen Blätter, auf denen der Weg des Tages mit dem angrenzenden Gelände eingezeichnet wurde. Mit der Rechten notierte ich auf der Karte die zuletzt genommene Peilung. Das Pferd war demnach sich selbst überlassen. Ein heftiger Windstoß fuhr über die Ebene hin, und die Kartenblätter begannen zu flattern und zu klatschen. Der kleine zottig-schwarze Wilde aus dem Gjekungtal, den ich ritt, verlor vor Schreck die Besinnung, ging durch und schoss wie ein Pfeil über den Kiesboden. Ich wollte gerade die Kartenpappe zwischen zwei Knöpfen meiner Lederweste in Sicherheit bringen, als ein Einriss im Boden das Pferd zwang, eine scharfe Seitenbewegung zu machen. Dabei drehte sich der Sattel, und ich schoss kopfüber auf die Erde, wobei ich innerhalb des Bruchteils einer Sekunde ein brillantes Feuerwerk sah! Der indische Korkhelm wurde bedenklich platt gedrückt, aber er rettete meinen Schädel. Ich blutete an der linken Schläfe, und meine Korbbrille wurde erdrückt. Als ich nach der ersten Überraschung ein wenig zur Besinnung gekommen war, stand ich vorsichtig auf, streckte die Beine und bewegte die Arme, um mich zu überzeugen, ob ich noch ganz sei. Folgerichtig hätte ich mich eigentlich totfallen oder mir wenigstens ein Bein brechen müssen, um dann, provisorisch eingeschient, in einer Wüste ohne Wasser einen langen Monat zu verbringen!
Atemlos und zitternd, mit Schaumflocken am Zügel und schweißtriefenden Weichen kehrte das Pferd schließlich zu seinen Kameraden zurück. Der Sattel hing ihm lose unter dem Bauch, und die hin und her schlenkernde Geologentasche hatte wohl nicht zur Beruhigung des Tieres beigetragen. Allerdings hatte es getan, was es vermochte, um mich los zu werden, aber wir ritten doch zusammen weiter, als ob nichts geschehen sei. Ein bisschen Kopfweh, ein geschwollenes Augenlid und ein blauvioletter Ring um das linke Auge waren die einzigen Folgen des Purzelbaums.
Ohne Grenzen dehnt sich vor mir die Ebene aus, bestreut mit Steinen aus Lava, Tuff und Porphyrit, die der Wind poliert hat. Von einer löffelförmigen Anschwellung aus lasse ich den Blick rückwärts schweifen über das hoffnungslos öde Land, das wir durchquert haben. Dort zeigen sich die kleinen Seen, schmal und glänzend wie Säbelklingen, inmitten der ausgedehnten Ebenen und ganz im Osten von den Bergen Jumba-matsens in matten, rosigen Farbentönen begrenzt. Sarijol hieß die Quelle, an der wir endlich in später Stunde das Lager 244 aufschlugen.
Am folgenden Morgen lag ein dichter Nebelschleier wie ein Flor über dem Lande; er dämpfte alle Farben und machte alle Konturen verschwommen und unklar. Wir reiten über Geröllabhänge und nähern uns wieder der Wasserscheide des Indus, die wir bald auf dem 5178 Meter hohen Passe Bokar-la überschreiten. Hier verlassen wir demnach das abflusslose Land, in welchem wir einige Tage geweilt haben, und betreten einen Boden, der nach dem Meere hin entwässert wird. Auf dem Passe umfasst der Blick gewaltige Räume. Noch immer schaut man vergeblich nach Zelten und Herden aus. Außer Steinen, die bald als anstehendes Gestein, bald als Geröllabhänge, bald als Verwitterungshaufen und bald als Talfüllungen auftreten, ist hier nichts zu sehen. Kein Grün schmückt die Hänge, keine Flüsse blitzen in der Sonne. Hier ist es leer, tot und dürr, und man versteht, weshalb der Quellarm des Indus, der seinen Saft aus dieser Gegend saugt, so wasserarm ist.
Vom Bokar-la ziehen wir zuerst steil, dann auf unmerklich abwärtsführendem Pfade nach einem Tale hinunter, wo sich das Wasser einiger Quellen zu einem gewundenen Bächlein vereinigt. Das Tal verschmälert sich allmählich zwischen seinen aus Quarzporphyr bestehenden Felswänden, und auf seinen Seiten erheben sich mehr oder weniger ununterbrochene Erosionsterrassen, die manchmal sechs Meter hoch sind und von ergiebigeren Niederschlägen in vergangenen geologischen Perioden zeugen. In der Nähe des Punktes, wo dieses Nebental in das Industal einmündet, lagerten wir auf einer Wiese an einer Quelle (Lager 245), und es fehlte uns auch dort nicht an dem gewöhnlichen Brennmaterial, das die Herden der Nomaden zu liefern pflegen.
Wir hatten auch Nachbarn. Einer unserer Wegweiser führte Ische zu einem versteckt liegenden Zeltlager, und er kehrte bald mit zwei Eingeborenen und einem herrlichen Vorrate süßer und saurer Milch zurück.
Hier waren wir wieder in bekannten Gegenden. Im Jahre 1867 hatten zwei der Punditen des Oberst Montgomerie diese Gegend erforscht, und 1906 hatte Herr Calvert im Auftrage der indischen Regierung das Land auf seiner Reise von Gartok nach Tok-dschalung durchquert. Das Gebiet um den obersten Indus herum heißt Singtod, weiter abwärts liegt ein anderes, Singmet, d. h. oberer Indusdistrikt und unterer Indusdistrikt, denn Singi-tsangpo ist der tibetische Name des Indus, und Singikabab ist die Quelle des Löwenflusses. Eine Tagereise flussaufwärts gibt es einen kleinen Tempel, den nur im Winter ein einsamer Lama bewohnt. Er muss ein Philosoph sein, der arme Mann! Wie verlassen und trostlos ist sein Leben, wenn der Frost in den Felsen knackt und der Schneesturm um die Ecken seiner Wohnung heult! Aber einmal wird es ja doch Frühling, und dann darf er wieder hinaus. Es ist ein Trost, zu wissen, dass er dort nicht in der Dunkelheit eingemauert ist wie die Mönche in den Grotten von Linga.
Während der Nacht flüchteten unsere durch Wölfe gehetzten Karawanentiere talaufwärts. Es wurde Alarm geschlagen, die Männer folgten der Spur und kamen noch zu rechter Zeit, um Pferde und Maulesel zu retten. Zwei Stunden später wurden sie wieder beladen, und der Zug schritt nach dem zwischen ziemlich hohen Bergen eingeschlossenen Industale hinab. Die Felsen der linken Talseite sind steil, und an ihrem Fuße zieht sich der von unserm Wege aus noch unsichtbare Fluss entlang. Hier und dort überschreiten wir eine Quellader, die zum Indus hinabrieselt. Ein Zelt zeigt sich am Fluss, ein wenig weiter entfernt stehen sieben dicht nebeneinander und dann wieder drei. Hier gibt es wenigstens Menschen!
Am Abhang weidet eine Yakherde. Was haben die Tiere da zu fressen? Ich kann dort nicht einmal einen grünen Schimmer sehen. Zwischen den Steinen verbirgt sich das samtweiche Yakgras, sowie auch Moose und Flechten, die sie mit ihrer Zunge, die kräftig ist wie ein Reibeisen, auflecken.
Der Platz, wo wir unsere Lasten wieder abluden und im Lager 246 unsere Zelte errichteten, hieß Hlagar. Gerade hier macht der Indus einen scharfen Bogen und biegt zwischen wilden, malerischen Porphyrfelsen nach Norden ab. Meine luftige Behausung wurde unmittelbar an der Wasserlinie des rechten Ufers aufgeschlagen, und ich konnte mich im Zelt an dem Anblicke des stolzen Flusses freuen, dessen kristallklare Flut sich lautlos zwischen den Vergen fortringelte.
Einen Steinwurf weit von uns standen zwei Zelte, deren Bewohner gar nicht wussten, was sie uns alles Gutes erweisen sollten. Ich lebte auch wie ein Prinz in dieser wilden, naturschönen Gegend, die mir umso entzückender erschien, weil ich in der letzten Zeit nichts anderes als Wüsten gesehen hatte. Ein feistes Schaf wurde sofort erstanden und geschlachtet, und alle Tibeter der Nachbarschaft lud ich zu einem großartigen Schmause ein. Die Hunde, bei denen lange genug Schmalhans Küchenmeister gewesen war, wurden nicht vergessen. Tundup Sonam lieferte ein ganzes Bündel Rebhühner in die Küche, und ich zog sie dem ewigen Schaffleisch vor. Saure Milch war büttenweise vorhanden, und Brot wurde in der Asche von Yakdung gebacken — konnte man es in einem Land wie diesem wohl besser haben?
Der Tag war herrlich, die Luft in dem tiefen Tale warm und still, 13,1 Grad um 1 Uhr, und 12,1 Grad im Fluss. Nur gelegentlich kam ein Windstoß von dem nächsten Grate heruntergesaust.
Mit ausgestreckter Zunge und höflicher Verbeugung erschienen vor meinem Zelte drei Häuptlinge, die den Titel „Gova“ führten. „Es freut mich, euch zu sehen; nehmt Platz“, begrüßte ich sie.
„Wir sind gekommen, um Ihnen nach besten Kräften zu dienen, Herr; Sie haben nur zu befehlen, und wir gehorchen.“
„Gut. Die Männer, die uns mit Pferden und Yaks aus Jumba-matsen hierher geleitet haben, kehren morgen wieder zu ihren Zelten zurück. Ich bedarf daher neuer Pferde und Yaks und auch neuer Führer, die die Gegend auf dem Wege nach dem Dschukti-la genau kennen.“
„Herr, es tut uns leid, Ihnen dies sagen zu müssen; aber gestern ist der Serpun von den Goldgruben in Tok-dschalung hier durchgekommen, und er hatte es sehr eilig, nach Gartok zu gelangen. Wir mussten ihm daher alle vorhandenen Pferde geben. Wollen Sie aber zum Reiten und zum Lasttragen mit Yaks vorliebnehmen, so sollen Sie so viele haben, wie Sie wünschen.“
Das Anerbieten, mir Yaks zu stellen, nahm ich mit Dank an, und in ein paar Minuten waren wir vertraut wie Jugendfreunde. Sie erzählten gern und hatten keine Geheimnisse. Ich fürchte indessen, dass ihre Erzählungen den Leser nicht so sehr anziehen werden, wie es mich interessierte, als die Tibeter von Hlagar von ihren Lebensgewohnheiten und ihren Wanderungen sprachen. Dann und wann ziehen sie nach dem Salzsee Tsak-tsaka, der fünf Tagereisen weit im Nordosten liegt. Dort brechen sie Salz, packen es in Säcke, beladen ihre Schafe damit und kehren nach Hlagar zurück, um sich dort erst auszuruhen und dann den neun Tagereisen weiten Weg nach Gyanima zurückzulegen.
Der Weg zwischen Tok-dschalung und Gartok ist eine Tasam, eine Poststraße für Reiter, wie die Nomaden mir sagten. Deshalb wohnen sie auch das ganze Jahr hindurch in Hlagar, um vornehmen Reisenden Pferde zu stellen. Eine andere Straße folgt dem Industal abwärts, an dem Zeltdorfe Pekija und der Mündung des Langtschuflusses vorbei bis an den Punkt des Zusammenflusses mit dem Gartong, dem südlichen Indusarme. Auf dem ganzen Wege hat der Indus nur schwaches Gefälle; keine Wasserfälle und keine Stromschnellen stören seinen ruhigen Lauf. —
Bei Hlagar, dessen absolute Höhe 4672 Meter beträgt, friert der Indus schon zu Anfang des Winters zu, aber das Wasser ständiger Quellen rinnt doch stets unter der Eisdecke. Um die Mittwinterzeit schneit es gelegentlich so, dass der Schnee eine Spanne hoch liegt. Die Kälte ist schneidend, aber weniger grimmig als in Tok-dschalung. Selten fallen so heftige Sommerregen, dass der Fluss über seine Ufer tritt und sich nicht durchwaten lässt. Bei meinem Besuche war der Singi-kamba, wie man den Indus hier nennt, in zwei Arme geteilt, die zusammen kaum sechs Kubikmeter Wasser in der Sekunde führten. Der größte Arm war höchstens 41 Zentimeter tief, und seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 66 Zentimeter in der Sekunde.
Am Morgen des 22. September grunzten sieben starke Yaks im Lager. Einige wurden beladen, die anderen sollten geritten werden, und ich selbst erhielt ein ausgeruhtes Pferd. Die Rupien klimperten in den schwarzen Tatzen der wettergebräunten Bergbewohner, die Nomaden von Gjekung zogen ihres Weges, um wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Ich sagte allen freundlich Lebewohl und mit zwei jungen Führern patschten wir durch den ruhmreichen Fluss, der hier, in der Nähe seiner Quelle, so bescheiden und dort, wo seine ungeheuren Wassermassen über die Ebene am Fuße des Himalajas hin rollen, so gigantisch ist.
Wirft man einen Blick nach Nordnordwesten, so sieht man das Industal verschwinden, verdeckt durch seine eigenen Bergkulissen. Unsere Straße nach Gartok führt bergauf durch das Nebental Terruk. Der Marsch wird anstrengend dadurch, dass der Boden dicht mit scharfkantigem Porphyritgrus bedeckt ist. Man ist daher froh, zu finden, dass das Tal nur kurz ist und dass der Weg unmerklich auf den Pass Terruki-la (4874 Meter) hinaufgeführt hat, in dessen Sattel der Granit ansteht. Auf der Passhöhe hatte der Wind freien Spielraum, und die Wimpel des Passmales klatschten wie Peitschen.
Hier ist das Land außerordentlich zerschnitten. Das nächste, zuerst in Porphyrit und höher droben in Granit eingesenkte Tal führt zu einem neuen Passe, dem Särtsoki-la. Und jenseits einer Talmulde haben wir noch einen dritten Pass, den Dotsa-la (5045 Meter). Unweit seiner Schwelle wurde an der Quelle Dotsa das Lager 247 aufgeschlagen.
Ein großartiges Panorama zieht im Südwesten und Westsüdwesten den Blick unwiderstehlich auf sich. Dunkel und finster, aber doch durch die Entfernung gedämpft, erhebt sich wie ein Theaterhintergrund unter der sinkenden Sonne eine mächtige Bergkette, deren flach pyramidenförmige Gipfel ewiger Schnee krönt. Es ist der Transhimalaja! Die Sonne sinkt. Die Schneefelder, die eben noch wie Metall glänzten, verschwinden in der scharfgezeichneten Kontur des Kammes.
Das Abendrot ist erloschen. Von Osten her schleicht eine neue Nacht heran. In prachtvoller Majestät gießt der Mond sein kaltes Silberlicht über das schweigende Land. Der Hintergrund des Transhimalaja ist nur noch als schwacher Nebeldunst sichtbar, aber die vom Mond bestrahlten Firnfelder scheinen wie weiße Wölkchen am Rande des Horizontes zu schweben.
Der Wind hat aufgehört. Es ist mir, als ob etwas Gewohntes fehle. Schwer liegt das Schweigen über den Bergen. Der Weltenraum, die unendliche Leere wacht draußen vor meinem Zelt. Noch unterhalten sich meine Leute mit halblauter Stimme. Die Yaks stehen an einem Taue angepflöckt und knirschen ab und zu mit den Zähnen gegen die hornigen Schwielen. Gelegentlich ertönt Hundegebell, und manchmal knistert es in der Dungglut, wenn das Feuer wieder aufflackert.
Doch bald erstirbt das Leben. Die Männer werden müde und legen sich schlafen. Die Yaks schlummern ein und träumen. Die Hunde rollen sich so zusammen, dass die Schnauze unter dem Schwanze versteckt ist, und das Feuer erlischt aus Mangel an Nahrung. Das Schweigen wird erdrückend und unheimlich. Eine solche Nacht hat etwas Erhabenes. Man schläft wie in einem Tempelsaale ein, um an der Schwelle der Ewigkeit zu erwachen.
Am 23. September lenkten wir die Schritte noch immer westsüdwestwärts durch eine zerrissene, verwitterte Landschaft, in der Quarzporphyrit, Porphyr und Basalt ein Gewirr kleiner Kämme, Landrücken und Schwellen bildeten. Hier und dort ist von abgetragenen Felshügeln nichts übriggeblieben als grobkörniger weißer Sand. Aber im Norden dehnt sich eine weite Ebene aus, die infolge des Gruses, der ihren Boden bedeckt, so dunkel ist wie die Wüste Kewir in Persien. Fern im Norden wird diese Ebene durch die Bergketten begrenzt, welche das Tal des Singi-kamba einrahmen.
Hlari-kunglung ist ein dunkler Kegel, Lumbo-sädschu ein mächtigerer Berg von rötlicher Färbung, beide im Süden. Sie erheben ihre Scheitel wie Wegweiser oder Leuchttürme hoch über dem unregelmäßigen Lande, und es dauert viele Stunden, ehe man an ihnen vorbeigelangt ist. Im Südwesten thront wieder der Transhimalaja wie eine ungeheure Mauer; verächtlich blickt er auf dieses verwitterte und ausgetrocknete Schlachtfeld herab, wo ehemalige Berge vergeblich gegen die Einwirkung der Atmosphäre gekämpft haben und wo nur noch vereinzelte Hügel aus härterem Gestein der alles ausebnenden Zerstörung standhalten.
Wir machen einen langen Tagemarsch, um diesen neuen Wüstengürtel so schnell als möglich hinter uns zu haben. Der Boden ist gerade fest genug und mit feinem Kiese und grobem Sande bedeckt; eine bessere Reitbahn kann man sich nicht wünschen. Nach Wasser schaut man vergeblich aus, Pflanzen- und Tierleben fehlt auch; nur hin und wieder huscht eine genügsame Eidechse über den Sand. Es sind 15 Grad Wärme. Am Himmel segelt nicht ein Wölkchen. Kein vom Winde aufgewirbelter Staub trübt die Aussicht. Soweit der Blick reicht, steht das Gebirge scharf und deutlich gezeichnet da.
Jetzt ist das Terrain in der Richtung des Weges soeben wie eine Wasserfläche. Vor der Karawane schreitet der eine Führer her, ein zerlumpter, gemütlicher Greis. Er hat uns eben mit der Nachricht erfreut, dass diese Wüstenebene nie ein Ende nehme, wenn man auch noch so eifrig drauflos marschiere. Nun gut, dann können wir ja gern eine Viertelstunde Rast halten und uns an der kalten Milch erfrischen, die in einer Kanne mitgenommen worden ist. Ich untersuche den Horizont mit dem Fernglas. Nichts Lebendes zeigt sich. Die Wildesel haben keine Fährten in diesem Boden hinterlassen, Antilopen zeigen sich nicht mehr.
Wir sind die einzigen lebenden Wesen in dieser Wüste; sogar die Raben scheuen sie.
Wir folgen keinem Wege. Dort, wo unser Zug vorwärtsschreitet, ist noch nie jemand gegangen. Der Alte an der Spitze sagt, es sei einerlei, wo man gehe, wenn man nur nicht die kegelförmigen und pyramidenförmigen Berge, die sich im Süden erheben, aus den Augen verliere. Die zerstreuten Spuren der Reisenden seien schnell durch die Stürme verweht. Der Name der Wüste sei Tschaldi-tschüldi.
In der Ferne erhebt sich ein dunkler Hügel, das Ziel des Tages. Er scheint unerreichbar zu sein; die Stunden vergehen, und er wird nur langsam größer. Aber Geduld überwindet allen Widerstand; wir reiten an dem Hügel vorbei und gewahren auf seiner anderen Seite eine Oase, Njanda-nakbo, wo üppiges Gras um einen kleinen Sumpfsee herum wächst. Der Rauch steigt einladend aus den Spalten eines halben Dutzend schwarzer Zelte, und zwei indische Wollkarawanen halten auf dem Platze Rast.
Sobald mein Zelt im Lager 248 fertig ist, lasse ich mir die Hindus zur Befragung rufen. Sie sind aus Rampur und haben in Gerke Wolle gekauft. Diese sollte auf 500 Schafen, die sie ebenfalls in Gerke erstanden hatten, nach Gartok und Indien befördert werden. Für jedes Schaf hatten sie zwei Rupien bezahlt. Es sollen jährlich ungefähr sechzehn indische Karawanen Wolle aus Gerke holen, und ohne Zweifel verdienen sie gut bei der Reise.
Der Gova von Njianda erzählte uns eine Räubertat, die vor zwei Wochen an einem aus sieben Zelten bestehenden Nomadengemeinwesen verübt worden war. Mit Messern, Säbeln und Flinten bewaffnet hatten acht Schurken unter dem Schutze der Dunkelheit das Dorf überfallen. Die Bewohner hatten nicht einmal versucht, sich zur Wehr zu setzen, sondern waren Hals über Kopf ins Gebirge geflohen. Als die Bande abzog, nahm sie alles mit, was nicht niet- und nagelfest war, alle Esswaren, alle Kleidungsstücke, dreißig Töpfe, Kannen und Schüsseln und dazu noch 740 Schafe und 69 Yaks. Sie ließen kaum etwas mehr als die kahlen Zelte und die Hunde zurück. Die ausgeplünderten Nomaden lebten in der entsetzlichsten Armut und wanderten als Bettler in der ganzen Gegend von Zelt zu Zelt. Aber die Rache schlief nicht! Sechzehn Reiter hatten die Spur der Räuberbande verfolgt. Große Yak- und Schafherden können unmöglich spurlos in den Bergen verschwinden. Man würde die Friedensstörer schon erwischen. Dann aber wird von Pardon keine Rede sein. Die Köpfe und Hände der Verbrecher werden nach Lhasa geschickt.
Am nächsten Morgen kamen vier Frauen der ausgeplünderten Zeltgemeinde auch zu mir und waren dankbar für die Gaben, die ich ihnen spenden konnte.
Ein kurzer Tagemarsch führte durch wegloses Gelände nach dem Ufer des Baches Dschukti-loän-tschu; dieser kommt von dem gewaltigen Passe im Transhimalaja herab, der uns noch von Gartok schied. Man hat die Wahl zwischen drei Pässen, erklärten unsere Führer, zwischen dem Dschukti-hloma, dem Dschukti-tschangma, dem südlichen und dem nördlichen Dschukti-Passe, und dem Lasar-la, der ein wenig nördlich davon liegt. Die über sie hinüberführenden Wege vereinigen sich jedoch bald auf der südlichen Seite des Kammes. Mitte Dezember versperrt der Schnee alle drei, und dann ist es vier bis fünf Monate lang unmöglich, den Transhimalaja in dieser Gegend zu überschreiten.
Es gibt aber andere Auswege, deren sich diejenigen bedienen können, die aus Njanda nach dem unteren Gartok wollen. Sie ziehen nordwestwärts längs des Fußes des Gebirges und benutzen den niedrigen, sandbedeckten Pass Pele-rakpa-la, den der Schnee nie unzugänglich macht. Der Lapta-la ist ein fünfter Pass, der noch weiter nordwestwärts liegt. Und schließlich kann man immer durch das Durchbruchstal des Indus hindurchkommen, wobei man alle Berge vermeidet.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Hauptkette des Transhimalaja, die sich hier zwischen den beiden Indusarmen erhebt, beinahe all die Feuchtigkeit sammelt, die von dem Südwestmonsun herangeführt und nicht von den Regionen des Himalajas aufgefangen worden ist. Ich habe selbst gesehen, dass das Land im Nordosten des Transhimalaja eine echte Wüste ist, und es erregt nicht länger meine Verwunderung, dass der Singi-tsangpo, der Quellarm des Indus, auch kurz nach Beendigung der Regenzeit nicht imstande ist, mehr als sechs Kubikmeter Wasser in der Sekunde zu sammeln.
Viertes Kapitel. Über den Transhimalaja nach Gartok.
Der Morgen des 25. September brach klar, kalt und windstill an, und die 15,4 Grad Kälte während der Nacht hatten die ruhigeren Stellen des Baches mit Eisbrücken belegt, die an den im Bette liegenden Steinen haltfanden. Doch als wir aus dem Lager 249 zwischen Vorsprüngen und Wänden aus Granit und Porphyr langsam talaufwärts zogen, begegneten wir bald dem neuen Schmelzwasser, das die Morgensonne auf den Höhen aus seinen Banden befreit hatte und das nun die eine Nacht alten Eisschollen hell erklingen ließ.
Hier und dort starrt uns ein Quellauge an, dessen Wasser in der Kälte gefroren ist. Verlassene Lagerplätze zeugen von Besuchen der Nomaden und der Pilger. Manchmal hört das Geröll eine kürzere Strecke auf, Moos oder feines hochalpines Gras bildet einen weichen Teppich unter den Hufen der Tiere, und die Karawane schreitet lautlos dahin. Dort haben die Murmeltiere ihre Höhlen.
Der wilde Yak scheut die öden Gegenden, die wir eben hinter uns zurückgelassen haben. Hier aber, auf den Höhen des Transhimalaja, hat er eine Freistatt und findet die Weide und die Kälte, die ihm zusagen. Ein berühmter Jäger aus Njanda hatte kürzlich auf den Abhängen des Dschulti-Passes einen Yakstier verwundet und hätte dabei beinahe sein Leben eingebüßt. Schäumend vor Wut hatte das Tier den Mann mit seinen Hörnern angegriffen, und es war dem Bedrohten nur mit genauer Not gelungen, sich zwischen zwei Blöcke zu flüchten, deren Zwischenraum zu eng war, als dass der Yak sich hineinzwängen konnte.
Das Tal erweitert sich zu einer steil ansteigenden Mulde. Bei Tschangsang-karpo, wo heller Porphyrit ansteht, wird der Pfad reizend. Ein Riese scheint dort einen Lastwagen voll gewaltiger Blöcke umgeworfen zu haben, um uns den Weg zu versperren. Zwischen den Blöcken schlängelt sich der Pfad im Zickzack zum Passe hinauf. Manchmal können die Tiere sich kaum durch die engen Zwischenräume hindurchzwängen.
Einige Stufen sind so steil, dass man es vorzieht, zu gehen. Vergeblich späht man nach den Höhen hinauf, hoffend, dass der Kegel bald ein Ende nehmen werde. Doch beständig erheben sich vor und über uns neue Blockrücken, und mit unaufhörlichen Unterbrechungen schreitet der Zug zum Dschukti-la hinauf.
Meine gemieteten Yaks marschieren leicht und gewandt, und ich muss mich immer wieder wundern, dass die Pferde sich in den tückischen Löchern, die oft schwarz zwischen den Steinen gähnen, nicht die Beine brechen. Zuweilen sehen wir unter einem Felsblocke einen zugefrorenen, grünglänzenden Tümpel von mittlerer Größe. Im Süden schieben sich ein paar steil herabhängende Gletscherzungen zwischen schwarzen Felsschultern im Kamme der Kette vor. Das Eis des Gletscherendes glänzt wie polierter Stahl.
Die Steigung wird geringer, aber noch haben wir einen weiten Weg nach Nordwesten vor uns, ehe wir zwei kleine Steinmale mit flatternden Wimpeln und Schnüren erreichen. Es ist der Höhepunkt des Dschukti-la. Hier sauste der Westwind mit halber Sturmstärke, schneidend und rau. Die Karawane musste sogleich ihren Marsch fortsetzen und in das geschützte Tal auf der anderen Seite hinunterziehen. Ich selbst blieb mit dreien meiner Leute auf dem Passe, um seine Höhe über dem Meeresspiegel festzustellen. Es war mein fünfter Übergang über den Transhimalaja! Der Dschukti-la war allerdings schon überschritten worden, von Herrn Calvert und den Punditen. Aber ich wollte doch eine genaue Höhenbestimmung mit dem Siedethermometer haben. Es handelte sich jetzt nur darum, das Wasser mit den letzten Spiritustropfen, welche die Lampe noch enthielt, zum Sieden zu bringen.
Tundup Sonam und Rabsang bildeten mit ihren Pelzen einen Windschirm, und ich zündete den Docht an; das Wasser begann in dem Gefäß zu summen und zu singen, und bald stieg die Quecksilbersäule in dem Rohre des Thermometers. Da erlosch die Lampe! Doch sollte ich hier auch tagelang warten müssen, die Höhe musste ich haben! Nie wieder würde mich das Schicksal zum Dschukti-la führen, und versäumte ich diese Gelegenheit, so würde ich es nachher bitter zu bereuen haben.