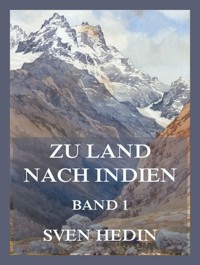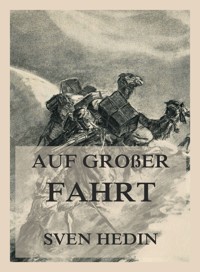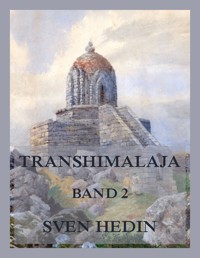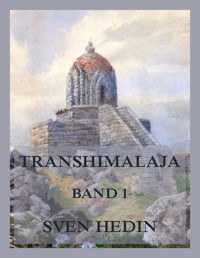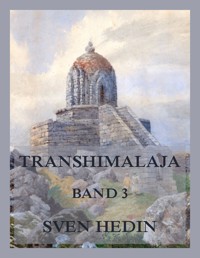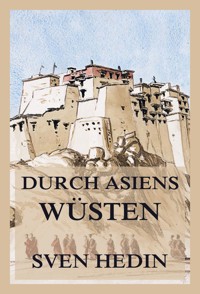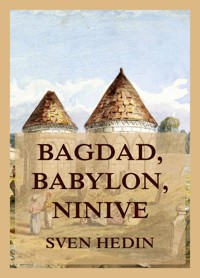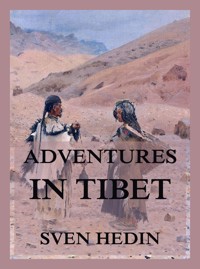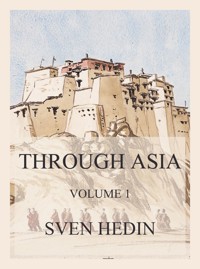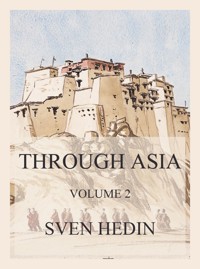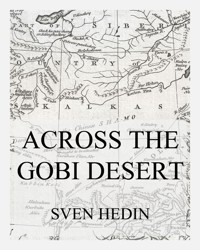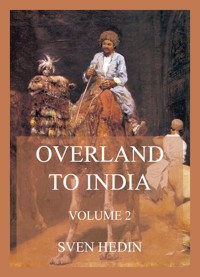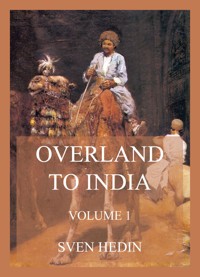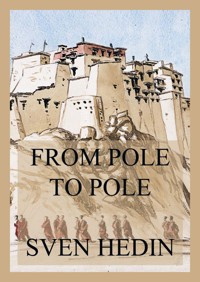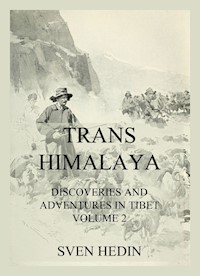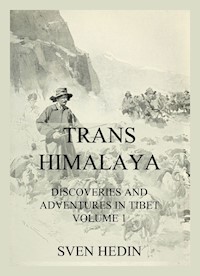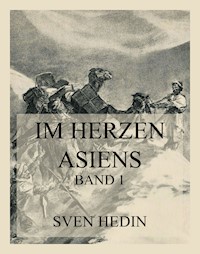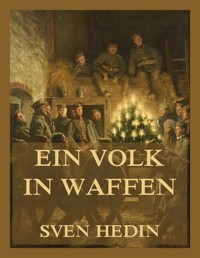
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sven Hedin, der berühmte schwedische Forscher, besuchte in den Monaten September und Oktober 1914 die von den Deutschen besetzten Gebiete Belgiens und Frankreichs; er schildert uns, wie er selbst behauptet, die "größten Eindrücke seines Lebens", die er als Gast im Hauptquartier des Deutschen Kaisers, auf den blutgetränkten Schlachtfeldern, in den Schützengräben und Feldlagern sowie bei den Artillerieständen gewonnen hat. In 51 Kapiteln gibt er auf meisterhafte Weise das Gesehene und Erlebte wieder. Hedin hat aufgrund der Kritik, die seine Bücher zum Ersten Weltkrieg geerntet haben, immer wieder beteuert, dass es niemals in seiner Absicht lag, die deutschen Truppen oder ihren Angriffskrieg zu glorifizieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ein Volk in Waffen
SVEN HEDIN
Ein Volk in Waffen, S. Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681720
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Was ich will. Ein Vorwort.1
1. Wo ist das Große Hauptquartier?. 2
2. Kriegsbilder auf der Fahrt.4
3. Ein Franzose im Lazarett zu Ems.8
4. Feldpostbriefe.10
5. Verwundete und Gefangene.11
6. Im Hauptquartier.15
7. Der Kaiser.17
8. Zur fünften Armee.21
9. Beim Kronprinzen.24
10. Hinter der Feuerlinie.26
11. Im Schrapnellfeuer.28
12. Madame Desserrey.30
13. Morgengrauen.32
14. Die »Brummer« bei Eclisfontaine.34
15. Verhör französischer Gefangener.36
16. Sturm auf Varennes.38
17. Das Feldlazarett in der Kirche zu Romagne.41
18. Der letzte Abend beim Kronprinzen.44
19. Longwy.46
20. Ein Brief an den Kaiser.48
21. Die Eisenbahn im Kriege.49
22. Sedan — 1870!55
23. Bei der vierten Armee.58
24. »Barbarische« Justiz.62
25. Der Krieg in der Luft.64
26. Deutsches Sanitätswesen im Felde.68
27. Leben an der Front.71
28. Die Feld-Telefonstation.74
29. Am Scherenfernrohr.76
30. Feldgottesdienst.78
31. Nach Belgien.81
32. Die 42-cm-Mörser vor Namur.84
33. »Vandalismus.«. 86
34. Generalgouverneur Exzellenz von der Goltz.88
35. Antwerpen einen Tag nach seinem Fall.91
36. Gäste des Generalgouverneurs.98
37. An der Schelde.99
38. Löwen.101
39. Die weiße und die schwarze Marie.102
40. Über Gent und Brügge nach Ostende.104
41. Das Bombardement von Ostende.107
42. Mein erster Abend in Bapaume.112
43. An der Front bei Lille.116
44. Die B(apaumer) Z(eitung) am Mittag.120
45. Im Schützengraben.121
46. Allerseelen.125
47. »Lieb Vaterland, magst ruhig sein!«. 129
48. Kronprinz Rupprecht von Bayern.130
49. Tommy Atkins in Gefangenschaft.132
50. Die englische Lüge.134
51. Heimwärts.137
Was ich will. Ein Vorwort.
... Kein Schwede in verantwortlicher Stellung durfte eine Ahnung haben von meiner Reise an die deutsche Front. Unser Land gehört ja zu den neutralen Staaten, und auf seine Regierung durfte auch nicht der Schatten eines Verdachts fallen, dass ich in irgendeiner Art geheimer Mission reiste. Nein, der Anlass war ganz einfach. Ich sagte mir: In der Entfernung von einigen Tagereisen wird der gewaltigste Krieg der Weltgeschichte ausgefochten. Dieser Krieg muss von grundlegender Bedeutung werden für die politische Entwicklung der nächsten fünfzig, hundert, vielleicht noch mehr Jahre. Seine Folgen müssen unbedingt das weitere Dasein der gegenwärtigen Generation bestimmen. Der Krieg von 1870/71 wurde der Beginn eines neuen Zeitalters in Deutschlands Entwicklung. Dasselbe wird in noch viel höherem Maße, im Guten oder Bösen, vom Krieg 1914 gelten! Alle politischen Probleme der nächsten Zukunft müssen ohne Zweifel ihre Wurzeln in diesem großen deutschen Krieg haben. Gehen beide kämpfenden Machtgruppen mit stark verringerten Kräften aus dem Streit hervor, so ist er in seinen erlöschenden Funken der Keim zu einem neuen, vielleicht noch mehr verheerenden Weltbrand. Siegt aber Deutschland auf der ganzen Linie, so wird die Weltkarte durchgreifende Änderungen erfahren, und Deutschland lässt dann in seiner blühenden Machtfülle keinen neuen Krieg mehr zu. Siegt Russland, so ist das Schicksal Schwedens und Norwegens besiegelt! Wie der Krieg auch endet, müssen große und denkwürdige Ereignisse aus ihm hervorgehen. Wie lehrreich muss es also sein, ihn am Herd der die Zukunft umstürzenden Ereignisse, in den zerstörten Gegenden selbst zu studieren, wo die deutschen Soldaten das Schicksal ihres Landes und der ganzen germanischen Welt auf den Spitzen ihrer Bajonette tragen! Denn nur wer mit eigenen Augen gesehen, wie die Deutschen kämpfen, kann ganz verstehen, was für Deutschland in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Meine Fahrt an die Front war also in erster Linie eine politische Studienreise.
Aber auch andere Absichten und Gedanken ließen mich Sehnsucht nach der Front empfinden. Ich wollte den Krieg als solchen sehen und kennen lernen, um auch für andere die Schatten- und die Lichtseiten des Krieges beschreiben zu können. Die Schattenseiten sind Hass, Vernichtung, verbrannte Häuser, vergeudete Ernten, Verwundete, Krüppel, Gräber, Trauer und Sorge. Aber auch Lichtseiten hat ein Krieg, der von einem einigen Volk ausgefochten wird, das leben und seine Selbständigkeit bewahren will. Das sind die Einigkeit, Opferwilligkeit und Siegesgewissheit der Deutschen. Und schließlich wollte ich mit eigenen Augen sehen, wie weit Zivilisation, Christentum und Friedensbestrebungen im Jahre 1914 nach Christi Geburt gediehen waren!
Im ersten Abschnitt des Krieges hatte die englische Presse die Deutschen barbarischer Grausamkeit gegen ihre Gefangenen und gegen verwundete Feinde beschuldigt. Keinen Augenblick hatte ich daran geglaubt, aber um der Germanen willen wollte ich die Verleumdung ausrotten und die Wahrheit zur Kenntnis der Allgemeinheit bringen. Kann man nichts anderes von einem Volk verlangen, das auf der Höhe der Kultur stehen will, so doch mindestens das eine: dass es seinem Gegner nicht Verbrechen vorwirft, die er nie begangen hat. Deutsche Proteste gegen die Beschuldigungen der feindlichen Zeitungen nützten natürlich nichts. Vielleicht glaubt man mir, wenn ich vor Gott beteuere, dass ich keine Zeile niederschreibe, die nicht Wahrheit ist, und nichts anderes schildere, als was ich mit eigenen Augen gesehen habe....
1. Wo ist das Große Hauptquartier?
Mit diesen Gedanken trug ich mich Anfang September; sie waren in mir selbst entstanden, ohne den Schatten eines Impulses von schwedischer oder deutscher Seite. Als ich meinen Beschluss gefasst hatte, wandte ich mich an den deutschen Gesandten in Stockholm, Exzellenz von Reichenau, der mit größter Freundlichkeit meinen Wunsch an die betreffende Stelle in Deutschland weitergab. Nach acht Tagen erhielt ich die Antwort, mein Besuch an der Front werde willkommen sein. Schon am folgenden Tag, am 11. September, trat ich meine Reise ins Ungewisse an, und am 12. September ließ ich mich im Auswärtigen Amt in Berlin, Wilhelmstraße Nr. 76, melden.
Der Unterstaatssekretär Herr von Zimmermann, der den Minister des Äußeren in Berlin vertritt, solange Exzellenz von Jagow sich im Großen Hauptquartier aufhält, nimmt mich mit offenen Armen auf und teilt mir mit, das einzige, was er wisse, sei, dass ich mich nur geradeswegs zu Exzellenz von Moltke ins Große Hauptquartier zu begeben habe.
»Aber wo ist das Große Hauptquartier?« frage ich.
»Das ist Geheimnis«, antwortet Herr von Zimmermann lächelnd.
»Aber wie soll ich dann hinkommen?«
»Der Chef des Generalstabs, General von Moltke, hat Befehl gegeben, dass ein Automobil zu Ihrer Verfügung stehen soll. Sie können jederzeit aufbrechen. Als Begleiter erhalten Sie einen Offizier und einen Soldaten; Sie können in einer Tour Tag und Nacht fahren, aber auch selbst Weg und Reisezeit wählen. Mit einem Wort: Sie haben volle Freiheit.«
»Und dann?«
»Ihr weiteres Geschick hören Sie von Exzellenz von Moltke. Das einzige, woran Sie jetzt zu denken haben, ist, ihn aufzusuchen.«
»Und wo finde ich das Auto?«
»Darüber gibt Ihnen dieses Papier Bescheid.«
Herr von Zimmermann überreichte mir ein vom Großen Generalstab unterzeichnetes Blatt etwa folgenden Inhalts: »Der Inhaber dieses Zeugnisses ist berechtigt, sich des Relais des Kaiserlichen Freiwilligen Automobilkorps bis ins Große Hauptquartier zu bedienen. Was irgendwie seine Reise erleichtern kann, soll zu seiner Verfügung stehen.«
Das Freiwillige Automobilkorps hatte in der Friedrichstraße Nr. 243 sein Bureau; sein Chef war Dr. Arnoldi. Ich fand ihn in einem großen mit Offizieren und Ordonnanzen gefüllten Arbeitszimmer, dessen Tische mit Karten, Papieren und Telegrammen bedeckt waren, und wurde auch hier mit der größten Liebenswürdigkeit empfangen. Zunächst bekam ich eine Karte der großen Relaisstraße zu sehen. Und dann kam die Frage an mich: »Wollen Sie unabhängig von allen Bestimmungen oder wollen Sie Relais fahren, d. h. 700 Kilometer in 16 Stunden, 44 Kilometer die Stunde, in einer Tour?«
Ich dachte einen Augenblick nach und wählte dann: »unabhängig«. Denn wenn ich 16 Stunden reiste, hätte ich den letzten und sicherlich interessantesten Teil der Fahrt in dunkler Nacht zurücklegen müssen; ich war aber gekommen, um soviel wie möglich zu sehen. Die Wegstrecke von Berlin bis zum Hauptquartier musste ein beständiges Crescendo sein: immer weiter vom Frieden fort — immer näher den Kampflinien. Ich glaubte in meiner Unschuld, die Landstraßen in Westdeutschland müssten von Soldaten und Fuhrwerken überschwemmt sein. Keine Spur davon! Es dauerte lange, bis man des Gedränges wegen langsam fahren musste; und innerhalb Deutschlands geschehen ja alle Transporte per Bahn.
»Wer wird mein Chauffeur?«
»Ein Offizier, begleitet von einem Soldaten. Beide leisten ihre Dienstpflicht im Freiwilligen Automobilkorps.«
»Wer bestimmt den Offizier?«
»Ich; und ich denke eben an den Rittmeister von Krum aus Württemberg.«
Dr. Arnoldi drückt auf einen Knopf und fragt die eintretende Ordonnanz, ob Rittmeister von Krum in der Nähe ist. »Ja.« — »Bitten Sie ihn hierher zu kommen.« Und herein tritt in feldgrauer Uniform ein Offizier von vorteilhaftestem Aussehen und gewinnendem Wesen.
Rittmeister von Krum war aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden, aber bei Kriegsausbruch wieder unter die Fahnen getreten, und nach geltenden Mobilisierungsbestimmungen hatte er sein Automobil der Krone zur Verfügung gestellt. Er führt es selbst; der Soldat, der uns begleiten soll, ist in Friedenszeiten sein Chauffeur.
Am folgenden Tag war ich mit meinem Rittmeister unterwegs und equipierte mich feldnässig von Kopf bis zu Fuß, von der Automobilmütze bis zu den Schnürstiefeln und Beinbinden, mit einem passend warmen Sportanzug, mit Pelzweste und Pelzrock, Regenmantel, warmem Filzhalstuch und einer Automobilbrille — die ich nie benutzt habe.
Der 15. September war der Tag des Aufbruchs. Rittmeister von Krum lenkte seinen Wagen selbst und mit bewundernswerter Sicherheit. Neben ihm saß der Chauffeur, ein Unteroffizier aus Württemberg namens Deffner, ich selbst auf dem Rücksitz des Autos. Auf dem Boden des Wagens lag mein Gepäck, zwei Taschen nur so groß, dass ich sie im Notfall selbst hätte tragen können. —
2. Kriegsbilder auf der Fahrt.
Felder und Wälder, Höfe und Städte fliegen vorüber, und der Geschwindigkeitsmesser zeigt auf 70 Kilometer.
Wannsee — Potsdam. Nichts deutet an, dass Deutschland eben seinen größten Krieg erlebt. Gewaltige Ladungen duftenden Heus werden von den Wiesen hereingefahren. Es gibt also noch Pferde in Deutschland, die anderes ziehen als Kanonen und Munition. Die Flügel der Windmühlen drehen sich knarrend und mahlen das Korn, das in Brot für Millionen von Soldaten und ihre Familien daheim verwandelt werden soll.
Wittenberg. Auf der Straße zieht ein Trupp Freiwilliger. Sie sehen fröhlich in die Welt hinaus, marschieren können sie mit taktfesten Schritten, und sie singen ein munteres, belebendes Soldatenlied. An der nächsten Straßenecke ein neuer Trupp, der vom oder zum Übungsplatz marschiert, junge, kräftige Männer von soldatischer Haltung; man sieht, wie sie sich darnach sehnen, ins Feld zu ziehen. Sie singen nicht, sie pfeifen eine gemütliche Melodie, die ganz lustig zwischen den alten wittenbergischen Häusern erklingt. Es sind Germanen. Sie sind nicht geboren, um von slawischen oder lateinischen Völkern besiegt zu werden. Ihre Väter sind von Tacitus besungen worden und haben im Teutoburger Wald gesiegt. Nun sind sie würdige Nachkommen der alten Germanen, die sich unter den deutschen Adlern zum Kampf für die Freiheit zwischen Rhein und Weichsel und jenseits der großen Stromtäler versammeln. Es ist gefährlich, Adler zu reizen; noch können sie ihre Horste verlassen und ihre Schwingen erheben! Jetzt hat Deutschlands Schicksalsstunde geschlagen, jetzt gilt es den Platz und die Zukunft der Germanen auf der Erde! Hört das Echo ihrer stahlfesten Schritte in Wittenbergs Straßen! So hallt es ähnlich in allen deutschen Städten, wo die Freiwilligen zu den Fahnen strömen! Es ist eine Völkerwanderung, deren gleichen die Welt noch nicht gesehen hat!
In Bitterfeld treffen wir ein, als gerade der Wochenmarkt in höchstem Flor steht: Vor den Verkaufsständen malerisches Leben, farbenreich, altertümlich und friedlich — kein Mensch kann hier ahnen, dass Deutschland im Krieg steht, und doch denken alle, auch die, die die kleinen Geschäfte des Tags besorgen, nur einen einzigen Gedanken, den Krieg. Auf der Straße vor der Stadt sehen wir Frauen, die in ihre Dörfer zurückwandern oder fahren, nachdem sie auf dem Markt ihre Ein- und Verkäufe gemacht haben. Bei den Braunkohlengruben vor Bitterfeld sind die Körbe der Luftbahnen in voller Fahrt und führen die Kohle in die Fabriken, wo Briketts daraus verfertigt werden.
Bei jeder Brücke, die wir passieren, über oder unter einem Bahngleis, stehen immer ein oder ein paar ältere Landsturmleute; sie tragen dunkelblaue Uniformen, abends und in der Nacht graue Mäntel. Sie stehen mit verschränkten Armen, das Gewehr waagerecht unter den linken Arm geklemmt, und gehen langsam und treu am Kopf der Brücke oder unter ihrer Wölbung, bis sie von Kameraden abgelöst werden. So oft das Auto mit seinem flatternden Kriegswimpel daher gefahren kommt, nehmen sie Stellung, Gewehr bei Fuß. Mindestens ein Armeekorps ist durch solchen Wachtdienst in der Heimat gebunden.
Auf der Hauptstraße in Halle ist reges Leben, denn hier ist die große Straße nach Merseburg und weiterhin nach dem westlichen Kampfplatz. Während wir uns in der Stadt aufhielten, sausten noch verschiedene Militärautomobile vorüber. Auch hier hängen in den Fenstern der Buchhandlungen große Kriegskarten, und davor stehen Gruppen von Schuljungen, die laut und wichtig von dem sprechen, was die kleinen Fähnchen andeuten — vom Krieg.
Wir zünden den Scheinwerfer des Automobils an und fahren aus Halle heraus, südlich an Merseburg vorüber auf der Straße nach Naumburg, immer im Saaletal. Der scharfe Lichtschein erhellt die Landstraße ein gutes Stück voraus. Die Schnelligkeit ist auf 40 Kilometer in der Stunde herabgesetzt. Die Laubbäume der Alleen werden von den Lampen von untenher beleuchtet; es sieht aus, als führe man durch einen unendlichen grünen Tunnel. In der Ferne, zu beiden Seiten der Straße, werden helle Perlenschnüre von glänzenden Lichtern sichtbar: die Fenster in Dörfern und Höfen, wo Väter und Mütter, Geschwister, Jungfrauen und Kinder bei der Abendlampe sitzen und zum zwanzigsten Male die Feldpostbriefe und -karten lesen, die Soldaten von der Front in Frankreich oder in Belgien nach Hause geschickt haben. Ihre Anzahl geht in viele Millionen. Was steht wohl in diesen oft schwer leserlichen Briefen? Ich habe einige von ihnen gelesen. Da erzählt der Soldat den Seinen, wie es im Quartier geht, wie das Essen nach den Strapazen des Felddienstes schmeckt, wie ihm zumute ist, wenn die Granaten in seiner Nähe krepieren und die Kameraden neben ihm fallen. Da steht auch, dass der Feind verloren ist und im Handumdrehen zurückgeworfen werden wird, wenn der General die Stunde für gekommen hält, um Sturm zu kommandieren. Da wird mit gutmütiger Achtung von den Franzosen als tapferen, ehrlichen Soldaten gesprochen und von den Engländern mit glühendem Hass. Und schließlich sagt oft genug der Soldat, es könne keine Rede davon sein, dass er in die Heimat zurückkehrt, ehe er verwundet und, was Gott verhüten wolle, kampfunfähig geworden und ehe der Sieg über die Feinde des Deutschen Reiches erfochten ist. Denn das wissen die Soldaten vom Veteran bis zum jüngsten Rekruten, dass Deutschland wohl bis an die Zähne gerüstet war in Erwartung des Krieges, dass aber der Kaiser und die Staatsmänner Deutschlands alles, was in ihrer Macht stand, taten, um ein Unglück abzuwehren, das die ganze Erde treffen und unerhörte Ströme von Blut und Tränen kosten musste, ein namenloses Elend in verödeten Häusern und verwüsteten Dörfern, unzählige Nächte des Wartens und der Unruhe und lange Jahre trostloser Sorge und Trauer.
Der Wirt im Hotel »Zum mutigen Ritter« in Kösen leistet uns bei einer Tasse Tee Gesellschaft und berichtet, dass alle seine Badegäste auf einmal verschwanden, als der Krieg ausbrach; der ganze Hotelbetrieb stehe still. »Aber was tut das,« fügt er hinzu — »wenn wir nur siegen!«
16. September. Wenn man sich im Goethehaus zu Weimar in diese Welt großer, teurer Erinnerungen hineinversenkt hat und plötzlich wieder auf die Straße hinaustretend eine Schar Landsturmleute sieht, die nach dem Schießplatz marschiert, dann muss man sich die Augen reiben und sich zusammennehmen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und dieses Volk, das einen Goethe hervorbrachte und jetzt mit glänzender Tapferkeit an einem halben Dutzend Fronten kämpft, ist von einer ganzen Presse, von einer ganzen Nation ein Volk von Barbaren genannt worden! —
Erfurt–Gotha. Links von uns steigen die dunklen, regenschweren, nebligen Höhen des Thüringer Waldes empor. Aber unser Weg führt durch behagliche Dörfer mit freundlichen Fachwerkhäusern; schreiende Gänse und gackernde Hühner tun ihr Möglichstes, um von uns überfahren zu werden oder wenigstens unsere Fahrt aufzuhalten. Schnell ist Eisenach erreicht und hinter uns. Die Straße biegt nun scharf nach Südwesten ab, und in schön abgerundeten Windungen erklimmen wir die Höhen des Thüringer Waldes. Tiefer, dunkler, kühler Schatten; es duftet von feuchtem Erdboden und saftigen Nadeln; ab und zu erinnert die prächtige Gegend lebhaft an die Straße von Rawalpindi bis Kaschmir.
Marksuhl–Hünfeld in Hessen. An einem Tisch im Speisesaal des Gasthofs sitzt eine Krankenschwester, das Zeichen des Roten Kreuzes am Arm, und unterhält sich mit zwei Herren, offenbar Ärzten, denn sie sprechen von der Pflege verwundeter Soldaten. Eine Schar Jäger tritt ein, ihre Taschen voll Rebhühner und Hasen. Sie tragen grüne und braune Anzüge und kecke, federgeschmückte Filzhüte, auf der Schulter die Gewehre. Sie sprechen eifrig vom Krieg, diesem Krieg, der alle beschäftigt und alle waffentüchtigen Verwandten nach Westen oder Osten ruft.
Gelnhausen–Hanau. Unter uns fließen die trüben Wassermassen des Mains. Es regnet stark. Die Straßen sind aufgeweicht, aber doch immer gleich gut. Man merkt, dass man sich einer großen Stadt nähert, der Verkehr auf der Straße nimmt zu. Die Menschen wohnen dichter beieinander, und die Telegraphendrähte sammeln sich zu mächtigen Bündeln. Diese stummen Drähte, die doch immer sprechen und mehr wissen als wir — vielleicht durcheilt sie in diesem Augenblick die große Neuigkeit, auf die ganz Deutschland wartet? Wir hofften, sie in Kösen anzutreffen, vielleicht erwartet sie uns in Frankfurt?
17. September. Frankfurt. Der Tag brach in freundlicher Schönheit an, trotzdem schwere Wolken am Himmel segelten. Wir mussten erst zu einer Tankstelle, um Benzin aufzufüllen, und dann zum Immobilen Kraftwagendepot, wo immer alles vorhanden sein muss, was zur Reparatur der Kriegsautomobile erforderlich sein kann. Hier holten wir fünf Reservereifen, die rechts und hinten am Auto festgemacht wurden. Von Bezahlen ist natürlich keine Rede; die Autos gehen ja für Rechnung der Krone.
Endlich geht es weiter, und wir fahren durch Frankfurts lange Straßen und seine westlichen Vorstädte, die fast ganz aus Arbeiterwohnungen bestehen. Man denkt vielleicht, diese Arbeiter sympathisierten nicht mit dem Krieg, den Deutschland für seine Zukunft führt? Weit gefehlt! Sozialdemokratische Arbeiter haben ihren Jungen, die auf den Höfen richtige Schlachten liefern und sich Kluck und Hindenburg nennen, kleine Helme und Holzschwerter geschenkt. — Wiesbaden–Eiserne Hand. In Langenschwalbach stechen die feinen Hotels grell ab von den ernsten Fahnen des Roten Kreuzes und den verwundeten Soldaten, die schon auf dem Wege der Besserung sind und auf Balkons und in den Gärten sitzen, um Luft zu schöpfen. Dann windet sich die Straße jäh zu Höhen empor, wo die Luft klarer ist und gedämpfte Aussichten auf lachende Täler und waldbekleidete Hügel sich öffnen.
Nassau an der Lahn. Bezaubernd schön ist dieses Land, herrlich seine Straßen, majestätisch seine Wälder in ihrer dunkeln, stummen Einsamkeit. Auf dem Gipfel eines Hügels thront eine alte Festung. Das Volk ist freundlich und grüßt und winkt, wohin wir kommen, und ein junges Mädchen wirft eine rote Rose in unser Auto — nicht für uns, vermute ich, sondern als Gruß an ihren Verlobten, der draußen im Felde steht.
Die Lahn entlang — Ems. Wir lassen das Auto in einer Nebenstraße halten und bleiben auf dem Fußsteig entblößten Hauptes stehen, um einen Leichenzug passieren zu sehen. Der Tote ist ein Major, der seinen Wunden erlegen ist. Die Musikkapelle spielt einen langsamen Trauermarsch; zwei Fahnen wehen vor dem schwarzen sarkophagähnlichen Sarg, und diesem folgen die Mitglieder des Emser Kriegervereins, die Kampfgenossen, alle in Zylinder, langem Rock und schwarzer Halsbinde; den Schluss bildet eine Schar verwundeter Soldaten, Rekonvaleszenten, die im Kursaal einquartiert sind. Langsam bewegt sich der feierliche Zug nach dem Bahnhof, denn die Leiche des Majors soll in seine Heimat befördert werden. Nach einiger Zeit kam die Musikkapelle mit den Rekonvaleszenten zurück, aber diesmal spielte sie eine fröhliche, belebte Melodie. Das sei so Sitte bei Militärbegräbnissen, hörte ich; erst die Trauer und die Ehrung des Toten, dann die Rückkehr der Lebenden zum Leben und seinen täglichen Freuden.
3. Ein Franzose im Lazarett zu Ems.
Im Kurhaus mit seinen vielen prächtigen Zimmern werden achtzig Verwundete gepflegt, und man erwartete mehr. Viele der Schwerverwundeten lagen in ihren Betten; wer sich bewegen konnte, saß auf den Altanen, genoss die frische Luft und sehnte sich, das versicherte man mir überall, an die Front zurück.
Auch ein junger französischer Leutnant hatte, schwer verwundet, im Kurhaus Unterkunft gefunden. Mit welcher schändlichen Grausamkeit sollten nach den Meldungen der englischen Presse die Deutschen ihre französischen Gefangenen behandeln! Ich konnte daher dem Wunsche nicht widerstehen, mich zu erkundigen, was der Franzose selbst darüber zu sagen hatte. An seinem Zimmer war nichts auszusetzen, es lag unmittelbar gegenüber einem der sechs kleinen Räume, in denen König Wilhelm I. 1867–1887 Jahr für Jahr einige Zeit zubrachte. Der Verwundete wurde von einem deutschen Arzt gepflegt, der die besten Hoffnungen für seine Wiederherstellung hatte, und von zwei barmherzigen Schwestern, von denen die eine französisch sprach. Auf meine Frage, ob er mit der Pflege, die ihm in Deutschland zuteilwurde, zufrieden sei, antwortete der Leutnant aus überzeugtem Herzen heraus mit Ja!
Er lag in einem großen Bett, und sein Gesicht war kaum weniger bleich als die reinen weißen Bettlaken, aber er sah gut aus mit seinem kurzgeschorenen Haar, der edlen Nase, dem schwachen Schnurrbart über den feingeschnittenen Lippen, und seine schwarzen französischen Augen erzählten von Lebenslust und scharfem Verstand. Er berichtete, er sei im Juni von Guinea heimgekehrt und habe gerade vor der Hochzeit gestanden, als der Krieg ausbrach und ihn von der Braut und den Eltern wegriss. In dem Gefecht bei Rossignol in Belgien traf ihn die Kugel. Es war ein entsetzlicher Tag. Er kämpfte im Feuer der Granaten, Maschinen- und Handgewehre. Die Kugel drang ihm durch Knie und Unterschenkel. Er fiel und blieb die ganze Nacht auf dem Schlachtfeld liegen. Am nächsten Tag las ihn die deutsche Ambulanz auf, und er wurde etappenweise bis Ems befördert. Ende August war Kaiser Wilhelm in Ems gewesen, und als er erfuhr, dass ein verwundeter Franzose da sei, hatte er ihn besucht. Der Leutnant erzählte, der Kaiser habe sich in ausgezeichnetem Französisch nach seiner Verwundung und seinem Befinden erkundigt. Ich sagte ihm, ich würde wahrscheinlich binnen kurzem den Kaiser treffen und dann Seiner Majestät mitteilen, welchen Eindruck der hohe Besuch auf den Verwundeten gemacht habe. Als ich mich später des freiwillig übernommenen Auftrags entledigte, zeigte sich, dass der Kaiser sich sehr wohl des französischen Leutnants erinnerte und sich über seine voraussichtliche Genesung freute.
Schließlich fragte ich den Kranken, ob ich ihm einen Dienst erweisen könnte, soweit das von den deutschen Behörden erlaubt sei. Er schien auf diese Frage gewartet zu haben. Tag und Nacht hatte er über dem einzigen Gedanken gebrütet: wie können meine Eltern und meine Braut erfahren, dass ich lebe und es mir gut geht? ich bin ja in Feindesland und habe keine Postgelegenheit! Ich bat ihn um seine Adresse, und er schrieb in mein Tagebuch: Monsieur Verrier-Cachet, Horticulteur, 52 Rue du Quinconce, Angers, Marne et Loire. Bald darauf saß ich an einem Schreibtisch, berichtete auf offener Postkarte und in deutscher Sprache das Schicksal des Leutnants Verrier und schickte die Karte an meine Familie in Stockholm, die durch Vermittlung des französischen Gesandten die Nachricht an obenstehende Adresse befördern sollte. Und dass die Nachricht ans Ziel kam und große Freude bereitete, das weiß ich; denn ich habe später aus Verriers Elternhaus die herzlichsten Grüße erhalten.
Oft bin ich seither schweren und zögernden Schritts durch Feld- und Kriegslazarette gewandert, besonders durch die Säle, in denen verwundete Franzosen, Engländer und Belgier lagen und die langsam verrinnenden Stunden zählten. Wie leicht hätte ich, der ich meine Freiheit und gesunde Glieder hatte, Postkarten in die Welt hinausschicken und sehnsüchtig Harrende von ihrer Unruhe erlösen können! Nichts ist so peinigend und schwer zu tragen wie die Ungewissheit über das Schicksal derer, die man liebt. Wenn in der Verlustliste der Name eines Sohnes, Bruders oder Ehemanns unter den Vermissten steht, ist das Leid für die Daheimgebliebenen größer, als wenn er gefallen wäre. Zwar besteht noch die Hoffnung, dass er am Leben sei, aber sie wird von unheimlichen Vorstellungen verdrängt: man sieht ihn verwundet, verblutend, einsam und verlassen in Nacht, Kälte und Durst. Oft habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass ich solche Postkarten nicht schrieb. Aber ich tröstete mich damit, dass ich einmal kein Recht dazu hatte, mich in die Bestimmungen hineinzumischen, die die deutschen Militärbehörden über die Verbindung Verwundeter mit ihrer Heimat getroffen hatten, und dann waren ihrer auch allzu viele. Immer sah ich schon am Abend des Tages ein, dass das Wirken als barmherziger Bruder eine hoffnungslose Aufgabe gewesen wäre. Übrigens wurde vom Beginn des Oktober an allen Gefangenen, also auch den Verwundeten, der Briefwechsel mit ihrer Heimat gestattet, nachdem die französische Regierung den Grundsatz der Gegenseitigkeit anerkannt hatte. —
Wir betrachteten noch den Denkstein, der an die bedeutungsvolle, feste Antwort erinnert, die König Wilhelm am 13. Juli 1870, 9 Uhr 10 Minuten vormittags dem französischen Minister Benedetti gab, jene Antwort, die der Anlass zum Französisch-Deutschen Kriege wurde. Und nun nach 44 Jahren standen wir wieder am selben Fleck! Nun war der Revanchegedanke zum Ausbruch reif geworden — soweit nicht andere böse Mächte Frankreichs Sehnsucht nach Rache für Elsass-Lothringen benutzt haben, um selber daraus Vorteil zu ziehen und den Aufschwung aufzuhalten, den Deutschland inzwischen genommen hat. Denn ich habe genaue Kenner versichern hören, dass der Revanchegedanke in weiten Kreisen des französischen Volkes mit den Jahren im Abnehmen begriffen war. Eine nahe Zukunft wird entscheiden, wen die Verantwortung dafür trifft.
4. Feldpostbriefe.
Der Rhein in seiner gewaltigen Pracht. Wir kreuzen ihn auf einer langen Pontonbrücke, auf der die Wachtposten zahlreicher als sonst stehen, und sind in Koblenz. Da, wo die Mosel in den Rhein mündet, steht ein Reiterdenkmal des alten Kaisers Wilhelm; der Sockel trägt die denkwürdigen Worte: »Nimmer wird das Reich zerstöret, wenn ihr einig seid und treu.« Heute bewahrheitet sich dieses Wort vor Deutschland und der ganzen Welt.
Die Straße führt uns auf das rechte Ufer der Mosel, wo eine Steinbrücke in schönem Bogen von Ufer zu Ufer führt und ein paar Moseldampfer unter der Roten Kreuz-Flagge verankert liegen. Ein Gewirr von engen Gassen, wimmelnd von Straßenbahnen, Droschken, Karren und Volk und vor allen Dingen von deutschen Soldaten. Die Landschaft liegt unbeschreiblich schön an diesen ewigen Flusswindungen; eine Stadt nach der anderen lugt hinter den Vorgebirgen hervor, und graue Häuser mit ihren schwarzen Schieferdächern und schöne Kirchen lösen sich von dem grünen Hintergrund.
Schließlich erreichen wir Treis, wo eine lustige Fähre, wie ich sie von den sibirischen Flüssen kenne, uns auf das linke Ufer hinüberführt. Dort setzten wir unsere schnelle Fahrt fort. Wir kamen an mehreren Militärzügen vorüber und begegneten auch einem Lazarettzug, dessen beide erste Wagen verwundete Franzosen beherbergten, die übrigen deutsche. Den Franzosen ging es weder besser noch schlechter als den Deutschen. Alle lagen auf Stroh. Die Schiebetüren in diesen zum Lazarett eingerichteten Güterwagen standen offen, um den Kranken frische Luft zu verschaffen.
In der Stadt Eller rasten wir einige Zeit in einem Wirtshaus, dessen Wirt, Herr Meinze, uns mit allem unterhält, was er vom Krieg weiß. Sein Töchterchen springt davon und bringt einen Brief, der eben vom Sohn der Familie angelangt ist, einem zweiundzwanzigjährigen Potsdamer Garde-Ulanen. Der Briefschreiber beklagt sich, dass er einen Monat lang kein Wort von zu Hause gehört habe. Er sei in einem Gefecht gewesen, in dem ein französischer Flieger eine Bombe auf eine Batterie herabwarf, drei Mann tötete und zwanzig verwundete. Über seine englischen Gegner spricht er mit großer Verachtung. Er vergisst, dass, man mag über die englische Leitung sagen was man will, die Soldaten doch tüchtig sind, große persönliche Tapferkeit zeigen und sich mit Löwenmut und Todesverachtung schlagen. Seinen Brief beginnt er mit den Worten: »Liebe Eltern und Schwester«, und am Schluss gibt er der Hoffnung Ausdruck, dass Deutschland bald mit seinen Feinden fertig werden möge. Der bezeichnende Zug all dieser Feldpostbriefe ist die unbefangene Beurteilung der Lage und der blinde Glaube der Soldaten an die unüberwindliche Macht des Heeres und den schließlichen Sieg. Wenn ich falle, das bedeutet nichts — ob ich bei dem Triumphzug der heimkehrenden Krieger durch das Brandenburger Tor dabei bin oder nicht, was tut's? — aber Deutschland soll siegen, wenn nicht früher, doch sobald die Frühlingsblumen aus meinem Grab hervorwachsen!
5. Verwundete und Gefangene.
Der nächste Weg nach Trier. — »Nach Wittlich?« fragt Rittmeister von Krum in einem Dorf, als er des Wegs nicht sicher ist. — »Nach Paris!« antworten ein paar muntere Mädchen, die uns die Richtung zeigen. Als wir endlich vor dem »Trierischen Hof« in Trier haltmachten, war es bereits dunkel. Wir waren durchnäßt und wollten uns nur trocknen, um dann die Reise nach Luxemburg fortzusetzen. Da aber der unbarmherzige Regen mehr zu- als abnahm und in Luxemburg kein Zimmer zu bekommen war, beschlossen wir, zu bleiben, wo wir waren. Im Restaurant wimmelte es von Offizieren, und auf den Straßen gingen die Soldaten in ihren grauen Mänteln. »Wo ist das Große Hauptquartier?« fragten wir bald hier, bald da. Keiner wusste es. Einige meinten, es sei in Luxemburg, andere, es sei nach Belgien verlegt. Nun, dachten wir, wir werden schon allmählich hinkommen.
Im »Trierischen Hof« waren wirklich noch ein paar Zimmer frei, in denen wir es uns bequem machten. Mein prächtiger Freund Krum erzählte mir, dass in Kriegszeiten alle Offiziere das Recht haben, sich einzuquartieren, wo sie wollen. Ein Zimmer mit Frühstück soll kostenlos zu ihrer Verfügung stehen; Mittagessen und sonstige Beköstigung müssen sie bezahlen. Der Offizier hat nur eine gedruckte Quittung auszufüllen, die er dem Wirt beim Aufbruch statt klingender Münze übergibt. Gegen diese Quittung bekommt der Wirt von der betreffenden Militärbehörde sein Geld, doch nicht die gleiche Summe wie in Friedenszeiten, denn die Taxe wird niedriger angesetzt als unter normalen Verhältnissen. Dasselbe gilt von Pferden, Wagen und allem, was im Krieg gebraucht wird; es wird von besonderen Kommissionen abgeschätzt und mit Quittungen bezahlt. In Trier war kein Auto aufzutreiben, nicht einmal eine Droschke, da alle Pferde fort waren. Als daher unser Wirt ein Telegramm erhielt, sein leicht verwundeter Sohn sei gegen 3 Uhr nachts zu erwarten, konnte er kein Fahrzeug auftreiben, um ihn abzuholen. Unser Automobil durften wir ihm nicht leihen; schließlich fand er das Auto eines Arztes und traf seinen Sohn bei ganz gutem Humor.
In besserem Gang waren die Straßenbahnen, und einer solchen bedienten wir uns, als wir am Abend die Horn-Kaserne aufsuchten, in der sonst das Infanterieregiment Nr. 29 von Horn liegt. Jetzt war das ganze Regiment im Feld und die Kaserne ein Lazarett. Sie kann tausend Soldaten aufnehmen, aber nur fünfhundert Verwundete, denn diese brauchen mehr Raum und Platz für Ärzte und Krankenwärter; außerdem werden mehrere Zimmer als Operationssäle, Baderäume usw. in Anspruch genommen. Bei unserem Besuch waren nur 220 Plätze belegt; 150 von ihnen hatten Franzosen inne. Sechs Ärzte und ein Oberarzt, dazu eine ganze Schar von Rote-Kreuz-Schwestern pflegten die Verwundeten.
Mit einigen jungen Ärzten schritten wir durch einen langen Korridor und besahen zunächst einige Operationssäle, die beim Ausbruch des Krieges in aller Eile hergerichtet und dann, soweit möglich, ganz modern ausgerüstet worden waren. Die Operationstische standen in der Mitte der Zimmer, die Wasserleitungen, Becken, Apparate, eine Masse chirurgischer Instrumente, alles in bester Ordnung. Wände und Boden dieser Säle waren mit Ölfarbe gestrichen. Es wurden hier im Durchschnitt fünfzehn Operationen am Tage vorgenommen. Ähnlich waren mehrere andere Kasernen in Trier in Krankenhäuser umgewandelt worden.
Dann betraten wir einen großen Saal mit deutschen Verwundeten. Alle waren vergnügt und munter, befanden sich vortrefflich und konnten sich keine sorgsamere Pflege denken, als sie in diesem Lazarett erhielten. Nur wurde ihnen die Zeit allzu lang; sie mussten immer an ihre Kameraden in den Schützengräben denken, sehnten sich in den Krieg zurück und hofften, bald wieder auf die Beine zu kommen, d. h. diejenigen, die wussten, dass sie nicht Krüppel fürs Leben waren!
In einem anderen Saal wurden französische Soldaten gepflegt. Auch hier unterhielten wir uns mit einigen Patienten. Sie waren alle höflich und mitteilsam, ließen aber den fröhlichen Lebensmut der Deutschen vermissen, was ja auch kein Wunder war, da sie sich in Feindesland befanden und von aller Verbindung mit der Heimat abgeschnitten waren. Einer von ihnen war bei Rossignol verwundet worden, wie Leutnant Verrier, den er aber nicht kannte. Er hatte einen Schuss durch die linke Hand und durch das linke Bein, das der Arzt hatte amputieren müssen. Bei seiner Verwundung hatte er die Kraft und die Geistesgegenwart gehabt, bis zu einem Graben zu kriechen, wo er vor Wind und Wetter und Feuer geschützt war; einige Fetzen aus seinem Mantel hatte er um seine Wunden gewickelt. Tags darauf fanden ihn deutsche Sanitätssoldaten, legten ihm den ersten ordentlichen Verband an und trugen ihn ins nächste Feldlazarett, von wo er vor kurzem mit der Eisenbahn ins Trierer Kriegslazarett transportiert worden war.
Der andere Soldat hatte zwei Nächte auf dem Feld gelegen und unsagbar an Durst gelitten. Einige Male hatten Deutsche, die an ihm vorüberkamen, ihm Wasser und Schokolade gegeben. Schließlich hatte man Gelegenheit gefunden, ihn in das Verwundetenlager zu bringen. Wie sein Kamerad sprach er seine Dankbarkeit aus über die Behandlung, die ihm in Trier zuteilwurde, und aus mehreren Betten in der Nachbarschaft erscholl Zustimmung. Die beiden deutschen Ärzte, die uns begleiteten, erzählten, die französischen Verwundeten wollten gewöhnlich das Lazarett nicht verlassen, da sie wie einfache Gefangene behandelt werden, sobald sie wieder auf die Beine gekommen sind. Diese Auffassung ist ganz natürlich und wird sicher von allen Verwundeten geteilt, welcher Nation sie auch angehören mögen, denn es ist behaglicher, in seinem warmen Bett zu liegen und auf alle Weise gepflegt zu werden, als in einer Baracke zu wohnen oder in einem Gefangenenlager inmitten von Senegalnegern, Marokkanern und Indern!