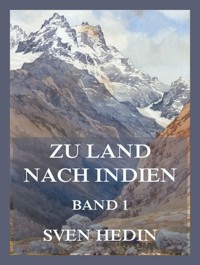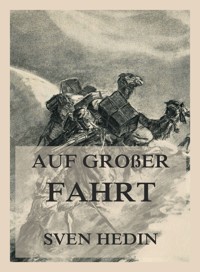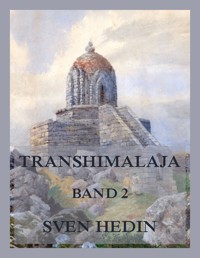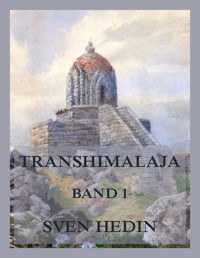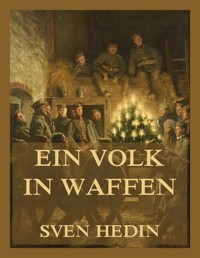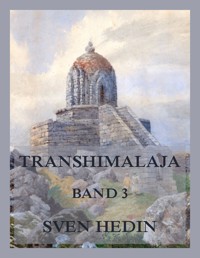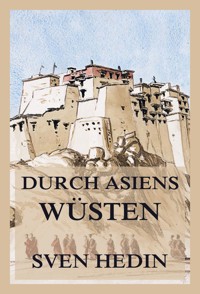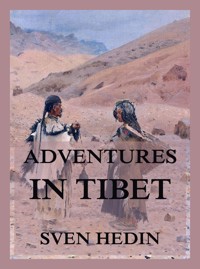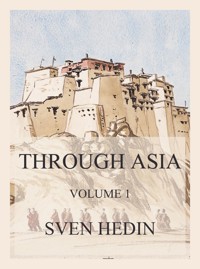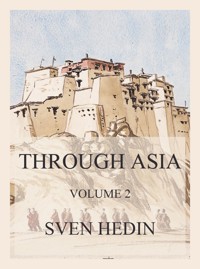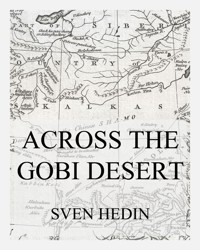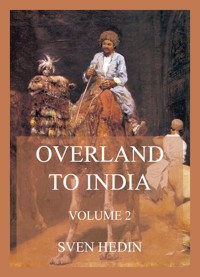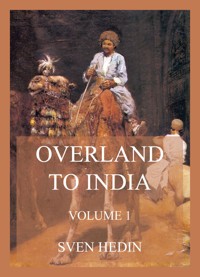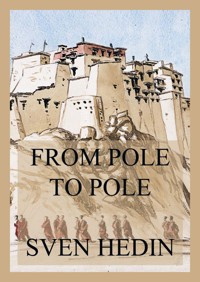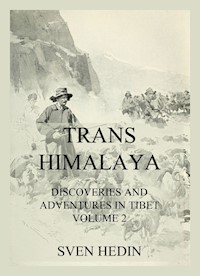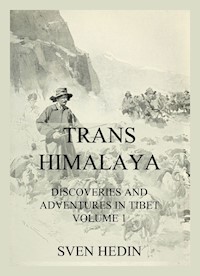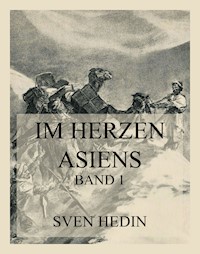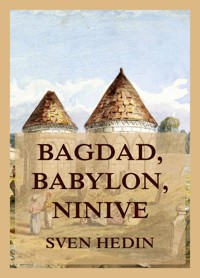
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seinen Reisen nach Zentralasien ließ Sven Hedin mit diesem Band seine Fahrt in den Nahen Osten folgen, die in der Hauptsache in einer Exkursion zum Euphrat, dem Besuch von Bagdad mit den Ruinen Babylons und von Mosul mit den Ruinen Ninives bestand, alles höchst anschaulich und lebendig geschildert. Besonders interessant ist sein Besuch bei Prof. Koldewey, der die Ausgrabungen auf den Hügeln von Ninive leitete, aus denen die älteste Bibliothek der Welt in 22000 Tontafeln aus der Zeit Assurbanipals, des assyrischen Königs (668-626) ausgegraben wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bagdad, Babylon, Ninive
SVEN HEDIN
Bagdad, Babylon, Ninive, S. Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681218
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Erstes Kapitel. Die Türkei im Weltkrieg.1
Zweites Kapitel. Aleppo.5
Drittes Kapitel. Eine missglückte Autofahrt.10
Viertes Kapitel. Mein neuer Feldzugsplan.23
Fünftes Kapitel. Auf den Wellen des Euphrat.27
Sechstes Kapitel. Unter Nomaden und armenischen Flüchtlingen.34
Siebtes Kapitel. Deutsche Artillerie auf dem Wege nach Bagdad.44
Achtes Kapitel. Im Reich der Palmen.51
Neuntes Kapitel. Mein Einzug in Bagdad.61
Zehntes Kapitel. Bagdad einst und jetzt.67
Elftes Kapitel. Sommertage in „Dar-es-Salaam“.78
Zwölftes Kapitel. Zwei Deutsche: von der Goltz und Moltke.91
Dreizehntes Kapitel. Kut-el-Amara.98
Vierzehntes Kapitel. Meine Fahrt nach Babylon.108
Fünfzehntes Kapitel. Bibel und Babel.118
Sechzehntes Kapitel. Die Ruinen Babylons.128
Siebzehntes Kapitel. Eine deutsche Studierstube am Euphrat.145
Achtzehntes Kapitel. Samarra, die Hauptstadt des Kalifen Mutawakkil.150
Neunzehntes Kapitel. Die Karawane des Herzogs.157
Zwanzigstes Kapitel. Die Königsstadt Assur.164
Einundzwanzigstes Kapitel. Erlebnisse auf einer Etappenstraße.171
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Mosul.179
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Ninive.187
Vierundzwanzigstes Kapitel. Die Keilschrift und die älteste Bibliothek der Welt.193
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Über Mardin zurück nach Aleppo.199
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Assyrien und Babylonien.206
Erstes Kapitel.Die Türkei im Weltkrieg.
Stockholm, 7. Mai 1917.
Wer dieses Buch in der Erwartung zur Hand nimmt, eine ausführliche Schilderung des Anteils der Türkei am Weltkrieg zu finden, wird schon, ehe er bis Bagdad gekommen ist, enttäuscht ausrufen: Aber das ist ja kein Kriegsbuch! Das ist ja nur eine Reisebeschreibung!
Er hat vollkommen recht. Nicht der Krieg lockte mich zu neuen Abenteuern. Davon hatte ich an den europäischen Fronten genug gesehen. Diesmal sehnte ich mich vor allem danach, die Weltreiche des Altertums, Assyrien und Babylonien, und die Ergebnisse der modernen Forschung auf diesem ehrwürdigsten Boden der Erde kennen zu lernen. Ich wollte die altberühmten Städte sehen, die der Spaten der Archäologen jetzt aus vieltausendjährigem Schlummer geweckt hat.
Den Leser an der überreichen Fülle meiner Eindrücke teilnehmen zu lassen, ist die vornehmste Aufgabe dieses Buches. Bald aber wird er merken, dass meine Reise in kriegerischer Zeit vor sich ging. Er hört den Schritt marschierender Soldaten und sieht deutsche Batterien in türkischen Diensten den königlichen Euphrat hinabfahren. Der Kanonendonner von Kut-el-Amara dringt an sein Ohr, und ich kann ihm einige Mitteilungen über den Vormarsch der Engländer in Mesopotamien nicht ersparen. Doch diese Gegenwartsbilder ziehen nur flüchtig vorüber vor dem machtvollen Hintergrund des Altertums.
Den Kampf der Osmanen gegen Russland kann ein Schwede nicht aufmerksam genug verfolgen. Denn er berührt die Zukunft seiner Heimat näher, als viele meiner Landsleute zugeben wollen. Bisher war Russland auch unser Erbfeind — die nächste Zukunft wird zeigen, ob der jetzige Umsturz den Erbfeind in einen Freund verwandelt hat. Seit Karl XII. den Europäern die Augen für die moskowitische Gefahr öffnete und die Vernichtung des slawischen Großstaates als das unumstößliche politische Ziel seiner Nachbarn bezeichnete, haben Schweden und die Türkei das gleiche Lebensinteresse gehabt. Der Sieg des einen war auch des andern Vorteil, die Niederlage des einen auch der Schaden des andern. Schwedens Missgeschick gab den russischen Zaren stets die Hände im Süden frei. Türkische Niederlagen sicherten ihnen den Rücken vor gefährlichen Feinden, wenn sie es für angebracht hielten, ihre Aufmerksamkeit auf unsre Grenzen zu richten.
Das Gemeinsame in den politischen Bedürfnissen Schwedens und der Türkei hat dennoch nicht vermocht, sie zu förderlicher Zusammenarbeit zu vereinen, nicht einmal da, wo es nur die Abwehr galt. Und doch hat die geographische Lage beider, die die Flanken des moskowitischen Reiches umfasst, jedem von ihnen mit oder gegen seinen Willen eine außerordentlich wichtige Rolle aufgezwungen. Schweden hält Russland vom Meere ab und sperrt seine Verbindungen mit Westeuropa. Das bisherige Russland — unter dem Zepter des Zaren — hat unser bloßes Dasein stets als einen erstickenden Druck empfunden; die Lehren des Weltkrieges haben diese Wahrheit nur bestätigt. Russlands auswärtige Politik will diese Fesseln sprengen. Andrerseits kann die künftige Sicherheit Schwedens und der Türkei zu keinem billigeren Preise errungen werden, als durch Verwirklichung der Pläne Karls XII.! Denn die neue Staatsform, mit der Russland soeben die Welt überrascht hat, gibt keinerlei Bürgschaft für die Zukunft. Nichts könnte törichter sein, als blind auf ihren Bestand zu vertrauen!
Die Stellung der Türkei zur westeuropäischen Frage im modernen Sinn ergab sich, als die Moskowiter ohne historisches Recht den Weg nach dem Bosporus und den Dardanellen einschlugen und ohne Umschweife erklärten, ihr Ziel sei „Zarigrads (Konstantinopels) Befreiung“! Zur selben Zeit wollte Karl XII. alle Kräfte sammeln zum gemeinsamen Kampf gegen einen Feind, dessen Charakter und Entwicklungsmöglichkeiten er wie kein andrer vor oder nach ihm mit prophetischem Blick durchschaute. Vergebens aber rief er Schweden, Polen und Türken auf. Sein Plan kam nicht zur Ausführung, nicht zum wenigsten, weil westeuropäische Mächte den Russen Helferdienste leisteten. Nach Karls XII. Tode war Schweden wie Polen und die Türkei durch innere Zwistigkeiten geschwächt, die Russland und England — damals wie jetzt in brüderlicher Eintracht — anfachten und schürten. Polen verschwand. Schweden wurde einstweilen durch Gustav III. gerettet. Den Türken aber öffnete der verhängnisvolle Vertrag von Kütschük-Kainardschi (1774) die Augen über die dunklen Pläne, die schon Zar Peter der Große im Schilde führte. Damals schon begann der Marsch über türkische Gebiete, die dem Vordringen Russlands nach dem Mittelmeer im Wege lagen.
Der Plan der Entente, die Mittelmächte in dem jetzt tobenden Weltkrieg zu zerschmettern, hat seine Wurzeln in der Balkanhalbinsel. Über das Ziel der Russen waren die Osmanen im Klaren: sie wussten, dass sich England und Russland, um ihre Absicht durchzusetzen, über türkisches Gebiet hinweg die Hand reichen mussten, und dass alles aufgeboten werden sollte, sich freie Bahn zu erzwingen. Für beide Teile handelte es sich also um einen Kampf auf Leben und Tod. Als daher die Hohe Pforte vor der Wahl stand: Krieg oder Untergang? gab es für sie kein Bedenken mehr. Zum ersten Mal nach zweihundert Jahren lebten Karls XII. Gedanken wieder auf, und aufs Neue erhob sich das Ziel, an das er Schwedens ganze Kraft gesetzt hatte. Diesmal waren auch die Nachbarn im Westen auf dem Posten. Nur Karls XII. eigenes Land fehlte in der Reihe — vom Geist des Eisenkopfs war bei den Nachkommen seiner Helden wenig mehr zu spüren. Immerhin wirkte Schweden durch seine geographische Lage.
Tatsächlich hatten die Türken keine andere Wahl, wenn sie am Leben bleiben wollten. Die neutrale Türkei hätte dasselbe tragische Schicksal getroffen wie das verfolgte, ausgehungerte, erwürgte Griechenland, dessen einziges Verbrechen war, dass es dem weltzerfleischenden Kampfe fernbleiben wollte. Dann hätte Konstantinopel jetzt eine russische und englische Besatzung, wie sich Athen der englischen und französischen erfreut.
Hätte sich der Türkei im Laufe des Weltkriegs jemals eine Spur von Zweifel oder Ermüdung bemächtigt, so sorgte der russische Ministerpräsident Trepow in seiner Dumarede vom 2. Dezember 1916 dafür, dass sie aufs Neue zu eisernem Widerstand zusammengeschmiedet wurde. Er gestand nämlich, eine mit Großbritannien, Frankreich und Italien im Jahr 1915 geschlossene Übereinkunft habe „definitiv Russlands Recht auf die Meerengen und auf Konstantinopel festgestellt“. Sein oder Nichtsein stand also für die Türken auf dem Spiel.
Wer nun geglaubt hat, das neue Russland werde auf solche Kriegsziele verzichten, erlebte eine große Enttäuschung. Die erste Revolutionsregierung wenigstens verharrte bei dem Anspruch auf die Dardanellen und Konstantinopel, und der Minister des Äußeren Miljukow übernahm in unveränderter Form den „russischen Reichsgedanken“, den Trepow in die Worte gefasst hatte: „Die Schlüssel zum Bosporus und zu den Dardanellen, Olegs Schild über dem Tor Konstantinopels — das ist der Jahrhunderte alte innerste Traum des russischen Volkes zu allen Zeiten seines Daseins.“
Die junge Türkei hatte also Grund genug, dem Umschwung der Dinge in Russland, den sie — selbst ein Kind der Revolution — an sich mit Befriedigung begrüßt hatte, größtes Misstrauen entgegenzubringen. Als unlängst der Großwesir Talaat Pascha der Presse seine Gedanken darüber mitteilte, tat er das mit den wohlüberlegten Worten: „Wir sehen indes mit Bedauern, dass der Gedanke der Revolution von aggressiven Absichten durchaus nicht frei ist. Miljukows ‚ehrenvoller‘ Friede setzt eine Lösung der türkischen Frage zugunsten Russlands voraus! Ob die russischen Liberalen diese alte Lehre von Angriff und Feindseligkeit billigen, wissen wir nicht. Wenn aber das russische Volk das verhängnisvolle Erbe des Zarismus als Richtschnur nimmt, dürfte es zwecklos sein, von Frieden zu reden.“ —
Was hat im Übrigen die Türkei dadurch gewonnen, dass sie unerschütterlich den Kurs beibehielt, den sie bei Beginn des Krieges einschlug? Nun, sie hat ihr eigenes Dasein für eine Zeitspanne gesichert, deren Weite wir noch nicht überblicken können. Indem sie die Verbindung zwischen Russland und England verhinderte, hat sie wirksam zum Zusammenbruch des Zarenreichs beigetragen. Russlands Kraft ist in Auflösung begriffen — kein Staat kann zu gleicher Zeit mit Erfolg Krieg führen und eine Revolution durchmachen. In diesem ungeheuren Kampfe, der nun seinem Ende zugeht, können die Moskowiter die Osmanen nicht mehr aufs Knie zwingen. Auch die zufällige Überlegenheit Englands in Mesopotamien wird daran nichts ändern. Denn die Entscheidung des Weltkriegs fällt auf den Schlachtfeldern Europas; außerdem erzittert das englische Weltreich selbst in seinen Grundfesten. Der Dienst, den die Türkei indirekt Deutschland geleistet hat, muss daneben auch in Anschlag gebracht werden. Großbritanniens Zusammenschluss mit Russland über die Dardanellen und den Bosporus hinweg war eine der Voraussetzungen für die Zerschmetterung Deutschlands. Bei Gallipoli wurde dieser Traum zuschanden.
Die russische Revolution verlief anders, als Englands Selbstsucht erwartet hatte. Damit war eine der letzten Karten ausgespielt — es gelang England nicht wie einst im Jahre 1808, Russland auf Kosten anderer zu kaufen. Jetzt ist es zu spät! Die Legionen Großbritanniens verbluten vergeblich an der deutschen Westfront, immer drohender erhebt sich das Gespenst des Hungers aus den Wogen des Atlantischen Ozeans. Der Sturz des russischen Zaren besiegelte Englands Misserfolg und entschied den Ausgang des Weltkrieges! Deutschland rechnet nicht mehr mit den Slawen, sie sind mattgesetzt. Das Riesendrama, das schon drei Jahre lang über die Weltbühne geht, beginnt seinen letzten Akt. Wir haben erlebt, wie Königreiche vernichtet, Kronen in Stücke zerschlagen und Verfassungen zerrissen wurden. Überall gärt es, auch in neutralen Ländern, die jetzt in der Stunde der Entscheidung besser täten, ihre Ruhe zu bewahren.
Mitten in diesem hoffnungslosen Durcheinander steht Deutschland unerschütterlich fest, wie der Fels im aufgewühlten Meer. Die Sturmwogen, die von allen Seiten hereinbrechen, zerschellen an seinen Klippen zu Schaum. Habt acht! Der Vorhang rauscht zum letzten Male empor. Hindenburg tritt auf. Dann wird die gewaltige Kampfgruppe, die seit dem Feldzug gegen Rumänien zu einer in der Weltgeschichte unerhörten Vollkommenheit ausgebildet wurde, ihre Ernte einbringen. Der Krieg wird zur Ruhe gezwungen werden. Frieden soll wieder auf dieser gemarterten, zerfleischten, vergrämten Erde herrschen! Stark und mächtig wird Deutschland der neuen Zeit entgegengehen. Dann darf auch das osmanische Volk des Dankes gewiss sein für seine ehrenvolle Teilnahme am Freiheitskampf der Germanen.
Zweites Kapitel.Aleppo.
Am 15. März 1916 war ich mit Graf Wichard von Wilamowitz-Möllendorff, dem neuernannten Militärattaché der deutschen Gesandtschaft in Persien, von Konstantinopel abgereist. Ein Dampfer hatte uns vom Goldenen Horn nach Haidar-Pascha an der asiatischen Küste gebracht, und in sieben Tagen erreichten wir mit der Bahn Aleppo.
Zweimal hatten wir den Zug verlassen müssen, denn die Strecke der Bagdadbahn bis Aleppo war noch nicht ganz ausgebaut. Zwischen Bosanti und Gülek im Taurus war zwar schon ein gewaltiger Tunnel durchs Gebirge gebohrt, er sollte aber erst im Herbst dem Verkehr übergeben werden. In Bosanti hatten uns zwei deutsche Offiziere in türkischen Diensten, Oberstleutnant Vonberg und Major Welsch, die auf dem Wege nach Bitlis waren, ein Kriegsautomobil zur Verfügung gestellt, das uns auf steilen und weiten, ohne Brustwehr über schwindelnden Abgründen hängenden Zickzackwegen über die 1300 Meter ansteigenden Höhen des Taurus nach Gülek beförderte. Auf der Talfahrt durcheilten wir die Pylae Ciliciae, den hohlwegartigen Engpass des Tales Tarsus-tschai, durch den Xerxes und Darius, Cyrus der Jüngere und Alexander der Große vorrückten, und in späteren Zeiten Harun-er-Raschid und Gottfried von Bouillon. Das Wetter war nicht eben einladend gewesen, es wechselte anmutig zwischen Land- und Platzregen. Dabei wimmelte die aufgeweichte und schlüpfrige Straße von Kamelkarawanen, die Baumwolle von Adana brachten, von Lastautos, requirierten Bauernwagen, Ochsenfuhrwerk mit Kriegsmaterial, marschierenden Soldaten und Reitern. Am meisten bemitleideten wir die Züge gefangener Sikhs, die von Bagdad her zu Fuß nach ihrem Bestimmungsort in Kleinasien wandern mussten, einen Stock in der Hand, den Brotbeutel auf dem Rücken, die Uniformen zerrissen und die Turbane zerlumpt. Welche Qual für die Söhne des Sonnenlandes Indien, dem kalten Regen auf den Höhen des Taurus schutzlos preisgegeben zu sein! Kleine Gesellschaften reisender Türken mit Eseln, Kühen und — aufgespannten Regenschirmen boten dagegen einen lustigen Anblick.
In der Mitte zwischen Bosanti und Gülek, in dem offenen Gebiet des Taurus, das Schamallan-han genannt wird und ringsum von spärlich bewaldeten Bergen umgeben ist, lag eine deutsche Automobilstation, wo man uns mit liebenswürdiger Gastfreundschaft aufnahm und eine Nacht trefflich beherbergte. In dem welligen Kesseltal war eine ganze Stadt emporgewachsen von gelben, grauen und schwarzen Zelten oft riesiger Ausdehnung, Schuppen und Reparaturwerkstätten. Mannschaftsbaracken und Offizierszelten. Deutsche und türkische Flaggen wehten darüber. Von Gülek aus hatten wir Tarsus besucht, den Geburtsort des Apostels Paulus, ein sehr langweiliges Städtchen.
Zwischen Mamure und Islahije waren die Tunnel ebenfalls schon fertig, aber nur eine Feldbahn führte hindurch. Diese Strecke über den Amanus und durch das 300 Meter breite, zwischen Basaltklippen sich öffnende Amanische Tor, durch das einst König Darius zog, um seinem Gegner Alexander in den Rücken zu fallen, mussten wir auf der Landstraße in einem „Jaile“ zurücklegen, einem hohen, überdeckten, kremserähnlichen Fuhrwerk, das Wilamowitz „Leichenwagen“ taufte, als ob er geahnt hätte, dass er von seiner Reise nach Persien nicht mehr zurückkehren werde. Man sitzt nicht, sondern liegt in dieser merkwürdigen Fahrgelegenheit, polstert sich den Boden so gut wie möglich mit Stroh und nachgiebigem Gepäck aus und freut sich, wenn das „gerüttelt Maß“ nicht allzu reichlich ausfällt. Für mich war diese Fahrt noch dadurch besonders denkwürdig, dass auf ihr meine wohlversorgte große Proviantkiste aus Konstantinopel spurlos verschwand. Das immer trostloser werdende Regenwetter hatte uns schließlich gezwungen, in einem elenden Krug zu Islahije bei einem griechischen Wirt Georgios Vassili ein etwas romantisches Nachtlager zu bestehen, und schließlich hatte uns ein Pferdetransportzug in einem Viehwagen um 1 Uhr nachts glücklich nach Aleppo gebracht.
Hier sollte ich nun abwarten, was das Oberkommando der türkischen Armee über mein weiteres Schicksal beschließen würde. Minister Enver Pascha hatte mir die Erlaubnis zur Reise durch Kleinasien bis nach Bagdad nur unter der Bedingung erteilt, dass Feldmarschall von der Goltz, der von Bagdad aus die 6. Armee befehligte, keine Bedenken dagegen habe; er allein wollte die Verantwortung für meine Sicherheit nicht auf sich nehmen, da wilde Beduinenhorden die Wege unsicher machten. Das endgültige Ergebnis des Depeschenwechsels zwischen Konstantinopel und Bagdad sollte mir in Aleppo gemeldet werden.
Aleppo, das Haleb der Araber, nach Smyrna und Damaskus die größte Stadt Vorderasiens, ist Hauptstadt eines Wilajets, eines Gouvernements, das das ganze nördliche Syrien umfasst und im Osten vom Euphrat begrenzt wird. Die Einwohnerzahl soll 200 bis 250000 betragen; davon sind zwei Drittel Mohammedaner, 25000 Armenier, 15000 Juden, ebenso viele Griechen, die übrigen Lateiner, Maroniten und unierte Syrer. In der Altstadt herrscht noch der arabische Stil vor, der nach der Straße zu nur öde Mauern zeigt. Doch finden sich auch dort schon solide Steinhäuser mit Erkern, Balkonen und eingebauten Altanen, und die neuen Stadtteile an der Peripherie haben eine fast europäische Bauart. Mit ihrem unaufhörlich hin- und herwogenden orientalischen Verkehr bieten Aleppos Straßen wundervolle Bilder; noch lieber aber verirrt man sich in die dunkeln Labyrinthe der Basare, deren kleine, enge Kaufläden mit Teppichen und Stickereien, Gold und Silberschmuck, Pantoffeln und Lederwaren und all dem Kram angefüllt sind, der von Europa eingeführt wird.
Der Krieg hatte zwar den Handel ziemlich lahmgelegt; der Han Wesir, ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, war fast leergeräumt. Dennoch herrschte in den Basaren noch immer lebhafter Betrieb. Selbst französische Weine, Konserven, Lichte usw. konnte man kaufen, da die Vorräte der Küstenstädte noch nicht erschöpft waren, so dass ich meine verschwundene Proviantkiste leicht ersetzen konnte. Manche Artikel aber stiegen unerhört im Wert. Für Petroleum forderte man das Zwanzigfache des Friedenspreises, und das türkische Papiergeld stand tief im Kurs: in Konstantinopel galt ein türkisches Pfund 108 Piaster, in Aleppo nur 90, in Jerusalem sogar, wie man mir versicherte, nur 73 (ein Piaster hat einen Wert von etwa 18 Pfennig). In manchen Gegenden weigerte sich die Landbevölkerung überhaupt Papiergeld anzunehmen; ich hatte mich glücklicherweise in Konstantinopel mit einer größeren Summe in Gold und Silber versehen.
In der Mitte der Stadt erhebt sich die Zitadelle auf einer uralten, wahrscheinlich künstlich geschaffenen Anhöhe. Vom Rundgang des Minaretts dort oben hat man eine wundervolle Aussicht über das Häusermeer der Stadt mit seinem sparsamen Grün und die Straßen, die wie die Speichen eines Rades von diesem Mittelpunkt ausgehen, auf das weite, hügelige, graugelbe Gelände und das Tal des Kuwekflusses, wo Platanen, Silberpappeln, Walnussbäume, Oliven und vor allem Pistazien in den Gärten grünen.
Aleppos Hauptsehenswürdigkeit ist die „große Moschee“ Dschami-kebir oder Dschami-Sakarija. Sie hat ihren Namen vom Vater Johannes des Täufers, Zacharias, dessen Grab im Innern hinter vergoldetem Gitter gezeigt wird, und wurde von den Omaijaden an einer Stelle errichtet, wo vordem eine von der Kaiserin Helena gestiftete christliche Kirche stand. Ihr gegenüber erhebt sich die Dschami-el-Halawije, die ebenfalls ein Abkömmling einer von der Kaiserin Helena erbauten Kirche sein soll. Ihr Inneres zieren Pilaster und Chornischen mit Akanthusmotiven und ein „Maschrab“, eine Gebetsnische, von künstlerischem Wert. Vor der Stadt liegt die vornehme Begräbnisstätte Ferdus mit zahlreichen Heiligengräbern und den charakteristischen Grabsteinen: immer zwei aufrechtstehend als Sinnbilder des Lebens, dazwischen ein liegender als Sinnbild des Todes. Die Ecken des liegenden Steins haben schalenförmige Vertiefungen: darin sammelt sich das Regenwasser, und die Vögel kommen, um zu trinken und den Schlaf der Toten mit ihrem Gesang zu versüßen. Als ich den Friedhof besuchte, küsste eine alte Türkin weinend die Steine der Heiligengräber, um, wie sie sagte, Schutz zu erflehen für ihren Sohn, der an der Front gegen die Russen kämpfte.
Eine andere, teilweise verfallene Grabmoschee trägt den Namen Salhein. Über ihren Denkmälern erhebt sich ein sehr hübsches Minarett. Vor der Stadt liegt auch die Moschee Scheik-ul-Hussein; ihre Gebetsnische birgt einen Stein, der nach der Versicherung Rechtgläubiger alljährlich am 10. Oktober, dem Todestage des schiitischen Heiligen Hussein, blutet. Nördlich von Aleppo träumt zwischen Anhöhen das Derwischkloster Scheik Abu Bekr, eine viereckige Halle unter einer Kuppel, im Innern ausgestattet mit prächtigen Skulpturen und Fayencen; zahlreiche große Fenster werfen helles Licht auf die Farbenpracht der Kunstwerke. Im Hof spiegeln Zypressen ihr ewiges Grün in einem klaren Wasserbecken; daneben schlummert unter einem von Kletterpflanzen umsponnenen Grabmal eine Prinzessin. Hier hausen die betenden Derwische von der Brüderschaft der Mutevelli-Derwische, deren Hauptsitz Konya ist. Auch die tanzenden Derwische haben in Aleppo ein Haus.
Vor dem Krieg war in Aleppo eine deutsche Kolonie von ungefähr 300 Köpfen. Jetzt war ihre Anzahl bedeutend gesunken. Von den beiden deutschen Schulen war die katholische vor vier Jahren gegründet und in einem vornehmen, hundertfünfzig Jahre alten arabischen Hause untergebracht; sie beschäftigte sechzehn Lehrer und acht Borromäerinnen (barmherzige Schwestern) und hatte zur Zeit meines Besuches 220 Schüler, die nur deshalb ein geringes Schulgeld zahlen mussten, weil sonst der Unterricht nicht als etwas Erstrebenswertes gegolten hätte. Im Ganzen sollen 400 Borromäerinnen an den verschiedenen Fronten stehen. Die protestantische, noch jüngere Schule wird von 110 türkischen, deutschen, jüdischen und armenischen Mädchen besucht; sie gehört den Kaiserswerther Diakonissen, die auch in Smyrna, Beirut und Jerusalem Schulen und in Konstantinopel ein großes Krankenhaus eingerichtet haben. Aus Kairo und Alexandria wurden sie während des Krieges vertrieben. Andere Lehranstalten in Aleppo stehen unter der Leitung der Franziskaner und Jesuiten, der Sacré-Coeur- und St. Josephsschwestern.
Das gesellige Leben der Deutschen hat seinen Mittelpunkt im Hause des Herrn Koch, dessen Gattin als Schwester Martha mir zuerst bei Feldmarschall von der Goltz begegnete, als er noch Generalgouverneur in Brüssel war. Ihr gastliches Heim, das sich seit dreißig Jahren so manchem Reisenden aufgetan hat, wurde auch mir jetzt eine Freistätte, und hier im Kochschen Hause entschied sich mein nächstes Reiseschicksal.
Einige Tage nach meiner Ankunft in Aleppo brachte mir der Adjutant Neschad Paschas, des dortigen Etappeninspektors, den Bescheid Enver Paschas, ich könne nach Bagdad reisen und wohin ich sonst wolle. Ich hatte nur den Weg zu wählen. Aber eben darin lag die Schwierigkeit. Eine gewisse Vorsicht war durch die kriegerischen Ereignisse auf jeden Fall geboten. Schon in Konstantinopel hatte ich gehört, die Russen seien in Persien ziemlich stark. Kirmanschah hatten sie genommen. Bagdad war also nicht mehr weit. Im Norden war Erserum gefallen, und wenn es dem Großfürsten Nikolai gelang, nach Diarbekr vorzustoßen, und die Engländer, die sich allerdings bei den Dardanellen blutige Köpfe geholt hatten, etwa eine Landung im Golf von Alexandrette erzwangen, um sich mit den Russen zu vereinen, schlugen die Wellen des Krieges rettungslos hinter mir zusammen. Andererseits hatte uns schon auf der Fahrt nach Aleppo ein Eisenbahningenieur, ein Kroate, versichert, Bagdad sei von den Engländern besetzt; das war natürlich leeres Gerede, denn dann hätte der Feldmarschall auf dem Rückzug nach Westen sein müssen. Enver Paschas Telegramm strafte all diese Etappengerüchte Lügen. In Islahije schließlich hatte es geheißen, die Russen kämen Mosul immer näher. Ob ich überhaupt Bagdad erreichen würde, erschien also immerhin etwas unsicher, und doppelt unsicher war ich daher über den Weg, den ich einzuschlagen hatte. Mein Reisekamerad Graf Wilamowitz sollte eine Trainkolonne den Euphrat entlangführen; ihm und dem Obersten von Gleich, dem neuen Stabschef bei von der Goltz, konnte ich mich auf ihrem 800 Kilometer langen Ritt anschließen. Aber es gibt nichts Einförmigeres als die ewigen Wüsten an den Ufern des Euphrat. Da war es doch reizvoller, über Nesibin nach Mosul zu fahren, die Ruinen von Ninive zu sehen, von dort auf einem „Kellek“, einem Floß, den Tigris hinabzutreiben und die Altertümer von Nimrud und Assur zu besuchen. Freilich machten die Schammarbeduinen, die wegen ihrer Überfälle berüchtigt sind, den Weg bis Mosul unratsam, wenn ich nur auf den Schutz meines Kutschers angewiesen blieb. Auch waren die Nebenflüsse des Euphrat, die vom Armenischen Gebirge herkommen, zu reißenden Strömen angeschwollen. Aber die eigentliche Regenzeit war ja schon vorüber; in ein paar trocknen Tagen mussten sie wieder fallen. Ich beschloß also, meinem alten Glück zu vertrauen und mich von Aleppo aus gleich ostwärts zu wenden. Frau Koch hatte bereits einen „Arabatschi“, einen Hauderer, gefunden, der mir für 30 türkische Pfund (555 Mark) eine Viktoria und einen Jaile vermieten wollte, und ich beriet gerade mit dem deutschen Etappenkommandanten Rittmeister von Abel, Direktor Hasenfratz und Inspektor Helfiger von der Bagdadbahn und andern deutschen Freunden, wie Wagen und acht Pferde mit der Bahn nach Ras-el-Ain befördert werden könnten, als zwei junge deutsche Offiziere in türkischen Diensten ins Zimmer traten. Der eine von ihnen, Major Reith, hatte als Chef einer Automobilkolonne den Auftrag, die Verkehrsmöglichkeiten auf der Straße zwischen Ras-el-Ain und Mosul zu untersuchen, der andere, sein Bruder, sollte ihn als Arzt begleiten. Major Reith hatte kaum von unseren Beratungen gehört, als er rief: „Aber warum so viel Zeit und Geld verschwenden? Kommen Sie mit mir! Ich habe reichlich Platz für Sie und auch für Ihr Gepäck, und in drei Tagen sind wir in Mosul!“
Diesem verführerischen Vorschlag zu widerstehen, wäre übermenschlich gewesen. Eine günstigere Gelegenheit konnte sich mir ja gar nicht bieten. Also auf nach Mosul!
Drittes Kapitel. Eine missglückte Autofahrt.
Meine bisherigen Reisekameraden waren bereits aufgebrochen: Graf Wilamowitz mit Oberst von Gleich den Euphrat entlang, Vonberg und Welsch nach Ras-el-Ain, wo sie drei Tage auf Pferde und Wagen für die Fahrt nach Bitlis warten mussten, so dass ich ihnen am nächsten Tag noch einmal begegnete. Major Welsch sah ich einige Monate später wieder; Oberstleutnant Vonberg aber sollte von Bitlis nicht mehr zurückkehren: er starb dort am Flecktyphus.
Am 28. März schlug auch für uns die Stunde des Aufbruchs. Das Wetter war herrlich geworden, für unsere Autofahrt nach Mosul mussten die Straßen ausgezeichnet sein. Major Reiths fünf Automobile, zwei Personen- und drei Lastwagen, wurden auf offenen Loren verladen, und am Vormittag setzte sich unsre Kolonne mit neun Chauffeuren und einem türkischen Dolmetscher in Bewegung. Die Lastautos enthielten reichliche Vorräte an Benzin und Öl, Ersatzteile, Gummiringe, Werkzeug, Spaten, Zelte, Tische, Stühle, Betten und Proviant.
Zuerst brachte uns die Bahn nach Muslimije zurück. Dann wandte sie sich nach Osten durch wenig bebautes Land, wo nur hier und da die zusammengedrängten Kuppeldächer eines Dörfchens sichtbar wurden. Diese bienenstockartigen Hütten aus an der Sonne getrocknetem Lehm finden sich überall da, wo anderes Baumaterial, Holz oder Stein, fehlt. Weiter entfernt von der Bahnstrecke, wo Kalkstein zu Tage tritt, sind auch die Dorfhäuschen aus Stein und ihre Dächer flach. Fast ohne Ausnahme liegt auch die kleinste dieser Ansiedelungen auf dem Abhang oder am Fuß eines „Tell“, einer nackten Anhöhe, deren durchweg regelmäßige, flach konische Form aus dem ebenen Gelände einsam hervorragt. Solch ein Tell birgt die Geschichte des betreffenden Dorfes; er reicht bis in die Morgendämmerung der assyrischen und hethitischen Zeit zurück, beginnt vielleicht vor den frühesten menschlichen Urkunden und war auf alle Fälle schon uralt, als mazedonische Hopliten und Hypaspisten, die schweren Fußtruppen und leichter beweglichen Schildträger, durch diese Gegenden vorrückten. Eine Quelle, ein Bach oder auch nur die Nähe von Grundwasser reizten zur Ansiedelung, die dann durch Jahrtausende fortgelebt hat. Alte Häuser stürzten ein; Schutt und Unrat häuften sich auf; aber die nachkommenden Geschlechter bauten auf demselben Platze weiter, und so wuchs der Tell schichtweise zu einem Hügel empor.
Um die Dörfer herum breiten sich Äcker aus, auf denen die Fellachen, die festansässigen Bauern, mit Ochsen pflügen, und Frauen und Kinder in buntzerfetzter Kleidung unserem Zuge offenen Mundes nachschauen. Sonst ist der weiche rote Erdboden gewöhnlich mit Gras und Kräutern bewachsen, und seine Einförmigkeit wird nur selten durch eine wandernde Kamelkarawane unterbrochen. Neben der Eisenbahn wirken die prächtigen Tiere wie Anachronismen. Wie gut, dass es noch Gegenden gibt, wo die Menschen ohne das „Schiff der Wüste“ verloren wären!
Die Stationsgebäude sind feste Blockhäuser. Auf dem Bahnsteig von Akdsche-Kojunli wartet eine Kompagnie Rekruten auf ihren Zug. Der Ort liegt am Sadschur, einem Nebenfluss des Euphrat, und sein trübes Wasser verrät, dass in seinem Quellgebiet Regen gefallen ist. Ein bedenkliches Vorzeichen! Fern im Norden leuchten die Gebirge Armeniens, die zum Taurus gehören, unter ihrer Schneedecke.
Am Nachmittag stiegen wir in Dscherablus am Euphrat aus. Hier begrüßten uns der türkische Etappeninspektor des Flussweges, Oberst Nuri Bei, und Kapitänleutnant von Mücke, der berühmte Kommandant der „Ayesha“, jetzt Chef der Euphratfluss-Abteilung, die nicht weit vom Bahnhof am Ufer große Werften und Werkstätten angelegt hat. Eine kleine Stadt von deutschen und türkischen Häusern war hier erstanden, und auf der Werft waren deutsche Matrosen beim Bau gewaltiger Boote von 12 Meter Länge, 4 Meter Breite und einer Tragkraft von 25 Tonnen; sie sollten Kriegsmaterial den Euphrat abwärts nach Risvanije bringen, von wo eine Feldbahn es nach Bagdad schaffte. Die türkische Werft liegt 25 Kilometer weiter flussaufwärts in Biredschik. Dort baut man seit alter Zeit Euphratboote, sogenannte Schahtur, die 6 Meter lang und 2½ Meter breit sind und auf dem Wasser gewöhnlich paarweise zusammengebunden werden. Das Holz liefern die Gebirgsgegenden oberhalb Biredschik. Flussabwärts ist Holz sehr selten; was an solchen Booten oder Fähren dort hinunterkommt, wird daher gewöhnlich an seinem Bestimmungsort verkauft. Kapitänleutnant von Mücke wollte aber versuchen, die zahllosen Boote, die von Dscherablus ausgingen, zu retten, indem er sie durch deutsche Lotsen mit Motorbooten wieder an ihren Ausgangspunkt zurückbefördern ließ. Die ganze Stromstrecke bis Feludscha beträgt über 1000 Kilometer, ein einzelner Lotse kann sich daher nicht mit ihr vertraut machen. Deshalb sollte sie in zehn Teilstrecken zerlegt und im Herbst eine genaue Karte des ganzen Stromlaufs hergestellt werden, denn dann ist die Schifffahrt am schwierigsten. Jetzt war der Strom im Steigen, aber der Wasserstand wechselte; am 28. März war er schon fast einen Meter höher gewesen als jetzt; nach der bevorstehenden Schneeschmelze erwartete man, dass er wieder um anderthalb Meter steigen werde. Ein während des Hochwassers aufgenommenes Kartenbild würde leicht irreführen, da alle Untiefen, Sandbänke und Riffe dann überschwemmt sind und die Wassermenge bei niedrigem Wasserstand sich zu dem bei Hochwasser verhält wie 1:12. Obendrein sollten an den Ufern Signale angebracht werden mit Angaben über den Verlauf der tiefen Stromrinne und über alles, was der Euphratschiffer wissen muss.
Gleich oberhalb der Werft liegen die Ruinen einer uralten Stadt, die George Smith 1876 entdeckt hat. Auf einer Reise durch Syrien und Mesopotamien im Jahre 1879/80 kam auch Professor Sachau aus Berlin nach Dscherablus — er nennt es Dscherâbîs —, dem Europus der Römer, dem alten Karkemisch, mit dessen Namen die Erinnerung an einen glänzenden Sieg verknüpft ist. Hier schlug Nebukadnezar im Jahr 605 v. Chr., ein Jahr nach Ninives Fall und ein Jahr vor seiner Thronbesteigung, den Pharao Necho. Dieses Ereignisses gedenkt auch die Bibel; zum Propheten Jeremias geschah das Wort des Herrn: „Wider Ägypten. Wider das Heer Pharao Nechos, des Königs in Ägypten, welches lag am Wasser Euphrat zu Karchemis, das der König zu Babel, Nebukadnezar, schlug im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda.“
Als Sachau in Dscherablus eintraf, hatte der englische Konsul Henderson in Aleppo gerade seine Ausgrabungen begonnen. Sie deckten zwei Kulturperioden auf: die uralte hethitische mit künstlerisch ausgeführten Reliefs, breiten Treppen und massiven Häusern, und die römische. Noch bei Ausbruch des Weltkrieges waren englische Archäologen hier an der Arbeit gewesen. Jetzt stand ihr Wohnhaus leer, ihre Betten waren requiriert. Funde und Sammlungen hatte die türkische Regierung versiegeln lassen, damit sich niemand daran vergreife. Durch einen Spalt in der Holztüre sah ich Skulpturen, Vasen usw. auf Regalen und auf dem Boden aufgestellt. Von den größeren Skulpturen draußen auf dem Hof sind, fürchte ich, einige durch die Beduinen beschädigt worden. Seit Dscherablus ein so wichtiger Punkt auf der Etappenstraße nach Bagdad geworden ist, haben Türken und Deutsche die strengsten Maßnahmen zum Schutz der ausgegrabenen Altertümer getroffen. Das Ruinenfeld war auch in bestem Zustand. Da standen in langen Reihen die aus der Erde gegrabenen mächtigen Steinplatten, geschmückt mit Löwen und Greifen und den Bildern assyrischer Könige. Ein etwa einen Meter langer geflügelter Löwe trug außer seinem eigenen Kopf noch den eines Mannes mit eigentümlicher Zipfelmütze oder Krone. Die Grundmauern alter Häuser traten deutlich hervor, oft auch die Einteilung der Räume.
Oberhalb dieses Ruinenfeldes erhebt sich ein Hügel mit Spuren einer Akropolis, und von hier aus bietet sich eine herrliche Fernsicht. Flussabwärts verliert man den Euphrat zwischen seinen ziemlich hohen Ufern bald aus den Augen. Unmittelbar unter uns springt die Brücke der Bagdadbahn von Ufer zu Ufer, und weiterhin liegt eine Flottille von Kähnen, die mit dem erwarteten Schneewasser in wärmere Gegenden fahren soll.
Als die Dunkelheit unseren Studien im Freien ein Ziel setzte, versammelten wir uns an Kapitänleutnant von Mückes Tisch in der Offiziersmesse. Hier berichtete nun der Held der „Ayesha“, ein glänzender Vertreter des Offizierskorps der deutschen Marine, selbst über seine märchenhaften Abenteuer, wie er auf der nördlichsten Kokosinsel von der „Emden“ an Land ging, mit seinem kleinen Schoner über den Indischen Ozean das Rote Meer erreichte und sich in blutigen Kämpfen mit Araberstämmen durchschlug, bis der Weg nach Konstantinopel frei war.
Auch hier in Dscherablus gingen allerhand Etappengerüchte um, die befürchten ließen, dass sich die Russen von Norden her näherten. Teile einer türkischen Division waren auf dem Marsch nach Mosul, also auf dem Wege, den wir morgen mit dem Auto einschlagen sollten, überfallen worden; offenbar hatten die Russen die Eingeborenen aufgewiegelt, um den Verkehr auf der Etappenstraße zu stören. Die Türken hatten natürlich die Kurden in die Flucht gejagt. Aber war die Straße nun wieder frei?
Die Antwort auf diese Frage gab ein Telegramm aus Kut-el-Amara, das mir in diesem Augenblick ein Matrose überbrachte: „Habe bereits Großes Hauptquartier benachrichtigt, dass keinerlei Bedenken gegen Ihre Herreise vorliegen. Freue mich sehr, Sie wiederzusehen. Goltz.“
Wenn der Feldmarschall „keinerlei Bedenken“ hatte, mussten mir auch die bedrohlichsten Etappengerüchte gleichgültig sein.
Spät am Abend begleitete uns Kapitänleutnant von Mücke zum Bahnhof. Unsere Automobile waren schon nach Ras-el-Ain vorausbefördert, um sich dort reisefertig zu machen; am andern Morgen sollten wir wieder zu ihnen stoßen.
Gegen Mitternacht rollte unser Zug langsam nach Osten der 950 Meter langen Euphratbrücke zu, die mit zehn eisernen Bogen auf neun Steinpfeilern das gewaltige Flussbett überspannt. Die Nacht war sternenhell. Vor ihren Blockhäusern standen die Bahnwärter mit bunten Laternen unbeweglich wie Statuen. Bald begannen Räder und Schienen zu singen und zu donnern, die Brücke war erreicht, und im matten Schein der Sterne breitete der majestätische Strom seinen weiten Spiegel zu unseren Füßen aus. Dann stieg die Geschwindigkeit; die Bahn lief am Fuß von Anhöhen entlang und kletterte zwischen ihnen mit merkbarer Steigung auf das öde, einförmige Flachland zwischen Euphrat und Tigris hinauf.
Als ich am Morgen erwachte, waren wir schon fast am Ziel. Weit bis zum Horizont dehnte sich das Land eben wie eine Tischplatte oder doch nur ganz schwach gewellt. Hier und da verstreut zeigten sich schwarze Nomadenzelte und trieben Hirten ihre Herden auf die grüne Steppe. Der Himmel strahlte in sonniger Klarheit, der Tag versprach heiß zu werden; nur im Norden schwebten über den Bergen weiße Wolken, und weit im Süden stand der Dschebel (Bergrücken) Abd-el-Asis da wie ein hellblauer Schild. Wir überschritten einen kleinen Flussarm und waren im nächsten Augenblick in Ras-el-Ain.
Die fünf Autos warteten in Ras-el-Ain schon auf uns, und Major Reith brannte darauf, seinen Auftrag so schnell wie möglich auszuführen. In der türkischen Etappenkommandantur versicherte man uns obendrein, die Wege seien gut und trocken und die beiden Arme des Dschirdschib, die wir einige Kilometer östlich von Ras-el-Ain zu passieren hatten, jetzt ganz schmal. Also los!
Das ganze elende Dorf war auf den Beinen, als unsre Kolonne zur Abfahrt bereitstand. Vorauf die beiden Personenwagen, der erste ein Benz, von Major Reith selbst gelenkt, mit Dr. Reith, einem Chauffeur und mir als Passagieren; hinterdrein die drei Lastautos. ¾10 Uhr setzten wir uns in Bewegung. Die Straße hätte nicht besser sein können, das Gelände war eben oder ging in sehr flachen Wellen, und nach 17 Minuten waren wir schon am ersten Arm des Dschirdschib. Die Furt war ein paar hundert Meter nördlich von der Straße. Die Personenwagen brausten schäumend durch das Wasser und waren bald wieder auf dem Trocknen, aber die Lastautos fuhren auf der steilen, linken Uferterrasse fest, und es kostete unsere vereinten Anstrengungen, sie wieder freizumachen.
Nun bogen wir vom Damm der Bagdadbahn allmählich nach links ab, den Telegraphenstangen nach, die unsere einsame Straße verfolgten. Wir überholten einen Wanderer, einen Jaile und eine Karawane von Mauleseln. Sonst sahen wir an Lebewesen nur in einiger Entfernung einen Wolf, dem der Major vergeblich ein paar Kugeln nachschickte.
Schon nach 22 Minuten hatten wir auch den zweiten Flussarm des Dschirdschib erreicht. Er führte kaum drei Kubikmeter Wasser, sein Bett war hart und voller Kies, und die Uferböschung flach. Dieses Hindernis wurde also ohne Schwierigkeit genommen. Als wir dann aber in einen Hohlweg mit weichem Boden gerieten, fuhr ein Lastauto so gründlich fest, dass wir mit Spaten und Hebeln drei Stunden schwer zu arbeiten hatten.
In nordöstlicher Richtung ging es weiter, dem Gebirge von Mardin entgegen. Wie ein breites gelbrotes Band zog sich die Straße in leichten Krümmungen durch die grüne Steppe. Lerchen, Wildgänse, Falken und Geier beherrschten die Luft; auf der Erde sah man nur zahllose Löcher von Feldmäusen und hier und da die Reste eines gefallenen Kamels oder Maulesels. Ein türkischer Offizier, der uns auf seinem Jaile begegnete, berichtete uns, der Weg vor uns sei gut; zwei schwierige Stellen habe man ausgebessert, da Enver Pascha in Bagdad erwartet werde. Bei dem Dorfe Arade rasteten drei deutsche Soldaten, die vor einem Monat aus Bagdad aufgebrochen waren; dort sei es, versicherten sie, schon damals bedeutend wärmer gewesen als jetzt hier bei Arade.
Beim nächsten Dorf — Bunas mit Namen — standen mehrere Zelte, deren Bewohner ihre Rinder- und Schafherden zusammentrieben. Hier lebten Fellachen, Ackerbauer, und Beduinen, Nomaden, durcheinander, die eintönige Steppe wurde daher nicht selten durch bestelltes Feld unterbrochen. Die Dörfler starrten verwundert unsren vorbeisausenden Autos nach, von denen das erste die türkische — weißer Halbmond und Stern in rotem Feld —, das zweite die deutsche, schwarzweißrote Flagge führte.
Schon legte sich Abendstimmung über die Landschaft. Die Sonne verbarg sich hinter den Wolken. Einige Araber zu Pferde zeigten uns den Weg, der fast geradeaus nach Norden führte, wo die Berge von Mardin immer schärfer hervortraten. In dem Dorf Abd-el-Imam zeigten sich prächtige Gestalten, besonders Frauen in roten Trachten, zwischen den Hütten. Schließlich kamen wir über eine kleine neuerbaute Steinbrücke, eine seltsame Erscheinung in dieser Gegend, und an einem Tell ohne Dorf vorüber und bogen ¼7 Uhr etwa 50 Meter seitwärts von der Straße ab. Hier sollte unser erstes Nachtquartier auf dem Wege nach Mosul sein.
In militärischer Ordnung wurde unser Lager aufgeschlagen. Unsere Wagen- und Zeltburg — links die drei Lastautos, rechts die Personenwagen, vorn zwei Zelte und hinten die offene vierte Seite nach der Wüste zu — bildete einen kleinen Hof, in dessen Mitte bald ein Feuer brannte. Mit dem Dolmetsch Gabes waren wir insgesamt zwölf Mann. Im Handumdrehen waren die beiden Offizierszelte aufgerichtet, die Betten fertiggemacht, die Zeltstühle um eine Kiste gestellt, Büchsenkonserven, Suppe, Fleisch und Gemüse, gekocht, und bald saßen wir beim Schein einer Karbidlampe um unsern Abendbrottisch, während die Mannschaft es sich in malerischen Gruppen am Lagerfeuer bequem machte. Dann wurde die Lampe ausgelöscht, die Zigaretten angezündet, und wir lauschten noch eine Weile den frischen Gesängen der Chauffeure.
Am 30. März waren wir schon um ½ 6 Uhr zum Aufbruch fertig. Da erhob sich plötzlich aus Nordwest ein rasender Sturm, und kalter Regen peitschte die Steppe. Heraus mit den Regenmänteln! Und nun vorwärts zum Aufmarsch der Kolonne auf der Straße! Das erste Lastauto zog an, aber der Erdboden war bereits so feucht, dass die Räder nicht recht fassten. Noch einmal losgekurbelt! Man hörte ein betäubendes Knattern und Schleifen — und plötzlich stand die Maschinerie still. Die Chauffeure sprangen herunter, und eine kurze Untersuchung ergab als Resultat: das Auto ist ein Wrack, die nötigen Ersatzteile können nur aus Scham-allan-han am Taurus beschafft werden — und das kann ein paar Wochen dauern!
Nun kam das zweite an die Reihe. Es fuhr an, ratterte und krachte — und dann stopp! Genau derselbe Schaden wie beim ersten! Auch dieser Wagen war also erledigt. Der Major biss die Zähne zusammen über dies Missgeschick; aber nur nicht den Mut verlieren! Umladen, und dann mit dem Rest der Kolonne weiter!
Das dritte Lastauto wurde bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit, die drei Tonnen betrug, beladen; genügenden Vorrat an Benzin, Proviant, Öl und Wasser mussten wir mitnehmen, außerdem Betten, Kleider, Zelte und anderes. Die beiden Wracks blieben fast mit ihrer ganzen Last zurück. Darunter befanden sich mein Zelt, meine Proviantkiste und mein Primuskocher mit Kessel. Drei Chauffeure, Conrad, Buge und Lopata, und der türkische Dolmetsch Gabes sollten das unfreiwillige Depot bewachen und auf Ersatzteile warten. Waffen, Geld und Proviant hatten sie genug.
Gegen 1 Uhr war endlich alles fertig, und nachdem wir noch eine gründliche Regendusche von Nordwesten her erhalten hatten, fuhren wir los. Bei Tell-Ermen, einem großen Dorf mit Trümmern von Kirchen und Moscheen, kamen wir auf die alte Straße von Urfa nach Nesibin, den Heerweg Alexanders des Großen. Nordwärts führte ein anderer Weg über Mardin nach Diarbekr und Bitlis. Schon trat Mardin auf dem Gipfel eines Bergrückens immer deutlicher hervor. Aber wir kamen nur langsam vorwärts. Der nasse Erdboden klebte an den Rädern und bildete weiche Ringe von rotem, plastischem Lehm. Bei dem Dorfe Deguk am Westufer eines kleinen Flussbettes mussten wir die ganze männliche Bevölkerung aufbieten, um die Wagen das ziemlich steile Ostufer hinaufzuschieben.
Es regnete nicht mehr. Wenn wir nur erst an Nesibin vorüber und von dem Gebirge fort wären, wo die Niederschläge am stärksten sind! Dann wird sich das Wetter wahrscheinlich aufhellen. Aber bis dahin geht es noch entsetzlich langsam! Das Benzauto fährt voraus, muss aber immer wieder auf das Lastauto warten, das schnaufend herankommt; man hört, wie der Motor sich aufs äußerste anstrengt. Wir lassen es ein Stück voranfahren, folgen ihm, haben es bald überholt und warten wieder. So geht es in einem fort, bis wir endlich das kleine Dorf Bir-dava erreicht haben.
Einige Dorfbewohner laufen herbei und winken eifrig. Mein mangelhaftes Türkisch muss nun zur Verständigung dienen.
„Halt!“ rufen die Leute, „ihr könnt nicht weiterfahren. Gleich östlich vom Dorf ist eine Senkung, die der Regen in einen Sumpf verwandelt hat. Da sinken eure Wagen bis zu den Achsen ein, und ihr kriegt sie nie wieder los.“
„Wie weit geht der Moorboden?“ frage ich.
„Etwa drei Stunden nach Osten. Weiter kennen wir die Gegend nicht. Aber bis Nesibin wird es wohl nicht anders sein.“
„Gibt es weiter nördlich oder südlich keinen Weg?“
„Nein, die Senkung erstreckt sich sehr weit nach Norden und Süden.“
„Hat es in der letzten Zeit viel geregnet?“
„Nein, noch gestern war der Weg bis Nesibin ganz trocken. Heute aber ist er durch Regen unmöglich geworden.“
„Wie lange dauert es gewöhnlich, bis der Boden trocken wird?“
„Einen oder zwei Tage, wenn die Sonne scheint.“
„Glaubt ihr, dass es noch mehr Regen geben wird?“
„Das weiß Gott allein. Auf alle Fälle müsst ihr hier warten; denn eure schweren Wagen würden im Schlamm versinken.“
Einen Versuch wollten wir dennoch wenigstens mit dem kräftigen Benzauto machen. Die Straße führte unmittelbar nördlich an den kleinen elenden Lehmhütten von Bir-dava vorüber, dann senkte sich das Land zu einer flachen Mulde, an deren tiefster Stelle ein gemauerter Brunnen stand; er war jetzt von einer Wasserlache umgeben. Hinab kamen wir ganz gut. Als es aber wieder aufwärts ging, blieben wir rettungslos in dem zähen Lehm stecken. Unsere Chauffeure und einige Männer aus dem Dorf mussten aus Leibeskräften arbeiten, um uns wieder nach Bir-dava hinaufzubringen. Für heute blieb uns nichts anderes übrig, als hier auf ein besseres Morgen zu warten.
Die drei Wagen wurden nebeneinandergestellt, daneben das schwarze Zelt des Majors, das kaum unsre Betten fasste. Darüber brach die Nacht herein. Die Mannschaft hatte ihr Lager im Lastauto hergerichtet, und ihr Teekocher brannte lustig zwischen den Benzinfässern. Aber heute sangen die Chauffeure nicht, die Anstrengungen des Tages hatten sie übermüdet. Einer von ihnen, namens Lundgren, war schwedischer Abkunft, aus Umeå, aber in Deutschland geboren; die andern hießen Hofmeister, Buschkötter, Ludwig und Bodak — lauter tüchtige, prächtige Männer, die für solch eine Reise wie geschaffen waren.
Der Himmel sah bedenklich aus, nur ein einziger Stern blitzte zwischen den zerfetzten Wolken. Ich lag noch eine Weile wach und lauschte der wunderbaren Stille der Wüste, die nur hier und da von Hundegebell in der Ferne oder von den Lauten eines Nachtvogels unterbrochen wurde. Ich hörte meine Uhr unter dem Kopfkissen ticken und die langen, tiefen Atemzüge meiner beiden Reisekameraden. Dann schlief auch ich ein.
Gegen 11 Uhr aber erwachte ich durch einen furchtbaren Sturzregen. Schwere Tropfen platschten draußen in neu entstandene Wasserlachen und trommelten auf die Zeltbahnen. Und das Trommeln dauerte die ganze Nacht mit unverminderter Heftigkeit! So oft ich erwachte, hörte ich dieses trostlose Rauschen, das uns mindestens auch für den nächsten Tag den Weg nach Osten versperren musste.
Am Morgen spannten wir bei immerfort strömendem Regen die Zelttür zu einem Dach auf, das von zwei Stangen getragen wurde, und frühstückten auf dieser luftigen Veranda Eier und Schinken, die wir auf einem Primuskocher gebacken hatten. Nach Norden zu lag die freie Steppe vor uns, aber von den nahen Bergen war keine Spur mehr zu sehen. Schwere Wolken schwebten über der Erde, und wer das Zelt verließ, sank fußtief in den roten Schlamm ein.
Gegen Mittag hörte der Regen eine Weile auf. Da kamen auch schon die Dorfleute neugierig heran, und ein altes runzliges Weib bat um Medizin für ihren Sohn, den seit einigen Tagen starker Kopfschmerz und Fieber plagten. Dr. Reith gab ihr etwas für den Kranken. Vor kurzem war in Bir-dava der Flecktyphus ausgebrochen und hatte von den fünfunddreißig Einwohnern sieben weggerafft. Für Geld und gute Worte brachte man uns etwas armseliges Reisig zu einem Feuer, dessen Glut wir in einem eisernen Kessel ins Zelt trugen, um in der feuchten Kälte nur ein gewisses Gefühl von Wärme und Trockenheit zu gewinnen. Kleine zerlumpte Kinder sammelten Konservenbüchsen und leere Flaschen, und die Dorfhunde wurden immer frecher auf der Suche nach Abfällen. Sogar eine Maus quartierte sich unter unseren Kisten und Säcken ein und entwischte uns immer wieder, so oft wir auch Jagd auf sie machten.
Schließlich begann es wieder zu regnen. Man hörte und sah, wie ein Regenschauer nach dem andern wolkenbruchartig über die Steppe daherkam. Sogar in unserm Zelt waren wir nicht mehr sicher. Die Chauffeure mussten ringsherum einen Kanal graben und einen Erdwall aufwerfen, um uns vor Überschwemmung zu schützen. Vor dem Eingang bauten sie eine Brücke aus Planken des Lastautomobils. Das ganze Feld war ein einziger Sumpf, denn es dauerte lange, bis das Regenwasser den Lehm durchdrang, dessen Oberfläche glatt war wie Seife. Ein tragikomisches Schauspiel bot eine vorüberziehende kleine Karawane von Mauleseln: die auf den schwer beladenen Saumsätteln sitzenden Araber hatten ihre schwarz- und braungeränderten Mäntel über den Kopf gezogen, und der Regen floss nur so von ihnen und ihren Tieren herunter. Die endlich hereinbrechende Dämmerung wirkte fast wie eine Erlösung. Wir bereiteten mit möglichster Langsamkeit unser Abendessen und überließen uns einer neuen Nacht.
Gegen Mitternacht weckte mich wiederum ein fast tropischer Regenguss aus dem Schlaf. Feine Wassertropfen sprühten durch das Zelttuch auf uns herab, und einige Stunden später regnete es so kräftig herein, dass Dr. Reith in das Unwetter hinaus musste, um den Schutzlappen des Zeltfensters an der Windseite wieder festzubinden, der aufgegangen war.
Am Tage wurde es nicht besser. Die Zelttür musste geschlossen bleiben, denn der Wind stand gerade gegen sie; wir frühstückten auf meinem Bett und saßen da wie Schiffbrüchige auf kleiner Klippe in einem Meer von Schlamm; der Zeltgraben stand ebenfalls bis an die Ränder voll Wasser. Die schmutzigen Hunde wurden immer kecker, da wir sie nicht verfolgen konnten. Dazu kam die erschreckende Nachricht, dass der Kranke von gestern über Nacht gestorben sei — wir hatten also den Flecktyphus als nächsten Nachbarn!
Später am Tage sahen wir denn auch, wie sich ein kleiner Leichenzug nach dem Friedhof bewegte, der in einiger Entfernung südöstlich von unserm Zeltplatz lag. Auf einer Bahre trug man den Toten langsam dahin. Am Grabe sprachen die Begleiter Totengebete; bald reckten sie die Hände in der Richtung nach Mekka empor, bald sanken sie in dem fürchterlichen Schlamm neben der Leiche nieder. Endlich wurde der Tote in die Erde gesenkt, abermals Gebete gesprochen und das Grab zugeschaufelt. Ich glaube, die Zeremonie dauerte ein paar Stunden. Dabei regnete es unaufhörlich, und die groben Mäntel der Fellachen glänzten von Wasser. Nach vollbrachter Arbeit ging das Trauergefolge ebenso langsam nach Haus, wie es gekommen war.
Während der Flecktyphus-Epidemie in Aleppo haben deutsche Ärzte die Beobachtung gemacht, dass Europäer für Ansteckung weit empfänglicher sind als Eingeborene. Auch hat sich während des Krieges gezeigt, dass die Krankheit bei russischen Soldaten und Kosaken einen milden Verlauf nimmt, weil sie an Ungeziefer gewöhnt sind. Je älter der Patient ist, umso schwerer kommt er durch.
Einem türkischen Soldaten, der gen Westen ritt, gab der Major einen Brief mit, worin er die zurückgelassenen Chauffeure über unsre Lage unterrichtete. Sonst zeigte sich kein Reisender, der kühn genug gewesen wäre, den Kampf mit den Elementen aufzunehmen.
Bei Dunkelwerden hörte der Regen auf. Da brachte „Lohengrin“ — wie Lundgren von den Kameraden genannt wurde — das Teewasser ins Zelt und meldete, im Norden sei eine Reihe Feuer sichtbar. Was mochte das sein? Biwakfeuer? Doch nicht etwa russische? Aber das war unmöglich, dann hätten wir etwas von einem Rückzug der Türken merken müssen. Diese waren aber im Vormarsch. Nach der Karte lag in jener Richtung, nur 10 Kilometer entfernt, Mardin, das sich seit gestern hartnäckig hinter dem Regenschleier verborgen hatte; die Feuer waren nichts anderes als die Lampen in den Häusern dieser Stadt. Wir konnten uns also ohne Sorge in unserm Gefängnis zur Ruhe begeben und den Regenschauern lauschen, die am Abend mit vermehrter Heftigkeit einsetzten.
Am nächsten Tag dasselbe Bild! Man steht auf, wäscht sich, kleidet sich an, öffnet einen Spalt der Zelttür, frühstückt und hat den ewig langen Tag vor sich. Ich habe Bezolds „Ninive und Babylon“ und „Moltkes Briefe aus der Türkei 1835–39“ bei mir, aber die Ruhe zum Lesen fehlt. Man wartet in sehnsüchtiger Qual, dass irgendetwas geschehe, uns aus dieser hoffnungslosen Lage zu befreien. Volkstypen zu zeichnen ist auch unmöglich; Leute mit Flecktyphus bringenden Läusen ins Zelt hereinlassen — das fehlte noch! Im Dorfe geht das Leben seinen alltäglichen Gang. Frauen treiben von den Feldern Schafe und Ziegen herein oder holen in Lehmkrügen Wasser am Brunnen. Der Himmel ist blauschwarz. Zuweilen grollt unglückverheißend und dumpf der Donner in den Bergen. Und das ist Mesopotamien im April, wo ich Frühlingswärme erwartet hatte, Trockenheit und Skorpione! Aber wir waren ja freilich in einer Höhe von 550 Meter und am Fuß eines Gebirges, wo der Winter noch nicht gewichen war. Nachmittags um 5 Uhr zeigte das Thermometer nur 10 Grad, eine Temperatur, die wir nach den warmen Sonnentagen in Aleppo als Kälte empfanden.
Drei Soldaten kamen von Ras-el-Ain zu Fuß; sie hatten unsre verunglückten Automobile und das Zelt der Chauffeure gesehen. Ein paar andere zogen in entgegengesetzter Richtung. Sie waren schon 20 bis 30 Kilometer östlich von Nesibin in das Moorbad geraten, das bis hierher reichte, und sie gaben uns die tröstliche Versicherung, dass mindestens zwei Tage warmer Sonnenschein nötig seien, um das Land wieder zu trocknen.
Am Nachmittag trat einen Augenblick die Sonne hervor, und mit ihr in Nordnordwest die alte Festung von Mardin auf dem Gipfel des Bergkammes; unmittelbar darunter die Häuser wie Schwalbennester an den Böschungen, dazwischen die armenischen und syrischen Kirchen und weißen Minarette. Aber bald verschwand wieder alles unter schwarzen Wolkenmassen und neuen Regenschauern.
Eine verzweifelte Lage! Wären wir nur einen Tag früher aufgebrochen, so wären wir bereits in Mosul! Die ganze Strecke ist nur 320 Kilometer lang, für ein Auto zwei Tage Fahrt. Nun saßen wir in diesem elenden Gefängnis und konnten weder vor- noch rückwärts. Proviant hatten wir ja noch für acht Tage, nur Brot und Wasser gingen zu Ende. Aber an letzterem war ja kein Mangel — wir brauchten nur ein Stück Segeltuch aufzuspannen, um die Kannen gefüllt zu erhalten.
Am Morgen des 3. April weckte uns die Meldung, die Sonne scheine. Wirklich! Der halbe Himmel blau und hell, und über die andere Hälfte segelten freundliche weiße Frühlingswolken. Wir kleideten uns in aller Eile an und rasierten uns sogar aus lauter Feststimmung. Für vier Soldaten, die von Ras-el-Ain daher gewandert kamen, kauften wir bei der Dorfbevölkerung einige Brote, denn sie hatten nichts mehr zu essen, da sie während der Regentage hatten liegen bleiben müssen.
Dann beobachteten wir mit zunehmender Spannung, wie die Regenlachen zusammenschrumpften und die Ackerschollen rings um unsern Lagerplatz immer deutlicher hervortraten. Kurz nach Mittag war alles Wasser auf der Erdoberfläche verschwunden. Nur um Zelt und Autos herum war der von uns und den Chauffeuren zerstapfte Lehmschlamm noch fußtief. Die Mistkäfer aber schienen dem guten Wetter noch kein Vertrauen zu schenken, so eilig rollten sie ihre Erdklümpchen daher.
Nun zeigte sich auch wieder Leben auf der Straße. Eine Karawane von fünfzig mit Munition beladenen Kamelen zog nach Nesibin, und ein türkischer Offizier kam mit seinem Diener von Westen geritten. Wir luden ihn in unser Zelt ein und bewirteten ihn mit Kakao und