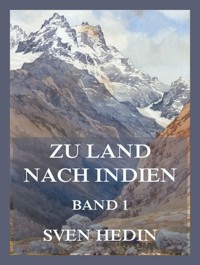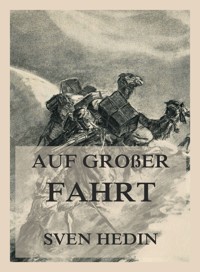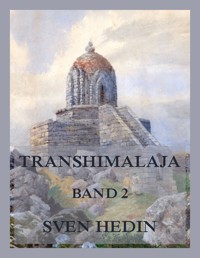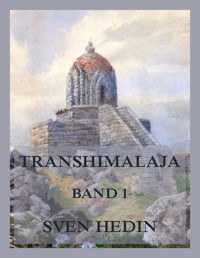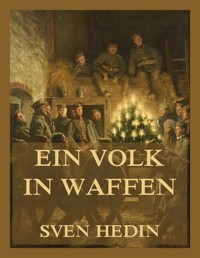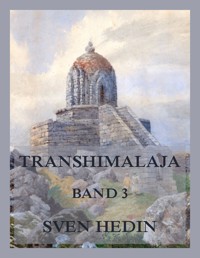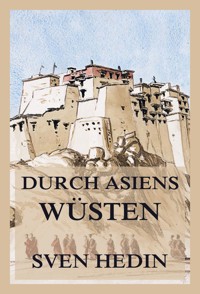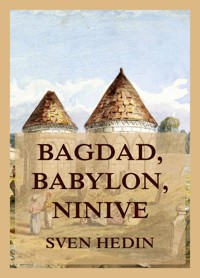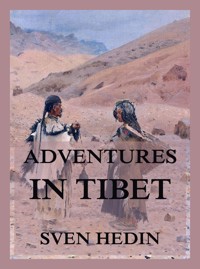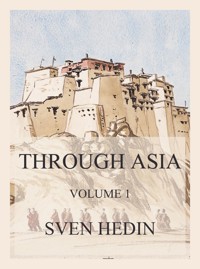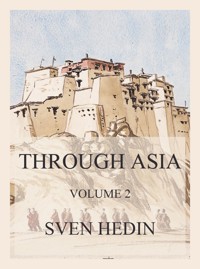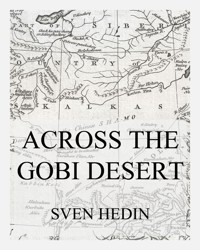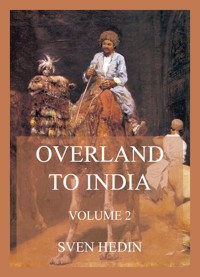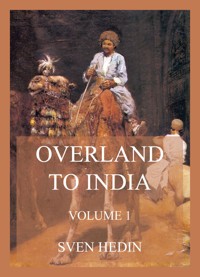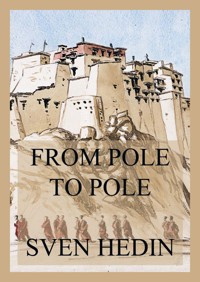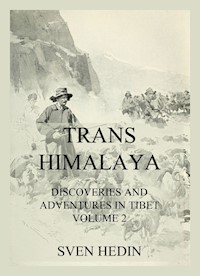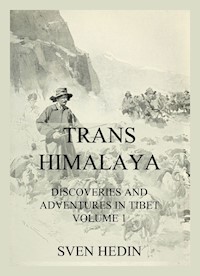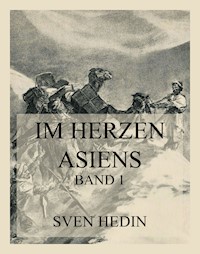
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten im Herzen Asiens, wo Großbritannien, Russland und China ihre Finger nach einem möglichen Zusammentreffen ausstreckten, liegt der geheimnisvolle Landstrich, der in den meisten Geographiebüchern nur auf einer halben Seite erwähnt wird . Es ist eine Region, für die sich die Menschen wenig interessiert haben. Der Norden und der Süden der Welt sind eifrig erforscht worden; den Pol und die Sahara hat man sozusagen vor unsere Türen gelegt. Aber im Laufe der Jahrhunderte gab es nur wenige Versuche, in den Kern des geheimnisvollen Ostens vorzudringen. Schon der Name Hotan, Pamir, Mus-tagh-ata hat etwas, das die Phantasie kitzelt, und viele werden beim Aufschlagen von Dr. Sven Hedins Buch eine Art mystischen Schauer verspüren. Dr. Hedin besitzt viel Humor, aber sein Buch ist sehr ernst zu nehmen. Er hat Tausende Kilometer durchquert, wo kein Europäer jemals zuvor einen Fuß hingesetzt hatte; seine Abenteuer und Erfahrungen waren an sich schon außergewöhnlich, und seine Entdeckungen von weitreichender Bedeutung; aber vielleicht liegt der Charme des Buches tatsächlich in der Kunst des Autors, seine Geschichte einfach und ungekünstelt zu erzählen und das menschliche Interesse von der ersten bis zur letzten Seite lebendig zu halten. Es gibt kaum ein faszinierenderes oder spannenderes Reisebuch . Die Beschreibungen der verschiedenen Versuche, den Mus - tagh - ata zu erklimmen, die wunderbaren Auswirkungen der Landschaft auf die geistigen und körperlichen Empfindungen des Reisenden lassen die Nerven beim bloßen Lesen kribbeln . Mit der Karawane, dem Kamel, dem Yak oder zu Fuß hat Dr. Sven Hedin über 9000 Kilometer zurückgelegt, davon über 3000 Kilometer unentdecktes Gelände. Insgesamt, einschließlich der Reisen mit der Bahn oder Fahrzeugen, legte er über 21000 Kilomter während dieser vier anstrengenden Jahren zwischen 1893 - 97 zurück. Seine wissenschaftliche Arbeit war unermüdlich. Frierend zwischen Gletschern, von der Hitze versengt in trockenen Ebenen, von Kopfschmerzen geplagt in der dünnen Atmosphäre der Berggipfel, fast verdörrt vor Durst in den Wüsten, hat der unerschrockene Forscher dennoch nie versäumt, seine Beobachtungen aufzuzeichnen. Zwischen dem Bagrash-köll im Norden und dem Koko-shili-Gebirge in Tibet hat er ein riesiges Stück Neuland erforscht und eine Menge unschätzbaren Materials gesammelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Herzen Asiens
Zehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden
Band 1
SVEN HEDIN
Im Herzen Asiens 1, S. Hedin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663094
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
Vorwort zur ersten Auflage.1
Einleitung.2
Zweites Kapitel. Vorbereitungen zur Wüstenfahrt.19
Drittes Kapitel. Die Schiffswerft in Lailik.27
Viertes Kapitel. Zweitausend Kilometer auf dem Tarim.37
Fünftes Kapitel. Der verzauberte Wald.47
Sechstes Kapitel. Vierzig Kilometer zu Fuß.60
Siebentes Kapitel. Friedliche Heiligengräber.71
Achtes Kapitel. Der große, einsame Tarim.85
Neuntes Kapitel. In schwindelnder Fahrt flußabwärts.93
Zehntes Kapitel. Der Jumalak-darja auf dem Wege durch die Sandwüste.104
Elftes Kapitel. Im Kampf mit dem Treibeise.114
Zwölftes Kapitel. Wir frieren fest und gehen ins Winterquartier.129
Dreizehntes Kapitel. Eine französische Visite.144
Fünfzehntes Kapitel. Das endlose Wüstenmeer.164
Sechzehntes Kapitel. Dreihundertvierzig Kilometer in 30 Grad Kälte.182
Siebzehntes Kapitel. Zwischen vergessenen Gräbern und ausgetrockneten Flußbetten.190
Achtzehntes Kapitel. Die Ankunft der burjatischen Kosaken in Tura-sallgan-ui.203
Neunzehntes Kapitel. Der Kurruk-tag und der Kurruk-darja.211
Zwanzigstes Kapitel. Das gelobte Land des wilden Kamels.224
Einundzwanzigstes Kapitel. Der frühere See Lop-nor.238
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Fünfundzwanzig Tage im Kahn.249
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Gefährliche Wasserfahrten.265
Vierundzwanzigstes Kapitel. Die letzte Reise der Fähre.281
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Poesie im innersten Asien.291
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Aufbruch nach Tibet.298
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Über den Tschimen-tag, Ara-tag und Kalta-alagan nach dem oberen Kum-köll.312
Achtundzwanzigstes Kapitel.326Fünftausend Meter über dem Meere.326
Neunundzwanzigstes Kapitel. Eine lange Seefahrt.343
Dreißigstes Kapitel. Über stürmische Seen und himmelhohe Berge.356
Einunddreißigstes Kapitel. Aldats Tod.374
Zweiunddreißigstes Kapitel. Ein trügerisches Feuer.384
Dreiunddreißigstes Kapitel. Über sechs Pässe.392
Vorwort zur ersten Auflage.
Das Buch, das ich hiermit den Freunden der geographischen Forschung auf Gnade und Ungnade übergebe, widme ich in der deutschen Ausgabe aus treuer Anhänglichkeit meinen deutschen Studiengenossen.
Es ist meine erste und teuerste Pflicht, unter denjenigen, welche bei vielen vorhergehenden Gelegenheiten meine Pläne mit verständnisvollem Interesse und mit Wärme erfaßt haben, Sr. Majestät König Oskar von Schweden und Norwegen, der mit gewohnter Freigebigkeit meine Reise ermöglichte, meine aufrichtigste Dankbarkeit zu bezeugen.
Auch Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland bin ich zu großem Dank verpflichtet für die Unterstützung, die er die Gnade hatte mir zuteil werden zu lassen. Die Kosakeneskorte, die mir der Kaiser zur Verfügung stellte, war für mich von unschätzbarem Wert. Selten habe ich solche Treue und solchen Gehorsam gefunden wie in den Jahren, die ich mit diesen Kosaken zusammen verlebte. In Verbindung hiermit muß ich auch dem russischen Kriegsminister General Kuropatkin dafür danken, daß er mir infolge seiner hohen Stellung die Reise in mehr als einer Beziehung erleichterte.
Sehr zu Dank verpflichtet bin ich allen meinen Landsleuten, die in freigebiger Weise einen ansehnlichen Teil der notwendigen Mittel zur Reise beisteuerten, während ich aus Eigenem das Honorar meiner früheren Reisebeschreibung für meine neuen Forschungen auf asiatischem Boden verwendete.
Mein Buch erhebt nur den Anspruch, ein in großen Zügen angelegtes Tagebuch meiner Erfahrungen und Erlebnisse im Herzen von Asien und eine Beschreibung jener Gebiete zu sein, die ich auf einer Wanderung von über 10000 Kilometern durchquert habe. Diese Länder sind vor mir noch nie besucht und noch weniger beschrieben worden und verdienen daher Aufmerksamkeit. Ich habe versucht, einen Begriff davon zu geben, wie man in der großen Einsamkeit Asiens lebt und wie die Tage dort vergehen. Durch Asien wandelt man nicht auf Rosen. Die Mühe findet jedoch ihren Lohn in dem Bewußtsein, das Wissen der Menschheit vergrößert zu haben. Die wissenschaftlichen Resultate der Reise berühre ich in diesem Buche nur flüchtig, da sie einem besonderen Werke vorbehalten sind, dessen Herausgabe die Freigebigkeit des schwedischen Reichstags ermöglicht hat. Auf die hochverdienten Reisenden, die vor mir oder gleichzeitig mit mir Asien bereist haben, habe ich in meinem Werke selten Bezug genommen, um auf dem mir zur Verfügung stehenden Raume den Verlauf meiner eigenen Reise ausführlicher schildern zu können.
Die absoluten Höhen hat Herr Dr. Nils Ekholm ausgerechnet. Die beigegebenen Karten können nur als vorläufige betrachtet werden. Mit Benutzung meines großen Kartenmaterials hat Hauptmann Byström sie in sehr verdienstvoller Weise, die viele Mühe gekostet hat, ausgeführt. Schwedische Künstler haben durch naturgetreue, wohlgelungene Bilder zum Schmucke der Arbeit beigetragen. Allen diesen Herren sage ich meinen herzlichen Dank für ihre Mitarbeit.
Meine Mutter ist mir eine unermüdliche Korrekturleserin gewesen; sie hat meinen guten Namen vor vielen Schnitzern bewahrt!
Sven v. Hedin.
Einleitung.
Am Johannistage des Jahres 1899, als der nordische Sommer in seiner größten Schönheit prangte, brach ich zum vierten Male von Stockholm nach dem Herzen von Asien auf, zu neuen Forschungen und Abenteuern im fernen Osten. Die Schiffe im Hafen waren reich mit Flaggen geschmückt, sie feierten das Johannisfest. Nur meine Eltern, Geschwister und nächsten Freunde standen am Ufer, als der Dampfer „Uleåborg“ langsam den Stockholmer Strom hinabglitt. Welche Schicksale und Entbehrungen ich auch während der folgenden drei Wanderjahre zu erdulden gehabt, ich habe keinen schwereren Tag erlebt als diesen ersten; denn eine weit größere Entschlossenheit als nachher täglich erforderlich ist, gehört dazu, sich von der Umgebung loszureißen, mit der man von Kindheit an durch die heiligsten Bande des Lebens verknüpft ist.
Auf dieser Reise führte ich viel schwereres Gepäck mit als auf meinen früheren; es wog nicht weniger als 1130 Kilogramm und war in 23 Kisten verteilt, von denen die meisten eigens so angefertigt waren, daß sie von einem Pferde bequem paarweise transportiert werden konnten. Meine Ausrüstung war auch jetzt sehr vollständig. Damit der Leser einen Begriff davon hat, wie man für eine Asienreise ausgerüstet sein muß, will ich hier die wichtigsten Gegenstände aufzählen.
Um mit den astronomischen Instrumenten zu beginnen, so benutzte ich diesmal einen Universalreisetheodoliten und drei Chronometer. Diese Instrumente sind unter allen Umständen die empfindlichsten und erfordern die liebevollste Sorgfalt. Sie nahmen auf der Reise nicht den geringsten Schaden und kamen unversehrt wieder heim.
An topographischen Instrumenten war ich versehen mit: Nivellierfernrohr mit Meßstangen und anderem Zubehör, Nivellierspiegel, Bandmaßen, Kompassen, Diopterkompaß mit Prisma zur Ablesung der Winkel, Meßtisch mit Stativ und Diopter.
Ich nahm auch zwei Strommesser mit, vorzügliche Apparate, die bei unzähligen Gelegenheiten gebraucht wurden und sich auch beim Rudern für Distanzmessungen erfolgreich verwenden ließen.
Die meteorologische Ausrüstung bestand aus einem Hypsometer mit 5 Kochthermometern, einem Aspirationspsychrometer, ein paar Aktinometern, einem Anemometer, einem Regenmesser und einer großen Anzahl gewöhnlicher Thermometer, Quellenthermometer, Maximum- und Minimumthermometer, Thermometer zur Untersuchung der Bodentemperatur usw. Das Kgl. Nautisch-Meteorologische Institut in Stockholm hatte mir einen Tiefseethermometer überlassen. Einen Barographen und einen Thermographen mit vierzehntägigem Gang hatte ich eigens herstellen lassen. Diese selbstregistrierenden Apparate waren mir zur Kontrolle von unschätzbarem Nutzen und arbeiteten vortrefflich. Ein großer Vorteil war, daß ihre Glasgehäuse so dicht schlossen, daß weder Sandstürme, noch atmosphärischer Staub ihren Gang im geringsten beeinflußten.
Drei Aräometer ließen nichts zu wünschen übrig, als daß die Skalen den sehr salzigen Seen Tibets hätten besser angepaßt sein müssen.
Nicht weniger als 58 Brillen hatte ich bestellt. Sehr wenige von ihnen kamen wieder ganz nach Hause. Besonders die Schneebrillen, grau und blau in verschiedenen Nuancen und mit ungeschliffenen Gläsern, fanden bei meinen Karawanenleuten und anderen Eingeborenen reißenden Absatz.
Dieselben Waffen, die mich 1893–97 begleitet hatten, leisteten mir auch jetzt Dienste. Ich hatte sie als Geschenk von dem Direktor der Waffenfabrik zu Husqvarna erhalten, der jetzt so gütig war, mich mit vier weiteren schwedischen Offiziersrevolvern und einer Menge kleinerer Revolver, die hauptsächlich zu Geschenken an die Eingeborenen bestimmt waren, sowie mit reichhaltiger Munition auszurüsten. Da die vier Kosaken, die mir Seine Majestät der Zar auf die Reise mitgab, mit den neuen russischen Magazingewehren versehen waren, besaßen wir ein ziemlich starkes Arsenal, 10 Gewehre und wenigstens 20 Revolver.
Daneben wurden natürlich unzählige Sachen mitgenommen, die ich hier nicht aufzählen kann. Ein paar verdienen jedoch besonders erwähnt zu werden: ein zusammenlegbares Bett, das mir im Sommer die behaglichste Ruhe verschaffte; im Winter und in Tibet schlief ich auf der Erde. Mit großer Zufriedenheit denke ich auch an „James’ Patent Folding Boat“ zurück (Abb. 1). Es bestand aus zwei Hälften, die beim Gebrauche zusammengesetzt wurden und eine sehr leichte Last für ein Pferd ausmachten; sogar ein Mann allein konnte es tragen. Sein Zubehör bestand aus zwei Rudern mit Klammern, Mast und Segel und zwei Rettungsbojen. Dieses kleine Fahrzeug war nicht nur von großem Nutzen, sondern bereitete mir auch eine sehr angenehme Abwechslung in der Einförmigkeit des Karawanenlebens. Dank ihm konnte ich in den tibetischen Seen Lotungen vornehmen, was vorher nie geschehen war; auch während der Flußreise leistete es mir große Dienste. Es erweiterte mein Arbeitsfeld und trug mich über Seen, die ich sonst nur vom Ufer aus hätte ansehen können. Einmal setzte dieses leichte, flinke Fahrzeug die ganze Karawane über einen tibetischen Fluß, dessen Umgehung uns großen Zeitverlust verursacht hätte.
Die photographische Ausrüstung erwies sich in jeder Hinsicht als vortrefflich. Dieselbe Watson-Camera, die fast ein Jahr im Flugsande der Wüste Takla-makan begraben gelegen, begleitete mich auch jetzt. Außerdem hatte ich eine kleine Veraskopcamera, ein ganz vorzügliches Instrument, einen Kodak Junior und einen Daylightkodak von Eastman. Es spielte keine Rolle, daß letzterer meinen Erwartungen nicht entsprach, da die drei anderen während der ganzen Reise vortrefflich funktionierten. Die Linsen waren die vorzüglichsten, die zu haben waren; als Glasplatten, die die schwerste Nummer meines Gepäcks ausmachten, benutzte ich Edwards „Antihalo“. Mit allem, was zum Entwickeln, Fixieren und Kopieren gehört, war ich ebenfalls ausgestattet und den größten Teil der aufgenommenen Platten (etwa 2500) entwickelte ich im Laufe der Reise selbst. Nur 700 Platten waren bei der Heimkehr noch nicht entwickelt. Sie wurden immer in verlöteten Blechkasten verwahrt. Allerdings kostete das Entwickeln der Bilder Zeit, aber ich fand, daß die Arbeit in hohem Grade an Interesse gewann, denn es versteht sich von selbst, daß es ein angenehmes Gefühl der Sicherheit gibt, wenn man weiß, daß die Platten gelingen und die Apparate dicht sind. Übrigens muß sich die Expositionszeit nach den Lichtverhältnissen richten, die in Ostturkestan und in Tibet sehr verschiedenartig sind. Da ich eine so vollständige photographische Ausrüstung hatte, kam ich selten dazu, Zeichnungen zu machen, und hatte auch selten Zeit dazu; meist sind ja auch Photographien infolge ihrer absoluten Treue wertvoller.
Hier sei auch erwähnt, daß eine Menge Kleinigkeiten, wie Messer, Dolche, Ketten, Uhren, Kompasse, Spieldosen usw. mitgenommen wurden, die zu Geschenken an die Eingeborenen bestimmt waren. Ein Eskilstuna-Messer erster Güte wird im innersten Asien weit höher geschätzt als ein viel wertvolleres Geldgeschenk. In vielen Fällen sind derartige Kleinigkeiten besser als Scheidemünze und selbstverständlich billiger.
Papier zum Kartenzeichnen, Tage- und Notizbücher, Schreibmaterial, Tintenpulver und dergleichen hatten ebenfalls ein achtunggebietendes Gewicht, aber ich bedurfte dieser Sachen für eine Karte von 1149 Blättern und für ein Tagebuch von 4500 Seiten!
Zur Verwahrung und Beförderung der empfindlicheren Sachen hatte ich sechs Koffer von Korbgeflecht mit wasserdichtem Futteral bestellt. Sie waren leicht und sehr stark und nahmen keinen Schaden, während Holz- oder Eisenkisten gründlich beschädigt wurden. Ferner wurde mir eine dauerhafte Kiste mit 300 Glasröhren für naturgeschichtliche Präparate geliefert.
Die Proviantfrage wurde außerordentlich befriedigend gelöst. Alle Waren (acht Kisten) hielten sich vorzüglich; besonders delikat waren die Schildkröten-, Kaiser- und Ochsenschwanzsuppe, die, fertig in Dosen, nur gewärmt zu werden brauchten. Um eine Schaf- oder Antilopenfleischsuppe schmackhaft und kräftig zu machen, war Liebigs Fleischextrakt unschätzbar und sehr praktisch, da er sich leicht mitnehmen ließ.
Alles war für eine Reise von zwei Jahren berechnet und reichte daher nicht aus. Aber bis in die Lop-nor-Gegend stand ich von Zeit zu Zeit mit Europa in Verbindung und konnte somit im Sommer 1901 Verstärkung erhalten, nicht nur an photographischem Material und Konserven, sondern auch für meine Kasse.
Meine Bibliothek war nicht groß; sie bestand aus: Bibel, Gesangbuch und einem Büchlein mit dem Titel „Parole für den Tag“, das ein Band zwischen mir und den Meinen in der Heimat bildete, ferner aus Supans „Grundzüge der physischen Erdkunde“, Geikies „The great Ice Age“ und Hanns „Handbuch der Klimatologie“, Kerns „Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien“, Rhys Davids „Buddhism“, ein paar wissenschaftlichen Nachschlagebüchern, sowie aus Odhners schwedischer Geschichte und ein paar Werken schwedischer Dichtkunst. Alle Karten, welche Reisende über das innerste Asien veröffentlicht hatten, wurden in einer besonderen Mappe verwahrt. Ich konnte demnach ihre Routen sorgfältig vermeiden und Gegenden aufsuchen, wo ich der erste war.
Ein so bedeutendes Gepäck 5300 Kilometer weit auf der Eisenbahn als Passagiergut mitzunehmen, hätte natürlich große Kosten verursacht. Mich aber kostete es nicht eine Kopeke. Seine Majestät der Zar hatte meinem Reiseplane großes Interesse entgegengebracht und mir für Rußland freie Reise und für mein Gepäck Fracht- und Zollfreiheit bewilligt.
In Petersburg genoß ich vom 26.–30. Juni 1899 wieder die Gastfreundschaft unseres Gesandten Reuterskiöld. Wie leid tat es mir, als ich eine Woche später von seinem plötzlichen Hinscheiden hörte! Unserem neuen Gesandten in Rußland, dem Grafen Aug. Gyldenstolpe, bin ich für die große Bereitwilligkeit, mit der er sich sowohl damals als auch während der drei folgenden Jahre meiner Interessen liebevoll angenommen hat, größten Dank schuldig. Er hatte die Güte, es so einzurichten, daß ich, außer der freigebigen Unterstützung, die ich von meinem Freunde Emanuel Nobel erhalten hatte, auch das ganze Reisegeld auf bequeme Weise in Taschkent erheben konnte. In Petersburg hatte ich auch die Freude, täglich mit meinem alten Wohltäter und Freunde, dem berühmten Polarforscher Professor Freiherrn A. von Nordenskiöld zusammenzutreffen. Zu tiefer Trauer für alle, die ihn liebten und bewunderten, und zu unersetzlichem Verluste für die Wissenschaft und unser Vaterland wurde auch er während der Zeit, in der ich fern von der Heimat weilte, dahingerafft.
Ich werde den Leser nicht mit einer Beschreibung der Fahrt durch Rußland und Westasien ermüden. Dem Plane dieses Buches gemäß muß ich an bekannten Orten vorübereilen und den Leser so schnell wie möglich nach dem eigentlichen Schauplatze neuer Erfahrungen und geographischer Entdeckungen führen. Während der letzten Zeit, bevor ich Stockholm verließ, hatte ich angestrengt gearbeitet, und es war daher eine wahre Erholung, sich in dem bequemen Abteil ausstrecken zu können, ungestört durch Korrekturen, Telephon und Zeitungen und Tausende von Bagatellen, die in einem zivilisierten Staate unsere Zeit und unsere Gedanken in Anspruch nehmen. Es war schön, Träumen und Plänen freien Lauf lassen zu können und zu fühlen, daß man sich mit jeder Minute dem Ziele näherte.
Die Fahrt ging über Moskau, Woronesch und Rostow am majestätischen Don und weiter nach Wladikawkas, denselben Weg, den ich bei meiner ersten Reise 1885 zurückgelegt hatte. Von da führte der Weg über das langweilige Petrowsk und über die weite Fläche des Kaspischen Meeres nach Krasnowodsk, einem der trübseligsten Orte, die man sich denken kann.
Kriegsminister General Kuropatkin hatte die große Freundlichkeit gehabt, telegraphisch in Krasnowodsk Befehl zu erteilen, daß mir zur Reise nach Andischan ein ganzer Eisenbahnwagen zur Verfügung gestellt werde. In diesen wurde all mein Gepäck verstaut, und ich selbst hatte es so bequem wie in einem Hotel. Da mein Wagen der letzte im Zuge war, konnte ich von seiner hinteren Plattform aus den Blick über die öde Landschaft schweifen lassen. Ich hatte die Schlüssel zum Wagen und war von den übrigen Leuten im Zuge vollkommen isoliert. Daher konnte ich bei der drückenden Hitze so leicht gekleidet als nur denkbar umhergehen und mich ab und zu im Toilettezimmer an einer Dusche erfrischen.
Am 7. Juli verließen wir nachmittags 5 Uhr die Küste des Kaspischen Meeres, rollten in den asiatischen Kontinent und verloren uns in der öden Steppe. Um Mitternacht fiel die Temperatur, die mittags in Krasnowodsk 37 Grad im Schatten betragen hatte, auf 28 Grad, und die Lebensgeister, die in der Hitze eingeschlummert waren, wachten wieder auf. Am Nachmittag des 8. Juli erreichten wir Aschabad, wo ich Oberst Svinhufvud traf, den ich von meiner vorigen Reise her kannte und der hier Bahnhofsinspektor war.
Ich muß eine kleine Episode von meinem neuen Zusammentreffen mit diesem sympathischen, heiteren Finnen einschalten. Ich bat ihn, nach Merw Auftrag zu geben, daß mein Wagen dort vom Zuge abgekoppelt und bei der ersten Gelegenheit an einen nach Kuschk bestimmten Zug angehängt werde. Auf der Reise durch Transkaspien war ich nämlich auf den Gedanken gekommen: warum sollte ich mir nicht das berühmte Kuschk und die Grenze gegen Herat ansehen, da auf meiner Fahrkarte doch klar und deutlich geschrieben stand: „Mit allerhöchster Erlaubnis wird Dr. Sven Hedin freie Reise und freie Gepäckbeförderung auf allen russischen Bahnen in Europa und Asien bewilligt“!
Oberst Svinhufvud lächelte freundlich, nahm aus seinem Taschenbuch ein Telegramm vom Kriegsministerium und las. „Im Falle, daß Dr. Sven Hedin beabsichtigt, sich nach Kuschk zu begeben, teilen Sie ihm mit, daß dieser Weg allen Reisenden verschlossen ist.“
Damit war die Sache entschieden. In meinem Herzen dachte ich, daß das russische Kriegsministerium sehr klug handelt, wenn es einen Punkt, der in strategischer Hinsicht von großer Bedeutung ist, so scharf bewacht. Ich erfuhr auch, daß diese Seitenbahn nicht einmal Russen offen steht; nur Militärpersonen, die nach der Festung Kuschk kommandiert sind, dürfen sie benutzen.
Am 9. Juli, um 2½ Uhr morgens, waren wir in Merw, von wo die neue Bahnlinie südwärts nach Kuschk abgeht. In der Oase Tschar-dschui mit ihrer lebhaften Station war die Ankunft unseres Zuges das große Ereignis des Tages. Gleich hinter der Station Amu-darja rollte der Zug auf der gewaltigen Holzbrücke über den gleichnamigen Fluß, was volle 26 Minuten dauerte. Als ich 1902 zurückkehrte, war die neue Eisenbrücke fertig.
Nach kurzer Fahrt war ich in Samarkand mit seinem reichen Vegetationsgebiete, das ich am Morgen des 10. Juli verließ. Hinter Dschisak hatten wir die einförmige, ebene Steppe zu kreuzen. Die Stationen heißen nach Generalen, die in der Geschichte des Landes eine Rolle gespielt haben, Tschernajewa, Wrewskaja usw. Schließlich rollt der Zug über den Sir-darja, und man ist in Taschkent, der Hauptstadt Turkestans, mit ihrem großen, lebhaften Bahnhofe, dessen Bedeutung noch größer wird, wenn in ein paar Jahren die Bahnstrecke Orenburg-Taschkent fertig ist.
Nach einem Besuche beim Generalgouverneur und bei alten Freunden und nachdem ich im Observatorium meine Chronometer verglichen hatte, verließ ich am Abend des 12. Juli Taschkent wieder.
Hinter Tschernajewa fährt der Zug das Ferganatal hinauf. Im Süden zeigte sich die turkestanische Bergkette, die bald in den Alai mit seinen schneebedeckten Kämmen und Gipfeln übergeht. In Dörfern oder wo Wege die Bahnstrecke kreuzen, haben sich manchmal Sarten versammelt; sie haben sich noch nicht ganz mit der seltsamen, schnellen „Maschina“, die auf dem „Temir-joll“ (Eisenbahn) dahinsaust, befreundet. Um 9 Uhr erreichten wir Andischan, den Endpunkt der zentralasiatischen Eisenbahn.
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, war es mir eine große Freude, meinen alten treuen Diener Islam Bai (Abb. 2) dastehen zu sehen, ebenso ruhig und sicher wie sonst; im blauen Chalate mit der von König Oskar von Schweden verliehenen goldenen Medaille auf der Brust. Er war sich gleich geblieben, sah gesund und kräftig aus, war aber freilich älter geworden, und sein Bart war ergraut; er selbst meinte, er sei ein Greis geworden. Ich begrüßte ihn herzlich; dann unterhielten wir uns drei Stunden lang, teils über seine vier Monate lange Heimreise von Urga im Jahre 1897, teils über die bevorstehende Reise. Islam erfaßte meine Pläne mit dem lebhaftesten Interesse. Es war mir eine Beruhigung, ihm jetzt das ganze Gepäck anvertrauen zu können, das er auf Arben (Wagen) nach Osch führte. Von diesem Tage an wurde er wieder mein Karawan-baschi (Karawanenführer); er kannte von früher her genau meine Reisegewohnheiten und Wünsche und besorgte alles, was zur Karawanenausrüstung gehörte. — Armer Islam Bai! — Mit den schönsten Hoffnungen traten wir zusammen jene lange Reise an, die für ihn auf so beklagenswerte, unglückliche Weise enden sollte!
Erstes Kapitel. Über den ersten Paß des Kontinents.
In Osch verlebte ich zwei sehr angenehme Wochen bei Oberst Saizeff, meinem vortrefflichen Freunde aus Pamir, und im Kreise seiner liebenswürdigen Familie. Er war jetzt Ujäsdnij natschalnik (Distriktschef) über den Distrikt Osch, der 175000 Einwohner zählt, während seine Hauptstadt von 35000 Sarten, 150 Russen und 800 Mann Garnison bewohnt ist. Die einzige Unbequemlichkeit während meines Aufenthalts in Osch war eine heftige Augenentzündung. Doch ich verlor nicht viel durch diesen unfreiwilligen Arrest, denn Islam Bai ordnete unterdessen das Gepäck, stellte die Karawane zusammen, mietete Diener, ließ zwei Zelte anfertigen und besorgte die notwendigen Einkäufe. Einmal besuchten Saizeff und ich Islam in seinem Heim, einer einfachen, ärmlichen Lehmhütte in der Sartenstadt, wo er auf eigenem Grund und Boden mit seiner Frau und fünf Kindern wohnte, unter die ich Goldmünzen und andere Geschenke verteilte, um sie über die bevorstehende Trennung von dem Gatten und Vater zu trösten. Auf der vorigen Reise hatte Islam monatlich 25 Rubel erhalten; jetzt wurde sein Lohn auf 40 erhöht, was für einen Asiaten, der überdies ganz freie Station hat, eine bedeutende Summe ist. Der Lohn des ersten Jahres wurde als Vorschuß Oberst Saizeff eingehändigt, der davon monatlich 10 Rubel an Islams Familie auszahlte.
1. Das englische Faltboot auf dem Panggong-tso in Westtibet.
2. Islam Bai.
3. Brücke oberhalb Gultscha.
4. Meine erste Karawane.
Als ich mich ganz wiederhergestellt fühlte und alles bereit war, wurde die Abreise auf den 31. Juli 1899 festgesetzt. Die Karawane brach frühmorgens auf und lagerte im Dorfe Madi. Nach einem glänzenden Diner bei Oberst Saizeff verließ ich nachmittags Osch, begleitet von meinen Wirten und verschiedenen jungen Damen und Offizieren. In einem Haine bei Madi waren die Zelte aufgestellt, und der Min-baschi der Gegend hatte eine geräumige Jurte (Zelt) mit Stühlen und Tischen hergerichtet, die unter den Delikatessen des Dastarchans (Imbiß) beinahe brachen. In der Dämmerung kehrten meine russischen Freunde nach Osch zurück. Erst jetzt war ich von der Zivilisation abgeschnitten und fühlte, daß ich mich wieder auf der Reise befand. Als abends 9 Uhr die erste Reihe meteorologischer Ablesungen gemacht wurde, war ich wieder im alten Gleise und gedachte der 1001 Nächte, die ich vor nicht langer Zeit unter ähnlichen Verhältnissen im Herzen des großen, öden Asiens verlebt hatte! Jetzt aber bewohnte ich ein prächtiges Zelt aus doppeltem, wasserdichtem Segeltuch, das mit Teppichen geschmückt und mit dem Feldbett und meinen Instrumentkisten möbliert war. Gesund und herrlich war es, wieder im Freien im Zelte zu wohnen, vor mir ganz Asien und eine Welt von Hoffnungen auf neue, wichtige Entdeckungen!
Islam hatte zwei nette junge Hunde, die wirklich hübsch zu werden versprachen, angeschafft; der eine, ein Hühnerhund, hieß Dowlet (Reichtum), der andere, ein asiatischer Wilder von gemischtem Blute, hörte auf den Namen Jolldasch (Reisegefährte). Sie wurden an mein Zelt angebunden, um allmählich daran gewöhnt zu werden, daß sie dessen treue Wächter sein müßten, was nicht viele Tage dauerte. Ich hatte diese Hunde so lieb, daß mir später ihr Verlust den tiefsten Schmerz bereitete.
Die Karawane bestand aus Islam Bai als Führer, Kader Ahun und Musa, Dschigiten (Kuriere) aus Osch, die für 15 Rubel monatlich angeworben waren, und vier Karakeschen (Pferdewärtern), welche die 26 Pferde begleiteten, die ich für 8 Rubel pro Stück für die ganze Wegstrecke bis Kaschgar (450 Kilometer) gemietet hatte. Die Leute hatten zwei Zelte, um welche das Gepäck ganze Bastionen bildete. Die ersten Tagereisen, soweit die neuangelegte Fahrstraße reicht, zog ich es vor, im Wagen zu fahren.
Am Morgen des 1. August dauerte es ziemlich lange Zeit, bis die Karawane marschfertig war. Es handelte sich darum, die Kisten und sonstigen Lasten genau abzuwägen, so daß sie paarweise gleiches Gewicht hatten und bequem auf dem Packsattel des Pferdes lagen.
Gleich hinter Madi wird die Landschaft durch die ersten Aule (Zeltdörfer) von Ferganakirgisen inmitten großer Herden von Schafen, Ziegen, Rindern, Kamelen und Pferden belebt. Besonders die Frauen mit ihren roten Gewändern, ihren Schmucksachen und hohen, weißen Kopfbedeckungen erregen Aufmerksamkeit. In Bir-bulak mit seinen russischen Häusern und Aulen machten wir den ersten Halt.
Die nächste Tagereise führte uns über den kleinen Paß Tschiger-tschig. Kirgisische Reiter griffen in lange, an der Deichsel befestigte Seilschlingen vor den Pferden meines Phaethons, und munter ging es die Paßhöhe hinauf. Aber die Fahrt abwärts, wo es viel steiler ist und der Weg in unzähligen Zickzackkrümmungen hinläuft, ist recht waghalsig. Würde nicht das eine Hinterrad gebremst, so würde der Wagen schneller hinabrollen, als es für den Fahrenden gut wäre.
Das klare Wasser des Baches Ile-su rauscht herrlich zwischen Steinen und Büschen dahin und bildet oft schäumende Kaskaden. Das Tal öffnet sich, vor uns zeigt sich Gultscha mit seinen leicht zu zählenden russischen Häusern, dem Fort mit einer Sotnja (100 Mann), den Kasernen, der letzten Telegraphenstation und dem Basare, umgeben von schlanken Pappeln. Der kleine Ort liegt am rechten Ufer des Kurschab- oder Gultscha-darja, der ziemlich wasserreich ist, obgleich die Tiefe 80 Zentimeter nicht übersteigt.
Der am rechten Ufer des Gultscha-darja weiterführende Weg ist vortrefflich, obgleich er bergauf und bergab geht; er wird aber auch jährlich sorgfältig unterhalten und muß jeden Frühling ausgebessert werden, weil er, namentlich an den Pässen, durch Lawinen und durch die Schneeschmelze zerstört wird. Die Brücken sind aus Holz und befinden sich an schmalen Stellen, bei denen eine einzige Spannung genügt (Abb. 3). Welch ein Unterschied gegen die schlechten, schwankenden Stege, die für die Bedürfnisse der Kirgisen genügten und die ich während meines früheren Besuches kennen lernte. Seitdem hat der Weg strategische Bedeutung erhalten; er geht durch das Alaital nach Bordoba (Bor-teppe) und von da über den Kisil-art und Ak-baital nach Pamirskij Post. Man kann jetzt den ganzen Weg fahren und Proviant, Bauholz usw. auf Karren nach den Ufern des Murgab bringen; selbst mit Artillerie kann man nun das öde Gebiet von Pamir durchkreuzen. An mehreren Stellen, wie Bordoba und Kara-kul, hat man steinerne Stationsgebäude erbaut. Sie liegen im Terrain so maskiert, daß man ahnungslos daran vorbeireiten würde, wenn man ihre Lage nicht kennte. Sie enthalten heizbare Zimmer mit Proviant usw., wo Reisende und Dschigiten im Winter oder bei Schneestürmen eine erwünschte Freistatt finden sollen. Die kleinen Herbergen und Hütten, in denen ich im Februar 1894 übernachtete, waren eingegangen.
Hier und da steht noch eine Pappel (Terek). Der Artscha (Wacholder) beginnt an den Abhängen aufzutreten. Wir sehen viele, gar nicht scheue Rebhühner. Bei Kisil-kurgan (rote Festung) steht ein kleines Lehmfort, wo die Kirgisen uns Tee vorsetzten. Ein wenig davon entfernt rastete ich im Schatten eines herrlichen Pappelhains, um die Karawane zu erwarten, und erfreute mich im Wagen des schönsten Schlafes, den ich seit langem genossen. Er war mir auch nötig, denn des bewegten nächtlichen Lebens und des Lagerlärms war ich noch ungewohnt. Doch nach einer Stunde weckten mich Rufe und Pfiffe: unsere stattliche Karawane marschierte vorbei (Abb. 4, 5). An der Spitze ritt ein Mann auf einem Esel und führte die drei Pferde, welche meine kostbaren Instrumentkisten trugen. Die übrige Karawane ist in drei Abteilungen geteilt, jede von einem Dschigiten überwacht, während einige Männer zu Fuß gehen, um die Lasten, die herunterrutschen oder nicht im Gleichgewicht sind, zurechtzurücken. Kader Ahun reitet hinterdrein; ihn begleitet ein neuangeschaffter, noch angebundener Karawanenhund. Fröhlich klingen die Glocken und geben ein gellendes Echo. Der lange Zug verschwindet hinter einem Hügel, taucht wieder auf und entschwindet wieder meinen Blicken, indem er langsam einen steilen Hang hinabzieht. Aber bald hole ich ihn ein.
Der Weg wird steiniger und zieht sich große Strecken lang auf der Höhe steil abfallender Schuttkegel und Geröllhügel hin, deren Basis vom Flusse bespült wird. Wo Nebentäler einmünden, öffnen sich malerische Perspektiven in das Gebirge hinein. Immer noch kommen Pappeln und Sträucher vor, die Steigung nimmt ein wenig zu, immer häufiger zeigen sich Stromschnellen, und immer lauter rauscht der Fluß. Bei der Talweitung Kulenke-tokai sieht man am rechten Flußufer einen sehr schönen Pappelhain, wo die Kirgisen freundlicherweise eine Jurte für uns aufgeschlagen hatten, da sich hier gerade keine Nomaden befanden, in deren Zelten wir hätten rasten können. Ich zog jedoch vor, die Ankunft der Karawane abzuwarten, um in meinem eigenen „Hause“ zu wohnen.
An diesem Punkte brachten wir den ersten Ruhetag der Reise zu. Es war ein herrlicher stiller Platz, denn die Pferde waren nach Jeilaus (Weideplätzen) in der Nachbarschaft gebracht worden. Der Himmel war trüb, die Temperatur angenehm. Abwechselnd wehte es talaufwärts und talabwärts, und wie eine Einweihungshymne klang es, wenn der Wind in den Kronen der dicht belaubten Bäume rauschte. Man konnte träumen und diesen wohlbekannten Lauten lauschen, die an so manche Ereignisse von früheren Reisen erinnerten. Ich sah in Gedanken den kommenden Jahren entgegen, in deren Schoße so viele seltsame Ereignisse und Abenteuer, so viele harte Schicksale und Entbehrungen, Verluste, Siege und Entdeckungen schlummern sollten! Noch hatte ich das Gefühl der Einsamkeit nicht völlig überwunden, aber die Zeit stählt das Gemüt, und der Mechanismus des Karawanenlebens geht bald seinen vorgeschriebenen Gang. Der Unterschied gegen die zwei vorhergehenden Jahre war recht schroff. Nach dem Aufenthalte im Weltgetümmel und in zivilisierten Verhältnissen war es ein seltsames Gefühl, wieder fort und vergessen zu sein, von der eigenen Sehnsucht verurteilt, im innersten Asien zu verschwinden. Noch am Abend sang es melancholisch in den Pappeln, und in dem unermüdlichen Rauschen des Flusses glaubte ich die alte, wohlbekannte Mahnung zur Geduld, die schließlich zum sicheren Siege führe, wiederzuhören. Jetzt erschien das Ziel noch fern und dunkel, aber jeder Tag würde mich ihm einen Schritt näher führen, und kein Tag würde ohne neue Erfahrungen und Forschungsgewinne vergehen. Still und verlassen lag das Biwak da; kein Rauch deutete auf Feuer, keine Menschen zeigten sich, denn meine Leute gaben sich in der Jurte dem Schlafe hin, nur der Fluß und der Wind störten die feierliche Stille.
Kurz nach Mitternacht fiel Regen, der lustig auf die Zeltleinwand trommelte. Es klang gemütlich und führte gegen Morgen eine ziemlich fühlbare Abkühlung herbei. Die unerwartete Dusche brachte Leben ins Lager, und die Leute waren sofort auf den Beinen, um das draußen stehende Gepäck unter Dach zu bringen.
Gleich hinter dem Lager überschreiten wir ein paarmal den Fluß und halten uns dann meistens auf dem rechten Ufer. Bei Sufi-kurgan läßt man links das Terektal liegen, das nach dem Passe Terek-davan hinaufführt, über den ein näherer, aber schwerer passierbarer Weg nach Kaschgar geht. Oberhalb dieses Tales ist die Wassermenge des Hauptflusses geringer, doch wird das Tal wieder breit, und sein gleichmäßig abfallender Boden hebt sich grau ab gegen die roten Terrassen von Sand, Geröll und Ton, welche das Bett zwischen ihren lotrechten Wänden einschließen. Dann passieren wir am linken Ufer einen kleinen, sanften Bergrücken auf dem Passe Kisil-beles, wo wir im Schatten massiger Artschas rasten. Es ist recht frisch, es geht ein lebhafter Wind, und auf den Bergkämmen fällt leichter Regen. Das Lager dieses Tages wurde in dem offenen Tale Bosuga aufgeschlagen. Wie gestern legten wir 39 Werst zurück; noch sind Werstpfähle längs des Weges angebracht.
Meine Hündchen Dowlet und Jolldasch waren klassische Wesen; sie waren erst ein paar Monate alt und konnten so weite Strecken noch nicht laufen. Wir hatten sie daher in einem Weidenkorbe hinten an meinem Wagen festgebunden. Anfangs waren sie über diese Art zu reisen so erstaunt, daß sie sich ganz still verhielten; bald aber hatten sie sich daran gewöhnt, und Dowlet, der den besten Platz haben wollte, hielt Jolldasch im Zaume und schalt ihn aus, wenn er nicht gehorchte; der Ärmste winselte beständig ganz jämmerlich. Wenn sie im Lager aus ihrem Gefängnis herausgelassen wurden, waren sie überselig und liefen wie die besten Freunde miteinander, aller Beißereien im Korbe vergessend. Schon jetzt fühlten sie sich im Lager heimisch und schliefen nachts neben meinem Bette. Sie hielten recht gute Wacht und bellten wie toll bei dem geringsten verdächtigen Geräusch. Ihre Mahlzeiten nahmen sie stets bei mir ein und entwickelten dabei einen beängstigenden Appetit.
Die Nacht auf den 6. August war recht kalt, und die Minimaltemperatur fiel auf 1 Grad unter Null. Ich mußte Pelz, Filzdecken und Mütze auspacken Die Luftverdünnung dagegen belästigte mich nicht im geringsten, doch merkte man an der sich bei anstrengenden Bewegungen einstellenden Atemnot, daß hier das herrschte, was die Eingeborenen „Tutek“ nennen, das Gefühl, welches man auf Hochpässen empfindet. Der Weg folgt dem Talldikbache aufwärts, manchmal im Bachbette selbst, das man verläßt, um die Abhänge hinaufzuklettern. Nachdem wir verschiedene Nebentäler passiert, beginnt der eigentliche Anstieg, der nicht sehr steil ist, da der Weg in zahllosen Zickzackwindungen angelegt ist. Das Gestein ist schwarzer, stark gefalteter Schiefer. Auf der Höhe des Talldikpasses steht ein mit einem Geländer umgebener Pfahl; zwei gußeiserne Tafeln an demselben verkünden, daß der Paß 11800 Fuß (3617 Meter) hoch ist, 88 Werst von Gultscha liegt und daß der Weg angelegt worden ist, als A. B. Wrewskij Generalgouverneur und N. J. Korolkoff Gouverneur waren. Die Wegarbeiten begannen am 24. April 1893 und endeten am 1. Juli desselben Jahres unter Leitung des Majors Grombtschewskij. Auf der anderen Seite, nach dem Alaitale zu, ist der Abstieg weniger steil. Kein einziger Wacholder überschreitet den Paß; auf der Alaiseite sind die Abhänge ganz unbewaldet.
Am oberen Sarik-tasch verabschiedete ich meinen Arabatschi (Kutscher) und gab ihm ein anständiges Trinkgeld und einen Dolch; er hatte sich gut geführt und den Wagen wohlbehalten bis ins Alaital gebracht. Von jetzt an ritt ich und weihte einen ungarischen Feldsattel aus Budapest ein. Bald sind wir im eigentlichen Sarik-tasch, wo das Paßtal des Talldik in das große, breite Alaital einmündet; dann biegen wir nach Osten ab, die letzten Werstpfähle hinter uns zurücklassend. Im Süden dehnt sich das großartige Gebirgssystem des Transalai aus; die gewaltigen Bergriesen stehen in kreideweißem, hellblauschimmerndem Schneegewande da, und die meisten der höchsten Gipfel sind wolkenumkränzt. Besonders im Westen sind die Wolken zahlreich, und der Pik Kauffmann ist daher unseren Blicken verborgen. Das Alaital ist breit, offen und reich an Weiden, auf denen hier und dort zahlreiche große Agile (Hürden) mit gewaltigen Herden zu sehen sind. Im Osten wird das Tal von Bergen versperrt, über welche der flache Paß Tong-burun führt, der die Wasserscheide und die östliche Schwelle des Alaitales bildet. Alle Augenblicke kreuzen wir flache Ausläufer vom Alai, die sich nach Süden nach dem Zentrum des Tales hinziehen; ein solcher ist der Katta-sarik-tasch. Hinter diesem überschreiten wir den Fluß Schalwa mit einem großen, steinigen Bett, aber wenig Wasser. Vom Transalai mündet hier das ebenso steinige Tal Mäschallä. Diese Talwege und Flüsse vereinigen sich nach und nach, nehmen mehrere andere auf und bilden allmählich ein Haupttal, dessen Fluß Kisil-su heißt.
Unser Rasttag in Äilämä, wo wir auf dem Wege nach Kaschgar die beste Weide für die Pferde finden sollten, war gerade nicht angenehm, denn es regnete in Strömen und der Herbst der Ferganaberge hatte sichtlich schon seinen Einzug gehalten; doch wir mußten uns damit trösten, daß man es bei solchem Wetter unter Dach besser hat als im Sattel.
Der 9. August war ein herrlicher Tag, und der Regenvorrat der Wolken schien jetzt für einige Zeit erschöpft zu sein. Wir stiegen langsam nach dem Tong-burun-Passe hinauf, einem breiten Bel (Paß), der nach Ansicht der Kirgisen kaum als ein Paß zu betrachten ist. Dennoch bezeichnet die kleine Steinpyramide auf der gleichmäßig abgerundeten, flachhügeligen Höhe eine sehr wichtige geographische Grenzmarke, indem sie den höchsten äußersten Ostrand des Alaitales bildet und die Wasserscheide zwischen dem Aralsee und dem Lop-nor, also eine wichtigere Grenze als selbst der Talldik ist, der nur das Gebiet des Sir-darja von dem des Amu-darja trennt. Von diesem Punkte an fällt das Terrain nach dem Lop-nor ab. Der Abstieg wurde den Pferden sauer, einige Lasten rutschten und verursachten Aufenthalt. Die Berge zur Rechten, die östliche Fortsetzung des Transalai, sind uns ganz nahe; sie sind in Schnee gehüllt und die Spitzen von Wolken bedeckt. Hier und da wachsen kleine Wacholder in den Spalten, und die Sor oder Steppenmurmeltiere (Arctomys bobac) sind unzählbar. Am Eingange ihrer Erdhöhlen auf den Hinterbeinen sitzend, betrachten sie die Karawane und verschwinden, sobald man sich ihnen nähert, mit größter Gewandtheit unter schrillem Pfeifen.
Von der Vereinigungsstelle des Kisil-su mit dem Kok-su gelangen wir über mehr oder weniger tiefe Rinnen zum breiten, tiefeingeschnittenen Tale des Nuraflusses, auf dessen linkem Ufer ein Begräbnisplatz liegt, der unter dem Namen Ak-gumbe bekannt ist. Der Nura war jetzt größer als der Kisil-su, sein Wasser ebenso rot wie das des „Roten Flusses“ und recht unangenehm zu durchreiten, da man die tückischen Rollsteine in dem trüben Wasser nicht sehen konnte und mein Pferd daher beinahe kopfüber in die wilde Flut gestürzt wäre. Nicht weit von hier vereinigen sich Nura und Kisil-su zu einem ansehnlichen Flusse, dessen Bekanntschaft wir bald machen werden. Der Pfad ist ein stetes Bergauf und Bergab, bis man von einem letzten Passe in der Tiefe die weißen Mauern der russischen Grenzfestung Irkeschtam mit ihren Türmen und Kasernen, in denen Kosaken Wacht halten, erblickt.
Irkeschtam ist nicht nur eine Grenzfestung gegen China, sondern auch eine Zollstation; der Vorsteher dieser, Herr Sagen, war ein alter Bekannter von mir von einem früheren Besuche in Kaschgar her. Er war ein großer Tierfreund und hielt eine Menagerie, bestehend aus einem Wolfe, einigen Füchsen und einem Bären, der in einer Hütte mitten auf dem Hofe angebunden war. Einige Zeit nach meinem Besuche war es dem Petz gelungen, sich von seinen Banden zu befreien; er machte einen Besuch im Zimmer der Dschigiten, zum großen Schrecken der Bewohner. Das Abenteuer hatte für Petz ein verhängnisvolles Ende, da die Männer ihre Zuflucht auf das Dach nahmen, von wo aus sie ihren Feind zu Tode bombardierten.
Eine halbe Stunde von Irkeschtam gelangen wir an den „Roten Fluß“, der sehr wasserreich und mehr als 80 Zentimeter tief war. Wir sind jetzt auf chinesischem Boden, und das „Himmlische Reich“ dehnt sich vor uns bis an den Stillen Ozean aus. Der Pfad führte nach dem Tor-pag-bel hinauf. Die ganze Landschaft ist eine öde Sand- und Kiesebene, von Bergen umschlossen, den Ausläufern des Pamirgebirges, die auf beiden Seiten immer niedriger werden und in Geröll- und Kiesrücken und Hügel übergehen. Doch kommt noch immer anstehendes Gestein vor. Wir steigen in das Jegintal hinab, das ein ziemlich wasserreicher Fluß durchströmt, an dessen linkem Ufer ein chinesisches Fort erbaut ist.
Unser Zug schreitet das Tal hinunter, das immer enger wird. Ein schmaler Vegetationsgürtel von Pappeln, Weiden, Sträuchern und Gras begleitet jedes Ufer; er verbreitert sich nach dem Vereinigungspunkte mit dem Kisil-su zu. Die Gegend heißt Nagara-tschalldi (Abb. 6, 7) und ist die herrlichste Oase auf dem ganzen Wege nach Kaschgar.
Unser Lager befand sich nur ein paar hundert Meter unterhalb des Zusammenflusses des Flusses von Nagara-tschalldi und des Kisil-su. Ohne Unfall zog unsere Karawane nach einem Rasttage am 12. August über den Fluß, der zwar wasserreich war, sich aber doch ohne Gefahr überschreiten ließ. Es freute mich, die Wassermenge noch groß zu finden, denn der Kisil-su ergießt sich in den Jarkent-darja, und selbst wenn nur ein geringer Teil des Wassers den Hauptfluß erreicht, würde schon dieser mit dazu beitragen, unsere Fähren nach der Lop-nor-Gegend hinab zu tragen, wohin ich mich auf diese bequeme Weise zu begeben gedachte.
In einer großen Talweitung liegt die viereckige Lehmfestung Ullug-tschat, der äußerste Vorposten der Chinesen gegen die russische Grenze. In Semis-chatun, wo ebenfalls ein kleiner Kurgan (Festung) lag, galt es, den Fluß zum letztenmal zu überschreiten. Doch dies ging nicht so leicht wie bisher. Er strömte in einem einzigen Bette dahin und war dazu im Laufe des Tages so gewachsen, daß die Wassermenge wohl 80–100 Kubikmeter in der Sekunde betrug. Dumpf und schwer wälzte sich die trübrote Wassermasse durch das Bett, tiefe Rinnen verbergend.
Erst versuchte Islam Bai die Furt. Er kam ein gutes Stück vorwärts, geriet dann aber in tiefes Wasser und nahm ein gründliches Bad, ehe er sich nach dem anderen Ufer hinüberretten konnte. Kader, der es an einer anderen Stelle probierte, ging es noch schlechter; er kam in eine tückische Rinne, wo das Pferd nicht festen Fuß fassen konnte und in schwindelnder Fahrt von dem Strome, aus dem nur noch die Köpfe des Pferdes und des Mannes hervorguckten, fortgerissen wurde. Glücklicherweise hatte ich selbst den Transport des Kodaks, den sonst Kader zu tragen pflegte, übernommen. Nun bestieg einer von den Karawanenleuten nackt ein ungesatteltes Pferd, und indem er es suchen, tasten und ausprobieren ließ, gelang es ihm schließlich, eine gute Furtschwelle ausfindig zu machen. Auch die anderen Leute entkleideten sich nun und führten die Karawane in kleinen Abteilungen hinüber, zuletzt die Pferde, welche meine Instrumente und die photographische Ausrüstung trugen, wobei jedes Pferd einzeln geführt und von drei nackten Reitern begleitet wurde, die bereit waren, zuzugreifen, wenn das Pferd fallen sollte. Man empfindet natürlich große Unruhe, wenn man die Kisten schwanken und bald rechts, bald links ins Wasser tauchen sieht, während das Pferd gegen die unerhörte Kraft der gewaltigen Wassermasse ankämpft, die gegen dasselbe drückt und preßt; denn die Furt führt größtenteils aufwärts gegen die Strömung, die schäumend um die Brust des Pferdes wirbelt. Ist der Reiter ungeübt, so wird ihm schwindlig und es scheint ihm, als stürme das Pferd derart vorwärts, daß das Wasser wie um den Vordersteven eines Dampfers kocht, und unwillkürlich hält er die Zügel an, obwohl das Pferd ganz langsam geht (Abb. 8). Auf dem linken Ufer wurden die Lasten wieder in Ordnung gebracht und ein provisorisches Trocknen der nassen Sachen vorgenommen. Wir lagerten in der Nähe eines kirgisischen Auls bei Jas-kitschik und konnten nun dem Kisil-su, der von hier an südlich von unserer Straße fließt, ohne allzu großes Bedauern Lebewohl sagen.
Es war ein schöner, kühler Abend; in der stillen Nacht ertönte aus der Ferne gedämpftes Glockenklingen von der großen Kamelkarawane herüber. Es erweckt bei unseren Hunden einen Sturm der Entrüstung, aber es klingt herrlich und imposant und markiert den majestätischen, ruhigen Gang der Kamele. Immer heller ertönen die Glocken, immer deutlicher hören wir die Rufe und den Gesang der Karawanenleute. Sie ziehen im Dunkel der Nacht mit Lärm und Stimmengewirr an uns vorbei; dann erstirbt das Geräusch wieder langsam in den Bergen.
Die letzten Tagereisen nach Kaschgar führen durch eine recht einförmige Landschaft; die Berge nehmen an Höhe ab, bis ihre äußersten Vorposten sich in der Ebene verlieren. Am 13. August überschritten wir den Mäschrabdavan, auf dessen Höhe sich eine kleine Festung und drei mit Lappen behängte Masare (Heiligengräber) erheben. Ehe wir Kandschugan erreichten, überfiel uns ein so heftiger Platzregen, daß wir Halt machen und so schnell wie möglich die Zelte aufschlagen mußten. Es nützte uns jedoch nichts, denn sowohl wir wie die Sachen wurden gründlich durchnäßt; es klatschte unter den Stiefeln in dem Lehmboden, und als ich endlich ins Zelt kam, wo die triefenden Kisten durcheinander standen, fühlte ich bei der Kälte eine große Unlust, und der Pelz war gar nicht überflüssig; 12,6 Grad um 5½ Uhr nachmittags ist hier in dieser Jahreszeit etwas ganz Abnormes.
Am 15. ritten wir bis an das Dorf Min-joll, und am 16. traten wir die letzte Tagereise bis Kaschgar an. Beim Dorfe Kalta kamen mir der Generalkonsul Petrowskij und einige andere in Kaschgar wohnende Russen, von einer Kosakeneskorte geleitet, entgegen.
5. Meine Kamelkarawane.
6. Rast in der Oase Nagara-tschalldi.
7. Oase Nagara-tschalldi.
Zweites Kapitel. Vorbereitungen zurWüstenfahrt.
In Kaschgar blieb ich vom 17. August bis zum 5. September, um die Karawane, die mich durch die Wüsten des innersten Asiens begleiten sollte, endgültig auszurüsten. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß mein alter vortrefflicher Freund Generalkonsul Petrowskij (Abb. 9) mir auch diesmal in jeder Weise behilflich war. Er stellte mir seine reiche Erfahrung und seinen in Ostturkestan beinahe allmächtigen Einfluß vollständig zur Verfügung, und ohne seinen Beistand wäre vieles kaum ausführbar gewesen.
Die erste Angelegenheit, die wir in Angriff nahmen, war die Einwechslung meiner Reisekasse (11500 Rubel) in chinesisches Silbergeld. Eine Jamba galt damals in den Basaren Kaschgars 71 Rubel, aber der Markt ist so wenig umfangreich, daß ein Einkauf von 161 Jamben sich so fühlbar machte, daß der Wert einer Jamba in ein paar Tagen auf 72 Rubel stieg. Eine Jamba hat 50 Sär zu 16 Tenge, von denen jeder in 50 Pul zerfällt. Ein Sär entspricht 37 Gramm Silber und hat einen Wert von 3,09 Mark; es zerfällt auch in 10 Miskal von je 10 Pung zu 10 Li. Der Kurs unterliegt großen Schwankungen, und die Jamba wiegt selten genau 50 Sär, und da man auf chinesisches Geld angewiesen ist, muß man stets eine chinesische Wage zur Hand haben. In Ostturkestan sind kürzlich runde Silbermünzen von höchstens 8 Tenge Wert eingeführt worden, die neben den gewöhnlichen chinesischen Silberklümpchen — einer sehr unbequemen Geldsorte — im Lande gangbar sind. Ein alter geriebener Makler, Isa Hadschi, besorgte die Umwechslung und schaffte das Silbergeld an, und als die ganze Transaktion fertig war, stellte es sich heraus, daß es ihm gelungen war, uns nur um 36 Rubel zu bemogeln. Für mich war es aber doch ein außerordentlich gutes Geschäft, denn der Wert der Jamba stieg bald darauf schnell. Sich mit einer Reisekasse, die 300 Kilogramm wiegt, zu schleppen, ist gerade nicht angenehm, aber es bleibt einem keine Wahl. Die Jambastücke wurden auf die Kisten, die nicht täglich geöffnet zu werden brauchten, verteilt, und so konnte man doch wenigstens sicher sein, daß nicht alles Geld auf einmal gestohlen werden würde. Der Betrag reichte jedoch kaum für die halbe Reise aus, und ich mußte nachher mehr Silbergeld beschaffen.
Die andere Angelegenheit, die Islam Bai besorgte, waren verschiedene Einkäufe für die Ausrüstung und den Proviant. Auch eine Menge Chalate, Zeugstoffe, Tücher und Mützen wurden angeschafft, die zu Geschenken an die Eingeborenen bestimmt waren. Islam kaufte auch 14 außergewöhnlich schöne und große Kamele und ein Dromedar. Mit Ausnahme von zweien, die alle Strapazen überstanden, waren die Tiere dem Untergange geweiht, aber die Dienste, die sie mir treu und geduldig geleistet, waren hundertmal den Preis wert, den sie gekostet. Führer der Kamelkarawane wurde Nias Hadschi, der sich trotz seiner Wallfahrt zum Grabe des Propheten als ein Erzschelm erwies. Unter den übrigen Dienern, die vorläufig angestellt wurden, will ich besonders Turdu Bai aus Osch nennen, einen alten Weißbart, der es an Ausdauer mit jedem der jüngeren Leute aufnehmen konnte und an Treue und Tüchtigkeit alle die anderen Mohammedaner, Islam inbegriffen, übertraf; er war der einzige, der die ganze Reise mitmachte. Faisullah, ebenfalls ein russischer Untertan, gab Turdu Bai in den genannten guten Eigenschaften nur wenig nach, konnte mich aber nur anderthalb Jahre begleiten. Beide waren Spezialisten in der Behandlung der Kamele und gehörten daher später immer zum „Stabe“ der Kamelkarawanen. Ein Kaschgarjunge, Kader, wurde mitgenommen, weil er der arabischen Schrift kundig war.
Für die nächste Zukunft wurde der Reiseplan so bestimmt, daß die ganze Karawane nach Lailik am Jarkent-darja ziehen sollte. Dort mußte eine Teilung stattfinden. Ich selbst wollte mich mit einigen der Leute und einem kleinen Teile des Gepäcks von der Strömung den Jarkent-darja oder Tarim hinabtragen lassen, während die Hauptmasse der Karawane auf der großen Straße über Maral-baschi, Aksu und Korla ziehen sollte, um mit mir irgendwo im Lop-nor-Gebiete zusammenzutreffen, wo sich nach Verabredung auch die beiden burjatischen Kosaken Ende Dezember einfinden sollten. Petrowskij hielt es für gewagt, die ganze große Karawane und die bedeutende Silbermenge ohne Bedeckung durch ganz Ostturkestan zu schicken, und stellte mir aus dem Konsulatskonvoi die zwei semirjetschenskischen Kosaken Sirkin und Tschernoff (Abb. 10) bis zum Zusammentreffen mit den burjatischen Kosaken zur Verfügung, welches Anerbieten ich dankbarst annahm. Während der folgenden Jahre gaben mir diese beiden Männer täglich Beweise von einer Treue und Tüchtigkeit, die alle Diener, die ich je gehabt, in den Schatten stellte.
Mit dem Konsul traf ich noch das Übereinkommen, daß meine im Herbst und Winter in Kaschgar eintreffende Post viermal von Dschigiten nach der Lop-nor-Gegend zu bringen sei, wo es von ihrer eigenen Klugheit abhängen würde, mich aufzufinden. Der Kurier sollte seinen Lohn erst dann von mir erhalten, nachdem er die Post abgeliefert und seinen Auftrag redlich ausgeführt hatte. Der Plan mißlang nie, und man kann sich denken, wie angenehm es für mich war, auf diese Weise mit den Meinen und der Außenwelt, wenn auch selten, in Verbindung zu stehen.
So verflossen die Tage unter allerlei Arbeit, die durch Besuche und Einladungen zum Mittagessen unterbrochen wurde. Ziemlich oft war ich bei meinem alten Freunde, dem englischen politischen Agenten Macartney, zu Gaste, dessen früher einsames Heim jetzt von einer jungen Gattin verschönt wurde. Es freute mich, den alten Eremiten Pater Hendriks, sowie Herrn und Frau Högberg wiederzusehen, die zur schwedischen Missionsstation zwei neue Mitglieder zugezogen hatten. Chan Dao Tai und Tsen Daloi gehörten zu meinen alten Bekannten, aber Tso Daloi war eine neue Erscheinung; er versah uns mit zwei Durgas, die dafür zu sorgen hatten, daß die Dorfbevölkerung der Karawane alles lieferte, was sie brauchte, natürlich gegen angemessene Vergütung. Auch einen „Kunstgenuß“ hatte ich, da auf dem Markte ein asiatischer „Blondin“ vor dem massenhaft herbeigeströmten Publikum seine Künste auf dem Seile zeigte (Abb. 11).
Ich war nicht der einzige Reisende, der sich in diesen Tagen in Chinas westlichster Stadt befand; am 21. August langte nämlich Oberst McSwiney dort an, in dessen Gesellschaft ich im Jahre 1895 bei der Pamirgrenzkommission so manchen frohen Tag verlebt hatte. Am Tage darauf trafen zwei französische Reisende ein, Herr St. Yves und ein junger Leutnant, die nach einigen Tagen über Pamir wieder heimkehrten.
Als alle Einkäufe besorgt waren, wurden die Lasten noch einmal geordnet, abgewogen und dann an einer Art Holzleitern befestigt, deren Oberenden paarweise aneinander gebunden waren, so daß sie leicht auf das liegende Kamel gehoben und ihm wieder abgenommen werden konnten.
Nachdem ich von meinen Freunden in Kaschgar Abschied genommen, brach ich am 5. September gegen 2 Uhr nachmittags auf (Abb. 12). Jetzt begann die eigentliche Reise und die große, lange Einsamkeit. Noch eine Umarmung, ein letztes Lebewohl, dann ziehen wir bei dem dumpfen, bedeutungsvollen Klange der Glocken, die gleich dem Ticken des Sekundenpendels den Gang der Zeit und die uns dem Ziele zuführenden Schritte angeben, an der westlichen Stadtmauer entlang nach Kum-därwase, wo ich von den Europäern Abschied nahm. Wir hatten gerade die Brücke erreicht, unter der sich das in Farbe und Dicke an eine Hagebuttensuppe erinnernde Wasser des Kisil-su hinwälzte, als der Himmel sich im Nordwesten verdunkelte und schwere, dichte Regenvorhänge sich von den Bergen an ausbreiteten; der Tag war heiß und schwül gewesen und hatte nichts Gutes verkündet. Da kamen die ersten heftigen Windstöße, und zugleich begann ein Platzregen von ungeheurer Gewalt. Auf dem sonst lebhaften Wege sah man nur ab und zu einen Wanderer, weil die Menschen schleunigst in den nächsten Gehöften und Serais Schutz gesucht hatten. Diese waren jedoch für unsere große Karawane zu klein, und es blieb uns also keine andere Wahl, als unseren Weg fortzusetzen. Das Unwetter hielt mit unverminderter Kraft anderthalb Stunden an; ein Blitz nach dem anderen durchzuckte den Himmel in grellem Zickzack von blendendem blauweißem Feuer, und die Donnerschläge krachten mit entsetzlichem Gepolter, stärker als ich es je zuvor gehört. Die Kamele und Pferde nahmen jedoch die Sache ruhig auf, und langsam schritten wir nach Süden zwischen den Weiden hin und trösteten uns damit, daß wir nicht nasser werden konnten, als wir schon waren.
War der Regen unangenehm gewesen, so waren seine Folgen noch schlimmer. Lange Strecken weit lag der Weg unter Wasser, und der lehmhaltige Boden von feinem Staube war so glatt, daß es den Kamelen mit ihren flachen, weichen Fußschwielen schwer wurde, sich auf den Beinen zu halten; sie glitten aus, stolperten, glitschten, und immer wieder wurde der Marsch dadurch aufgehalten, daß ein Kamel gefallen war. Oft fallen sie so nachdrücklich, daß sie alle viere von sich strecken, als hätte ihnen ein unsichtbarer Riese ein Bein gestellt, und dabei poltert die schwere Bürde zu Boden, daß der Schlamm hoch aufspritzt. Von allen Seiten hört man schreien und rufen, die Karawane macht Halt, die Männer eilen herbei, um das Kamel wieder aufzurichten oder es erst von der Last zu befreien und dann wieder zu beladen; die Folge davon ist, daß wir in dem heimtückischen Schlamme wie die Schnecken vorwärtskommen. Am schlimmsten ist es da, wo der Weg uneben ist oder kleine Hügel bildet; dort müssen mit Spaten Tritte in die Erde gegraben werden.
Die erste Tagereise von Kaschgar, die eigentlich eine Kleinigkeit hätte sein müssen, war also durchaus nicht leicht. Nie hatte ich diese Stadt unter ungünstigeren Umständen verlassen. Es war, als hätte eine höhere Macht unseren Aufbruch den unbekannten Gefahren entgegen mit himmlischen donnernden Kanonenschüssen salutieren und uns mit einem überwältigenden Knalleffekt daran erinnern wollen, daß man nicht ungestraft unter Ostturkestans Pappeln wandelt. Für die Zukunft aber sollte ich einen wirklichen Platzregen so bald nicht wiedersehen — als er das nächste Mal eintrat, war es in der Nähe von Lhasa, nach zwei Jahren!
Inzwischen wurde es dunkel, und in den Basargäßchen waren die Papierlaternen schon angezündet. Gleich hinter der chinesischen Stadt war die Straße beinahe eine Stunde weit vollständig überschwemmt, und wie in einem seichten Flußbette plätscherten wir zwischen Gärten, Feldern und Lehmmauern dahin. Die Alleen waren nur als schwarze Schattenrisse zu erkennen, aber der Regen hatte aufgehört, der Weg war jetzt besser, und die Kamele konnten festen Fuß fassen. Es war jedoch schon spät, als wir in unserem provisorischen Lager im Dorfe Musulman-natschuk zur Ruhe kamen, nachdem wir des Silbergeldes halber bei dem Gepäck Nachtwachen aufgestellt hatten.
Den Weg nach Lailik kannte ich zum größeren Teile von 1895 her und will ihn daher nur sehr kurz beschreiben. Der Tagemarsch am 6. September führte uns durch eine ziemlich spärlich bewohnte, aber recht gut angebaute Gegend. Von Chan-arik an war der Weg durch eine üppige Allee von Maulbeerbäumen, Weiden und Pappeln begrenzt, die dichten, tiefen Schatten spendeten. Die Pappeln werden geköpft, um nicht in die Höhe zu wachsen, und bilden am oberen Teile des Stammes ein massiges Bündel aufwärtsstrebender Zweige. Auf weite Strecken hin vermag kein Sonnenstrahl durch das dichte Grün zu dringen, unter dessen kühlem Gewölbe es sich außerordentlich angenehm reitet. Der Weg glich an solchen Stellen einem Tunnel, durch welchen die Kamele, an einen Zug von lauter Güterwagen erinnernd, mit ruhigem, gleichmäßigem Gange hinschreiten und sich von dem grünen Hintergrund malerisch abheben. Es liegt etwas Feierliches über dem Marsche einer solchen Karawane dem Tode entgegen, der die meisten Kamele mit Gewißheit irgendwo in den Wüsten des fernen Ostens oder in den Berggegenden Tibets erwartet. Die Glocken läuten ihre abgemessene melancholische Melodie, welche unwillkürlich an eine Beerdigung erinnert; doch mit philosophischem Blick und ruhiger Haltung messen die prächtigen Tiere den Weg mit langen, langsamen Schritten unter ihren im Verhältnis zu ihren Kräften nicht schweren Lasten. Die Silberkamele tragen die schwersten Lasten, besonders ein Matador, dem allein 40 Jamben zuerteilt worden sind. Die Lasten sind ausgeglichen, und Unterbrechungen des Marsches kommen nicht mehr vor; nur hin und wieder muß, ohne daß das Kamel deshalb stehen zu bleiben braucht, eine Leiter etwas nach der einen oder anderen Seite hinübergerückt werden. Die Kamele haben starken Appetit und brandschatzen Weiden und Pappeln im Vorbeigehen, oft auf Kosten des Nasenstrickes. Wenn dieser zu hart angespannt wird, reißt er in der Mitte an seinem schwachen Punkte, wo seine beiden Hälften mit einer dünneren Schnur zusammengebunden sind, welch letztere reißt, ehe die Nase des Tieres hat Schaden nehmen können.
Jeder Mann unserer Gesellschaft hat seinen bestimmten Platz im Zuge und seine bestimmte Aufgabe bei der Aufrechterhaltung der Ordnung. Voran reiten die beiden Durgas aus Kaschgar, dann kommt Faisullah auf dem ersten Kamele, an dessen Seite Nias Hadschi ein Pferd reitet; auf dem sechsten Kamele hockt der junge Kader, und hinter dem siebenten reitet Islam. Die zweite Abteilung wird von Turdu Bai geführt, in ihrem „Kielwasser“ reitet Musa. Die Kosaken decken die Flanken; ich reite gewöhnlich hinterdrein. So geht es vorwärts durch Gärten und Dörfer, zwischen Mais- und Weizenfeldern hindurch, über Kanäle mit oder ohne Brücken (Abb. 13), über öde Steppen und kleine Sandfelder, wo vereinzelte, gleichsam verirrte Dünenindividuen von ungefähr 3 Meter Höhe ihre steilen Abhänge nach Osten kehren (Abb. 14). Im Dorfe Jupoga, unserer nächsten Raststelle, suchte man in mehreren Bassins das kostbare Wasser des großen Kanals Chan-arik aufzufangen.
Am 8. September erhielten die Tiere ihren ersten Ruhetag; ihre Packsättel waren seit Kaschgar nicht abgenommen worden, und man muß genau nachsehen, damit auf dem Rücken oder an den Seiten der Höcker, wo der mit Stroh gestopfte Sattel oder ein Teil der Last dicht anliegen und drücken kann, keine Scheuerwunden entstehen.
Nach einer ganz sternenklaren Nacht erscheint die Morgenluft beinahe kalt; die Minimaltemperaturen sind in beständigem Fallen begriffen, aber die Tageswärme steigt allmählich, je mehr wir uns von den gut bewässerten Vegetationsgebieten und den Bergen entfernen. Unterwegs hatten die Dorfbewohner mehrmals Dastarchane aufgetischt in Gestalt von Zucker- und Wassermelonen, in der Hoffnung auf ein anständiges Trinkgeld, eine Artigkeit, die auf die Dauer recht lästig wird.
Das Dorf ist bald zu Ende; dann folgt die hügelige Steppe, wo wir zahlreichen Landleuten begegnen, die den Ertrag ihrer Äcker und Gärten auf Eseln, Kühen und Pferden nach dem Markte in Jupoga bringen. Dann und wann wird die Steppe von einer unfruchtbaren Dünenreihe durchkreuzt; dazwischen sieht man Schafherden, Mais- und Baumwollfelder, trockene, jämmerliche Kanäle, die nur selten von der letzten Flut aus dem Chan-arik noch am Boden feucht sind. Rechts vom Wege zieht sich ein Gürtel hübsch blühender Tamarisken hin, eine wehmütige Erinnerung an das Heidekraut unserer Wälder. Die staubige Landstraße geht allmählich in einen Pfad über und zeigt damit an, daß der Verkehr nach Osten hin abnimmt. Am Rande von Terem finden wir wieder den langen Bewässerungskanal Chan-arik mit 4 Meter breitem, gänzlich trockenem Sandboden und kleinen Brücken, die verraten, daß hier von Zeit zu Zeit auch Wasser fließt. Um den langen Wüstenmarsch des nächsten Tages, den ich schon von früher her kannte, abzukürzen, ritten wir durch das ganze Dorf und lagerten uns bei dem letzten nach der Wüste zu liegenden Gehöfte.
Am 10. September machte ich, für eine Zeit von mehreren Monaten, die letzte Reise zu Lande. Die Temperatur fiel während der Nacht auf 8,3 Grad, was einem nach einem Tage von über 30 Grad im Schatten grimmig kalt vorkommt. Als ich aufstand, war der größere Teil der Karawane schon marschfertig. Der Tag war heiß, der Marsch lang und ermüdend, und die Wassermelonen, die wir mitgenommen hatten, fanden reißenden Absatz. Steppen- und Wüstengürtel wechseln ab, die Dünen sind bald schwach mit Tamarisken bewachsen, bald völlig nackt; die ersteren heißen „Kara-kum“, die letzteren „Ak-kum“, was schwarzer und weißer Sand bedeutet (Abb. 15). Die Nachbarschaft des Flusses macht sich schließlich bemerkbar, indem kleine Gruppen von Pappeln (Tograk) auftreten und nach und nach immer frischer und laubreicher werden, je mehr wir uns der großen Wasserstraße nähern.
Bei der Poststation Lenger wurden wir von einigen neugierigen Chinesen begafft und in der Dämmerung erreichten wir die breite mächtige Flut des Jarkent-darja. Der Fluß war hier in Arme geteilt, von denen der linke, an dessen Ufer wir hinzogen, viel zu seicht war. Wir zogen daher noch eine Weile in der Dunkelheit nach Norden weiter; von den Tritten der Kamele knisterte und krachte es in den trockenen Zweigen des Unterholzes und des Gesträuches. Das Terrain wurde jedoch nicht besser, und als sich das silberne Horn des Mondes im Walde versteckte, machten wir aufs Geratewohl Halt und schlugen, ziemlich müde von der dreizehnstündigen Reise, am Ufer unser Lager auf.
Endlich hatten wir den Fluß erreicht. Nun begann eine neue Abteilung der Reise und dazu eine Reisemethode, die ich bisher noch nicht erprobt hatte.
8. Durch die Furt des Kisil-su.
Jetzt folgte eine knappe Woche für die Vorbereitungen zu der langen Flußreise. Islam hatte in Merket eine längere Unterhandlung mit Beks und Kemitschi (Fährleuten). Ich hatte gefürchtet, daß die Chinesen Mißtrauen gegen mein Vorhaben hegen würden und daß die Erfahrungen der Wüstenreise des Jahres 1895, deren Ausgangspunkt Merket ebenfalls gewesen, die Dorfbewohner abschrecken würden, uns beim Aufbrechen zu helfen. Denn damals war der Bek zum Dao Tai gerufen, verhört und getadelt worden, weil er mir nicht einen zuverlässigen Führer mitgegeben. Nun aber hatte Merket einen neuen Bek erhalten, dem der Dao Tai Befehl erteilt hatte, uns weiterzuhelfen und uns wie vornehme Leute zu behandeln. Islam kehrte denn auch bald mit dem Bescheid zurück, daß ein Fährmann uns sein Fahrzeug für 1½ Jamba zu verkaufen bereit sei.
9. Nikolai Fedorowitsch Petrowskij,
Wirklicher Staatsrat, kaiserlich russischer Generalkonsul in Kaschgar.
10. Die beiden Kosaken Sirkin und Tschernoff.
DrittesKapitel.DieSchiffswerftinLailik.
Mit dem Kosaken Sirkin unternahm ich eine Probefahrt in dem englischen Segeltuchboote auf dem kleinen, abgeschnürten Flußarme, an dessen Ufer unser Lager aufgeschlagen war. Auch von Mast und Segel machten wir Gebrauch. Bei der schwachen Brise kam die vortreffliche kleine Jolle gut vorwärts; sie schien ein ziemlich sicheres Boot zu sein. Bei einem kleinen Nebenarme führten wir das Boot nach dem Hauptflusse hinaus, wo es ruhig und elegant, aber ziemlich schnell dahinglitt. Nur unbedeutende, langsam tanzende Wasserringel waren auf der Oberfläche des Flusses zu sehen und von Stromschnellen war nichts zu hören. Es war ein Genuß, sich so forttragen zu lassen, ein Vorgefühl des Behagens, womit die Flußfahrt später auf Hunderte von Meilen hin verknüpft sein sollte. Die Vereinigungsstelle des Seitenarms mit dem Hauptflusse schien noch fern zu sein, und wir hielten es für an der Zeit umzukehren. So schleppten wir denn das Boot in dem weichen, zähen Lehm bis an unseren Seitenarm. Doch auch in diesem herrschte eine Strömung, die kräftig genug war, um das Flußaufwärtsrudern zu schwer zu machen. Sirkin ging daher an Land und holte einen Mann und zwei Pferde. Mitten im Wasser reitend, zog er das Boot an einem Stricke nach. Manchmal blieb das Pferd in dem zähen Lehme beinahe stecken, und die Tiefe war stellenweise bedenklich groß. Einmal erreichte das Pferd den Grund nicht mehr; es wurde von der Strömung fortgerissen und war nahe daran sich zu überschlagen; der Reiter sprang ab und schwamm auf das Boot zu, das ich ihm entgegensteuerte. Doch ihm erschwerte die Kleidung die Bewegungen, und gerade als er nach dem Ruder griff, das ich ihm hinhielt, versank er ganz im Wasser. Endlich gewann er jedoch Halt am Bootrande und hätte die kleine Jolle beinahe umgerissen, als er sich hineinschwang. Alles ging so schnell vor sich, daß ich kaum dazu kam, mich zu beunruhigen. Doch was hätte es für ein Unglück geben können, wenn mein Kosak einen Starrkrampf bekommen hätte oder des Schwimmens unkundig gewesen wäre! Am Ufer war das Pferd, das seinen eigenen Weg geschwommen war, nahe daran, in dem zähen Schlamme umzukommen, aber es arbeitete sich ebenfalls wieder heraus. Sirkin war nach dem Bade ganz matt und angegriffen, aber seine kleine Schwimmtour hatte so einladend ausgesehen, daß ich mich entkleidete und ein erfrischendes Bad nahm.
Unser Versuch, wieder nach dem Lager zu kommen, war also gescheitert; glücklicherweise waren aber einige unserer Leute am Ufer flußabwärts gegangen, um uns zu suchen. Sie mußten uns vom Ufer aus an einer langen Leine ziehen, während ich das Boot mit dem einen Ruder in der Stromrinne hielt.
Das Lager bot bei unserer Ankunft ein lebhaftes Bild dar. Die Zelte waren von einer ganzen Volksversammlung von Besuchern umgeben (Abb. 16). Ich fand dort viele alte Freunde von 1895 wieder, Lailiks On-baschi (Bezirkshauptmann, eigentlich Chef von 10 Mann) und Örtängtschis (Gastwirte), verschiedene Bewohner von Merket und Frauen in langen Hemden von dünnem, rotem Zeuge mit ihren Kindern auf dem Arme.
Nachdem die Unterhaltung sich eine gute Weile um jene unglückliche Wüstenreise gedreht, wurden die Flußreise und die Fährfrage Gegenstand einer Diskussion. Um die Sache abmachen zu können, ritt ich mit einem großen Gefolge nach der Fährstelle zwischen Lailik und Merket, wo die von Islam vorgeschlagene Fähre lag. Ich fand sie vorzüglich, von kernfesten, ungehobelten Planken, die von mächtigen eisernen Krampen zusammengehalten wurden, neu erbaut und ganz dicht. Sie kam mir nur ein bißchen groß und schwer vor, was hier oben gewiß vorteilhaft ist. Doch wer konnte wissen, ob der Fluß überall gleich tief und wasserreich wäre, und viel wahrscheinlicher war es, daß es schwierig sein könnte, diesen schweren Koloß wieder flott zu machen, wenn er mit Unterwasserbänken in allzu innige Berührung gekommen wäre. Die Frage wurde mit den Lailiker Fährleuten von allen Gesichtspunkten aus erörtert; die meisten rieten uns, das „Schiff“ zu nehmen, wie es war.
Der Beschluß, der gefaßt und schon am folgenden Morgen ins Werk gesetzt wurde, bestand darin, das Schiff nach einem Punkte am rechten Ufer, unserem Lager gerade gegenüber, zu bringen (Abb. 17). Wir mußten eine Schiffswerft anlegen, wo eine Ausrüstung und Rekonstruktion mit wirklichem Vorteil stattfinden konnte. Bei unserem Lager auf dem linken Ufer ließ sich dies nicht machen, denn dort floß nur ein Seitenarm, der vom Hauptflusse durch eine tiefliegende, feuchte Schlammzunge, hinter der das Wasser zunächst seicht war, getrennt war. Auch das rechte Ufer war insofern ungeeignet, als es infolge der Erosion des Flusses eine anderthalb Meter hohe steil abgeschnittene Wand bildete. Häkim Bek aus Merket bot neunzig Landleute auf, die mit ihren Spaten einen nicht allzusteilen Abhang herstellten, auf den Bretter gelegt wurden; auf dieser Unterlage wurde die Fähre unter Gesang und Geschrei mit vereinten Kräften aufs Trockene gezogen. Der Bek, dessen Adern reicher an chinesischem als an muhammedanischem Blute waren, stand die ganze Zeit über mitten auf der Fähre; sie wurde dadurch gerade nicht leichter, aber er imponierte durch seine hohe Gegenwart, hielt eine lange Rute in der Hand, klatschte und schlug nach allen Seiten und kommandierte wie ein Zirkusdirektor. Die Kinder des Wüstenrandes verdoppelten ihre Kräfte, und der schwere Prahm wurde ruckweise auf ebenen Boden gezogen, wo er zwischen den Hagedornbüschen auf einigen Querbalken ruhte.