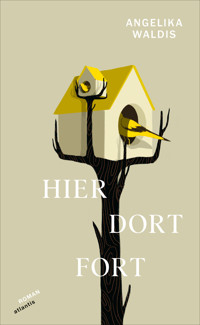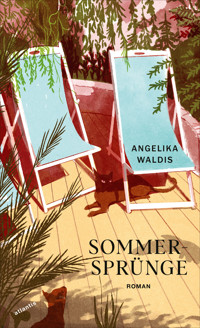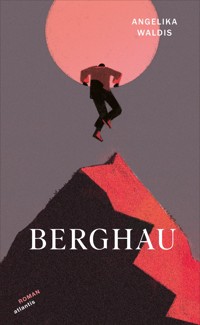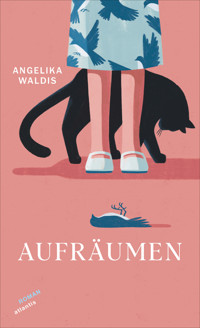
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hauptsächlich waren es Männer, die Luisa die ersten siebzig Jahre ihres Lebens schwer gemacht haben: ihr Ehemann Alfred natürlich, ein »Künstler« (was eigentlich nur bedeutet,dass er nicht einmal zum Geldverdienen gut ist), Roman, ihr Schwiegersohn mit der »leidenschaftlichen Natur« (was das in Bezug auf andere Frauen bedeutet,kann man sich ja denken), und Dr. Hausammann, der damals bei der Operation ihrer Tochter gepfuscht hat. Als sie ihrer Nachbarin beim Kistenpacken für den Umzug ins Altersheim hilft, gelangt Luisa zu dem Schluss, dass es auch in ihrem Leben an der Zeit ist, endlich mal so richtig reinezumachen, aufzuräumen, Ballast loszuwerden. Und deshalb sitzt sie jetzt im Zug nach Genua, mit neuer Frisur und im Gepäck: Alfreds liebste Currypaste mit einer ganz besonderen Beigabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Angelika Waldis
Aufräumen
Roman
Atlantis
Einmal mehr für Otmar
1Ja nicht auffallen
Luisa hat beschlossen aufzuräumen. Als Erstes mussAlfred weg.
Seit beinah vierzig Jahren ist sie mit Alfred verheiratet. Alfred ist ein Egosaurier. Er hat vor allem an sich gedacht und tut es immer noch. Die Tatsache, dass Luisa und zwei Töchter an seiner Seite lebten, war für ihn etwa so maßgebend wie der Terminkalender der Müllabfuhr. »Ich bin halt ein Künstler«, sagte er. »Er ist halt ein Künstler«, sagte Luisa. Sie sagte es jahrelang – und wusste, dass er keiner war.
Sie sitzt im Zug nach Wien und blättert im Reiseführer. Der ist schon längst nicht mehr aktuell, aber das macht nichts. Noch nie ist sie in Wien gewesen. »Jetzt bin ich siebzig und noch nie in Wien gewesen«, hat sie zur Coiffeuse gesagt. »Jetzt will ich mir das mal leisten, ohne Grund. Machen Sie mich schön, los.« »Sind Sie sicher, Frau Gallmann?«, fragte die Coiffeuse. »Zwei Zentimeter kurz?« »Sicher, schneiden Sie.« Und die Coiffeuse schnitt, schnitt die seit Jahrzehnten ewig gleichen Lockenbüschel ab.
Und jetzt sieht Luisa im spiegelnden Zugfenster ihren neuen Kopf. Jünger schaut sie aus mit dem grauen Kurzhaar. Fast wie ein Mann schaut sie aus. Hinter ihrem Kopf fliegen Felder und Wälder durch den Sommerabend, leuchten ein paar Pinselstriche Abendrot, schön.
Bereits nach kurzer Fahrt kommt der Schaffner. Er registriert ihr elektronisches Ticket. Einmal Wien und zurück. »Schönen Abend noch, Madam.« Sorgfältig steckt sie das Ticket wieder ein, es wird der Beweis sein, dass sie nach Wien gefahren ist.
Das klappt ja besser als erhofft, denkt Luisa. Bereits in Sargans kann sie aus- und umsteigen und nach Zürich zurückfahren, rechtzeitig für den frühen Nachtzug nach Mailand. Von Buchs, Feldkirch oder Innsbruck aus wär’s komplizierter gewesen. Sie hat die Fahrpläne genau studiert. Aber eigentlich hat sie keine Eile. Sie ist für volle zehn Tage abgemeldet. Sie hat genügend Zeit, ganze Arbeit zu leisten.
Das Schwierigste an der Arbeit wird sein, nicht aufzufallen. Niemand soll sich an sie erinnern, auch der Herr nicht, der ihr gegenübersitzt. Er sieht nicht unsympathisch aus, der alte Knacker, er liest im Steppenwolf, Luisa hat es gleich gesehen, sie hat eine gute Rundumsicht, wie ein Hase, sieht auch ein bisschen wie ein Hase aus mit den weit auseinanderliegenden Augen. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie mit dem alten Knacker vielleicht ein Gespräch angefangen. Aber jetzt will sie nicht auf sich aufmerksam machen, will still und unscheinbar in ihrer Verkleidung verharren: graue Regenjacke, extra fades lavendelblaues Shirt, graue Altfrauenhose, scheußliches senfgelbes Foulard mit Hufeisenmuster. So stellt sie sich eine Nonne auf Urlaub vor. Ihre schönen Sachen hat sie im Koffer. Knallblau, Eierschale, Seidenglanz. Den Tropenvogelhut. Die Eidechsenschuhe.
Alfred, Arschfred. Ein Glück, dass sie ihre Ausbildung schon abgeschlossen hatte, als sie Alfred kennenlernte. So war sie in der Lage, über alle die Jahre für den Unterhalt der Familie aufzukommen, Luisa Gallmann, geborene Racher, Hauswirtschaftslehrerin, Dozentin an der Pflegefachschule. Sie vergisst sie nicht, diese Müdigkeit, aus der sie sich täglich herausstrampeln musste. Die Todesmüdigkeit.
In Sargans wird sie auf dem Bahnsteig von einem jungen Hündchen stürmisch begrüßt, es wedelt mit allen Körperteilen. Am anderen Ende der Leine zieht ein junger Mann, auch an ihm scheint alles zu schlenkern. Dass man so jung sein kann, denkt Luisa beinahe verwundert und krault dem Hündchen die Ohren. Du sollst dich nicht an mich erinnern, hörst du, Hundekind. Ich will hier nicht gesehen werden. Ich fahre nach Mailand, und das weiß niemand. Ich werde in einem Hotel übernachten, in dem ich noch nie war. Ich werde morgen nach Genua weiterreisen, dort sitzt Alfred und zeichnet an seinem Epos. So nennt er das.
Luisa findet im Zug nach Zürich ein leeres Abteil, sie hat Hunger und wünscht sich ein Schinkenbrot, so ein weiches, ungesundes. Der Walensee glänzt schwarz, sieht aus wie nasser Asphalt. Sie weiß, dass er unheimlich tief ist, er wäre ein wunderbares Grab für die drei, die sie entsorgen will. Alfred, Roman und Doktor Hausammann. Dass es lauter Männer sind, ist Zufall. Es sind einfach drei, die ihr, Luisas, Leben verwüsten, das ist alles. Sie müssen weg. Erst wenn sie weg sind, wird sie Ruhe haben.
Sie hat ihrer Nachbarin Magi geholfen, vor dem Umzug ins Altersheim die Wohnung zu räumen. Es war furchtbar mit Magi, sie wollte sich von gar nichts trennen. Was Luisa in die Säcke fürs Brockenhaus legte, holte Magi wieder heraus. Eine Vogeluhr, die zu den falschen Zeiten pfiff, Wander-, Bade-, Stepptanzschuhe, Reiseführer für Lappland und Namibia. »Ich ziehe ins Altersheim, nicht ins Grab«, sagte Magi wütend. Sie sortierte stundenlang ihre Bücher, und zum Schluss standen fast alle wieder im Regal. »So geht das nicht«, sagte Luisa, »man muss sich trennen können. Du meinst doch nicht, du wirst mit deinen geschwollenen Füßen noch Stepptanz machen wollen.« »Und du meinst doch nicht«, entgegnete Magi, »du wirst mir mit deinem geschwollenen Gerede das Leben verleiden. Schau dich in deinem eigenen Leben um. Müsstest du nicht mal aufräumen?«
Das war der Moment, als Luisa beschloss, mit dem Aufräumen anzufangen.
Sie nimmt eine Zeitung vom Nebensitz, sie heißt Rheintaler Bote, und macht sich auf die Suche nach einem Satz. Seit Langem sammelt sie Sätze, die irgendwie schief sind, und notiert sie untereinander in einem kleinen roten Heft. Das Heft hat sie immer dabei, auch jetzt. Sollte sie unter den Zug geraten, und jemand würde dann die Handtasche der armen Verunglückten untersuchen, wären die Sätze ein wundersames Rätsel für die Nachwelt oder einfach die unbrauchbare Hinterlassenschaft einer alten Schrulle. Im Heft stehen Sätze wie:
Ich stehe nur auf Siamkatzen, sagte Frau Füglistaller.
Die Volkspartei lässt die Gebärenden auf der Straße stehen.
Und dann machten sie auch noch den Neckar.
Wenn sie die Sätze liest, liebt sie das Leben, weil es so ungewollt seltsam ist. Streichle mich, sagt das Leben, und liegt vor ihr wie ein zuckender Hund mit zu vielen Füßen.
Der Rheintaler Bote gibt nichts her.
Die Churfirsten auf der anderen Seite des Walensees sind im Abendlicht errötet, was aussieht, als drängten sie sich schamhaft aneinander. Luisa sieht Amden, das einzige Dorf am Hang, und sie versucht angestrengt, nicht an Roman zu denken, Romans Mutter kommt aus Amden, macht ein großes Geschrei draus: »Wir haben eben Bergblut.«
Romans Bergblut, so ein Kitsch. Seine ungeheure Schwermut soll damit erklärt sein, seine leidenschaftliche Natur, was für ein Stuss. Luisa hat ihren Schwiegersohn durchschaut. Er steigt anderen Frauen nach, das ist mit leidenschaftlicher Natur gemeint. Und zu Hause hockt er schweigend vor dem Fernseher und ist zu träge, Mirjam zu antworten. Das ist mit ungeheurer Schwermut gemeint. Luisa kann ihn nur noch still und leise hassen. Er hat mit seinem verdammten Bergblut dafür gesorgt, dass Mirjam jede Fröhlichkeit verloren hat. Sie hat sich in den zehn Ehejahren völlig verändert. Früher hat sie im Bad gesungen, hat in der Küche getanzt, hat sich im größten Durcheinander wohlgefühlt. Jetzt hat sie diesen besorgten, gehetzten Blick, und sie räumt dauernd auf. Wenn sie bei Luisa vorbeischaut, fängt sie sofort an, aufzuheben, was am Boden liegt, und wenn es nur ein heller Faden auf dem dunklen Teppich ist. Sie bleibt nie ein Weilchen sitzen, sondern steht auf, kaum ist die Teetasse leer, und rückt Dinge zurecht, zupft an den Vorhängen, stellt Schuhe präziser in die Reihe. Wie gern hat sie früher gelacht. Wie ein Riesenrülpser kam das Lachen aus der Tiefe und hopste in alle Richtungen. Jetzt ist ihr Lachen nur noch ein höfliches Geräusch. Es wäre höchste Zeit, dass sie sich trennte von Roman. Aber davon will Mirjam nichts wissen. Das wäre eine Niederlage. Mirjam will Siege.
Es liegt an mir, Roman zu entfernen, denkt Luisa. Es hat immer an mir gelegen, die unangenehmen Dinge zu erledigen. Ich weiß nur nicht, wie ich das diesmal anstellen soll. Noch nicht.
Bereits jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Sie hätte in Sargans ein Ticket nach Zürich lösen müssen. Es ist ihr nicht eingefallen, sie hat zu lange mit dem jungen Hund geschäkert. Was macht sie jetzt, wenn der Schaffner kommt? Sie wollte doch ja nicht auffallen. Unruhig blickt sie über die Schulter, wenn sie die Tür hört. Zur Rechten liegt jetzt der Zürichsee, der weite, sanfte, wie sie ihn liebt, aber für beschauliche Blicke hat sie nun keine Muße mehr, sie wartet nur noch auf den Schaffner. Sollte er in den nächsten Wochen ihr Bild in der Zeitung sehen, wird er sich wahrscheinlich an sie erinnern. Im Mordfall Gallmann wird die Ehefrau verdächtigt. Da schau, das ist doch die süßsaure Alte, die keine Fahrkarte hatte, ganz rot geworden ist die. Luisa sitzt aufrecht da, das Portemonnaie in den Händen, horcht auf das Schnauben der Tür. Schon ist in der Ferne der Rücken des Pfannenstiels zu sehen, an seinem Saum die Dörfer der Goldküste im Abendgoldstaub, da taucht der Schaffner auf und ist auch schon vorbei, er hat Luisa nicht mal angesehen.
Es ist 18:48 Uhr, als der Zug in Zürich einfährt.
Sie hat zwanzig Minuten. Das reicht für den Kauf von Ticket und Zeitungen. Doch dann stolpert dieser Tölpel über ihren Koffer, bleibt am Boden sitzen und schaut verwundert zu ihr hoch. Eine Flasche in seiner Papiertüte ist zerbrochen, rote Flüssigkeit rinnt gegen ihre Schuhe. Seltsamerweise steht der Mann nicht wieder auf. Vielleicht bedeutet die Verwunderung in seinem Gesicht, dass ihm etwas wehtut. Das hat ihr gerade noch gefehlt. Sie kann nichts dafür, sie hat ihren Koffer ganz ordentlich hinter sich hergezogen. Inzwischen sind bereits drei Leute stehen geblieben und blicken Luisa fragend an. Was haben Sie mit dem Mann gemacht? Was ist das rote Nasse da am Boden? Endlich zieht sich der Mann an Luisas Koffer hoch, bückt sich, reibt sein Knie, seine Wade, ein junger Kerl, ein tätowierter Tölpel. Sie weiß nicht, ob der säuerliche Geruch aus seinem Mund oder von der Lache am Boden kommt. Als er davonhinkt, rennt sie zum Fahrkartenschalter, sie merkt, dass sie zittert. Und sie schwitzt in ihrer Regenjacke, die Bahnhofshalle wirkt wie geheizt.
Wieder findet sie ein freies Abteil, belegt die drei leeren Sitze mit Regenjacke und Zeitungen und räumt sie erst weg, als der Zug durch Zürich-Enge fährt. Hier hat sie einmal gewohnt, aber daran mag sie nun nicht denken. Sie lässt sich ins Polster sinken und prüft, ob die feuchtgeschwitzten Achseln des leidigen Lavendelshirts zu riechen sind. Jetzt hat sie eine Weile Ruhe, sie wird im Speisewagen gepflegt zu Abend essen und sich die Zeitungen vornehmen, auf der Suche nach dem einen oder anderen Satz.
Sechs Jahre wohnte sie mit Alfred in Zürich-Enge, ein bisschen Stuck an der Decke, ein bisschen Sicht auf den See, ein bisschen Enttäuschung bald nach der Hochzeit. Alfred, der Luisa unten am See angesprochen hatte, wo sie beide zuschauten, wie die Seepolizei einen Schwan von einem Angelhaken zu befreien versuchte, dieser Alfred wurde als Ehemann schon bald unfreundlich, und er schien das nicht einmal zu merken. Oft stand Luisa in der kleinen Wohnung am Fenster, blickte auf das bisschen See und fragte sich, warum sie sich von Alfred so hatte bezaubern lassen. »Stellen Sie sich vor«, sagte er, »Sie seien ein Schwan, und ich sei der, der die Angel auswirft.« Sie lachte. »Ich, ein Schwan«, sagte sie, worauf er mit größter Leichtigkeit passende Komplimente aus der Luft holte: königliche Haltung, vornehmes Weiß von Hals und Gesicht, Haar voller Glanz wie Gefieder. Sie lachte, es gefiel ihr. Was sie selber jeweils im Spiegel sah, war nichts Weißes, sondern etwas Bleiches, und ihr Haar glänzte nur gerade am Tag der Haarwäsche, dann wurde es stumpf.
Als der befreite Schwan davonschwamm, hatte Alfred Luisa gefangen.
Sie weiß, wie sie es machen wird, hat lange im Internet recherchiert, hat sich das holländische Handbuch zum Suizid besorgt. Sie hat alles Nötige im Koffer, der Koffer ist tödlich, vielleicht ist der Mann in der Bahnhofshalle deswegen darüber gestolpert. In Genua wird sie ein teuflisch scharfes Vindaloo-Curry kochen, so wie Alfred es liebt, zur Feier des Tages. Wenn er wissen will, was gefeiert wird, wird sie sagen: das Leben. Das Curry wird so scharf sein, dass Alfred nichts von der chemischen Beigabe spüren wird. Für sich wird sie während des Kochens eine Extraportion abzweigen, noch bevor sie die selbst gemachte Vindaloo-Paste zugibt. »Ich darf eine Weile nichts Scharfes essen, meine Magenschleimhaut«, wird sie zu Alfred sagen. Auch für das Curry hat sie das Wichtigste im Koffer, Chili, Zitronengras, Vindaloo-Paste, eine Dose Austernpilze. Sie ist gut vorbereitet, sie hat das Vorbereiten gelernt, spätestens als die Kinder kamen, erst Maya, dann Mirjam. Und nach Mayas Unglück erst recht.
Wieder sieht sie – jetzt in umgekehrter Fahrtrichtung – auf der anderen Seite des Sees den Pfannenstiel. Hügel, Himmel und See sind nun aus drei verschieden blauen Stoffen geschnitten und mit dunklen Nähten verbunden. Auf das Leben, wird sie sagen bei Alfred am Tisch. Auf das verweinte, verpfuschte, verlorene Leben. Sie hält sich die Lesebrille, von der ein Bügel abgebrochen ist, wie ein Lorgnon vor die Augen und liest den Flyer des Speisewagens. Heute Abend gibt es paniertes Schweinsschnitzel mit Bratkartoffeln und Blumenkohl an Béchamel oder Salatteller mit Ei. Sie wird das Schnitzel essen, danach noch Tiramisu, wenn’s sein muss, samt Salmonellen. Seit sie alleine lebt, isst sie am liebsten ungesund. Über dreißig Jahre lang war sie Fachfrau für Ernährungskunde, so hat sie ihre Familie ernährt, jetzt will sie von Ernährung nichts mehr hören. Sie isst unbesehen Fettes, Süßes, Übersalzenes, verschlingt alles aus Teig, schmiert überall Butter drauf oder chemisch aromatisierte Streichpaste, schlägt sich den Bauch übervoll oder vergisst ganz und gar zu essen. Wenn ihre Nachbarin Magi ihr besorgt einen Apfel reicht, lacht sie nur und isst ihn dann mit angespanntem Mund. Ich bin ein Ross, denkt sie, ich werde nicht krank, ich habe alles überstanden, alles für alle durchgezogen, und was mich schmerzt, sieht man mir nicht an.
Als der Zug durch Horgen fährt, schließt sie die Augen. Sie mag das Dorf nicht mehr sehen. Einmal hat sie sich aufgemacht und das Haus von Doktor Hausammann unten am See gesucht, hat davorgestanden und durch den Zaun gespäht, hat die gelben Jalousien, die runden Buchsbäume und die Sonnenuhr im Rasen registriert, wollte wissen, wie der Hausammann lebt und wo er seine Schuld begraben hat. Er hat mit seinem Pfusch meine wunderbare Maya zerstört, hatte sie gedacht, und was tut er, er wohnt, schläft und scheißt in einem Haus mit gelben Jalousien und runden Buchsbäumen, als ob nichts gewesen wäre. Als sich hinter einem Fenster etwas rührte, ging sie nicht weg, sondern starrte weiterhin über den Zaun, es war ihr recht, wenn sie von Hausammann gesehen wurde, oder von seiner Frau oder von seinen Söhnen. Sie wusste, dass er Söhne hatte, gesunde Söhne. Sie blieb stehen, bis sie jemanden im Hause lachen hörte, dann lief sie weinend zum Bahnhof hoch.
Luisa rechnet: Das ist nun achtundzwanzig Jahre her. Und der Hausammann ist achtundzwanzig Jahre älter. Ich muss ihn entsorgen, solange er noch munter ist, denkt Luisa. Aber eins nach dem andern.
Als der Zug den dunkelgrünen Urnersee entlangfährt, setzt sich Luisa aufrecht hin und späht hinaus. Irgendwo dort drüben gibt es einen Strand, wo vor sechzig Jahren ein Schild stand: »Baden verboten«. Hier sei es schön, sagte ihr Vater und zog hinter einem Baum die Badehose an. Dann suchte sich auch Mutter einen Baum, und Vater sagte zu Luisa: »Los, mach.« Sie fror, weil das Baden verboten war und das Wasser kalt, wenn auch schön grün. Die Fahrräder, an der Verbotstafel aneinandergelehnt, glänzten in der Sonne, Mutter sah einen Fischreiher, während sie auf dem Rücken schwamm. Und irgendwo dort drüben gibt es eine Kapelle, wo vor sechzig Jahren die Tür verschlossen war, doch Vater fand einen Hintereingang und kletterte über das Gitter, das den Aufstieg zur Empore versperrte. Oben setzte er sich ans Harmonium und spielte »Näher mein Gott zu dir«, und wieder fror Luisa, weil sie Unerlaubtes nicht mochte, auch wenn es schön traurig klang und ihre Mutter dazu summte. Inzwischen hat sie keine Scheu mehr vor Verboten. Sie fürchtet keine Strafe mehr. Was man für richtig hält, findet sie, soll man tun, und es ist nichts Böses dran, wenn man es heimlich tut.
Niemandem hat sie gesagt, dass sie nach Genua fährt. Mirjam und Magi glauben, sie fahre nach Wien.
Und Maya weiß nichts, weil sie nicht weiß, was Wien ist oder Genua.
Vom Abteil schräg vorne hört sie ein Gespräch, die Frau redet quäkend und unangenehm deutlich, vom Mann vernimmt man nur tiefe vibrierende Töne. Sie sagt etwas von einer unpassenden Strumpfhose und von auffälligen Briefkästen. Er streicht dann ein paarmal über seinen Bass. Jung sind sie beide vermutlich nicht. Luisa wundert sich immer wieder, warum ein Mann und eine Frau zusammenbleiben, die gar nicht zusammenpassen, nicht mal für die Länge einer Bahnfahrt. Sie versucht sich vorzustellen, wie sich die beiden da vorne umarmen, eine Tröte und eine Bassgeige, das geht doch gar nicht. Und doch, überall, wo sie hinschaut, sieht sie Paare, seltsame Doppelwesen, die aus irgendeinem Grund aneinanderhaften, mit einem Klebstoff, der schon längst vertrocknet oder verdunstet ist. Wenn sie Menschen erfinden müsste, würde sie von vornherein auf Geschlechter verzichten, auf die ganze Mühsal gegenseitiger Anziehung und auf den lächerlichen Akt der Paarung. Das ist alles sehr schlecht durchdacht, findet Luisa, die Fortpflanzung mit den Milliarden verschleuderten Spermien und mit der knorzigen Gebärerei. Viel besser als Paare wären flinke, unbelastete Individuen, mit einem klaren Blick nach vorne statt nach links und rechts. Gefühle wie Liebe wären weiterhin erwünscht, aber beschränkt, zum Beispiel auf Kinder, die man nach dreimonatiger Brutzeit von der Schulter pflücken könnte.
Die Tröte schräg vorne scheint ihren Reisepass vergessen zu haben. »Warum hast du mich nicht daran erinnert«, sagt sie, und der Bass streicht wieder ein paarmal über die Saiten.
Luisa wühlt in der Handtasche, sie hat ihren Pass dabei. Gallmann-Racher, Luisa Frederike, Größe: 166 Zentimeter. In alten Pässen stand jeweils noch die Augenfarbe. Graublau. Graublau ist Durchschnitt, hat Alfred gesagt. Noch heute wird sie in Italien sein und morgen in Genua. Und dann wird gekocht.
2Mit zugehaltener Nase und Seele
Luisa war neunundzwanzig, als sie merkte, dass sieschwanger war. Sie kotzte sich krank. Damals arbeitete sie in verschiedenen städtischen Schulhäusern, als Ernährungsexpertin im hauswirtschaftlichen Unterricht. Sie lernte eine Schultoilette um die andere kennen, es roch in allen ähnlich, nicht schlecht, nach Scheuermittel, Fichtennadel und nassem Tuch. Sie kotzte in Waschbecken, WC-Schüsseln oder Putzeimer, wischte sich den Mund und trat lächelnd wieder vor die Klasse. »Sie sollten sich besser ernähren, Frau Ernährungsexpertin«, sagte ein Lehrer, der sie in der Toilette hatte würgen hören.
Auch Alfred machte sich lustig. Er werde ihr zum Abendessen Blut- und Leberwurst auftischen, sagte er, wenn er sie bleich im Badezimmerspiegel sah. Oder kalte Kuttelsuppe. Oder sauren Hering mit Spiegelei. Sie sagte ihm lange nichts. Zwar hatte er nie etwas geäußert, das gegen Kinder sprach, aber sie wusste nicht, ob er sie tatsächlich liebte oder ob er sie einfach nur komfortabel fand. 1968 hatten sie ganz konventionell geheiratet, vom Achtundsechziger-Aufbruch hatten sie beide kaum etwas mitbekommen. Erst später behauptete Alfred, er sei damals ein leibhaftiger Rebell gewesen. Als sie die Hose nur noch mit einem Stück Schnur zwischen Knopf und Knopfloch zumachen konnte, musste sie ihn informieren. »Ich bekomme ein Kind«, sagte sie. »Und ich einen Furunkel«, sagte er.
Alfred tat so, als ob er alles Bürgerliche nur mit Mundschutz ertrage. Er hatte ein Kunstgeschichtsstudium nach einem Semester abgebrochen, war herumgereist und als Künstler nach Zürich zurückgekommen. Er legte sich einen düsteren Stil zu, lernte lithografieren und brauchte das Geld seines Vaters auf. Als Luisa ihn kennenlernte, hatte er eine Teilzeitstelle in der Stadtverwaltung. An zwei Tagen in der Woche führte er das Inventar der Bildersammlung. Er registrierte auf Karteikarten, was die Stadt seit Jahrzehnten an Grafiken und Gemälden aufgekauft hatte und nun als Schmuck in Amtshäusern, Polizeiwachen oder Spitälern hing. Ein Büroangestellter der unteren Hierarchiestufen durfte sich im Lager eine nummerierte Grafik aussuchen. Höhergestellte hatten Anrecht auf ein Originalwerk. Wenn jemand auf- oder abstieg, wegzog oder starb, kam das Bild ins Lager zurück, und Alfred war verantwortlich für die Standortkontrolle. Manchmal machte er sich vor Luisa lustig über die Qualität der Bilder oder über den Geschmack der städtischen Angestellten. Aber zu anderen Leuten sagte er nichts von dieser Arbeit. Man sollte ihn als Künstler sehen. Wenn er sagte: »Ich mach das nicht mehr lange«, glaubte Luisa ihm nicht, denn sie merkte, dass er an den »städtischen« Tagen viel besserer Laune war.
Es war Alfred, der für das Kind den Namen Maya vorschlug. Auf einer Mexiko-Reise hatte er sich Bewunderung für die alten Mayas angeeignet und hatte von dort eine handgewobene Decke mitgebracht. Er legte die neugeborene Maya für ein Foto auf die Maya-Decke, drückte aber gar nicht erst ab, da sich ihre rosa Strampelhose nicht mit dem schwarz-roten indianischen Design vertrug. Wäre Maya ein Junge gewesen, hätte er Narvik heißen sollen, weil Alfred auf seiner Reise ans Nordkap in Narvik übernachtet hatte. Er sprach mit schwärmender Wehmut von Narvik, Luisa vermutete, dass er dort eine Frau geliebt und von ihr zum Andenken den Tupilak erhalten hatte, den kleinen Dämon aus Rentierhorn auf dem Küchenregal.
Maya war ein Schreikind, das trieb Alfred aus dem Haus. Er mietete sich eine Mansarde in der Nachbarschaft, um dort in Ruhe zu zeichnen. Luisa sah selten Licht im Mansardenfenster, sie wusste, dass Alfred seine Abende vorwiegend in der Quartierbeiz verbrachte und dort mit anderen Männern das Leben vertiefte. »Du kannst das Leben nicht verlängern«, sagte er, »aber vertiefen.« Er hatte die Gabe, aus seinen Sätzen Sentenzen zu machen. Wenn er zu Maya sagte, sie solle ihr Mus essen, klang das wie Salomons Wort. Iss Mus, meine Tochter, denn es ist gut. Oder wenn Luisa ihn bat, den Duschvorhang zu flicken, sagte er etwas von der Freiheit des Wassers.
In den Anfängen übernahm Alfred als Familienvater einige Pflichten und kam ihnen leidlich nach. Er brachte Maya in die Krippe, räumte den Frühstückstisch auf, bündelte die Zeitungen, putzte die Toilette. Was er ungefragt und regelmäßig erledigte, war der Geschlechtsverkehr. Er übte ihn stets in den frühen Morgenstunden aus, in noch winterlicher Dunkelheit oder beim ersten Vogelgezwitscher. Er ließ sich durch nichts davon abbringen, auch nicht durch Maya, die manchmal während des ganzen Manövers schrie. Und Luisa tat, was er wollte, mal gern, mal weniger gern. Und immer öfter mit zugehaltener Nase und Seele.
Alfred mochte Maya so leidlich, schien es Luisa, mehr nicht. Vielleicht war er insgeheim enttäuscht, dass aus ihr keine schwarzlockige Maya-Prinzessin wurde. Sie hatte spärliches dunkelblondes Haar, wasserhelle, leicht vorstehende Augen und dicke rosarote Bäckchen. Als sie etwa zwei Jahre alt war, machte Alfred eine Zeichnung von ihr, darauf sah sie aus wie ein verängstigter Frosch in etwas Gestricktem. Die Zeichnung hing lange im Wohnzimmer, mit Alfreds schmissiger Signatur.
In jenen Jahren wurde Luisa schön. Mayas Geburt veränderte ihren Körper, die Hormone spielten was Neues. Luisa sah verwundert, dass ihr Haar glänzte und ihre Haut schimmerte. Weil sie dauernd rannte und hetzte, wurde sie schlank, sie passte in Kleider, die sie sich vorher nie zugetraut hatte. Und das Beste: Maya brachte sie zum Lachen, und das Lachen blieb im Gesicht wie eine Erinnerung, auch wenn sie ernst war.
Manchmal fing sie von Alfred einen prüfenden Blick auf. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, sagte der Blick.
Manchmal übergoss er sie mit Verachtung, prügelte sie mit Sätzen wie:
Wenn du ein Buch wärst, läse man nur das oberste Blatt.
Du glaubst, Mittelmaß sei eine Tugend.
Dein Herz wird nie so voll sein, dass es überläuft.
Ich bin der einzig richtige Pfeffer für deine Fadheit.
Als Alfred ganze Nächte wegblieb, dachte sich Luisa noch nichts. Er habe so lange gearbeitet, sagte Alfred jeweils, und dann in der Mansarde geschlafen. Der vorherige Mieter hatte ihm eine Matratze voller Flecken überlassen. Luisa begriff nicht ganz, dass sich Alfred da drauflegen mochte.
Dass er sie betrog, merkte sie erst, als er anders zu riechen anfing, es war kein Parfum, der Geruch steckte in den Kleidern, ein Geruch nach Waschmittel und Bügeleisen. Um ihm nachzuspionieren, fehlte ihr die Zeit. Sie hatte ihre Arbeit in den verschiedenen Schulhäusern der Stadt wieder aufgenommen und war entweder unterwegs oder mit Maya beschäftigt. Und mit Maya auf den Schultern konnte sie schlecht Alfreds Verfolgung aufnehmen, sich hinter Autos ducken und in Hofeingängen verstecken. Sie hatte schon angefangen, sich an den Geruch zu gewöhnen, da half ihr der Zufall in Form eines Vogels. Alfred hatte sich gegen Abend aufgemacht, um in der Mansarde zu arbeiten, wie er sagte. Kaum hatte er die Wohnungstür hinter sich zugezogen, knallte ein Vogel gegen das Küchenfenster. Luisa riss es erschrocken auf und spähte nach unten, tatsächlich lag da ein lebloses Häufchen auf dem Plattenboden neben der Haustür, eine Amsel vielleicht, eine junge. Gleich würde Alfred unten ins Freie treten und sich durchs Haar fahren, und Luisa würde ihm zurufen und auf den Vogel deuten. Aber nichts geschah, niemand trat aus der Haustür. Luisa wartete eine ganze Weile, und in ihrem Kopf begann eine Rechnungsmaschine zu rattern und spuckte sehr rasch ein Resultat aus. Es lautete: Frau Wendt. Frau Wendt vom Erdgeschoss. Frau Wendt mit dem Lockenschopf, mit der Olivenhaut, mit den blitzenden Zähnen. Frau Wendt mit den rosa Nachthemden, den gepolsterten Büstenhaltern, den gemusterten Strumpfhosen, den Spitzenslips. Luisa kannte Frau Wendts ganze Lingerie von den Wäscheleinen im Keller. Frau Wendt wusch dienstags, Luisa mittwochs, und jetzt war Donnerstag, und Alfred war in Frau Wendts Wohnung verschwunden. So musste es sein. Direkt vom Treppenhaus in die große Schneise von Frau Wendts Busen. So musste es sein.
Luisa nahm Maya auf den Arm und lief herzklopfend treppab. Alles war ruhig, und der Vogel war tot. Eine Drossel war’s, hell gesprenkelt, den Schnabel geöffnet. Vorbei.
Zwei Monate lang schlief Luisa auf dem Sofa im Wohnzimmer. Was los sei, wollte Alfred wissen. »Lass mich in Ruhe«, sagte Luisa dreimal hintereinander. Als er etwas von Weiberlaunen sagte, warf sie ihm eine Babyflasche an den Kopf. Darauf ließ er sie tatsächlich in Ruhe. Sie sprachen nur noch das Nötigste. Und gelacht wurde gar nicht mehr. Einmal brachen beide gleichzeitig in Lachen aus, weil Maya die Pyjamahose über den Kopf gezogen hatte und die baumelnden Hosenbeine aussahen wie Hasenohren. Und im selben Augenblick sahen sie sich verwundert an und hörten umgehend mit Lachen auf.
Frau Wendt wurde nie erwähnt, auch nicht, als sie auszog. Nach Düsseldorf, sagte der Hauswart. Sie ging an einem Dienstag, und am Mittwoch ertastete Luisa in der Ecke ihres frisch gewaschenen Deckenbezugs ein unbekanntes feuchtes Knäulchen, es war ein in der Waschmaschine vergessener Slip von Frau Wendt.