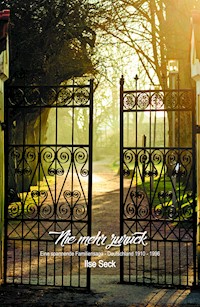2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ruhrgebiets-Autobiographie
Das E-Book Aus meinem Herzen wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Liebe, Freude, Glück, Leben, Biographie, Deutsch, Freunde, Kindheit, Kraft, Autobiographie, Wahrheit, lustig, Deutsche Geschichte, Vergebung, Verständnis, traurig, Ruhgebiet, Zirkus des Lebens, Seck, Ilse, Kindheitserrinerungen, Ruhrgebietsbiographie, Ilse Seck, Marl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus meinem Herzen
Eine Ruhrgebiets-Autobiographie
Ilse Seck
Impressum:
© 2017 Ilse Seck
Umschlaggestaltung: Kreativ B.druckt, Marl
Druck und Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-9214-0
e-Book
978-3-7345-9215-7
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Epilog
Kapitel 1
Heute am 28.9.2015 beginne ich, meine Biografie zu schreiben. Meine ersten Erinnerungen gehen zurück an ein Haus in der Zechensiedlung Marl-Brassert. Heute ist dieses Haus eine türkische Begegnungsstätte. Ich erinnere mich, dass ein schlanker Mann mit Schnäuzer mich in die Luft warf, mich wieder auffing und dann an sich gedrückt hat. Das tat mir gut.
Als nächstes ist mir dieses schicke Treppenhaus aufgefallen und ein Mädchen, das mit mir spielte. Nach den Familienfotos zu urteilen, war der Mann mein Großvater mütterlicherseits, der kurz darauf tödlich verunglückte. Das Mädchen war Ute, aus der Wohnung über uns.
Heute treffe ich sie noch ab und zu auf dem Friedhof, wenn wir die Gräber unserer Mütter besuchen.
In unserem Familiengrab liegt auch mein Vater und ein Stückchen weiter in der Grabreihe meine im Jahr 2000 verstorbene ältere Schwester Uschi, die ich sehr geliebt habe. Dann gab es in unserer Familie noch meinen jüngeren Bruder, der die steinerne Treppe heruntergefallen war und danach fürchterlich schrie und am Kopf blutete.
Er war wohl ungefähr zwei Jahre alt und ich knapp vier. Damals. In diesem Haus sehe ich noch heute vor mir, wie meine Oma Paula im Garten arbeitete, mühselig das Unkraut zupfte, aber auch leckere Sachen erntete. Zum Beispiel die Kartoffeln, die aus dem Boden kamen und hinterher gekocht wurden.
Als ich mal wieder mit meiner geliebten Oma im Garten war ich war ungefähr fünf Jahre alt - kam bei mir Langeweile auf, weil Oma zu viel Arbeit hatte. Ich war immer sehr neugierig, wusste auch, wo sich meine Eltern gerade befanden.
Sie bauten in der Blumensiedlung ihr von den Bomben zerstörtes Haus wieder auf. Das Arbeitsame von Oma Paula nutzte ich aus, um zu verschwinden. Ich wollte zu meinen Eltern. Dort angekommen sah ich ihnen zu, wie sie den Putz von den Steinen klopften, um diese dann für den Wiederaufbau nutzen zu können.
Meine Mutter brachte mich zu meiner Oma zurück, die fürchterlich weinte, denn sie hatte mich schon in der Nachbarschaft gesucht. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ich die knapp 3 km alleine gelaufen war. Sie hat mir dann gesagt, dass mich ja schließlich jemand hätte mitnehmen können. Die Geschichte vom schwarzen Mann aus der amerikanischen Besatzungsmacht, der ihr kurz zuvor Schokolade in den Kinderwagen meines Bruders geworfen hatte - daran denke ich noch heute.
An die Angst und Gefahren wegen des Krieges und an den Hunger - daran erinnere ich mich kaum oder eigentlich gar nicht. Aber an meine liebe Mutter: Dass sie immer Kinder stillte. So beispielsweise meinen jüngeren Bruder, meine beiden Cousinen und von einer guten Bekannten das Kind. Sie hat die Kinder gekuschelt und sah dabei ganz glücklich und stolz aus.
Da sie so viel Milch hatte, schaffte sie das locker; hatte immer die Zeit für die Kinder, hat dabei gesungen und jedes kleine Kind musste das Händchen bewegen: „Wie das Fähnchen auf dem Turme.“ Sie war so eine, wenn sie morgens ein Kind bekommen hatte, ging sie schon abends wieder hamstern.
Diese starke Frau hat mich fünfundsechzig Jahre meines Lebens begleitet. Erst nach 65 Jahren verriet sie mir zwei brisante Familiengeheimnisse, die sie immer mit sich herumgeschleppt hatte.
Es waren auch Straftaten dabei, die unter anderem mit einem bestimmten Paragrafen zu tun hatten, davon erfuhr ich erst, bevor meine Mutter starb.
Aber mein Leben rollt jetzt ab. Die Zeiten mit meinem fast gleichaltrigen Bruder, der denselben Schulweg hatte wie ich. Aber sein Weg verlief immer anders als meiner. Während ich brav zur Schule ging, machte er zwischendurch seine Pausen. Er musste mit den Nachbarjungen seine Kräfte messen und immer der Stärkste sein.
Es war ihm gleichgültig, ob er sich in der Matsche, auf der Wiese oder in dem kleinen Bach herumwälzte. Auch ob seine Hose zerrissen war oder nicht, interessierte ihn wenig. In der Schule lief er dann halt so herum. Im Unterricht aufmerksam zu sein, das gelang ihm nicht. Er lenkte gern die Aufmerksamkeit auf sich.
Manchmal war zum Kämpfen keine Zeit, dann musste er sich beeilen, um auf den Wochenmarkt zu kommen, der nur ein paar Meter von unserer Schule entfernt war. Dort kaufte er sich entweder Tauben, weiße Mäuse, Kaninchen oder Ziertauben, besonders aber kleine Küken. Natürlich nahm er sehr zum Entsetzen seiner Lehrerin diese Tiere mit in die Schulklasse.
Klar. Sie brauchten auch mal ihre Freiheit und liefen dann zur Freude der Klassenkameraden durch das Klassenzimmer. Die Lehrerin hatte fast immer einen Nervenzusammenbruch. Lange machte sie das Theater auch nicht mit, bald kümmerte sich ein Lehrer um die Klasse. Doch das Kaufen der Tiere ging weiter.
Lehrer Reuter fragte: „Warum kaufst du die Tiere nicht nach der Schule?“ Dann antwortete mein Bruder, dass dann die besten Tiere weg wären. Das Geld für die Tiere verdiente er sich, indem er Schrott sammelte und diesen an die Schrotthändler verkaufte. Er war eben da schon sehr geschäftstüchtig.
Leider musste ich zu dieser abenteuerlichen Zeit für fast eineinhalb Jahre nach Münster, in die Fachklinik Hornheide. Meine Mutter hatte an meiner rechten Wange ein rotes Fleckchen entdeckt, das nicht mehr weggehen wollte.
Da sie eine Freundin hatte, die am Gesundheitsamt arbeitete, besorgte diese uns einen Termin bei einem Professor aus Münster, der gerade in Marl zu Gast war. Und so wurde ich gründlich untersucht, und es wurde dabei unter anderem ein Hautlupus entdeckt.
Das bedeutete, dass ich schon kurze Zeit später in einem Zug nach Münster saß, begleitet von einer Dame des Gesundheitsamtes und schon am Nachmittag in einer anderen Welt war: Eine große weiße Holzbaracke mit einem großen Schlaf- und Speisesaal. Einer Kapelle für die Nonnen, einem langen Flur und einer Küche, das war jetzt mein zu Hause.
Ich habe am Abend geweint und in der Nacht ins Bett gemacht. Ich habe mich sehr geschämt, war sehr still und schüchtern und habe anfangs manchmal Tränen vergossen und Heimweh gehabt. Doch dann habe ich mich angepasst.
Meine Familie durfte mich nicht besuchen. Nur einmal kam meine Mutter nach einigen Monaten und brachte mir meine Puppe und einmal, nach einer für mich endlos langen Zeit, kam meine geliebte Oma, nach der ich mich so sehr sehnte. Es gab kein Telefon, und schreiben konnte ich auch nicht, manchmal kam eine Karte oder ein Brief, die mir dann vorgelesen wurden.
Zu kaufen gab es auch nichts. Wahrscheinlich hatte ich noch mehr Krankheiten, die eventuell ansteckend waren. Und so verbrachte ich mehr als ein Jahr, also das ganze zweite Schuljahr und den Beginn des 3. Schuljahres, im Krankenhaus.
Dieses Kinderkrankenhaus war neben einem großen Gebäude, dem eigentlichen Krankenhaus, in dem sämtliche Untersuchungen und Behandlungen stattfanden. Ich erinnere mich besonders an eine blaue Kobaltstrahlenlampe, die meinen Flecken auf der Wange bestrahlte, was fürchterlich brannte.
An so graue Umhänge, die Strahlen abhalten sollen, erinnere ich mich schemenhaft. Vielleicht tun deshalb meine Knochen und Gelenke heute oft so sehr weh. Es wurden begleitend Röntgenaufnahmen gemacht und es gab viele Untersuchungen und Behandlungen, die im Hauptgebäude durchgeführt wurden.
Unter anderem Höhnsonnenbestrahlungen und Wassergymnastik, aber ebenso Waldspaziergänge, Freizeit und auch anderweitige Beschäftigungen. Den Tag verbrachte ich mit den anderen mehr oder weniger kranken Kindern, mit Schwester Maria Marilla, einer Ordensschwester, einer Frau für Küche und fürs Putzen - sie hieß Agnes - und einem Hausmeister, der für die Anlagen und Reparaturen zuständig war.
Es war aber nicht so, dass wir wie Kranke bedient und verwöhnt wurden. Nein, wir mussten auch immer mithelfen, und wenn wir mal ungehorsam waren, mussten wir mit einem schweren Bohnerbesen den Flur bohnern, bis er glänzte.
Einmal bekam ich keine Luft mehr von der Anstrengung, denn meine Lunge war auch krank.
Die Schwester und Agnes waren sehr streng.
Es gab aber auch Spaziergänge im nahegelegenen Wald. Da konnten wir Eichhörnchen und Rehe bewundern und lernten, Vogelstimmen zu erkennen. Im angrenzenden Park blühten zur Osterzeit viele hunderte Narzissen. Und auf den großen Wiesen durften wir den ganzen Sommer lang spielen. Wir machten Leiterwagenfahrten mit dem Hausmeister in der Umgebung.
Und kirchliche Feste, wie das Erntedankfest, wurden mit uns gemeinsam vorbereitet.
Zu Weihnachten wurde am Ende des langen Flures ein großer Altar aufgebaut mit einer Krippe. An einem Weihnachten bekam ich ein Paket von meiner Familie und was mich besonders freute, ein großes Paket von meiner Schulklasse. Das hatte die Mutter eines Mitschülers organisiert. Es war aber so, dass ich fast alles aus diesem Paket an die anderen Kinder verteilen oder auf dem Altar opfern musste.
Eine Kleinigkeit habe ich natürlich auch bekommen. Die anderen Kinder haben sich sicher auch über die leckeren Sachen gefreut, denn nicht jedes Kind bekam ein Paket von Zuhause. Im Winter schickten meine Eltern wieder Kleidung und ich freute mich wieder auf den Frühling, wenn die Natur erwachte.
Niemals wusste ich, wie lange ich noch bleiben müsste!
In dem neuen Schuljahr waren meine Mitschüler schon in der dritten Klasse, als ich dann endlich entlassen wurde.
Zuhause hatte man mir einen tollen Empfang bereitet. Über ein Jahr weg von Zuhause, da sah alles ganz anders aus. An der Haustür hingen Girlanden, ein herzliches Willkommen in großen Buchstaben, überall war alles bunt geschmückt und die ganze große Familie war da und wir haben lecker gegessen und viel erzählt.
Und dann musste ich wieder in der Schule angemeldet werden. Da hat man überlegt, ob ich nach mehr als einem Jahr überhaupt noch in meine alte Klasse gehen könnte. Der Schulrat wurde informiert und kam. Die Rektorin und die Klassenlehrerin haben mich geprüft, ob ich den Anschluss schaffen würde. Probeweise hat man es versucht, und ich habe den Anschluss geschafft.
Als ich dann in meiner alten Schulklasse war, wurde ich von allen betrachtet und manchmal ein bisschen ausgelacht, wenn ich nicht wusste wie viel 5 × 5 ist. Schnell habe ich dann zu Hause das Einmaleins gelernt. Und so nach und nach habe ich alles aufgeholt, was ich versäumt hatte und konnte sogar nach der fünften Klasse zur Realschule gehen.
Meine Klassenlehrerin hat es mir nicht so ganz zugetraut und war sehr erstaunt über meinen Entschluss.
Ich gehörte nicht zu den Kindern, die von dem geschlachteten Schwein zuhause Fleisch mit in die Schule brachten, um eine Qualifikation für das Gymnasium oder die Realschule zu bekommen. Ich glaube, ich habe als einzige aus meiner Klasse die Aufnahmeprüfung in der Realschule bestanden und später ohne Komplikationen einen guten Abschluss erreicht.
Während dieser Schulzeit habe ich noch eine kleine Schwester bekommen, um die ich mich wie eine Mutter gekümmert habe. Denn meine Mutter hatte noch einen kleinen Laden, für den sie viel Zeit brauchte, der aber nicht viel einbrachte, weil wir selbst die besten Kunden waren. Manche Leute aus der Siedlung dachten schon, meine Schwester sei mein Kind, denn ich war ja schon 14 Jahre alt und bereits mit 13 Jahren schon 173 cm groß.
Diese Körpergröße störte meine Realschullehrerin am ersten Schultag in der neuen Schule. Ich saß in der letzten Bank und kramte mein neues Etui aus meiner Schultasche.
„Du Lange dahinten, steh mal auf! Wie oft bist du eigentlich schon sitzen geblieben?“, fragte sie mich. Ich stand brav auf, hatte wohl gestört, wäre aber am liebsten weggelaufen. Zum Glück war diese Frau nur eine Vertretungslehrerin. Die anderen Lehrer und Lehrerinnen waren fast alle nett. Nett waren auch alle meine Klassenkameraden.
Während der Schulzeit war ich manchmal krank, hatte häufig Mandelentzündung, einmal eine starke Anämie und musste jeden Morgen vor der Schule zum Arzt zum Spritzen. Aber vor allen Dingen konnte ich nicht gut laufen.
Einmal hat mich der Schuldirektor beim Rennen angefeuert, wir hatten Sportfest. Er konnte nicht verstehen, dass ich mich nicht mehr angestrengt habe, aber es ging nicht mehr. Er wusste nichts von meiner Vorerkrankung. Aber ich hatte das Gefühl, dass er mich sehr mochte.
Als meine Mutter mich aus Kostengründen nach der 8. Klasse in die Lehre schicken wollte, es war ja die Nachkriegszeit, vier Kinder, ein Haus gebaut, Schulgeld zahlen - da wuchs ihr finanziell alles über den Kopf.
Unser Schuldirektor hat dafür gesorgt, dass ich bleiben konnte. Er hat das Schulgeld erlassen, Bücher und Hefte bekam ich von da ab von der Schule gestellt. Das war auch gut so, denn die Grundlage, die ich da bekommen habe, hat mir im Leben in meiner Ausbildung und in meinem Umgang mit anderen Menschen sehr viel weitergeholfen.
Es war leider so, dass die Lehrer uns nicht so sehr vermittelt haben, dass wir gut sind, und aus diesem Schulabschluss noch viel mehr machen könnten. Es gab damals noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute, besonders nicht für Mädchen.
Die Frauen hatten nicht so viele Rechte. Meine Mutter bekam nur Wirtschaftsgeld und war in vieler Hinsicht rechtlich eingeschränkt.
So war es eben zur Zeit des Hitlerregimes. Die Frauen mussten sich ihre Rechte, also die Gleichberechtigung, erst erkämpfen. Diese wurde 1949 per Gesetz verabschiedet. Das Gesetz greift bis heute noch nicht ganz, und manchmal glaubt man, das wird nie ganz gleich zwischen Männern und Frauen, allein schon wegen der Kinder.
In höhere Positionen kommen immer noch die Männer, und der Verdienst und damit die zu erwartende Rente ist bei Frauen immer noch geringer, obwohl sie es sind, die dem Staat die neuen Erwerbstätigen bringen.
Ich habe es in meiner Berufsausbildung auch zu spüren bekommen.
Mein eigentlicher Wunsch war es, Erzieherin zu werden. Ich hatte mich aber noch bei der Sparkasse beworben und die Aufnahmeprüfung bestanden und bei den damals Chemischen Werken Hüls fürs Büro, da ging auch eine Bewerbung hin.
Mein Test muss dort so gut gewesen sein, dass man meinen Vater, der dort beim Werkschutz beschäftigt war, so sehr bearbeitet hat, dass ich den Anlernvertrag auf sein Drängen hin, unterschrieb.
Ich betone: Anlernvertrag. Frauen durften nicht, wie die Jungen aus unserer Klasse, eine kaufmännische Ausbildung machen, sondern sie konnten nur den Beruf der Bürogehilfin erlernen. Ich habe damals einen ziemlichen Aufstand gemacht, als ich dahinterkam.
Aber es hat nichts genutzt, erst ein paar Jahre später war es soweit. In der Berufsschule fühlte ich mich ehrlich gesagt unterfordert, habe auch als Beste meine Abschlussprüfung gemacht und anschließend noch eine Sekretärinnen Prüfung abgelegt.
Zu dieser Zeit bin ich immer abends nach der Arbeit und samstags mit dem Bundesbahnbus nach Essen gefahren und habe dort eine hoch qualifizierte Weiterbildung erhalten. Die Realschule gab mir die Grundlage und hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Vor unserer Schulentlassung haben wir noch eine Abschlussfahrt nach Berlin gemacht. Wir waren u.a. auch einmal, so kurz vor dem Mauerbau, im Berliner Osten. Hier durften wir nach einer Kontrolle durch das Brandenburger Tor fahren.
Das Pergamonmuseum wurde besichtigt und einige Denkmäler und viele bedeutende Plätze und uns fiel auf, dass alles schon sehr russisch geprägt war. Und viele russische Soldaten mit Gewehren und ernsten Mienen standen überall herum.
Im Westen Berlins, in unserer Unterkunft angekommen, zogen wir abends los und durften feiern. Tagsüber haben wir alle markanten Punkte besucht und es war locker und befreiend, während im Osten unser Direktor immer zur vorgeschriebenen Disziplin mahnte und bei uns ein bisschen Angst im Spiel war, auch als wir in Helmstedt über die Grenze fuhren. Dort wurde unser Bus durchsucht und wir wurden bei persönlicher Befragung durch die Volkspolizei von diesen Männern eingeschüchtert.
Hierzu muss man wissen, dass der westliche Teil Berlins nämlich in der russisch besetzten Zone lag, und auf der Fahrt von Helmstedt nach Berlin und zurück sahen wir vom Busfenster aus Männer mit Maschinengewehren im Straßengraben liegen, schussbereit bei jedem falschen Verhalten. Das war sehr angsteinflößend!
Der Mauerbau war nicht mehr fern, er kam ein paar Monate später, man sah es in den Medien. Menschen, die noch schnell in den Westen fliehen wollten, wurden erschossen von der Volkspolizei der DDR.
Mit großem Aufwand wurde die Mauer 1961 gebaut und der ganze östliche Teil Deutschlands erhielt eine unüberwindbare Grenze mit schussbereiten Wachposten.
Zu unserer Schule gehörte ein Schullandheim. Zwei- oder dreimal durften wir mit unserer ganzen Klasse jeweils 14 Tage dort verbringen. Das war eine herrliche Abwechslung. Mit der Familie Urlaub zu machen, war vielen zu dieser Nachkriegszeit noch nicht möglich. Die Eltern waren schon froh, wenn sie sich zu dieser Zeit einen Fernseher auf Abzahlung kaufen konnten oder einen Koboldstaubsauger.
Wir hatten schon einen Fernseher 1954 zur Fußballweltmeisterschaft. Da war die halbe Nachbarschaft bei uns im Wohnzimmer.
Zurück zum Schullandheim. Schullandheim Veckerhagen war da schon etwas ganz Besonderes. Hier gab es Wanderungen und Besichtigungen. Wir nahmen unsere Mahlzeiten gemeinsam ein und verbrachten die Freizeit auch miteinander.
Natürlich wurde auch etwas gelernt, aber es war nicht so streng wie in der Schule. Im Nachhinein betrachtet, hat uns Schüler die Zeit sehr nah aneinander gebracht.
Heute noch, nach über 50 Jahren, treffen wir uns regelmäßig und jedes Mal ist es so, dass wir uns freuen und ganz nah miteinander sind. Dort, in Veckerhagen, entstand sogar eine Liebe zwischen einer Mitschülerin und einem Mitschüler, die heute noch besteht. Diese beiden Menschen gehören zu meinem engsten Freundeskreis.
Realschule hat mit Realität zu tun. Neben den allgemein üblichen Fächern lehrte man uns zu kochen, zu nähen, selbst das Maschinenschreiben hat man uns dort beigebracht.
In der Aula durfte ich immer Gedichte vortragen. Einmal bin ich leider an einem Goethegedicht gescheitert. Ich hatte einen „Blackout“, wie man heute sagen würde.
Man war auch großzügig, wenn es mal um Schulbefreiung ging. Meine kleine Schwester war einmal, als sie noch keine drei Jahre alt war, in heißes Wasser gefallen. Drei Wochen lang lag sie auf Leben und Tod. Unsere ganze Familie hat sich abgewechselt, so dass ständig jemand bei ihr im Krankenhaus war. Sie war dritten Grades verbrannt und hatte kaum eine Überlebenschance.
Natürlich war ich von den Hausaufgaben befreit und auch oft von den Schulstunden. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal vollkommen durchnässt in der Schule ankam. Meine Lehrerin, die nahe der Schule wohnte, ging schnell nach Hause und holte mir von sich trockene Kleidung.
Gern erinnere ich mich daran, dass wir während der Schulzeit zur Tanzschule gehen konnten. Bei dem Abschlussball war unsere ganze Lehrerschaft vertreten.
In der Schule ging es in Bezug aufs Lernen streng zu, aber in Ausnahmefällen spürte man immer eine Herzlichkeit und Menschlichkeit, so auch beim Übergang ins Berufsleben.
Werte wie Herzlichkeit, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Glaube, Ehrlichkeit wurden mir zuhause vermittelt.
Zuhause, das war das neu errichtete Haus, da wohnten meine Eltern, anfangs wir drei Kinder, später waren es vier, und meine Oma, die uns vorher in ihrer Zechenwohnung aufgenommen hatte, als die Bomben das Elternhaus meines Vaters zerstört hatten. Sie war Witwe, weil Opa tödlich verunglückt war.
Direkt nebenan in einer Holzbaracke lebte die andere Oma, die aus Ostpreußen kam. Sie war inzwischen ebenfalls Witwe, weil der Opa tot in einem Bombenloch gelegen hatte. Außer meinem Vater hatte sie noch einen Sohn, der jedoch im Krieg gefallen war.
Die älteste ihrer zwei Töchter war schon außer Haus und hatte selbst schon 6 Kinder, da half die Oma manchmal aus. In der Baracke lebte Oma mit ihrer kleinen Tochter, die kaum älter war als meine ältere Schwester.
Etwa sechs dieser Barackenhäuser, für 12 Familien insgesamt, hatte man direkt nach dem Krieg aufgebaut, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf hatten. Die andere Hälfte der Baracke bewohnten die Nachbarn, denn deren Haus war auch von den Bomben zerstört worden. Die Baracke blieb stehen, bis wir 1997 anfingen, unser Haus zu bauen. Die Oma, die vorher darin gewohnt hatte, war schon tot.
Zu der Anfangszeit gab es noch keine Kanalisation in unserer Siedlung und ich erinnere mich noch, dass in der Baracke anfangs ein Plumpsklo war. Trinkwasser bekam man aus einer Pumpe und darum musste es immer abgekocht werden.
Im gemeinsamen Garten wurde Gemüse angebaut und die Straßen rundherum waren noch nicht gepflastert. Sie bestanden aus festem und sandigem Boden.
Durch die Straßen fuhren überwiegend Pferdefuhrwerke; der Bäcker hielt an bestimmten Stellen an und man konnte dann zum Wagen gehen und kaufen. Brot kostete damals nur ein paar Groschen und ein Brötchen 5 Pfennige. Selbst der Kartoffelhändler fuhr durch die Straßen, ebenso der Lumpen- und Schrotthändler sowie der Milchbauer.
Die Oma, die mit uns im Haus wohnte, war nicht nur die wahre Liebe in Person, sondern sie half meiner Mutter sowohl bei der Hausarbeit wie auch finanziell. Sie bekam eine gute Rente, denn mein Opa war Holzmeister bei der Zeche Brassert, bevor er starb. Für uns Kinder war das ein Segen, denn so eine Oma hatte nicht jeder. Ich meine - nicht wegen des Geldes.
Oma erzählte Geschichten, wir konnten mit ihr im Bett kuscheln, für fast jede Krankheit hatte sie ein Naturheilmittel und wenn es nur das Bauchstreicheln war, wenn man mal einen grünen, unreifen Apfel gegessen und dadurch bedingt Bauchschmerzen hatte.
Ich fand sie schön und elegant. Sie trug viel schwarze Kleidung, hatte aber immer einen steifen glatten, weißen Kragen oder einen noch feineren aus edler Spitze. Und wenn wir verreisten, hatte sie einen schicken Hut auf. Damit Oma noch schöner wurde, habe ich sie stundenlang frisiert, und sie hat stillgehalten.
Sie war immer froh, wenn sie mal sitzen konnte und manchmal fielen ihr die Augen dabei zu.