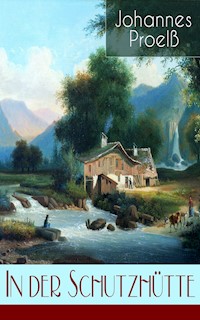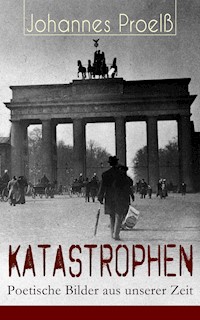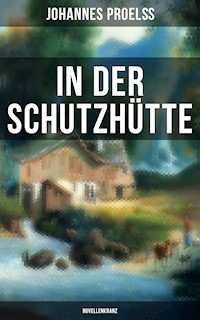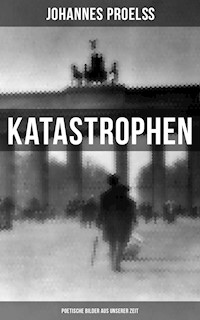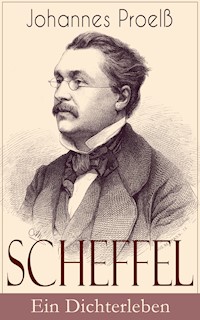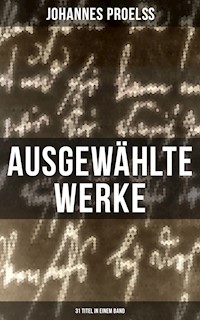
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Johannes Proelß, ein bedeutender Autor des 19. Jahrhunderts, präsentiert in seinem Werk 'Ausgewählte Werke' eine Sammlung von 31 Titeln in einem Band. Diese vielfältige Auswahl umfasst Gedichte, Romane und Essays, die Proelß' breites literarisches Spektrum und seinen einzigartigen Stil zeigen. Der Autor zeichnet sich durch seine präzise Sprache, tiefgründige Themen und emotionale Intensität aus, die seine Werke zu zeitlosen Klassikern machen. Sein literarischer Kontext ist geprägt von der Romantik und der aufkommenden Moderne, was sich in seinen komplexen Charakteren und literarischen Motiven widerspiegelt. Proelß' Werke bieten den Lesern einen Einblick in die vielschichtige Welt des 19. Jahrhunderts und laden sie dazu ein, über die menschliche Natur und die Gesellschaft nachzudenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgewählte Werke
(31 Titel in einem Band)
Books
Inhaltsverzeichnis
Prosa und Lyrik
Katastrophen
Poetische Bilder aus unserer Zeit
Zum Geleit
Ein Märchen leitet die kleinen poetischen Erzählungen ein, die ich in diesem Buche zusammenstelle, und die sich als poetische Bilder aus unserer Zeit, als realistische Darstellungen des modernen Lebens geben. Dieselben entstanden sämmtlich unter dem Eindruck gewaltiger, herzerschütternder Unglücksfälle, denen manches kraftvolle Menschendasein zum Opfer fiel: sie schildern allgemein betrauerte Katastrophen im Leben der Natur und der Gesellschaft im Zusammenhang mit Konflikten der Herzen und der Gemüther, welche über die verheerende Wirkung der ersteren den verklärenden Schimmer der Versöhnung breiten. So blüht aus der Asche einst kraftvoller Bäume die duftige Blume des Waldes.
Das Märchen »Hans im Glück« dagegen erstand im Gemüthe des Autors zu einer Zeit seligen Glücks, die vom frischen Hauche des Frühlings, der in der Natur wie in seinem Herzen fröhliche Ostern hielt, durchweht war.
Der Sinn des Märchens aber ist der: wahrhaft glücklich auf Erden ist allein der Mensch, dessen Auge geschärft ist für die Schönheiten der Welt außer ihm, dessen Ohr im Stande ist, den harmonischen Akkord zu erfassen, welcher auch für die Dissonanzen des Daseins besteht. Ihm ist die Erde weder die schlechteste der Welten, noch die denkbar beste, aber der vorhandene Ausgleich zwischen Gut und Schlimm, Schön und Häßlich versöhnt ihn immer aufs neue mit den Schattenseiten des Lebens. Wessen Seele dieses Glück birgt, dem genügt es aber auch nicht, sich seiner in selbstsüchtigem Behagen zu erfreuen, der fühlt sich auch angetrieben, die von ihm empfundene Harmonie zwischen sich und der Welt anderen zu verkünden als ein Apostel der Liebe zum Leben, als ein Gegner seiner Verächter. Dieses Glücksempfinden und seine Verkündigung ist Poesie. Unser »Hans im Glück« ist solch ein Glücklicher: Nur als Ahnung regt in dem Knaben sich Anfangs das poetische Drängen. Aber die Mauern der Schule versperren ihm den Weg zur Erkenntniß, die ihm das Wesen seines Berufs offenbart. Nur tastend findet er den rechten Pfad. Er empfindet die Poesie vergangener Zeiten und fremder Sinnesgenossen; er glaubt sie für sich zu gewinnen durch das Studium abstrakter Regeln, nach denen das Schöne sich bilde, aber erst der Genuß des eigenen Lebens, die Empfindung seines Zusammenhangs mit der Natur und seinen Mitmenschen, das Glück der Liebe und der freien Lebensbestimmung lösen seiner Seele die Zunge Es ist der Entwicklungsgang des modernen Dichters. Uns Söhne der Gegenwart nimmt die Schule und deren scholastischer Vergangenheitskultus frühe in ihre beengende Zucht. Auf dem Umweg durch die Welt fremder Geisteswerke, durch die dürre Haide der abstrakten Theorie gelangen wir erst auf die fette grüne Weide des Lebens Wohl dem, dessen Sinn darüber nicht jene Frische des Blicks, jene Feinheit des Gehörs für die unmittelbare Poesie des eigenen Daseins verliert!
Die folgenden kleinen Beiträge zur Poesie der Gegenwart sind von ihrem Autor geistig empfangen worden mitten in dem lauten, dissonanzenreichen Getümmel, das der Zusammenprall der öffentlichen Meinungen, Forderungen und Klagen in dem Redaktionsbureau einer großen Zeitung erzeugt. Während er die herzerschütternden Berichte über den furchtbaren Brand des Ringtheaters zusammenstellte, stieg vor seiner Seele das kleine Lebensbild auf, welches dieser verheerenden Katastrophe eine versöhnende Seite abgewinnt. Während er die Einzelheiten der letzten großen finanziellen Krise in Paris für feine publizistischen Berufszwecke studirte, entstand »Lili«, eine Erzählung, welche für die Katastrophe des plötzlichen Vermögensverlustes ein harmonisch ausklingendes Gegenbild bietet. Das große nationale Unglück der letzten Rheinüberschwemmung regte ihn zur Gestaltung der Hochflutgeschichte an, die »zwischen Himmel und Wasser« den Sonnenschein der Poesie verklärend fallen läßt und der zerstörenden Elementargewalt der Natur die siegreiche Ueberlegenheit der Kultur gegenüberstellt.
Der Dichter will sein Recht. Der Publizist stellt das Unglück dar in seiner ganzen schreckensvollen Größe, auf daß praktisch gegen seine Folgen und seine Wiederkehr angekämpft werde; der Dichter aber wird gerade auch hier seine Wünschelruthe benutzen, die ihm selbst da, wo Jammer und Elend herrschen, das Vorhandensein einer besonderen Glücksquelle zu verrathen vermag; er wird gerade auch hier dem Gedanken der Versöhnung zum Triumph verhelfen. Denn selbst dort, wo der Tod sein grausames Tagewerk verrichtete, kann sein Auge die Blume des Trostes emporblühen sehen.
Dieses Amt des Versöhners ist nicht die einzige Mission, welche der Dichter auf Erden hat. Er kennt noch eine höhere, die im Gegensatz zu jener, die gedankenlose Zufriedenheit mit den Zuständen der Welt aufrüttelt aus ihrem Stumpfsinn und der Menschheit Ideale vorführt, die erstrebt werden können und sollen zum Heile der Gesammtheit der Menschen. Aber schon diese eine Mission macht den Beruf des Dichters zu einem innigst beglückenden, zu einem der Welt unentbehrlichen. Denn was ist ohne den Glauben an die Möglichkeit eines Glückes auf Erden, ohne die Liebe des Einzelnen zum Leben alles Mühen um den Fortschritt und die Vervollkommnung der allgemeinen Zustände? Wer kämpft muthig, wenn ihm das Dasein nichts werth ist?
Frankfurt a. M., 15. April 1883.
Johannes Proelß.
Hans im Glück
Ein Frühlingsmärchen
Er war ein schmucker Klosterschüler und seine Kameraden nannten ihn »Hans im Glück«. Sein eigener Name lautete zwar ganz anders und vom Glück der Welt hatte er bisher wenig erfahren. Vielmehr war das Schicksal schon recht bös mit ihm umgegangen; es hatte ihn, den jüngsten Sohn eines ritterbürtigen Hauses, rücksichtslos zur Klerikerlaufbahn verdammt, obgleich sein thatenmuthiger, lebensdurstiger Sinn nach ganz anderen Dingen stand. Und auch nachdem das Schicksal in so wichtiger Sache gar widrig gesinnt sich erwiesen, hatte es nachträglich noch oft den flotten Jungen recht unfreundlich am krausen Gelock gezaust, denn er war jähen Sinnes und mußte dies öfters büßen. Also bei Lichte betrachtet, hatte unser Hans im Glück Pech, aber dies stand ja auch nicht im Widerspruch mit dem Märchen, nach dessen Helden die eifrigen Lateinschüler der Benediktinerabtei ihren frohherzigen Gefährten nannten. Wie dieser hatte er zwar nie einen gewichtigen Goldklumpen erhalten und somit auch nie einen solchen mit einem Gaul umtauschen können, und diesen mit einer Kuh, einem Schwein, einer Gans, einem Wetzstein, der schließlich in den Ziehbrunnen fällt. Wohl aber hatte er wie dieser einen echten Goldschatz im Herzen, ein zufrieden Gemüth, das sich schnell mit jeder neuen Lage des Lebens versöhnt und auf deren gute Seiten den Blick gerichtet hält, das lächelnd einen Verlust hinnimmt, weil es weiß, daß damit auch eine Last von der Seele genommen. Er war einer jener fröhlichen Gesellen, denen die Welt so schön erscheint, die Sonne so hell erglänzt, der Duft der Blumen so süß ist, daß sie auch mit batzenleerer Tasche, wie jener Hans im Glück des Märchens rufen können: So glücklich wie ich bin, gibt es keinen Menschen unter der Sonne.
Auch heute war er nicht trüben Sinnes, obgleich er wahrlich Ursache dazu hatte. Denn fällt es dem jungen Blute schon an und für sich schwer, lange stille zu sitzen, so pflegen Schloß und Riegel diesen Zwang zur Qual zu steigern. Und heute war Hans im Glück in Arrest. War da des Morgens ein vornehmer Jungherr auf den Klosterhof geritten gekommen, um bei seinem Ohm, dem hochwürdigen Herrn Abt, Einkehr zu halten. Es war gerade Freistunde und der seines Reiters ledige Rappe reizte bald die Neugier der unternehmenden Klosterschüler. Hans hatte eine passende Gelegenheit wahrgenommen, sich in den Sattel des stolzen Hengstes geschwungen und festen Griffes das Roß zu allerhand kühnen Reiterkünsten genöthigt. Unter dem Jubel der Kameraden war er in den Klosterhof gesprengt und hatte auf den zierlich gewundenen Kieswegen seine ritterlichen Uebungen fortgesetzt. Inzwischen war der stolze Herrensohn zurückgekehrt, begleitet von seinem hohen Verwandten. Er vermißt sein Pferd; man ruft, man sucht danach die Freude des jungen Volkes findet ein jähes Ende und ihr Held bekommt zunächst in einem der düsteren Bibliothekzimmer Muße, über die Wahrheit nachzudenken, daß wer zu hoch steigt, auch leicht fällt. Doch ihn focht dies wenig an. Sein Auge blieb hell und klar und weidete sich an dem funkelnden Spiel der goldig glänzenden Staubkörnchen, das ein breiter Sonnenstreif, der durch die grünen Butzenscheiben fiel, sichtbar machte. Der hoffnungerweckende Sonnenstrahl fiel auch auf eine Flucht schön vergoldeter Bücherrücken auf einem der Regale und bei deren Anblick verschwand erst recht jede Spur von Sorge und Kummer auf des Jünglings Gesicht. Das waren ja seine Freunde, die so oft heimlich durchstudirten Folianten: da das »große Heldenbuch«, daneben das »kleine«, hier das Lied Gutrun und da eine saubere Handschrift von Minneliedern, deren melodischer Klang schon mehr als einmal sein Herz berauscht und von denen er so manches auswendig wußte. Das war seine Lieblingslektüre; so ein Sänger zu werden, ein Freund, ein Liebling von Vornehm und Gering, von Frauen und Jungfrauen um seiner Lieder willen, dünkte ihm noch begehrenswerther, als Heldenruhm und der Preis des Siegers im Buhurt. So saß er versunken in die Welt einer ihm aus der Vergangenheit lockend entgegendämmernden Poesie und las und las, nicht merkend, daß der Sonnenstrahl allmählich der Dämmerung wich, ja einmal zweimal gar überhörend, daß dicht vor ihm am Fenster leise geklopft ward.
Ein Freund hatte nicht ohne Gefahr die Höhe gewonnen, um ihm mitzutheilen, daß der Abt aufs höchste über seinen Streich, den er als persönliche Beleidigung aufgenommen, empört sei, und ihm diesmal gar schwere Strafe drohe.
Mitten in seinem Traume von Heldenruhm und Dichterglück gestört, achtete Hans nur wenig der Warnung. Er dankte, nahm Abschied, empfahl dem Freunde herzliche Grüße an die Kameraden. Allein gelassen, suchte er dann weiter zu lesen; doch die Finsterniß wehrte es ihm. Alte Pläne von Flucht und abenteuerlicher Fahrt wurden in seiner Seele wieder lebendig. So träumte er vor sich hin.
Es war Mitternacht vorüber, da beleuchtete der Mond eine schlanke Jünglingsgestalt, die sich gewandt dem Fensterrahmen der Bibliothek enthob, dann sacht herniederglitt, leise über den Hof schlich, die Mauer hinanklomm und ein Sprung: der Klosterhof umschloß eine freie Seele weniger. Allein, ohne Lebensplan, ohne Mittel und Kenntniß des Weges schritt Hans seinen Pfad immer dem Mondlicht entgegen und doch in seiner Seele jauchzten Wonnemelodien. Wohl hatte er allen sicheren Besitz seines Lebens eingetauscht um wilde Ungewißheit; er aber war und blieb doch Hans im Glück.
Es war heller Morgen, als er mitten im Wald einem Reiter begegnete. Es schien ein vornehmer Herr zu sein, sein Roß war wohl gerüstet und auch die Kleidung zeugte vom edlen Stande des Mannes. Aber ein Kriegsmann war er nicht; der weiße Bart, die hohe Stirn gaben der hageren Gestalt den Charakter eines Gelehrten.
»Wo hinaus, junger Gesell?« hörte sich Hans angeredet.
»In die weite Welt«, gab dieser zurück.
Der Alte lächelte und sagte: »Das ist aber sehr weit, junger Freund. Habt Ihr kein näheres Ziel?«
»Nicht, daß es mir bekannt wäre. Doch vertrau ich dem Glücke, das wird mich schon führen.«
»Ihr habt ein gutes Vertrauen. Wenn es aber nicht Stich hält.«
»Ich kann warten. Einmal wird sichs schon belohnt finden.«
Der Alte lächelte von neuem. »Wißt, Gesell, Ihr gefallt mir. Vielleicht hat das Glück bereits seine Hand im Spiel gehabt, als wir uns begegnen mußten. Sagt einmal, was wollt Ihr denn am liebsten werden.«
»Ein fahrender Sänger«, war Hansens schnelle Antwort. »Wißt Ihr etwa einen Meister, der mich in der Kunst unterweisen kann.«
»Ob ich den weiß«, sagte der Alte und strich sich über den weißen Bart. »Bin ich doch selbst ein solcher, dazu kundig geheimer Wissenschaft. Könnt Ihr schreiben?«
»Das will ich meinen. Gothisch, arabisch und griechisch. Komme ja direkt von der Schule.«
»Das ist gut. So ist Euer Glück gemacht, wenn Ihr nur als mein Schreibergesell mit mir gehen und mir helfen wollt bei meiner Arbeit. Auf drei Jahre seid der meine. Dann geb ich Euch frei. Ich brauch eine glückliche Hand; die habt Ihr, wie ich merke; ich will sie hoch schätzen. Mit reichem Lohn sollt Ihr dann von mir ziehen.«
Hans wars zufrieden und schloß sich dem einsamen Reiter an. Sie bogen seitwärts und bald öffnete sich eine breite Lichtung, an deren Ende ein stattliches Schloß erglänzte. Das war des Alten Wohnsitz. Staunenden Auges betrat Hans an der Seite seines Gönners die prächtigen Gemächer. Diener waren nicht sichtbar. Aber es war, als ob unsichtbare Geister dem Alten zur Verfügung ständen. An den Thüren berührte er nur einen kleinen Knopf; die Pforte sprang auf. Sie setzten sich in einem Gemach vor einen Tisch. Der Alte berührte auch hier eine Reihe von Knöpfen und die Tafel bedeckte sich mit Speisen und Getränken. Dann führte Doktor Scholastikus so nannte sich selbst der seltsame Wirth unseren jungen Freund in sein Laboratorium. Die Wände waren mit Bücherreihen bedeckt, auf Tischen stand allerhand seltsam Geräth Tiegel, Amphoren, Retorten in einer Ecke erblickte Hans ein Gerippe und in der Mitte des Raumes brodelte ein Schmelzofen.
Zunächst wurde Hans angewiesen aus alten Folianten Abschriften von alchimistischen Recepten zu machen. Er schüttelte zwar den Kopf, inwiefern das alles mit der Poesie zu thun haben solle. Aber doch spannte das dunkle, geheimnißvolle Wesen sein Interesse. Er merkte bald, daß der Alte bestrebt war, den Stein der Weisen durch allerlei chemische Verbindungen künstlich herzustellen und wie der Weisheit war er auch der Schönheit auf der Spur. Wenn er beide Aufgaben gelöst hätte, würde er zugleich der weiseste Mann und der größte aller Künstler geworden sein. Die vielen hierzu nöthigen Studien brachte er nicht allein fertig. Deßhalb hatte er sich den sprachenkundigen Springinsfeld eingefangen. Der glaubte zwar anfangs nicht an die hohe Mission seines Meisters, aber er sah ein, daß er bei dieser Arbeit mancherlei lernen könne. Allmählich, nachdem er mehr und mehr in die Künste des Adepten eingeweiht worden, verlor sich jedoch auch seine Seele in diese Welt voll dunkler Probleme und halbgelöster Räthsel. In einem Gemach neben seiner Arbeitsstube arbeitete der Alte mit Vorliebe. Hier durfte er ihn nicht stören. Das Betreten dieses Gemachs hatte er ihm streng untersagt. Denn hier sann und schuf der Meister ganz für sich, um das Wesen der Schönheit und damit aller Kunst und Poesie Seele auf künstliche Weise zu ergründen und darzustellen.
Einst hatte Hans bis tief in die Nacht vor seinen Retorten und Tiegeln gesessen. Er hatte am selben Tage eine Mischung gefunden, die genau erfüllte, was er aus einer dunklen Weisung des Nostradamus herausgedeutet. Lange hatte sein Blick das Flackern der Flamme verfolgt, unwillkürlich war seine Hand dabei einem Drücker neben dem Herde nahegekommen, den er ehedem nicht bemerkt hatte. Da gieng plötzlich die Thüre des Nebenzimmers auf, eine weiche Musik ertönte und jenseits der Schwelle erblickte er eine feenhaft schöne Mädchengestalt, die mit lockenden Mienen ihn grüßte. Da hielt es ihn nicht mehr zurück. Er eilte auf sie zu. Das lichtgoldne Haar glitzerte vor seinen Augen mit verwirrendem Glanze, die blauleuchtenden Blicke der Jungfrau schienen ihn zu umarmen; er breitete seine Arme aus, er riß das bezaubernde Geschöpf an sein Herz; heiß inbrünstig suchte er ihre Lippen. Doch entsetzt fuhr er zurück. Kalt und hart war der Mund den er berührte; hart und wächsern der Leib den er umfaßt hielt; eine leblose Puppe lag in seinen Armen.
Gebrochen an allen Gliedern erhob er sich. Er warf die Thür entsetzt zu. Von Frost durchschüttelt taumelte er zurück zu seinem Schmelzofen. Die Flamme dünkte ihn zu schwach, er schürte sie, daß sie hell emporschlug. Der Feuerschein that ihm wohl. Doch merkte er nicht, wie derselbe den Kessel allmählich zum Glühen brachte. Der Boden ward röther und röther und auf einmal dröhnte ein furchtbarer Knall durchs Gemach. Eine Explosion war erfolgt. Die Scheiben der Fenster zersprangen, sie selbst flogen auf. Hans lag in tiefer Ohnmacht.
Als er aufwachte, fluthete der linde Hauch eines Frühlingsmorgens durch das Zimmer und fächelte seine Schläfe. Würziger Fliederduft mischte sich in das Grüßen und lauten Schalles tönte ihm durch die Stille entgegen das Lied der Nachtigall.
Er eilte ans offene Fenster. Im Morgendämmerschein lag eine blühende Frühlingslandschaft vor ihm ausgebreitet. Wie eine Auferstehungsoffenbarung trat ihm die Natur in all ihrer Schönheit und Frische entgegen. Er strich sich über die Schläfe. »Wie schön, wie schön!« rief er und athmete tief und durstig die klare, dufterfüllte Luft ein, als schlürfe er Nektar. Da drang lautes Schelten an sein Ohr. Doktor Scholastikus war im Nebenzimmer erschienen und bemerkte an seiner Schönheitspuppe die Spuren sträflicher Umarmung.
Doch nicht mit Schrecken, nur mit Ekel und Spott erfüllte der Lärm den jungen Gesellen. Wie hatte er nur so lange sein Leben in dieser Winternacht verträumen können. Was waren ihm jetzt die Schätze, die ihm der Alte in Aussicht gestellt. Er ließ sie hinter sich! Frohgemuth stieg er auf den Sims des Fensters und eine Sekunde später lag Hans in Glück unten auf dem weichen Rasen, dem Frühling am Herzen.
Wie berauscht von all der Lebenswonne, die seine Adern durchschauerte, schritt er hin durch die Gänge des großen Gartens. Die Vergangenheit kam ihm vor wie ein wüster Traum, die Gegenwart hatte ihn neu geboren. Schöne Jahre seiner Jugend hatte er vergeudet an eitle Schemen, und der Poesie, der zu dienen sein Herz sich sehnte, war er inzwischen ferner gerückt, als in der Umfriedung der Klostermauern. Wo war sie zu finden? Nicht in Büchern, nicht in phantastisch erfaßten Gesetzen der Natur, die diese doch nur entwürdigten, dessen war er sich jetzt klar! Der Natur? Ja, zu dieser, der reinen, großen, fühlte er sich gezogen mit magnetischer Gewalt!
So wogte es auf und nieder in seinem Herzen, während er unter dem schneeigen Gezweig eines blühenden Apfelbaumes sich gelagert hatte und ins klare Blau des Himmels blickte. Der Baum erhob sich dicht bei dem Bretterzaun, der den Schloßgarten von der Außenwelt trennte. Hans lag mit dem Rücken gegen den Zaun und erst der feurige Streif, welcher von der aufgehenden Sonne über denselben hinweg in den Garten fiel, veranlaßte ihn, sich umzuwenden. Er fuhr mit der Hand über die Augen wie geblendet. Was war das? Das waren nicht Sonnenstrahlen, die ihn zwangen das Auge niederzuschlagen und gleich darauf wieder zu erheben! Diese Strahlen kamen aus Augen von klarem und doch feurigem Glanze, deren Blick freundlich auf ihn niedergerichtet war. Wie ein holder Genius der Natur erschien ihm das frische Mädchen, das, die halb entblößten Arme auf die Planke gestützt, nun ihr schwarzes Krausköpfchen vorbeugte und den sie grüßenden jungen Mann freundlich anlachte. Mit Staunen hörte sie von ihm, was der alte Schloßherr eigentlich treibe und wie er selbst vor geraumer Zeit in dessen Dienste gerathen.
»Wißt Ihr auch Junker, daß man Euch das viele Studiren und Nachtwachen ansieht.« Sie sah ihm dabei tiefer ins Auge und beide wurden darüber roth. »Es war wohl höchste Zeit, daß Ihr dem bösen Manne Valet sagtet und zu uns kamet. Uns ist vor ein paar Wochen der Lehrer im Ort gestorben und ich will wetten, mein Vater, der Schulze, gibt Euch gerne die Stelle.«
»Ich aber wollte ein Spielmann werden.«
»Ei, das könnt Ihr auch bei uns. Den Liedersang lernt man am besten im Freien, in der Natur; darum sind auch die Vöglein in ihm solche Meister. Im Waldesrauschen, im Frühlingsgrün mag man das Dichten wohl besser lernen als da drin in den dunklen Stuben.
»Am besten aber,« rief Hans, »bei Dir in den Armen der Liebe!« und er neigte sich über die Planke, umarmte die holde Maid und küßte sie beherzt auf den schwellenden Mund.
Im Nu war er drüben bei ihr. Sie küßten sich sorglos und sprachen einander von Liebe, ohne zu wissen, wie es gekommen, daß deren süßer Zauber so schnell sie gefangen genommen. So giengen sie Hand in Hand der majestätisch emporwachsenden Sonne entgegen. Erst jetzt fragte sie den Freund nach seinem Namen.
»Sie nennen mich Hans im Glück. Aber erst von dieser Stunde an weiß ich, wie Recht sie haben.«
Dann saßen sie nieder unter einem blühenden Fliederbusch, dessen elastisches Gezweig lauschig sie umfieng. Sie frugen sich anfangs viel und gaben treulich Bescheid, schließlich war Frage und Antwort nur noch ein einziger Kuß.
In ihr Schweigen aber tönte festlich und fröhlich das Lied der gefiederten Sänger des Waldes und es war, als ob tausendstimmig es durch die Lüfte hallte: Nun bist Dus wirklich! Heil, Heil, »Hans im Glück«!
An jenem Tage jedoch erstand in des Gesellen liebseligem Gemüth das erste wahrhaft eigene Lied. Lateinische Hexameter hatte er wohl früher mit Eifer geschmiedet, die neue Weise entstand mühelos, von innen heraus. Das Versmaß gab ihm weder Ovid noch ein deutscher Meister und den Text entnahm er keinem Rezept der Magie. Es kam aus dem Herzen, wie das Lenzentzücken und die Liebe über dasselbe gekommen. Es war das Walten der allmächtigen Natur.
Und ein Hans im Glück blieb er sein Lebelang. Nun ist er längst gestorben. Aber sein Lied lebt noch heute und Knaben und Mädchen singen es, wenn sie am Frühlingsmorgen über den blumigen Anger durch die blaue Luft schreiten und heimlich träumen von dem wahren Glück des Lebens, von dem Geheimniß aller Poesie, der Liebe.
Durchs Fegefeuer zum Paradies
Nochmals, ich bitte Dich, laß heute das Theater und bleibe daheim. Ich bin nicht wohl und die ganze Woche schon sind wir nicht zu Ruhe gekommen. Laß uns einmal den heutigen Abend in der eigenen Häuslichkeit verbringen.«
Kurt Fernaus Stimme bringt die Bitte ruhigen Tones hervor, obgleich ein leises Zittern derselben auch die nur mühsam unterdrückte Erregung verräth.
»Du bist immer derselbe Griesgram und mußt mir alles verderben. Seit Tagen hab ich mich auf diese neue Operette gefreut und nun auf einmal, nur Deiner Grille zu lieb, soll ich daheim wie im Gefängniß bleiben. Ich will aber nicht.« »Nun, wenn Dir unser Heim wie ein Gefängniß vorkommt, gut, so geh, ich halte Dich nicht.«
Die junge, nicht geradezu auffallend, aber doch ein wenig kokett gekleidete Frau streift ein zorniger Blick des ungeduldig auf- und niederschreitenden Gatten, der, eben beim Kamin angelangt, seine nur halb gerauchte Zigarre in die glimmenden Kohlen schleudert, daß die Funken emporsprühen.
»Ja, spiele nur den Beleidigten. Diesmal behalte ich meinen Kopf!« ruft dagegen die kleine Frau, indem sie sich vom Spiegel, vor dem sie sich eben einen Bund frischer Schneeglöckchen in die Haare gesteckt hat, lebhaft abwendet und, mit dem kleinen Stiefelchen aufstampfend, eine stolze Haltung annimmt. »Wozu soll ich bei Dir bleiben? Um Deine spitzen Vorwürfe anzuhören? Ja sieh mich nur immer an mit Deinen großen Augen. Es ist umsonst. Ich lasse mich nicht mehr tyrannisiren! Wenn Dir meine Freude am Leben zuwider ist, so hättest Du das bedenken sollen, ehe Du mich zur Frau nahmst.«
Der Mann seufzt und sucht jetzt mit halb wehmüthigem Blick das Auge seiner Frau. »Emmy, Du frevelst« »Nein, Du frevelst an mir. Ich bin noch jung; ich habe ein Recht darauf, das Leben zu genießen und will es. Mama sagt es auch. Ich will mir die Lust nicht verderben lassen durch Dein sauertöpfisch Gebahren. Ich bin es müde, ja! recht müde! Und damit basta. Das Billet ist da; ich hab es angenommen, und daß ichs benutze, bin ich schon der Tante schuldig! Adieu! «
Wenige Wochen noch und das junge Paar hätte die Erinnerung an die Hochzeit zum dritten Male festlich begehen können. Aber die Stimmung ihrer Seelen dachte nicht an solche Feier der Herzen. Der Zauber, welcher die Liebenden damals berauscht und in Bann gehalten, als sie sich die Hand zum Bunde fürs Leben gegeben, war allzu früh für ihr Glück gewichen und Emmy und Kurt waren zwar noch ein junges Paar, aber halfen bereits die Menge der unglückliche Ehen vermehren. Und doch war er, wenn auch beträchtlich älter und gesetzter als die lebhafte Lebensgefährtin, ein liebenswürdiger, stattlicher Mann, wohl im Stande jedes Weib, das ihn liebte, zu beglücken. Und auch das überschäumende Temperament und der leichte Sinn des Wiener Kindes, das er an seine Seite gefesselt, war nur die Außenseite eines Innern, dem gefährlicher Leichtsinn fremd war und starke, innige Liebesempfindung eigenthümlich. Auch hatte sie beide aufrichtige Neigung zusammengeführt und der Glaube, für einander bestimmt zu sein; nicht Spekulation. Und dennoch schienen die Gluten, die einst so hell emporgeflammt, erloschen. Die Sonne des Liebesfrühlings war jäh untergegangen und kalter Frost hatte die einst so glühende Wärme der Herzen vernichtet.
Kurt Fernau, ein talentvoller Musiker, war vor fünf Jahren nach Wien gekommen, wo er an einem der großen Concertinstitute der Donaustadt lohnende Anstellung gefunden. Er war Norddeutscher von Geburt und auch nach Bildung und Wesen. Wie aber das Fremdartige auf die meisten Naturen einen ganz besonderen Reiz ausübt, so hatte auch der Zauber des Wiener Lebens ihn überkommen wie eine holdselige, süß berauschende Offenbarung. Das bestrickende Lied der schönen, berückenden Sirene an der Donau bethörte auch ihn. Auch ihm wurde das Leben hier zu einem melodischen Reigen glänzend bunter Feste und die im Walzertakte das Leben genießenden Wiener fanden in ihm einen gar wackeren Kameraden. Doch auch ihm blieb die Abspannung, die den Fremden in Vindobonas Rosengarten so leicht befällt, ähnlich der Wirkung allzu würziger Blumendüfte, nicht erspart. Der leichte Sinn der Bewohner erschien ihm bald haltlos und selbst das wechselreiche Bacchanal ihrer Freuden schal und ermüdend. Die Gegenwart befriedigte ihn nicht mehr und er begann sich zu sehnen, zu sehnen nach ruhigem, dauerndem Glück. »Laß fahren dahin das allzu Flüchtige« im schnell verfliegenden Rausch der Sinne hatte er diese Wahrheit erkannt und nun suchte er das Glück in Dauer, die Liebe in Ruh. Doch in dem neuen Ideal wogte noch auf und nieder die Freude an der heiteren Auffassung des Lebens, die sonnige Heiterkeit, die seiner Seele bei seiner Herkunft nach Wien so wohl gethan. Nicht ganz wollte er sie missen, nur ruhig genießen, für sich, ohne Aufregung.
In dieser Stimmung hatte er Emmy kennen gelernt. Sie zählte damals noch nicht ganz neunzehn Jahre. In dem Feuerglanz ihrer dunklen Augen, in der sanften Glut ihres noch in der Knospe befindlichen Wesens glaubte er gefunden zu haben, was er suchte, eine Vermittlerin des Glücks, das sein Herz ersehnte. Sie war das Kind eines Beamten in der Provinz und lebte seit nahezu zwei Jahren unter der Obhut ihrer Tante in Wien, einer gutmüthigen alten Damen, die ihre helle Freude hatte an dem Goldkind, das ihr von den Eltern übergeben worden war, damit es in der Kaiserstadt seine hübsche musikalische Begabung ausbilde. Auf einem Ball, der zu Ehren einer musikalischen Berühmtheit gehalten wurde, in dessen hellaufwirbelnder Luft Fernau der ganze Zwiespalt seines Innern klar ins Bewußtsein trat, war er ihr zuerst begegnet. Ihm war als habe ihm die Muse seines Lebens eine Erlöserin gesendet. Die Wonne darob gab seiner Werbung jene Bestimmtheit und Kraft, denen der Erfolg selten versagt bleibt und wie im flüchtigen Begegnen der Augen sich die Seelen gefunden, so genügte ein bald sich darbietender Augenblick zum Bunde derselben für ewig. Hindernisse standen den Liebenden nicht im Wege und bald war auch der Bund vor dem Altare besiegelt.
Die volle Flut des Glücks nahm das gemeinsam bestiegene Lebensschiff der jungen Eheleute zunächst auf seine fröhlich aufschäumenden Wellen. Wohl trat bald die Verschiedenheit der beiden Naturen an tausend Punkten hervor, aber die Wahrnehmung erhöhte nur den Reiz des Lebens, erweiterte den Kreis der gemeinsamen Freuden. Die Macht der Wahlverwandtschaft entgegengesetzter Elemente schien sich wieder einmal siegreich bewähren zu wollen. Das gieng bis nach dem ersten Rausch der Flitterwochen, nach der an Eindrücken wie an innerem Glück überreichen Hochzeitsreise und den geselligen Zerstreuungen, welche die Heimgekehrten begrüßten, bei Fernau das Bedürfniß nach stillem Familienglück täglich stärker sich geltend machte und die naive Genußsucht der jungen Gattin mit allerhand Bedenken kreuzte. Was die Liebe anfangs immer wieder heilte, zerstörte jedoch der Einfluß der Tante, die, eine echte Wienerin, ihren Liebling in nichts verkürzt sehen wollte. Ihr hatte das ruhige Wesen Fernaus von vornherein nicht so recht gefallen. Als sie aber wahrnahm, wie an dem Mann ihres lieben Miezerl täglich mehr hervortrat, daß er von Grund seines Wesens ein rechter Stubenhocker und Häferlgucker, hatte sie es für Pflicht gehalten, einen geheimen Krieg gegen ihn zu eröffnen, der zum Zweck hatte, dem überhäuslichen Schwiegersohne seine Pflicht ins Gedächtniß zu rufen, für das Vergnügen seines jungen Weibes zu sorgen. Wie so oft im Leben säte ihre falsch geleitete Liebe nur Unheil. Was im Grunde nur Einflüsterung der Tante war, nahm Fernau als Offenbarung des innersten Wesens seiner kleinen Frau; der Wahn befiel ihn, er habe sich völlig in ihr getäuscht, und damit der Glaube, strenges Auftreten könne allein vom gesunden Kern ihres Wesens noch retten, was zu retten sei.
Doch auch diese Pädagogik konnte sich keines erquicklichen Resultates erfreuen. Emmy fühlte sich von ihrem Gatten falsch verstanden und ungerecht behandelt und hin und wieder mit Recht. Denn sie durfte oft für Laune und Hypochondrie halten, was thatsächlich auf seiner Seite nur ein verfehlter Versuch war, den noch wenig häuslichen Sinn seiner jungen Lebensgefährtin der eigenen Sinnesart anzupassen. Er umgekehrt nahm dieses und jenes durchaus berechtigte Aufflackern einer natürlichen, die Schranken des Sittlichen achtenden Lebenslust für bedenkliche Zeichen eines unausrottbaren Flattersinns, eines schmählichen Mangels an Liebe.
Mit besonders einschneidender Schärfe war der Zwiespalt zwischen den beiden Gatten aber erst in den letzten Wochen hervorgetreten. Der Besuch von Emmys Mutter hatte statt der erwünschten Gemüthlichkeit eine Reihe aufgeregter Tage gebracht, deren Festlichkeit aus Zerstreuungen und Vergnügungen bestand, an denen Fernau nur die Unbequemlichkeit verspürte. Und der Einfluß der Tante brachte es schon am ersten Tage dahin, daß für Fernau das viel bezweifelte Märchen von der bösen Schwiegermutter zur unerquicklichen Wirklichkeit wurde. Auch die Mutter der Frau versuchte nun an ihm herum zu doktern. Oft gab ein Wort das andere, aber im Geräusch der gastlichen Zusammenkünfte bei Verwandten und Freunden konnte die Verstimmung nicht zu einem vollen Ausbruch kommen. Nun war endlich, so meinte Kurt der Besuch wieder von dannen gereist. Der geplagte Ehemann athmete auf, und er holte tief Athem, um seinen Zorn in wenig Worten auf das Haupt der Gattin zu entladen. Natürlich blieben auch unzarte Bemerkungen auf die Mutter Emmys nicht aus, die diese beleidigen mußten und welche sie nicht unerwidert ließ. Schon einmal hatte er eine Berufung auf die Meinung der Mutter brüsk mit der Bemerkung erwidert, er hindere sie nicht, bei dieser sich Trost zu suchen.
So stand es am heutigen Tage. Die katholische Bevölkerung feierte Mariä Empfängniß; in dem Modetheater der Saison, dem glänzend ausgestatteten Ringtheater, war eine neue Operette, ein hinterlassenes Werk Offenbachs, angesetzt und die Tante hatte ihrem Liebling ein Billet zu verschaffen gewußt. Emmy hatte unterlassen, rechtzeitig ihrem Manne von ihrem Vorhaben etwas zu sagen, und so traf er sie am Nachmittag bei seiner Nachhausekunft vor dem Spiegel in voller Toilette, wie wir Eingangs sahen, beschäftigt, die letzte Hand an dieselbe zu legen.
Auf das verletzend genug hervorgestoßene »Adieu!« der Frau wußte sich Kurt nicht mehr zu halten. Mit hastigem Schritt vertrat er ihr den Weg und mit der Linken die Klinke der Thüre ergreifend, faßte er mit der Rechten die ausgestreckte Hand der Frau: »Hier bleibst Du«, raunte er ihr mit von Erregung verschleierter Stimme zu. »In der That Du hast Recht: es ist genug! Und eh Du gehst, sei das entscheidende Wort gesprochen. Dein ganzes Benehmen sagt mirs: Wir passen nicht zu einander. Der Augenblick ist zu ernst, als daß ich nur Dir die Schuld daran zuschieben möchte. Aber das Eine höre: Geh ins Ringtheater nur zu, ergötze Dich an der bunten Komödie Du kannsts ja! Geh wohin Du willst und amüsir Dich von Herzen. Aber dann geh auch Zu Deiner verehrten Frau Tante, betrachte deren Häuslichkeit als die Deine. Dort wirst Du ja glücklich sein Und nun sage auch ich: Adieu! Leb wohl.« Seine Stimme war während dieser Worte fester, seine Sprache abwägend geworden. Jetzt ließ er die Hand seiner Frau los, sah sie noch einmal forschend an, als wolle er ihr das Innere ergründen, und gieng dann gemessenen Schrittes aus dem Zimmer in sein Privatbureau. Emmy aber, die einen Augenblick verdutzt drein gesehen, schüttelte ihr Köpfchen, wie um unwillkommene Sorgen abzuschütteln, versuchte eine Strophe aus Strauß »Fledermaus« zu trällern, die freilich auf den Lippen erstarb, schloß diese dann mit dem Ausdruck des Trotzes, sah nach der Uhr und verließ ohne weiteres Zögern Wohnung und Haus
Das Haupt auf die Hände gestützt, saß Kurt vor seinem Clavier. Seine Züge waren gespannt und starr, doch im Auge schimmerte ein feuchter Tropfen. Er hatte erwartet, Emmy würde Reue bekommen, aber er hatte vergeblich geharrt. Jetzt mußte die Vorstellung von »Hofmanns Erzählungen« bereits begonnen haben. Da schreckt ihn aus seinem düsteren Grübeln dumpfer Lärm auf. Auf den weißen Tasten vor ihm spiegelt sich eine helle Röthe Die Dezembersonne war doch längst untergegangen, er blickt auf und eilt ans Fenster. Der Himmel ist blutigroth. Eine Feuersbrunst sie muß mitten in der Stadt sein Unbestimmte Ahnung treibt ihn hinunter. Seine Straße ist leer, die nächste auch. Endlich stößt er auf einen Dienstmann. »Wo brennts?« ruft er diesem zu. »s ist kaum glaublich Herr,« giebt der zurück, »sie sagn, das ganze Ringtheater ständ in Flammen.« »Wie Mann! Besinnt Euch! Welches Theater,« schreit Fernau entsetzt. »Das Ringtheater ! Freilich. Das wird a böse Gschichtn geben.« Wie von tausend Dämonen verfolgt, die ihm markverzehrende Worte ins Ohr zischeln, eilt nun Fernau die Straßen hinunter. Er trifft einen Fiaker: »Schnell zum Ringtheater!« Der Wagen saust dahin, als wüßte der Kutscher, was der Arme da drinnen dort sucht. Doch bald stockt die Fahrt. Dichtes Menschengewühl hält den Wagen auf. Leichenblaß entsteigt ihm Fernau, und wie trunken strauchelt er, denn dort vor sich sieht er das Funkenmeer stieben, den flammendurchglühten Rauch schwelen und lohen, dort vom Theater, das seine Frau, seine kleine, unbedachtsame, sorglose, und doch so liebe, einst so zärtlich geliebte Frau vor wenigen Minuten betreten.
»Sind die Besucher gerettet?« stammelt er und fürchtet sich fast, die Frage an einen der Umstehenden zu richten. »Soll wohl sein! hörts eben einen Schutzmann behaupten.« »Unsinn, Unsinn,« sagt dagegen ein hoher, vierschrötiger Herr daneben. »Nichts ist gerettet, und drinnen waren genug als das Feuer ausbrach. War ja da als die Geschichte begann!«
Fernau steht einen Moment wie vom Donner gerührt. Dann rafft er sich empor und kennt nur ein Ziel: das Theater selbst. Er braucht Riesenkräfte. Die Menge umstaut das Theater. Endlich ist er am Ziel. Er hat den Ring erreicht, welchen die Schutzmannschaft um den Platz vor dem Theater bildet. Nun durchbricht er auch den. »Halt mein Herr!« herrscht ihn einer der Wächter an. »Mein Gott, lassen Sie mich! Meine Frau ist drinnen im Theater!« »Sie irren, Alles, was drinnen war, ist gerettet! Beruhigen Sie sich. Zurück, treten Sie zurück!« Fernau weicht der Macht. Aber er eilt einer anderen, schwächer mit Schutzleuten besetzten Stelle zu und sucht Eingang zu gewinnen. Doch nur mit demselben Erfolg. Dabei prasselts, zischts und lärmt es von anfahrenden Spritzen, von plätschernden Wasserstrahlen, von aufgeregt hervorgebrachten Kommandoworten, dazwischen tönen Wehelaute aus dem Publikum, ängstliches Hilfeverlangen, wüthende Anklagen. Alle diese Eindrücke stürmen mit betäubender Wirkung auf den Aermsten ein, der für einen Moment gebrochen dasteht, während sein Auge in die grelle Glut starrt, welche den Platz gräßlich erhellt.
Da stürzt ein Herr, rauchgeschwärzt, aus einem der Thore, in seinem Antlitz den Ausdruck des höchsten Schreckens. Zufällig nimmt er den Weg auf jene Gruppe, zu der Fernau gehört. »Sind noch Menschen drinnen«, ruft der Erste ihm bebend entgegen. »Freilich Oben Rettet!« stößt der Entkommene hervor. Die Nachricht verbreitet sich schnell, und gellend wie Wuthgeheul wird der Ruf nach Rettung wiederholt, während die Beamten bei ihren falschen Trostsprüchlein kaum zu beharren vermögen.
Jetzt entsteht plötzlich Stille, sie dauert einige Sekunden und dann erschüttert ein lauter Aufschrei die Luft. Ists Staunen, ists Drohung oder Klagelaut? Es ist die schreckliche Gewißheit, daß der unselige Brand wirklich auch Menschenleben in Gefahr gebracht hat. Der erste Todte war, entsetzlich verstümmelt und entstellt, herausgetragen worden. Vierzehn weitere Opfer folgen. Man trägt die Leichen nach dem Polizeigebäude. Alles drängt diesem Kondukte zu. Fernau jedoch steht still. Er will und kann nicht an das Gräßlichste glauben, seine Frau nicht suchen unter den Sterbenden. Sein Auge sieht an der reich dekorirten Front des brennenden Prachtgebäudes empor, es sucht die Fenster ab, ob sich an ihnen keine Spur von Geflüchteten zeige. Aber er sieht nur die Gestalten der Pompiers, die von außen auf den Simsen hinkriechen, um die Mündungen der Spritzenschläuche dem Feuerherd so nahe wie möglich zu bringen. Die Glut dort muß grenzenlos sein. Doch siehe plötzlich erscheint eine ängstliche Gestalt auf dem Balkon und wieder und wieder eine. Aufs neue entsteht eine drückende Pause schweigender Spannung. Und mit einem Klange, der fast Freude verwandt ist, ertönt der Ruf nach Leitern, Sprungtüchern, Tauen. Aber er verhallt ohne Wirkung. Von Rettungsapparaten ist noch nichts zur Stelle. Der Balkon füllt sich mehr und mehr. Der Hilferuf der vom Feuer Bedrängten dringt gellend von oben hernieder. Beim Feuerschein kann Fernau die einzelnen Gestalten erkennen. Angst entstellt Aller Züge Denn immer näher dringt zu ihnen das Krachen und Knistern von der Flammen schonungslosem Zerstörungswerk hinter ihnen. Wer weiß, wie lange dieser Standort noch ein Schutz ist?
Fernau späht sich seine Augen aus sucht und sucht. Da fährt er mit der Hand über die Stirn und benutzt sie als Schirm, um die Schärfe des Blicks zu erhöhen. Ists ein Traum? Kann es Wirklichkeit sein? Darf er das Wunder glauben? Ist die zarte Frauengestalt, die ihn hilfeflehend zu sich zu winken scheint, ist es ja sie ists, seine Emmy!
Nun wird jede Sekunde zu einer Ewigkeit voll jubelnder Hoffnung, voll verzweifelnder Ungeduld. Die Augen suchen sich, haften in einander. Denn die Gluten des feindseligen, zerstörbaren Elements haben längst den Frost, der beider Herzen erstarrt hatte, geschmolzen, und neue Glut voll zehrender, sorgender, quälender Sehnsucht fluthet auf und nieder in den Seelen der Gatten. Fernau hat kein Auge mehr für das, was um ihn her vorgeht. Er bemerkt nur mechanisch, daß einzelne der Männer, die auf das Sprungtuch nicht mehr warten wollen, direkt herunter springen, in die Menge, die ihrer mit offenen Armen harrt. Auch er streckt die Arme aus, voll Sehnsucht und bereit, sanft zu betten, wer dort von oben zu ihm den Sprung wage. Aber vergeblich, die junge Frau ist zu schwach für den Versuch. Wohl möchte auch sie. Da erleuchtet freudige Gewißheit den Blick. Die Zeit des Wartens ist vorüber. Die Sprungtücher sind angelangt, werden ausgebreitet. Erst werden sie von einigen Männern erprobt. Sie halten fest und tragen treu das kostbare Gut, das sich ihnen anvertraut. Und nun, ja, es ist Emmy, welche eben zwei freundliche Männer auf die Ballustrade heben. Es ist sein Lieb, was jetzt herniederspringt und das nun weinend und bebend sich in seine Arme schmiegt, stammelnd: »Da hast Du mich! Dein kleines Weib. Ganz und für immer.«
Dann schloß eine Ohnmacht ihre Lippen.
Ein grauenvoller Tag des Schreckens für Wien, für die Welt erreichte mit diesem 8.Dezember des Jahres 1881 sein Ende. Da ist kein Mensch, der die Kunde von all den Schrecknissen, von den schweren, unerträglichen Prüfungen, die durch jenen gräßlichen Theaterbrand über Tausende verhängt wurden, nicht mit Trauer und Herzeleid gelesen hätte. Wohl kein Auge blieb trocken in dem sonst so lustigen Wien angesichts der furchtbaren Heimsuchung. Aber in den Thränen zweier Augenpaare mischt sich doch ein seliges Lächeln, wenn ihre Besitzer an die furchtbare Schreckensnacht denken und in inniger Umarmung tauschen sie trauliche Worte.
»Uns brachte sie doch Glück, die fürchterliche Nacht. Denn sie führte uns zum mildwarmen Lande des echten Liebesglücks durch Frost und Gluten.«
»Durchs Fegefeuer zum Paradiese!«
Lili
Das waren unbeständige Frühlingstage, die ich im Mai des Jahres 1873 in der Heimat antraf. Ich kam aus dem Süden, dem Land der Sonne und der Sorglosigkeit, daheim hiengen Wolken am Himmel, umlagerte die Sorge das Leben. Und doch war es Mai. Aber alle bösen Eigenschaften, welche der Volksmund dem oft so lieblichen April nachsagt, hatte diesmal der vielbelobte Wonnemond entfesselt und dabei herrschte sommerliche Schwüle, die sich dann und wann in Gewitterschauern über der blühenden, kaum zu frohem Dasein erwachten Erde entlud.
Eine Gewitterstimmung fand ich auch in den Kreisen meiner Bekannten und Freunde und bald sollte ich erfahren, daß solche Schwüle auch im Leben der Gesellschaft gar oft Entladungen von vernichtender Wirkung zur Folge hat. Das Gewitter hieß Krisis des Geldmarktes. Das Spekulationsfieber hatte damals Menschen ergriffen, deren Gedanken- und Gesprächskreise sonst weitab von der Welt der Geldgeschäfte gelegen hatten, und mit aufgeregter Spannung verfolgte plötzlich der sonst so bedächtige Rentner das Steigen und Fallen der Course, die Erscheinungen und Bewegungen an der Börse, für die er vorher nur wenig Verständniß gehabt. Und in jenen Tagen war nur vom Sinken der Werthpapiere, nur von erschütternden Katastrophen an der Börse die Rede.
An dem Morgen, der mir heute mit greifbarer Lebendigkeit in der Erinnerung auftaucht, ließ freilich die Sonne und ihr lichtes Spiegelbild auf der Erde nichts von solchen Betrachtungen aufkommen. Wie die Jugend unter dem Gruß des Glücks, schnell und lebensfroh, das momentan durch einen Mißerfolg gebeugte Haupt erhebt, so heben die Blätter und Blüten des Frühlings unter der Sonne erneutem Gruß duftiger und kräftiger denn vorher ihre zarten Spitzen und Häupter, als sie unter des Regens Druck und der Tropfen Last tiefgesenkt und niedergebeugt wurden. Von den Stürmen der vergangenen Nacht wußte der helle Morgen nichts, der glitzernd im Sonnenlicht, über den Weinbergen und Obstgärten des Dresdner Villendorfes Loschwitz im Blau des Himmels sich wiegte. Daß am Abend vorher rauhes Wetter in den Laubkronen der Pfirsich- und Aprikosenplantagen rücksichtslos gehaust und gezaust, verrieth das rosafarbene Blütenmeer nicht, aus dessen schimmerndem Gewog die Paläste und Landhäuser, welche den anmuthigen Hügelkamm an der Elbe bedecken, malerisch hervorlugten. Was in den Kelchen der Blumen glänzte, ob es ein hängengebliebener Regentropfen von gestern oder nur perlender Morgenthau war, es wußte niemand zu sagen. Mir aber schien es Morgenthau zu sein, als ich durch die engen Bergpfade, welche die einzelnen Besitzungen trennen und verbinden, hinaufwanderte, vom Landungsplatze des Dampfschiffes, das mich nach kurzer Fahrt von Dresden heraus in diese Maienwelt gebracht hatte. Mir schien die Welt in Licht und Anmuth getaucht, als ich in das Gehege der reichen, glänzenden Besitzung eintrat, die mein Freund Erich Wollheim, wie er mir geschrieben, vor Jahresfrist hier erworben hatte und seitdem mit seinem jungen, damals ihm angetrauten Weibe bewohnte. Und mir war, als hätte ich ein Eden betreten, an dessen Pforten Schutzengel Wache halten, damit die Sorge und die Noth nicht eindringen können, als ich durch die blühenden Laubgänge, an den duftenden Jasmin- und Hollunderbüschen vorbei schreitend, um eine Wendung biegend, vor ein Bild trat, das in jedem Zuge ein heiteres Daseinsglück in reichster Fülle wiederstrahlte. Von dem schloßähnlichen Bau zweigte sich rechts eine Terrasse ab, deren Gitterwerk ganz mit edlem Rebengerank umzogen war. Von dieser herab führte eine Freitreppe nach einem von Strauchwerk reich umsäumten Platz, in dessen Mitte ein Springbrunnen seinen Wasserstrahl in tausend glänzenden Tropfen in die sonnige Luft versprühte.
Auf der letzten der Stufen dieser Treppe aber stand eine lichte Gestalt, deren knospende Formen sich vom tiefblauen Hintergrund des Himmels wundervoll abhoben; eine junge vornehme Frau, ganz in Weiß gekleidet, dessen frischen Glanz der helle Ausputz nur erhöhte; ein zierliches Morgenhäubchen auf dem lockigen kindlichen Krauskopf, aus dessen Mienen die Freude lachte, als wäre die Trägerin der Genius der Freude selbst. Huldigte ihr nicht alles, was sie umgab? Die Natur selbst mit allen ihren Reizen; der alte Gärtner, der ihr eben einen Strauß duftiger Moosrosen, offenbar das neueste seiner Zucht, überreichte, die schlanke Gesellschafterin, die eben davon eilte, um einen Auftrag auszuführen, Alles bis herab zu den beiden kleinen tollen Seidenspitzen, die in drolligen Sprüngen sie umspielten und ihre schwarzen koketten Näschen in den Falten der auf den Treppenstufen aufgebauschten Schleppe ihrer Gebieterin vergruben.
So trat mir die junge Frau des Hauses, die Gattin meines alten Freundes Wollheim, seine Lili, wie er sie in seinen Briefen mir genannt hatte, entgegen; mir noch unbekannt und doch erkannt, mir noch fremd und doch schon vertraut. Uns verband die Liebe zu Einem, zu Erich, ihrem Herzensschatz, meinem Jugendfreund. Er selbst war nicht anwesend, sondern schon zeitig in die Stadt gefahren. Natürlich galt unser Gespräch, ihr Geplauder ihm. Er hätte jetzt überhaupt viel in der Stadt zu thun, sagte sie, sie wisse freilich nicht was; aber wichtiges müsse es sein, sonst würde er sie nicht so oft und so lange ganze Tage oft sagte sie schmollend, allein lassen. Er habe sich an einem großen Bauunternehmen betheiligt, das sei alles, was sie wisse. Erich liebe es nicht, von Geschäften mit ihr zu sprechen. Und sie verstände wohl sicher nur wenig davon. Im Grunde müsse sie sich auch freuen, daß ihr Mann eine Beschäftigung gefunden, die sein Inneres so in Anspruch nehme. Als er bei ihrer Verheirathung beschlossen habe, eine praktische Bethätigung seiner Kunst als Architekt zunächst ganz aufzugeben, um sich nur ganz ihr und seinen Studien im Hause zu widmen, da habe sie aufgejubelt und es sei so recht nach ihrem Wunsche gewesen. Dann aber habe sie oft recht drückend die Sorge empfunden, ob sie, ihre Unterhaltung, ihr geringes Wissen ausreichen könnten, ihm Ersatz für die reichen Eindrücke seines früheren Lebens, für den Verkehr mit Kunstgenossen, für den Reiz der Ausführung eigener Pläne zu bieten. Auch sei ihr im Hause fast nichts übrig geblieben, zu thun. Alles habe er, der Praktische, der Erfahrene, besorgt, bestellt, ausgeführt, auch im Hauswesen, in der Wirtschaft. Sie sei wohl manchmal da recht eifersüchtig auf ihr Ressort geworden, denn sie sei sich so überflüssig, so zwecklos neben ihm vorgekommen. Nur Schmuck, nur Zierrath. »Ja,« fuhr die kleine schmucke Hausfrau fort, indem sie mit naivem Stolz mit einem Schlüsselbund klirrte, welcher an altdeutschem Träger ihr vom Gürtel niederhieng, »das ist jetzt, wo Erich so oft abwesend, besser geworden und das ist auch ein Trost.« Indem kam geräuschlos ein Diener über den Kiesweg in die geräumige Laube, in der wir uns niedergelassen. Schweigend servirte er die Bestandtheile eines einladenden Frühstücks. »Es ist gut, Anton«, sagte sie. »Hat der Herr Weisungen hinterlassen?« Der Diener hatte eine ganze Liste von Aufträgen zu melden und zum Schluß den Gruß, daß er zu Tisch schwerlich zurückkommen werde. So gern er möchte, denn er erwarte Besuch dabei nannte der Diener meinen Namen und gieng.
»So ist er nun. Bis zu den Arrangements der Küche reicht seine Sorge und dann kommt er selbst nicht zu Tisch. In der letzten Zeit ist er wirklich ein wenig zu viel vom Hause fort. Ueberhaupt« und ein Schatten flog über die heiteren Züge »er macht mir seit einigen Wochen rechte Sorge. So oft ist er zerstreut und bleibt abwesend, auch wenn er bei mir ist. Das war sonst nicht so. Auch sein Aussehen beunruhigt mich. Fast fürcht ich, daß er mir krank wird. Freilich will er nichts davon wissen; wie und wann ich auch frage, er weist alle meine Sorgen ab und lacht mich aus. Aber das Lachen kommt nicht aus dem Herzen. Ja, ja, so ganz wie Sie meinen, sind auch wir hier draußen vom Glück nicht bevorzugt und von der Sorge verschont. Trotz des lichten Frühlingswetters ist mir jetzt manchmal recht trüb ums Herz Sie haben meinen Mann noch nicht wiedergesehen?« Ich mußte es verneinen. Seit meiner Rückkunft hatt ich den Treuen von Angesicht noch nicht geschaut.
Erich Wollheim und ich waren Schulkameraden und als solche die besten Freunde gewesen. Verschiedenes Studium hatte dann unsere Wege getrennt; er war Architekt geworden, ich auf die Universität gegangen. Der Reichthum seines vor zwei Jahren verstorbenen Vaters, dessen einziger frühe verwöhnter Sohn er war, hatte ihm dann lange Reisen gestattet, in Frankreich, England, Italien; aber wiederholt waren wir uns auch in der Heimat wieder begegnet. Nach einigen erfolgreichen Versuchen, seine Kenntnisse und sein Talent praktisch zu verwerthen, hatte er vor Jahresfrist geheirathet und sich in die herrliche Villa in der Nähe seiner Vaterstadt mit seinem jungen Weibe eingesponnen wie in einem verwunschenen Schloß. Lili hatte schon seit längerer Zeit in seinen Briefen eine Rolle gespielt. Erst als eine ihn, den Verwöhnten, entzückende Badebekanntschaft, dann als Mittelpunkt seiner Zukunftspläne und dann eines Tages als seine Braut. Seitdem waren seine Korrespondenzen sparsamer geworden; gleich nach meiner Ankunft in Dresden aber hatte ich seine dringende Einladung erhalten, ihn so bald als möglich auf seinem Landsitze zu besuchen.
Lili war das Kind eines bekannten Kunstgelehrten, der stets in der guten Gesellschaft gelebt, aber dafür und für die Erziehung seiner Kinder auch sein jährliches Einkommen hatte aufwenden müssen. So hatte sie eine Bildung, wie sie den Töchtern reicher Leute wird; als Erich die eben zur Waise Gewordene zu seiner Braut erkor, war sie jedoch mittellos. Das war ihm gerade recht. So konnte er der Geliebten alles sein; alles hatte sie von ihm zu empfangen, von seiner Liebe. Und er überschüttete das kindlich liebliche Geschöpf, das so in jeder Beziehung die Seine ward, mit Aufmerksamkeiten, mit Geschenken, mit Kostbarkeiten, deren Werth sie selbst kaum zu schätzen wußte. Das ersah ich schon aus diesem ersten Gespräch. Armuth, Entbehrung waren ihr fremd geblieben durch die frohe Wendung des Geschicks, die, als der Vater starb, ihr Wollheim an die Seite stellte. Sie kannte keine Bedürfnisse, die ihr nicht erfüllt worden wären, erst vom zärtlichen Vater, dann vom Bräutigam und Manne. Und so hatte die Welt wohl Recht, sie ein Glückskind zu nennen. All dies überdachte ich, nachdem ich mich von der liebenswürdigen Wirthin verabschiedet hatte, auf der Rückfahrt nach Dresden, wo, wie mir Frau Lili versichert hatte, der Aufenthalt des Freundes beim Portier eines bestimmten Hotels leicht zu erfragen sein würde. In demselben pflegte er bei längerem Verweilen in der Stadt auch zu speisen. Ich sehnte mich, den Guten endlich zu treffen, nachdem wir uns in den Tagen seit meiner Rückkunft mehrmals verfehlt, wie auch heute. Umsomehr, als die Mittheilungen der kleinen Burgfee in ihrem Landidyll da draußen mir doch Sorgen um ihn rege gemacht hatten. Dennoch war der Nachmittag schon etwas vorgerückt, als ich dazu kam, das genannte Hotel aufzusuchen. Der Portier sagte, Herr Wollheim müsse jede Minute kommen. Es sei heute schon wiederholt nach ihm gefragt worden; er sei Mittags zur Table dhote gekommen, aber gleich wieder davon geeilt, nachdem er eine inzwischen für ihn angelangte Depesche gelesen. Vier Uhr habe er als Zeit seiner Rückkehr angegeben. »Da schlägt es eben.«
Ich gieng vor die Thüre des Hotels, um zu warten. Eben kehre ich mich gegen ein Plakat, da biegt hastig ein Herr in das Portal ein, mich dabei unsanft berührend, »Pardon«, ich wende mich. Ist er es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht, als ich in das Gesicht mit den vertrauten lieben Zügen blicke, die so aufgeregt, so entstellt sind, daß ich sie nicht anzuerkennen wage. Aber er ist es doch mein Freund Erich, wenn es auch nicht sein freundliches ruhiges Auge ist, was mit halb erschrecktem, halb ängstlichem Blick den meinen erwidert.
»Du, Du! Endlich!« stößt er kurz hervor. »Willkommen!« »Aber bitte eine Sekunde! Ich bin gleich zu Deiner Verfügung.« Er wendet sich zum Portier, der ihm eine Reihe von Briefschaften einhändigt. »Dies schickte soeben Ihr Bankier.« Erich legt alles Andere bei Seite und öffnet mit fieberhafter Spannung das Billet, nachdem er bei Seite getreten. Er liest, er stiert in das Blatt; er läßt es nicht sinken, sondern hält es starr vor sich, aber seine Hand zittert, seine Kniee wanken; ich stürze auf ihn zu. »Um Gotteswillen, was fehlt Dir?« Das erweckt ihn aus dem Seelenkampf, der offenbar ihn befallen. Ein gewaltsamer Ruck, er zerknittert das Papier und steckt es in die Tasche. »Es ist nichts, Freund. Gleich! Nur ein wenig Geduld«, sagt er leise und dann aufsehend und mir mit unsäglich wehmüthigem Blick ins Auge schauend: »O, was hab ich gethan Komm mit, Du sollst alles erfahren.«
Das schöne Frühlingswetter des Morgens war längst verzogen. Ein rauher Wind fegte durch die Straßen und trieb uns kalte Regenschauer ins Gesicht; Erich schritt stumm neben mir her. Lange wagte ich nicht, sein Schweigen zu stören, doch schließlich ertrug ich dies unheimliche Brüten nicht länger, ich rief ihn an und, um ihn auf heitere Gedanken zu bringen, begann ich von meinem Besuch in seiner Villa draußen zu erzählen, von dem Sonnenglanz umwobenen Idyll, dessen Zeuge ich heute morgen geworden, von seiner Frau!
»Mein Weib! O Gott. Die Aermste. Ihr kann ich nicht mehr unters Auge treten. Wie soll sie, das Kind, mein Kleinod, den Schlag verwinden. O Freund, ich bin namenlos unglücklich!«
Nur allmählich erfuhr ich, was ihn betroffen. Wie er dazu gekommen, was ihn verleitet, sein ihm vom Vater in bester Ordnung hinterlassenes großes Vermögen in gewagten Spekulationen anzulegen, ich weiß es des Genauen nicht mehr. Hineingerissen in den Strudel, in das Fieber, das damals so manchen Edlen ergriffen, hatte ihn sein gutes Herz, das immer jedem begründeten Appell an seine Freundschaft offen stand. Ein Akademiegenosse, Architekt wie er, der einst der Vertraute manches frohen Jugendstreiches gewesen, hatte dem Bankerott gegenüber gestanden, nachdem er, verlockt von der Gunst der Zeit, ganze Häuserreihen auf eigene Rechnung gebaut hatte, Mietskasernen, von denen er sich hohen Gewinn versprochen hatte, da ein Verkauf des ganzen Komplexes an eine Aktiengesellschaft in sicherer Aussicht stand. Allein seine Berechnungen liefen auf eine Täuschung hinaus, all sein Glück und sein Vermögen stand auf dem Spiel, die Rücksicht auf seine Kinder trieb ihn, alles zu versuchen, um einen Ausweg zu finden und er fand einen solchen in den Garantien und Anzahlungen, zu denen er seinen reichen Freund Wollheim zu bereden wußte. Dieser unbewandert in Geschäften dieser Art, überließ das Weitere seinen Bankiers und diese konnten der Versuchung nicht widerstehen, den naiven Kapitalisten, im gutem Glauben an den Erfolg ihrer Rathschläge, von einer Spekulation in die andere zu treiben. Nach und nach riß diesen die magnetische Macht des Spiels persönlich auf der beschrittenen Bahn weiter; um Verluste auszugleichen lud er sich neue Verpflichtungen auf, nahm Hypotheken auf seinen liegenden Besitz; der Zusammensturz mehrerer großer Unternehmungen, an denen er hervorragend betheiligt, hatte heute den Bankerott seines Vermögens zur Wahrscheinlichkeit, zur Gewißheit gemacht! Das war die Ahnung, die ihn schon die Tage daher geängstigt und gequält; das war die innere Krankheit, die ihm sein junges Weib vom Antlitz abgelesen, ohne sie selbst zu verstehen; das war die Nachricht, die er vorhin empfangen hatte, ihn angrinsend aus den kahlen trockenen Lettern mit dem kalten Blick des Todes.
Schon längst hatte ich den Freund von der Straße in ein behagliches Kneipzimmer gezogen, das wir allein innehatten; wir befanden uns in dem Hinterstübchen eines bekannten Weinrestaurants. Wie im Kreise bewegten sich die Gedanken und Bekenntnisse des schwer getroffenen Mannes: Anfang und Ende bildete stets seine Lili. Sich selbst traute er zu, den Schlag verwinden zu können, ja die Aussicht, nun gezwungen zu sein, fortan durch eigene Kraft, durch strenge Ausübung seines Berufs seinen Unterhalt zu suchen, hatte für ihn einen tröstenden Reiz. Aber wie sollte sie, die bisher nur durch das Leben getändelt, deren zarte Haut bisher nichts von der Rauheit des Lebens gefühlt, die er gehegt und gepflegt hatte wie eine Wolkenprinzessin, wie sollte sie, seine duftige Maienrose, sich in die Härte des Schicksals, in ein Leben voller Entbehrungen, voller Mühe und Arbeit finden? Er lachte gellend auf. »So mußte es kommen. Ich war zu stolz, zu übermüthig geworden. Aber das die Strafe auch das unschuldige Kind treffen muß, das ist zu grausam. Ich bin nicht feig, Freund, Du weißt es. Aber heute, jetzt, überkommt es mich wie Feigheit, wie markdurchfröstelnde Furcht. Ich bin nicht im Stande, ihr unter die Augen zu treten. Lieber in den Tod als mit ihr in das Elend.« Nach diesen Worten versank er in dumpfes Brüten, das er bald darauf wieder mit bebenden Anklagen gegen sich selbst unterbrach.
Immer hastiger, immer unruhiger sprach er, immer mehr entfärbten sich seine Wangen, trotzdem er von dem rothen Burgunder ein Glas nach dem anderen, ohne Bewußtsein davon, in hastigen Zügen leerte. Die Schwärze seines Haupthaares und Vollbartes, welche sein Gesicht umrahmten, erhöhte den Eindruck der Blässe, so daß ich eine ernstliche Erkrankung fürchten zu müssen glaubte und deshalb in ihn drang, doch zu versuchen, seiner fieberhaften Aufregung in etwas Meister zu werden, statt sie durch Selbstanklagen und fassungslose Unterwerfung unter sein Geschick immer höher zu steigern. Ich hielt es für das Beste, mit ihm wieder die freie Luft aufzusuchen, damit diese und die Bewegung beitrage, ihn in etwas zu beruhigen.
Es war Abend geworden. Der Regen hatte aufgehört zu fallen; der bleigraue Wolkenhimmel war gelichtet, nur vereinzelt jagten weißschimmernde Wolkenfetzen am Monde vorüber. Unwillkürlich waren wir, ziellos durch die Straßen eilend, in die Nähe der Brühlschen Terrasse gelangt und es überraschte mich selbst mit Grausen, als mir bewußt ward, daß neben mir der von tausend Seelenqualen gefolterte Freund von der Höhe derselben herab auf die Elbe starrte, deren freundliche Fluten ihn so oft nach dem lieblichen Heim seines Glückes getragen, welche er jetzt mied, wie eine Stätte des Grauens. Eben war der Mond wieder hervorgetreten, den auf einige Zeit eine an ihm vorbeisegelnde Wolke bedeckt hatte. Seine Strahlen spiegelten sich in der rauschenden Wasserflut unten, deren Anblick, deren heimliche Musik auf meinen stillen Nachbar offenbar eine mächtige Anziehungskraft ausübten. Unwillkürlich senkte sich sein Haupt über die Brüstung, tiefer und tiefer, als sehne er sich hinab in die kühle Tiefe, unterzutauchen in der Wogen Vergessenheit. Doch plötzlich richtete er sein Antlitz wieder empor. Sein Blick folgte dem Flug der Wolken am Himmel, die, vom Schimmer des Mondlichtes durchleuchtet, über die Höhen von Loschwitz und Pillnitz ihre Bahn verfolgten. Von den Höhen der Rebengelände glänzten vereinzelte Lichter. Ich kannte sie alle die Häuser, deren Lage durch die kleinen glimmenden Lichtpunkte markirt wurde. Und ihm erst, dem Freund an meiner Seite, wie bekannt waren sie ihm. Jetzt aber sah er nur eines. Und wie er mir später gestand, war es ihm, als ob sich dies eine Licht, das aus seinem Hause zu ihm herübergrüßte, allmählich immer vergrößert habe, bis es anwuchs zur lodernden Flamme, zum mächtigen Brand, der alles, was sein war, verzehrte. Aber aus den Flammen heraus hörte er den Hilferuf einer Stimme, vernahm er den Ruf nach Rettung, rief ihn sein Weib. Da sei es mit magnetischer Gewalt über ihn gekommen: »Zu ihr! Mag alles zusammenstürzen, was dein, das höchste Glück bleibt dir bewahrt, wenn sie nur dir erhalten bleibt. Brecht zusammen, ihr Säulen und Thürme, lodert ihr Flammen, aber laßt mir, gebt mir mein Weib!«
Ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust und im selben Moment fühlte ich seinen Arm krampfhaft in den meinen geschoben. Unsere Blicke begegneten sich; in seinen großen glänzenden Augen schimmerten Thränen. »Ich bin bereit,« sagte er dann leise, »ich muß hinaus zu ihr und alles gestehen. Ich werde versuchen, ihr das Schreckliche mitzutheilen.«
Seine Thränen flossen reichlicher, als er mir das sagte, während ich ihn die breite Treppe der Brühlschen Terrasse wieder herunterführte. Auf der letzten Stufe trat mir wie eine Vision das frühlingshafte Bild von heute morgen vor die Seele. Ein Schauder erfaßte mich. Der Kontrast dieses Morgens und dieses Abends, dieser freudeathmenden Frauengestalt und dem in sich gebrochenen Mann an meiner Seite war zu gewaltig.
»Nach Hause darfst Du jetzt nicht, Freund, Du bist zu aufgeregt, zu abgespannt. Ich bringe Dich in Dein Hotel. Deiner Frau ein kurzes Wort von Deiner Abhaltung zu telegraphiren, überlaß mir. Suche zu schlafen; und wenn das nicht geht, versuche Dich zu sammeln. Hast Du auch Dein Vermögen verloren, nicht hülfe- und aussichtslos stehst Du da. Deine Verbindungen werden Dir leicht ein lohnendes Arbeitsfeld öffnen. Und auch Deine Frau wird sich in das Unvermeidliche finden. Ich selbst will morgen früh hinaus zu ihr und sie vorbereiten auf die schlimme Kunde. Wie manche Familie, mit der du befreundet, wird sich freuen, sie aufzunehmen, bis Du Deine neuen Verhältnisse geordnet hast. Ich habe das Vertrauen, daß sie sich gar nicht so schwer in diese finden wird.«
Erich war wie verändert. Seine Aufregung hatte sich gelegt. Mit einem weichen Klang in der Stimme, der dieser sonst fremd war, sagte er nach meinem letzten Worte leise vor sich hin: »Glaubst Du das wirklich? Doch nein, Du irrst!« Dann schüttelten wir uns die Hände. Wir befanden uns vor dem Hotel. So schnell ließ er mich freilich nicht gehen. Er klammerte sich an meinen Vorsatz, seine Frau auf den Schlag vorbereiten zu wollen. Mit der Verabredung, daß ich das erste Schiff benutzen sollte, schieden wir endlich.