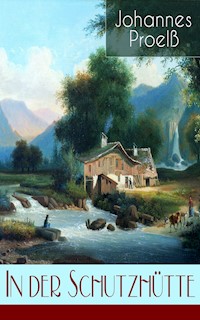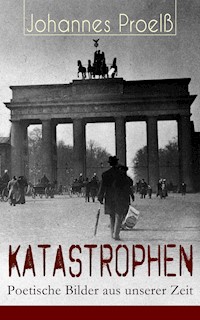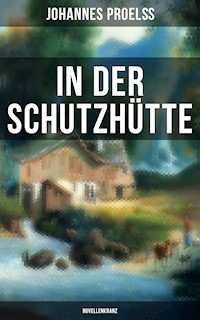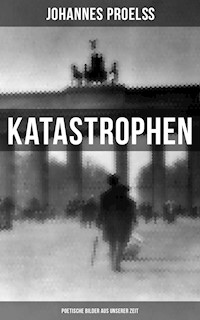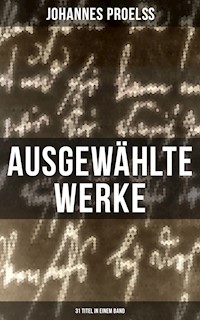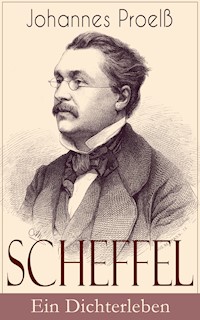Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Johannes Proelß' Buch "Scheffel - Ein Dichterleben" bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben des deutschen Dichters Joseph Victor von Scheffel. Proelß beleuchtet nicht nur die bedeutendsten Werke Scheffels, sondern taucht auch tief in die historischen und kulturellen Kontexte ein, die sein Schreiben geprägt haben. Scheffel, bekannt für seinen romantischen Stil und seine Verwendung von regionalen Dialekten, wird hier in all seiner Komplexität dargestellt. Proelß analysiert kritisch Scheffels Beziehung zu Literaturströmungen seiner Zeit und hebt die einzigartige Schönheit seines Schaffens hervor. Als Experte für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts vermittelt Johannes Proelß dem Leser ein umfassendes Verständnis für Scheffels künstlerisches Erbe. Proelß' gründliche Recherche und sein tiefes Einfühlungsvermögen in die Epoche machen dieses Buch zu einer unverzichtbaren Ressource für Literaturhistoriker und -liebhaber gleichermaßen. Der Autor zeigt, wie Scheffels Werke bis heute von kultureller Bedeutung sind und wie sie das literarische Erbe Deutschlands bereichern. "Scheffel - Ein Dichterleben" ist eine dringend empfohlene Lektüre für alle, die sich für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts interessieren. Proelß' packender Schreibstil und tiefgreifende Analyse machen dieses Buch zu einer wertvollen Entdeckung für jeden, der die Schönheit und Relevanz von Scheffels Dichtung neu erleben möchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Scheffel - Ein Dichterleben
Books
Inhaltsverzeichnis
Als in der großen sturmbewegten Zeit, die uns Deutschen das neue Reich schuf, Scheffel zum Lieblingsdichter der deutschen Jugend wurde und sein kraftfroher, echt süddeutscher Humor auch im deutschen Norden sich tausend und abertausend Herzen gewann, wußten nur wenige von dem innigen Zusammenhang, den später die biographische Forschung zwischen den Vorfahren des Dichters und seinen Werken festgestellt hat. Aber schon in meiner grundlegenden Scheffel-Biographie »Scheffels Leben und Dichten« (1887) habe ich eingehend nachweisen können, wie die wunderbare poetische Anschauungskraft Scheffels für die deutsche Kulturwelt früherer Zeiten ein geistiges Erbe aus der Anschauungswelt seiner eignen Ahnen war.
Am 16. Februar 1826 kam Joseph Victor Scheffel in Karlsruhe, der Haupt- und Residenzstadt des Großherzogtums Baden, zur Welt. Er war der älteste Sohn des Regierungsingenieurs Jakob Scheffel, welcher der badischen Wasser- und Straßenbaudirektion als Oberbaurat und dem badischen Geniekorps als Hauptmann à la suite angehörte. Mit seiner jungen Frau Josephine, geborenen Krederer, bewohnte er damals den zweiten Stock des dreistöckigen Wohnhauses Steinstraße Nr. 25. Gebürtig waren aber beide Eltern aus dem südlichen Schwarzwald, der Vater vom alemannischen Westrand, die Mutter vom schwäbischen Ostrand, und des Sohnes Ahnenbewußtsein lernte früh als seine Heimat im weiteren Sinne das ganze historisch so bedeutsame, landschaftlich so schöne Gebiet zwischen der jungen Donau, dem jungen Rhein und dem unteren Neckar betrachten, das sich dann in seinen Hauptwerken so farbenfrisch und anmutend spiegeln sollte.
Schon als Knabe ist das Karlsruher Stadtkind an der Hand seines Vaters durch die Gänge, Hallen und ehemaligen Schulraume der säkularisierten Benediktinerabtei Gengenbach im Kinzigtal geschritten, in der sein Urgroßoheim, Prälat Jakob Trautwein, der vorletzte Abt gewesen war, während sein Großvater Magnus Scheffel als Oberschaffner (Klosterrezeptor) die Hand über den reichen Weingütern und Kellereien des alten reichsunmittelbaren, von der Reichsstadt Gengenbach umschirmten Benediktinerstifts hatte. Der Name Magnus wies auf den heiligen Magnus zurück, dessen Gebeine in der Stiftskirche zu Füssen am Lech, dem alten Hochsitz der Augsburger Bischöfe, ruhen, und vom Lechfeld bei Augsburg, wo Otto der Große die wilden Ungarn schlug und Herzog Burkhard II. von Schwaben die tapfere Seele aushauchte, stammte Magnus Scheffel. Von ihm hatte Scheffels Vater einige Zeit nach Begründung des eignen Herds in Karlsruhe neben mancherlei altertümlichem Hausrat auch manch ein Stückfaß alten guten Gengenbacher und Ortenberger Weines geerbt, und er wußte von ihm auch manchen hübschen Charakterzug zu erzählen, der von einem, uns Heutige echt »Scheffelisch« anmutenden urwüchsig-schlagfertigen Humor zeugt. Als die Stelle des Oberschaffners im Stift neu besetzt werden sollte, hatte Prälat Jakob den Sohn seiner Schwester Veronika, die an den Landwirt Joseph Scheffel in Langen-Erringen im Lechfeld verheiratet war, nach Gengenbach kommen lassen, damit er sich neben den fremden Anwärtern um die Stelle bewerbe. Wer die Wahl hatte der Fürstbischof von Speyer, der aus Bruchsal im Stift erschien, zu entscheiden. Der Bischof und der Abt waren joviale Herren und den Freuden der Tafel in keiner Weise abhold. So wurde denn ein feines Mahl veranstaltet, an welchem auf besondere Einladung auch sämtliche Bewerber um die betreffende Stelle teilnahmen. Einem guten Witz bei diesem Mahle hatte Magnus Scheffel es zu danken, daß er zum Oberstiftsschaffner gewählt ward. Ein Aufwärter hatte beim Servieren des Fischs das Mißgeschick, die violette Soutane des Fürstbischofs mit der Sauce zu übergießen, was peinliche Verlegenheit schuf. Da rief hellauflachend Magnus Scheffel: »Ich hab doch mein Lebtag schon viel Schönes anrichten sehen, aber noch nie einen Reichsprälaten in einer Forellensauce!« Der Bischof stimmte in das Lachen ein. »Er ist ein origineller Kauz,« gab er zurück. »Er soll Oberstiftsschaffner sein!« Wie Magnus Scheffel es aber auch verstanden hat, das so gewonnene Vertrauen zu rechtfertigen, ist durch das Schreiben bestätigt, in dem bei der Säkularisierung des Stiftes im Jahre 1803 der Landvogt v. Roggenbach dem Markgrafen Karl Friedrich von Baden den Oberstiftsschaffner Scheffel zu weiterer Verwendung empfahl. Der seit 1788 mit Johanna Läuble verheiratete, nunmehrige badische »Amtskeller« behielt denn auch seine Stellung, bis er 1809 pensioniert wurde. Doch blieb er in Gengenbach wohnen bis zu seinem 1832 erfolgenden Tod. Seine Frau war schon im Jahre der Geburt ihres Enkels gestorben. Der einzige Sohn des Paares, des Dichters Vater, war am 29. Juni 1789 in Gengenbach zur Welt gekommen; neben Jakob wuchs noch eine Schwester, die zwei Jahre jüngere Genovefa Scheffel, heran. Diese wurde die Frau des Apothekers Zimmermann in Gengenbach, mit dessen zweiter Tochter Johanna sich 1829 der Apotheker Karl Heim aus der badischen Stadt Renchen verheiratete, der bald danach im nahen Zell am Harmersbach eine eigne Apotheke auftat.
Scheffels Großmutter Katharina Krederer aber stammte aus der Gegend des Hohentwiel. Sie war die Tochter des Löwenwirts und Posthalters Balthasar Eggstein in Rielasingen, einem der Stadt Singen gegenüber liegenden Ort an der alten Straße, die von Rottweil her über Tuttlingen nach Stein am Rhein in die Schweiz führt. Als sie am 17. Februar 1800 in Düggingen bei Donaueschingen den Kaufmann Franz Joseph Krederer in Oberndorf am Neckar heiratete, war dieser bereits Präsenzschaffner, d. h. Verwalter der Kirchenpflege daselbst. Ein Bruder von ihr, der ihre Trauung vollzog, war Stadtpfarrer in Offenburg. (Vgl. Brinzinger im Jahrbuch des Scheffelbundes 1905/6.)
Die Herrschaft Oberndorf hatte im frühen Mittelalter zum Besitz des Klosters Sankt Gallen gehört und war im 16. Jahrhundert, nachdem es eine Weile schon zu Württemberg gehört hatte, an Österreich gekommen, dessen Regiment ein erzherzoglicher Statthalter vertrat. Die Lage der Stadt in der Nähe des Salz ausführenden Sulz und der Straße, in die hinter Rottweil von Wien her die große Donaustraße mündet, machte sie zum Ausgangspunkt der quer durch den Schwarzwald führenden Straße zum Rhein, nach Straßburg; sie zieht durchs Kinzigtal, wo sie im Mittelalter den Wohlstand der Reichsstädte Gengenbach und Offenburg gründen half. Bald nachdem das Reichsstift Gengenbach an Baden gekommen war, fiel die Herrschaft Oberndorf (1805) an Württemberg. Seiner günstigen Lage, die es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auch zum Erscheinungsort des »Schwarzwälder Boten« gemacht hat, hatte Oberndorf es zu danken, daß in der kriegsbewegten Zeit von 1811 die württembergische Armeeverwaltung ihre Waffenfabrik hierher verlegte, wo ihr die Räume des säkularisierten Augustinerklosters zugewiesen wurden, in denen später die Mausersche Waffenfabrik zu ihrer außerordentlichen Blüte gelangt ist.
Hier also kam am 22. Oktober 1805 die Mutter des Dichters, Josepha Krederer, zur Welt. Ihr Vater, einer der angesehensten Männer im Ort, war bei fünfunddreißig Jahren bereits Stadtschultheiß, welche Würde auch sein Vater und sein Großvater in Oberndorf bekleidet hatten. Schon sein Vater Karl Krederer hatte das ansehnliche alte »Freihaus« am oberen Stadttor bewohnt. Aus freiherrlichem Besitz war es an Josephas Großvater übergegangen, »Doch behielt es,« so heißt es in den Aufzeichnungen der Dichtermutter, die Alberta von Freydorf 1902 in der »Deutschen Monatsschrift« veröffentlicht hat, »unter seinem bürgerlichen Eigentümer seinen mittelalterlichen Ernst wie den geheimnisvollen Hauch, der durch alle Räume ging und ganz geeignet war, die Gemüter seiner Bewohner zu Schwärmerei und träumerischem Wesen zu stimmen.« Josephinische Aufklärung herrschte in der Familie, der auch ein Geistlicher im Ort angehörte. Die freie Lage des Hauses auf der Höhe und nahe dem Walde begünstigte den poetischen Hang des reich beanlagten Mädchens, der sich früh in eigenen kunstlosen Gedichten aussprach. Die Waffentransporte, Truppendurchmärsche und Einquartierungslasten, die während der Freiheitskriege den Vater Josephas sehr in Anspruch nahmen, richteten ihren Blick auf die großen patriotischen Ziele, als deren Propheten sie bald Schiller verehren lernte und deren Bedeutung ihr Arndts, Körners, Rückerts und Uhlands patriotische Lyrik noch näher brachte. Schon 1816 verlor Josepha den geliebten Vater; er starb während eines Kuraufenthalts in Baden-Baden; von sieben Kindern war sie dem früh Kränkelnden als einziges am Leben geblieben. Als die Mutter sich nach drei Jahren wieder verheiratete, gab sie die Tochter in ein feines französisches Pensionat in Straßburg, in dem viele Töchter der angeseheneren Familien aus den Fürstenbergischen und angrenzenden Landen ihre letzte Ausbildung erhielten. Ein gutes Französisch, reiche Kenntnisse anderer Art neben besten gesellschaftlichen Formen nahmen die Schülerinnen von hier mit ins Leben.
Josephine Krederer war in zierlicher Anmut herangeblüht, als sie bei ihrer Tante Anna Stolz, der Frau des Kaufmanns Joseph Stolz in Gengenbach, den ihr schon von früher bekannten Hauptmann und Baurat Scheffel, welcher in Urlaub bei seinen Eltern weilte, wieder entgegentrat und so gefiel, daß er um sie warb. Er war mit seinen fünfunddreißig Jahren beträchtlich älter als das muntere Schwabenmädle vom Neckar, aber dafür ein noch recht jugendlicher Veteran der Freiheitskriege. 1814 und 1815 hatte er als freiwilliger Landwehroffizier unter Markgraf Wilhelm von Baden im Nieder-Elsaß mit gegen Napoleon gefochten und wegen besonderer Tapferkeit war ihm vor Straßburg der badische Militärverdienstorden verliehen worden. Auch einen russischen Orden besaß er aus jener Zeit für ersprießliche Dienstleistung als Dolmetsch und den Orden der Ehrenlegion für seine Mitwirkung in der nach dem Kriege eingesetzten Grenzregulierungskommission, Jetzt war er in Karlsruhe an dem großen Werk der Rheinkorrektion von Basel bis Mannheim unter Oberst Tulla beteiligt. Sein in sich abgeschlossener Charakter von energischem straffen Wesen war gemildert durch einen behaglichen trockenen Humor, Unter seinen Bekannten war er ein geschätzter Anekdotenerzähler. Ein freundlicher Ausdruck, erhöht durch die beim Lachen aufblitzenden dunklen Augen, belebte oft den Ernst seiner Züge, Um Pfingsten 1824, am 8. Juni, wurden er und Josephine ein Paar. Deren Mutter richtete die Hochzeit in Gengenbach aus, und da sie ihre nicht glückliche zweite Ehe durch Scheidung gelöst hatte, zog sie bald der einzigen Tochter in die badische Hauptstadt nach. Es war ihr Werk, daß schon im Jahre 1826 bald nach Josephs Geburt die junge Familie das schöne Anwesen Stephanienstraße 18 (jetzt 16), dessen Garten noch an den Hardtwald grenzte, als Eigentum beziehen konnte.
Wie viel unvergeßliche Erinnerungen sind damals mit der alten Frau und dem altertümlichen Familienhausrat aus dem Oberndorfer »Freihaus« eingezogen in dies neue Heim! Der Sagenschatz des Schwarzwalds, der Baar und des Hegau und hundert Überlieferungen aus der Familiengeschichte des Kredererschen Geschlechts! Die Großmutter war eine vortreffliche Erzählerin sowohl von Märchen wie von Selbsterlebtem. Die Herzogin Hadwig von Schwaben, die als Witwe auf dem Hohentwiel des Herzogsamts kraftvoll gewaltet hatte, war ihr eine vertraute Gestalt; als Rielasinger Kind, im Anblick des Bergs aufgewachsen, hatte es sie in Oberndorf gewiß nicht wenig angemutet, zu hören, daß im nahen Epfendorf noch immer für das Seelenheil der Herzogin Hadwig ein »Jahrtag« gehalten werde, und daß diese einst auf der ihr gehörigen benachbarten Schenkenburg gern geweilt hatte. (Vgl. Brinzingers Forschungen im Scheffel-Jahrbuch 1893 und meinen Aufsatz »Scheffels schwäbische Vorfahren« im Scheffel-Jahrbuch 1905/6). Die Erinnerung an die eigne Hochzeit war mit dem Hohentwiel verknüpft. In jenem Frühjahr 1800 wurde der alte württembergische Festungsberg im Hegau von den Franzosen unter Vandamme belagert, und die Feste, deren Kern im 10. Jahrhundert die Hofburg der Herzoge von Schwaben, dem alten Alemannien, gewesen, die später der Kommandant Wiederhold so standhaft verteidigt hatte, legten noch im Mai des Jahres die Belagerer in Trümmer! Was diese »schlichte deutsche Hausfrau, die bis an ihren letzten Lebensabend noch tätig war, zu Nutz und Frommen ihrer Angehörigen« dem heranwachsenden Enkel in rein menschlicher Beziehung wurde, hat dieser selbst nach ihrem Tod im Jahre 1851 mit warmen Worten ausgesprochen: »Sie ist an meiner Wiege gestanden und hat mich durchs tolle Leben bis seither als ihren liebsten Sohn Benjamin gehegt und gepflegt.« In Begleitung von Vater, Mutter und wohl auch der Großmutter wurde Scheffel schon als Knabe in Oberndorf wie im ganzen Schwarzwald, in der Landschaft zwischen den Quellen von Neckar und Donau und dem Bodensee heimisch. Die Freundschaft der Mutter zu der Familie ihres Vetters, des Schultheißen und württembergischen Landstands Ivo Frueth in Oberndorf, ging auf ihn über. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Familien reichten nach Horb, Gengenbach, Biberach, Zell a. H., Bühl, Offenburg, Freiburg, Donaueschingen, wo der badische Landstand Ludwig Kirsner zur Verwandtschaft zählte, und die Vetternstraße des Knaben Joseph Scheffel hatte im Schwarzwald viele Stationen. Auch in Säckingen war Major Scheffel heimisch; er hatte von dort aus in jüngeren Jahren den Bau der badischen Staatsstraße am rechten Rheinufer geleitet. Gewiß hat sein Sohn von den Aussichtswarten des Eggbergs wie vom Hohentwiel schon sehr früh das lockende Grüßen der firnbedeckten Schweizer Alpenhäupter vom Säntis bis zum Finsteraarhorn empfunden.
Eine ganz besondere Bedeutung erlangte für den historischen Sinn des Knaben und sein Ahnenbewußtsein aber ein literarischer Fund, den der badische Archivar Joseph Bader, ein Freund seiner Eltern, in einem Kloster des südlichen Schwarzwalds machte und aus welchem hervorging, daß ein Georg Balthasar Krederer im 16. Jahrhundert auf der Küssachburg am Oberrhein bei Thiengen, unweit Säckingen, als Schloßhauptmann der Grafen von Sulz gewaltet hatte. Das stattliche Hochschloß, dessen Ruinen noch stehen, erhob sich am Einfluß der Wutach in den Rhein. Im Jahrgang 1839 der »Badenia« berichtete Bader über dies »Stamm- und Gesellenbuch« des Schloßhauptmanns Balthasar Krederer, in das dieser die Besucher der Burg sich nach Leerung des Willekommtrunks mit einem Gedenkspruch eintragen ließ, und in Bezug auf den Schloßhauptmann Krederer schrieb der gelehrte Geschichtsforscher: »Anstatt der Waffen erklangen die Pokale munterer Zecher auf der Beste. Mancher fremde Junker trank nach der Sitte der Zeit auf das Wohl des gastlichen Schloßhauptmanns einen frohen Willkomm.« Dies Stammbuch des lebenslustigen Vorfahren, der einst Herr auf einer Burg am Rhein gewesen, machte der Frau Major Scheffel, als sie es kennen lernte, so viel Spaß, daß sie es erwarb, und wenn wir hören, daß das Eröffnungsgedicht in dem von ihr seit 1840 geführten »Reimbuch« die »alten Ritter am Rhein« pries, die es ebenso verstanden, mit ihrem Schwert zehn Franken in den Grund zu strecken, wie mit ihren Humpen zehn Franken in den Grund zu trinken, so ist leicht zu erkennen, daß Scheffels vielverkannte Freude an deutscher »Humpenpoesie« zu dem geistigen Familienerbe gehörte, das er als Kind in spielender Harmlosigkeit in sich aufnahm.
Seit 1891 des Dichters Sohn, Victor v. Scheffel, aus dem literarischen Nachlaß des Vaters den Band »Gedichte von Josephine Scheffel« herausgegeben hat, ist für jedermann klargestellt, daß diese deutsche Frau von Natur eine echte Dichterin war, deren Herzensfrische, deren Heimatsinn, deren Vaterlandsliebe, Freiheitsbegeisterung und Humor in der Poesie ihres Sohnes eine Wiedergeburt im Elemente abgeklärter, aus männlichem Kraftbewußtsein entsprossener Kunst erlebte, während sie selbst eine Dilettantin blieb. Hervorzuheben ist, daß sie sich auch in der Zeit ihres öffentlichen Auftretens als Dichterin darauf beschränkte, die Muse ihres gastlichen Hauses oder einer Gemeinschaft zu sein, zu der sie als Frau ihres Mannes gehörte. Als am 1. Febr. 1839 zu Offenburg das »Erinnerungsfest der Großherzoglich Badischen Landwehrbataillone und freiwilligen Jäger zu Pferde« unter dem Protektorate des Großherzogs Leopold und der persönlichen Teilnahme des Markgrafen Wilhelm gefeiert wurde, befand sich unter den zum Vortrag gelangenden Festliedern eines von Frau Major Scheffel (»Kennt ihr den Strom? Ein Silberstreif dem Blicke, Bewacht er treu dies gottgeliebte Land etc.«), und in der Festschrift des Offenburger Gymnasialdirektors Franz Weißgerber fand sich das Gedicht an erster Stelle abgedruckt, ohne Nennung ihres Namens zwar, aber mit der Bemerkung: »Dieses schöne Dichtwerk verdanken wir, dem Vernehmen nach, der Gemahlin des Majors Sch., eines der tapfersten vormaligen Landwehroffiziere. Ehre den Frauen, die so edle Gefühle für Freiheit und Vaterland in ihrer Brust beherbergen und in so wunderlieblichen Klängen sie kundzugeben durch der Götter Huld berufen sind. Der Ref.« (Vgl. Obser, Denkwürdigkeiten des Markgrafen Wilhelm von Baden, Bd. 1. 1906.) Wie damals trat die Frau Major, auch auf Wunsch ihres Mannes oder seiner Freunde, noch öfter als Festdichterin auf, so bei Eröffnung der Schiffsbrücke, die das Karlsruher Rheinufer mit der pfälzischen Maximiliansau verband, bei der Probefahrt auf der Eisenbahn von Offenburg nach Freiburg, bei der Silbernen Hochzeit des Fürsten Karl Egon von Fürstenberg und seiner Gemahlin Amalie, einer geborenen Prinzessin von Baden, in Donaueschingen. Solche und ähnliche Gelegenheitsgedichte der Frau Major, wie dasjenige »zur Feier der Wiedergenesung S. K. Hoheit des Prinzen und Markgrafen Friedrich von Baden« (des späteren Großherzogs Friedrich) im März 1843, eine Ode an Karl Friedrich zur Denkmalsenthüllung 1844, erschienen als Einzeldrucke. Der Erlös war stets zu wohltätigen Zwecken bestimmt.
Ihre »Veteranengedichte« lassen uns erkennen, wie sie aus ihren ganz persönlichen Verhältnissen dazu gelangte, in die politische Lyrik der Epoche 1840–48 einzustimmen, als Karlsruhe mit seiner Ständekammer ein Hauptherd aller auf »deutsche Freiheit und Einheit« gerichteten politischen Bestrebungen war. Es war die Zeit, da die badischen Volksvertreter v. Rotteck, v. Itzstein, Karl Welcker, Karl Mittermaier, Bassermann, Mathy, die Württemberger Albert Schott, Uhland, Römer, Tafel, Paul Pfizer, die Hessen Heinrich v. Gagern, Jaup u. a. im Einklang mit sächsischen und preußischen Liberalen den Kampf um Preßfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlfreiheit, Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Justiz in ihren engeren Heimatländern mit der großen Forderung eines deutschen Parlaments am Sitz des Bundestags, in Frankfurt a. M., in Einklang brachten, jene Zeit, da der schwäbische Dichter Georg Herwegh im Königsschloß zu Berlin vor dem neuen König Friedrich Wilhelm IV. Schillers Posaideal zu verwirklichen suchte, in der Beckers Rheinlied an Volkstümlichkeit wetteiferte mit dem 1842 auf Helgoland entstandenen »Deutschland, Deutschland über alles« Hoffmanns von Fallersleben. Frau Josephine Scheffel hatte ja schon 1839 ein »Rheinlied« gesungen; nun wandte sie sich an den Kölner Niclas Becker mit einem andern: ehe vom »freien deutschen« Rhein mit Recht gesungen werden dürfe, müßten die deutschen Fürsten und Völker selber erst frei und deutsch gesinnt sein, war der führende Gedanke darin. Der Schluß aber lautete:
»So wird's erreicht! Und wenn in künft'gen Tagen Das stolze Frankreich unsern Rhein begehrt, Wir werden es mit Lächeln dann ertragen, Dann ohne Lieder und die Hand am Schwert!«
In dieser Tonart hat die Frau Major u. a. auch den »Geisterruf« aus dem Straßburger Münster gedichtet; nie aber ließ sie sich in ihrer patriotischen Lyrik zu Schmähungen gegen die Franzosen hinreißen. Besaß sie doch in Paris Verwandte; zwei Geschwister. Stolz hatten sich dort mit Franzosen verheiratet, und von der Straßburger Pension her pflegte sie eine innige Freundschaft mit Pauline Piccard, die an den Großindustriellen Goldenberg in Saverne (Zabern) im Elsaß verheiratet war. Aus den Zeiten der Grenzregulierung bestand auch dauernde Freundschaft zwischen Scheffels und den damaligen Kommissären Graf von Guilleminot und Immelin. Letzterer Offizier gehörte zu Josephs Paten.
Unter den deutschen Freiheitsdichtern jener denkwürdigen Epoche war seiner Mutter nächst Uhland der Österreicher Anastasius Grün, Graf Anton Auersperg, ganz besonders sympathisch, wohl auch deshalb, weil sein Freisinn sich mit Pietät gegen das historisch Gewordene in Glaubenssachen vertrug. In ihren eignen religiösen Gedichten findet sich diese Pietät mit der Erkenntnis vereinigt, daß die Poesie des früheren Klosterwesens dem Geist der Neuzeit habe erliegen müssen. Die Tragik des Zölibats hat sie verschiedentlich behandelt. Ihre Romanze »Der Kapuziner von Salzburg« läßt einen Jüngling, dem »in Nacht die Liebe sank« und der darum Mönch ward, durch den Zauber der schönen Natur von dem ihn beherrschenden Trübsinn geheilt werden und in einer regen Wirksamkeit für Darbende und Leidende Trost finden. Sie selbst war auf dem Gebiete sozialer Hilfstätigkeit eine Bahnbrecherin; in dem Kanzleirat Bingner, dessen Frau ihr unverwandt war, besaß sie in dieser Richtung einen treuen Freund und Berater. Die Gründung des Elisabethenvereins in Karlsruhe im Jahre 1848 ging von ihr aus.
Reise- und Wanderlust war eine weitere hervorragende Eigenschaft der Dichtermutter. In Zürich lebte ihr in Frau Karoline Meyer-Ott eine Jugendfreundin, die sie öfters mit den Kindern besuchte; der Komponist Ignaz Heim, Dirigent des Züricher Sängervereins »Harmonie« gehörte zur Verwandtschaft; der lockende Anblick der leuchtenden Alpenfirnen ist schon dem Knaben Joseph Scheffel auch aus der Nähe zuteil geworden. Als er neun Jahre alt war, wurde er von den Eltern rheinab von Leopoldshafen bis Bonn mitgenommen, und in einer humoristischen Beschreibung dieser Fahrt, welche die Mutter zum Vorlesen im Freundeskreis niederschrieb, spielt der kleine Schmetterlingsjäger, der stets der erste auf den zu erklimmenden Burgen war, eine muntere Rolle. Ein kleines Gedicht von ihr bekennt, daß sie die Männer um nichts mehr beneide als um das Recht, sich ohne Begleitung in der freien Natur zu ergehen.
Allmählich wurde das Scheffelsche Haus zum Mittelpunkt des geselligen Verkehrs unter den Künstlern Karlsruhes, zu denen zeitweilig die in München ansässigen Maler Moritz v. Schwind, Jean Baptist Kirner und Feodor Dietz gehörten. Es war die Zeit, in der Oberbaurat Hübsch das Neue Akademiegebäude vollendete und jene Maler ihre Aufträge für die »Kunsthalle« ausführten. Von den nächsten Freunden des Hauses seien hier noch der Generalstäbler Klose, dessen Söhne Karl und Wilhelm Josephs früheste Gespielen waren, und der auch als Kupferstecher hervorragende Landschaftsmaler und Galeriedirektor Karl Frommel genannt. Seine Kupferstiche mit Land- und Stadtansichten aus Italien und Süddeutschland genossen damals weite Verbreitung. Von hervorragenden Mitgliedern des Hoftheaters wurde die Heroine Wilhelmine Thöne, als Frau v. Cornberg, eine intime Freundin des Hauses, Frommel und andere Maler brachten gern ihre Mappen mit Skizzen und Studien mit und erzählten von ihren Reisen. Die Kinder Joseph und Marie durften, als sie größer waren, an dieser Geselligkeit teilnehmen. Eine stille Welt für sich hatte der jüngere Bruder Josephs, Karl, der infolge eines Hirndefekts dauernd gelähmt war und im Parterre, unter der besonderen Hut der Großmutter, gewartet vom »treuen Anton«, umhegt von der Liebe seiner Eltern und Geschwister, ein Gartenzimmer bewohnte.
Hoch in Ehren stand im Scheffelschen Hause bei alt und jung der Dichter des badischen Oberlandes, Johann Peter Hebel, der als Direktor des Karlsruher »Lyzeums« im gleichen Jahre starb, in dem Joseph Scheffel zur Welt kam. Major Scheffel las gerne selbst aus den so gemütvollen »Alemannischen Gedichten« vor. Hebels Einfluß verrieten auch die für die Kinder verfaßten humoristischlehrhaften Märchen der Mutter, wie »Strikkrikkel« (vgl. »In der Geißblattlaube«, herausgegeben von A. v. Freydorf) und die kleinen schalkhaften Schwankgedichte in alemannischer oder schwäbischer Mundart, die sie, wie »Die Zopfmilizenbraut«, für die heranwachsende Tochter zum Deklamieren bei festlichen Gelegenheiten verfaßte. Auch dramatische Szenen dichtete sie für die Kinder und ihre Gespielen. 1835 fand die feierliche Enthüllung des Hebel-Denkmals im Karlsruher Schloßgarten statt; das war Josephs bedeutsamstes Erlebnis in seiner ersten Schulzeit.
Der Hebelkultus im Elternhaus, der Künstlerverkehr in demselben, mußten in die Vorliebe Josephs für die ländliche Ahnenheimat früh ein künstlerisches Element bringen. Hebel war aber auch in rein geistiger Beziehung von bedeutsamem Einfluß auf den reichbegabten Knaben, der im Lyzeum, wie das Karlsruher Gymnasium noch genannt ward, »von der untersten bis zur obersten Klasse entweder der Erste oder der Zweite, unbestritten aber immer der Erste war, was seine Fähigkeiten anbelangt.« Als auf Grund der 1818 dem Großherzogtum Baden vom Großherzog Karl Ludwig auf Anraten v. Marschalls verliehenen Verfassung ein Ausgleich der konfessionellen Gegensätze in dem starkvergrößerten Lande erstrebt ward, geschah dies im Geiste der Aufklärung und Parität, und die leitenden Männer dabei waren Heinrich v. Wessenberg