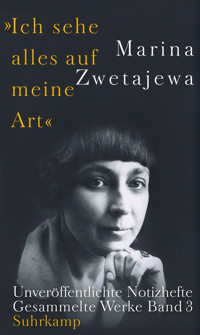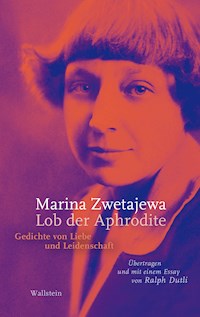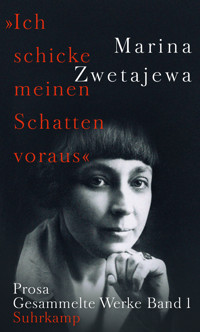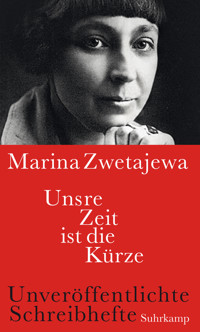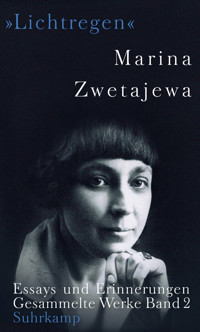
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marina Zwetajewa, neben Anna Achmatowa die wichtigste russische Dichterin der Moderne, lässt sich in Lichtregen, dem zweiten Band der auf vier Bände angelegten Werkausgabe, nicht nur als radikale Sprachkünstlerin, sondern auch als scharfsinnige und leidenschaftliche Essayistin erfahren:
Die erste Abteilung, »Erinnerungen an Zeitgenossen«, versammelt Porträts verstorbener Dichterkollegen und Freunde, darunter Ikonen des Silbernen Zeitalters wie Walerij Brjussow und Konstantin Balmont, aber auch Ossip Mandelstam, Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke und die avantgardistische Malerin Natalja Gontscharowa. Zwetajewa durchstreift Korrespondenzen und Gedichte, erzählerische Passagen und luzide Beobachtungen folgen auf prägnant protokollierte Gespräche. Dem Skandalon des Todes setzt sie – empfindsam, frei, schöpferisch – »Lebendes über Lebende« entgegen.
Die zweite Abteilung, »Essays«, bündelt eine Auswahl von Zwetajewas poetologischen Texten, denen sie sich in den Jahren von 1928 bis 1938 zuwandte. Darin schreibt sie über die Rolle des Kritikers oder die Übersetzung von Goethes »Erlkönig« ins Russische, sondiert das Terrain poetischer Schöpfung und – in »Mein weiblicher Bruder«, einem Text, den sie auf Französisch verfasste – jenes der gleichgeschlechtlichen Liebe.
Ihre Erinnerungen an Zeitgenossen und Essays waren für Zwetajewa zugleich auch immer »Anlass zu sich selbst«. Lichtregen erlaubt die Auseinandersetzung mit einer weiteren Facette des Werkes von Marina Zwetajewa, das von radikaler Hingabe und Ausgesetztheit zeugt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1221
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gesammelte Werke
Band 2
Marina Zwetajewa
»Lichtregen«
Essays und Erinnerungen
Herausgegeben von Ilma Rakusa
Übersetzt von Nicola Denis, Elke Erb, Rolf-Dietrich Keil, Hans Loose, Angela Martini-Wonde, Olga Radetzkaja, Ilma Rakusa und Ilse Tschörtner
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
I
ERINNERUNGEN AN ZEITGENOSSEN
Ein Held der Arbeit
Natalja Gontscharowa
Die Geschichte einer Widmung
Lebendes über einen Lebenden
Ein gefangener Geist
Ein Wort über Balmont
Ein Abend nicht von dieser Welt
II ESSAYS
Lichtregen
Der Dichter über die Kritik
Meine Antwort an Ossip Mandelstam
Einige Briefe von Rainer Maria Rilke
Der Dichter und die Zeit
Die Kunst im Lichte des Gewissens
Epos und Lyrik des zeitgenössischen Russland
Dichter mit Geschichte und Dichter ohne Geschichte
Zwei »Erlkönige«
Mein weiblicher Bruder
Puschkin und Pugatschow
Bildteil
Anhang
Ilma Rakusa »Jeder Dichter ist dem Wesen nach Emigrant« – Marina Zwetajewas Essays und Erinnerungsporträts
Auswahlbibliographie
Quellennachweise
Editorische Notiz
Bildnachweis
Fußnoten
AnmerkungenChronik zu Leben und Werk
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
IERINNERUNGEN AN ZEITGENOSSEN
Ein Held der Arbeit
(Notizen über Walerij Brjussow)
Erster Teil Der Dichter
»Und dem Feind seh ich heimlich verzückt ins Gesicht«
Balmont
IDer Dichter
Brjussows Gedichte liebte ich, seit ich sechzehn und bis ich siebzehn war – eine leidenschaftliche, kurze Liebe. Ich brachte es fertig, ausgerechnet das Brjussow-Untypischste an Brjussow zu lieben: das Liedhafte, die Melodie. Noch mehr als seine Gedichte liebte ich allerdings – und diese Liebe ist bis heute lebendig – den »Feuerengel« – damals als Idee und als Werk, inzwischen nur noch als Idee und als Erinnerung, den unverwirklichten »Feuerengel« also. Doch ich weiß auch noch, dass es mich schon mit sechzehn wie ein Peitschenhieb traf, als ich an einer eher pathetischen Stelle dort auf das triviale, taxierende Wort »interessant« stieß – undenkbar in der Epoche der Renata, zumal in einem Roman über einen Engel, und erst recht angesichts des Pathos des ganzen Buchs. So ein Fehlgriff, bei solch einem Meister? Ja, weil Meisterschaft nicht alles ist. Man braucht auch Gehör. Und das hatte Brjussow nicht.
Brjussows Amusikalität, bei aller äußerlichen (punktuellen) Musikalität einer ganzen Reihe seiner Gedichte, ist eine Amusikalität der Substanz, sie ist Dürre – hier fließt kein Fluss. Ich erinnere mich, dass die unlängst verstorbene Adelaida Gerzyk, die eine sehr besondere, tiefgründige Dichterin war, mir einmal über Max Woloschin und mich, die damals 17-Jährige, sagte: »In Ihnen ist mehr Fluss als Ufer, in ihm – mehr Ufer als Fluss.« Brjussow aber war durch und durch Ufer, ein Granitquai. Der begleitende, beherrschende (innerhalb der Stadtgrenzen) Granit der städtischen Ufermauern – das war Brjussows Verhältnis zum lebendigen Fluss der zeitgenössischen Dichtung. Außerhalb der Stadt hat die Uferstraße keine Macht. So konnte er weder den peripheren Majakowskij noch den roggenduftenden Jessenin verhindern, noch den Helden seiner letzten und heftigsten Eifersucht – Pasternak, der so neu war wie der erste Tag der Schöpfung. Doch alles, was der Sphäre von Stadt, Schreibtisch, Handwerk angehörte, brachte er entweder zum Vertrocknen, oder es nahm seine Konturen an.
»In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister«: Goethes unerbittlichem Satz, der vom Sieg über die eigene Maßlosigkeit handelt (die Wiege jeder schöpferischen Arbeit, der es zu entwachsen gilt, eben weil sie Wiege ist), Goethes Satz also nachlauschend muss man sagen, dass es für Brjussow diesbezüglich nichts zu besiegen gab: Bei ihm war die Beschränkung von Geburt an da. Schrankenlosigkeit lässt sich überwinden, indem man ihr eine Grenze setzt, die innere Schranke aber kann keiner überwinden. Ein Meister im Goethe'schen Sinne wäre Brjussow nur gewesen, wenn er diese natürliche Schranke in sich überwunden, wenn er sich selbst geweitet, womöglich auch – gesprengt hätte. Doch Brjussow, vom Stab des Moses getroffen, blieb stumm. Er war invulnérable (eine nur unvollständig übersetzbare Eigenschaft), er stand außerhalb des lyrischen Stroms. Aber gemacht war er, so behaupte ich, aus Granit, nicht aus Pappe.
(Goethes Satz ist ein Schutzzauber gegen Dämonen: vielleicht Brjussows äußerste, heimlichste, hoffnungsloseste Leidenschaft.)
Brjussow war ein Römer. Nur von dieser Seite her kann man ihn verstehen und ihm gerecht werden. Hinter ihm steht, unverkennbar, das Kapitol, nicht der Olymp. Nie haben seine Götter sich eingemischt – denken Sie an die verwundete Aphrodite! die flehende Thetis! an Zeus in seiner Betrübnis über Achills unausweichlichen Tod! – in die Kämpfe um Troja. Brjussows Götter saßen auf ihrem hohen Thron, sie hatten das Leben über den Wolken endgültig aufgegeben und sich auf der Erde niedergelassen. Aber gemacht waren sie, darauf bestehe ich, aus Marmor, nicht aus Gips.
Ich will keine Lügen über Brjussow, ich will keine posthume Hetze gegen ihn. Brjussow war keine quantité und schon gar keine qualité négligeable. Er war Russe durch und durch von Geburt, und als solcher stellt er ein Rätsel dar. Ein einmaliger Fall in der russischen Lyrik: ein bis oben hin zugeknöpfter Dichter. Tjuttschew? Aber Tjuttschew war es nur im Leben: in der Rohfassung, dem Entwurf zur Poesie. Brjussow dagegen war gerade in seinem Schaffen zugeknöpft (oder sogar zugenagelt?), unsprengbar gepanzert. Das sollte ein Russe sein? Ein Dichter? Russe war er zweifellos, Dichter ebenso zweifellos: in den Grenzen des menschlichen Willens. Ein Dichter der Grenze. Es gibt solche Häuser am Rand großer Städte, im Näherkommen sieht man sie als Erste: vieläugige (vielfenstrige) Häuser, die dennoch wie blind wirken, in denen zu wohnen völlig undenkbar scheint. Sie sind gesichtslos, geschichtslos (um es lyrisch zu wenden). Als ein solches Haus steht mir Brjussows Werk vor Augen. In seinen besten Momenten ist es ein Granitkorridor, der in eine Sackgasse mündet.
Brjussow: ein Dichter der Eingänge ohne Ausgang.
Mach die Probe aufs Exempel, Leser: wolltest du je ein Brjussow-Gedicht in die Länge ziehen? (Das Goethe'sche »Verweile doch! du bist so schön!«) Hattest du je das Gefühl eines jähen Abbruchs (dein Lotse hat dich im Stich gelassen!), ging dir je einen unerfassbaren, stockenden Herzschlag lang hinter seinen Zeilen – ein Land auf, zu dem die Verse nur der Durchgang waren: in fernster Ferne – zur fernsten Ferne – ein weit geöffnetes Tor? Hat Brjussow dir je das Herz zerrissen, wie Musik es tut? (»Vorbei? Schon?«) Hat dein Herz ihn je angefleht, wie am Ende einer Musik: »Schon vorbei? Mehr!« Bist du aus der Begegnung mit ihm auch nur einmal unbefriedigt hervorgegangen?
Nein, Brjussow befriedigt vollauf, er gibt alles und exakt das, was er versprochen hat, sein Buch lässt man hinter sich wie ein lukratives Geschäft (bezeichnend: bei anderen Dichtern geht das Buch, und du gehst ihm nach, bei Brjussow gehst du, das Buch bleibt zurück) – und wenn es dabei an etwas fehlt, dann allein an Unerfülltheit.
Unter jedem Gedicht von Brjussow steht ein unsichtbares »Ende«. Der Vollständigkeit halber hätte er es eigentlich auch graphisch (typographisch) daruntersetzen müssen.
Bei Brjussow ist die Schöpfung größer als der Schöpfer. Auf den ersten Blick klingt das schmeichelhaft, auf den zweiten traurig. Der Schöpfer, das ist das ganze Werk von morgen, die ganze Unausschöpflichkeit des Möglichen: das Unrealisierte, aber nicht Unrealisierbare – das Unerfassbare – in seiner Unerfassbarkeit Unbesiegbare: die Zukunft.
Bringen Sie Ihre Werke zu Ende, schuften Sie sich meinetwegen halbtot dafür, aber wenn ich dieses Ende beim Lesen schon spüre, ist das das Ende – für Sie.
Was für ein seltsames Wunder: je größer die Schöpfung (»Faust«), umso kleiner wirkt sie neben ihrem Schöpfer (Goethe). Woher kennen wir Goethe? Aus seinem »Faust«. Und wer sagt uns, dass Goethe größer ist als der »Faust«? »Faust« selbst – durch seine Vollkommenheit.
Nehmen wir einen ähnlichen Fall:
»Wie groß muss Gott sein, wenn er so eine Sonne geschaffen hat!« Das Kind vergisst die Sonne und denkt an Gott. Durch ihre Vollkommenheit führt die Schöpfung uns zum Schöpfer. Was ist die Sonne, wenn nicht eine Hinführung zu Gott? Was ist der »Faust«, wenn nicht eine Hinführung zu Goethe? Und was ist Goethe, wenn nicht eine Hinführung zum Göttlichen? Vollkommenheit ist nicht dasselbe wie Abgeschlossenheit, vollendet wird hier, aber vollbracht – Dort. Wo Goethe einen Punkt setzt – fängt alles erst an! Das erste Kennzeichen für die Vollkommenheit einer Schöpfung (für das Absolute) ist, dass sie den Sinn für Steigerung in uns weckt. Höhe ist nur dadurch Höhe, dass sie höher ist – als was? – als ein vorangegangenes »höher«, und auch dieses »höher« wird schon vom nächsten absorbiert. Der Berg ist höher als meine Stirn, die Wolke ist höher als der Berg, Gott ist höher als die Wolke – und weiter, die grenzenlose Übersteigung der Idee Gottes. An die Stelle der Vollendung (als Zustand) würde ich das Vollenden setzen (als Kontinuität). Der Durchbruch ins Göttliche, das im selben Maß ungleich größer ist als Goethe, wie Goethe größer ist als der »Faust«, eben das ist es, was sowohl Goethe als auch den »Faust« unsterblich macht: dass sie, in all ihrer Größe, so klein sind im Vergleich zu etwas ungleich Höherem. Nur so können wir Höhe wahrnehmen – als kontinuierliche vertikale Verschiebung der Punkte, an denen wir sie messen. Nur dort gibt es Größe auf der Welt, wo ich ein Gefühl für die Höhe über meinem Kopf bekomme.
»Aber Goethe ist tot, und der ›Faust‹ lebt weiter!« Trotzdem, Leser, hast du nicht das Gefühl, als würde gerade jetzt irgendwo – in einem ungleich weitläufigeren Herzogtum als dem Weimarischen – der Tragödie Dritter Teil – vollendet?
Das Versprechen: morgen besser! größer! höher!, auf dem die gesamte Dichtung – und etwas, das über der Dichtung steht – beruht: das Versprechen des Wunders, das mir geschieht und das ich deshalb an anderen vollbringe – dieses Versprechen ist in keiner einzigen Zeile von Brjussow enthalten.
Vielleicht ist das Leben nur Mittel
Zum Zweck: dem klangvollen Vers,
Den du seit der sorglosen Kindheit
Um Wörter und Reime vermehrst.
Nicht Bedeutungen, sondern Wörter, nicht Gefühle, sondern Reime … Als gingen Wörter aus Wörtern, Reime aus Reimen, Verse aus Versen hervor!
Fünfzehn Jahre später hat sich dieses Programm in Brjussows »Institut für Poesie« materialisiert.
Die vollkommenste Schöpfung ist – jeder Künstler weiß das – die Absicht: das, was ich wollte – und nicht geschafft habe. Je vollkommener für uns, desto unvollkommener für ihn. Bei Brjussow aber steht unter jeder Zeile: So viel habe ich geschafft. Und Größeres ist gar nicht möglich.
Wie wenig muss er gewollt haben, wenn er so viel geschafft hat!
Seine Möglichkeiten kennen – und seine Unmöglichkeiten. (Möglichkeiten ohne Unmöglichkeiten sind Allmacht). Puschkin kannte seine Möglichkeiten nicht, Brjussow – seine Unmöglichkeiten – nur zu gut. Puschkin schrieb auf gut Glück (ein Element von Wunder – trotz schwarzkorrigierter Manuskripte), Brjussow auf Sicherheit (Statuten, Institute).
Die wundersame Fügung – das ist der ganze Puschkin. Das Wunder des Willens – der ganze Brjussow.
Weniger kann ich nicht. (Puschkin. Allmacht.)
Mehr kann ich nicht. (Brjussow. Möglichkeiten.)
Was ich heute nicht geschafft habe, schaffe ich morgen. (Puschkin. Wunder.)
Was ich heute nicht geschafft habe, schaffe ich nie. (Brjussow. Wille.)
Doch er hat es immer – heute geschafft.
Die von Brjussow zu Ende geschriebenen »Ägyptischen Nächte«. Von der Tauglichkeit der Mittel einmal abgesehen – warum hat er den Versuch unternommen? Aus Liebe zur Begrenzung, zum semantischen und graphischen Schlussstrich. Er, dem das Geheimnis seiner ganzen Natur nach fremd ist, hat für das Geheimnis einer unvollendeten Schöpfung weder Respekt noch Gespür. Puschkin hatte keine Zeit mehr – also führe ich die Sache zu Ende.
Die Geste eines Barbaren. Denn in manchen Fällen ist vollenden eine größere Barbarei als vernichten.
Um es klar zu sagen, Brjussows ganzer Anschlag auf die Poesie war ein Versuch mit untauglichen Mitteln. Ihm fehlte die Grundlage, um Dichter zu werden (nämlich: als solcher geboren zu sein); er ist Dichter geworden. Überwindung des Unmöglichen. Eine Kraftprobe. Die Entscheidung für das, was ihm am wenigsten lag: die Dichtung (warum nicht für die Naturwissenschaften? die Mathematik? die Archäologie?) war einfach der einzige Ausweg für seine Kraft: ein Zweikampf.
Genauer: Brjussow kämpfte nicht mit dem Reim, sondern mit seiner fehlenden Neigung zum Reim. Dichtung als Arena des Ringens mit sich selbst.
Ist Brjussow nach alldem ein Dichter? Ja, aber keiner von Gottes Gnaden. Er ist ein Versemacher, ein Schöpfer von Gedichten und, viel wichtiger, Schöpfer seiner selbst als Schöpfer. Nicht der Mann aus dem Neuen Testament, der sein Talent in der Erde vergräbt – sondern einer, der es kraft seines Willens der Erde abringt. Der etwas erschafft – aus dem Nichts.
Voran, mein Traum, du treuer Ochse!
Dieser Zuruf, der eher einem Seufzer gleicht, ist kein zufälliger Reim, o nein. Wenn Brjussow je wahrhaftig war – bis auf den Grund –, dann hier. Schuften, sich ins Zeug legen, wie ein Ochse – was ist das: die Arbeit des Dichters? nein, sein Traum! Inspiration + Ochsentour ergeben einen Dichter, Ochsentour + Ochsentour ergeben Brjussow: ein Ochse, der ein Fuhrwerk zieht. Dieser Ochse entbehrt nicht der Größe.
Wer außer Brjussow hätte je seinen Traum mit einem Ochsen verglichen? Denken wir an Balmont, an Wjatscheslaw, Blok, Sologub – ich spreche nur von Dichtern seiner Generation (warum fehlt Belyj in der Reihe?) – wer von ihnen hätte, und in welchem Moment äußerster Erschöpfung, dieses »Traum, du Ochse« über die Lippen gebracht? Stünde anstelle des Traums der Wille, wäre der Vers eine Formel.
Ein Dichter des Willens. Der Wille wirkt nicht lange, aber für den Moment unbegrenzt. Er ist von dieser Welt, ganz hier, ganz jetzt. Wer sonst hat so über lebendige Menschen und Schicksale geherrscht wie Brjussow? Balmont? Zu ihm fühlte man sich hingezogen. Blok? Ihm verfiel man. Wjatscheslaw? Ihm lauschte man. Sologub? Über ihn rätselte man. Und allen hörte man begierig zu. Brjussow dagegen – gehorchte man. Ein Hauch »Steinerner Gast« umgab seine Auftritte bei den Festen der jungen Dichter (»Don Juans«). Der Wein gefror in den Gläsern. Brjussows Herrschaft unterwarf man sich ohne Freude, und sein Joch wog schwer. Ein »Magier«, ein »Hexenmeister« – das hat man weder über den berückenden Balmont noch über den magischen Blok, noch über den geborenen Schwarzkünstler Wjatscheslaw, noch über den mysteriösen Sologub gesagt, nur über Brjussow, den kalten Meister der Zeilen. Worin lag seine Kraft? Was für ein Zauber war das? Kraft wie Zauber waren unrussisch: ein für die Rus ungewohnter Wille, übernatürlich und wundersam in diesem verwunschen-fernen Reich, wo wie im Traum alles möglich ist. Alles, nur nicht der nackte Wille. Und von diesem nackten Willen ließ das ferne Reich der Seele – Russland – sich verführen, ihn verehrte es, ihm beugte es sich.[1] Der römische Wille eines Moskauer Kaufmannssohns vom Trubnaja-Platz.
»Ein Märchen?«
Ich glaube, Brjussows Schlaf war immer traumlos, aber da er wusste, dass Dichter träumen, ersetzte er die echten Träume, die er nicht hatte, durch erfundene.
Rührte daher – dass er nicht einfach träumen konnte – sein trauriger Hang zu Drogen?
Brjussow. Und Brjuss. (Der Moskauer Nekromant des 18. Jahrhunderts.) Vielleicht bin ich nicht die Erste, der das auffällt. (Im Wissen, dass ich über ihn schreiben würde, habe ich meine Vorgänger zum Thema Brjussow nicht gelesen – nicht, weil ich Überschneidungen fürchtete, sondern um ihn im Fall übertriebener Kritik nicht meinerseits übertrieben loben zu müssen.) Brjussow. Und Brjuss. Der Gleichklang ist kein Zufall. Zwei Rationalisten, die von ihren Zeitgenossen für Magier gehalten wurden. (Aus Aufgeklärtheit wird in Russland schwarze Kunst.)
Brjussows Schicksal und Wesen sind tragisch. Die Tragödie der Einsamkeit? An ihr schreiben alle Dichter.
… Und sind ihr ganzes Leben so allein …
(Rilke über die Dichter)
Die Tragödie der absichtlichen Einsamkeit, des künstlichen Abgrunds zwischen einem selbst und allem, was lebt, der verhängnisvolle Wunsch, noch zu Lebzeiten – ein Denkmal zu sein. Die Tragödie des Hochmütigen, und seine traurige Genugtuung, zumindest selbst schuld zu sein. Für dieses Denkmal hat er sein Leben lang unermüdlich gekämpft: nicht zu sehr lieben, nicht zu viel schenken, sich nichts vergeben!
Wie gerne wär ich nicht Walerij Brjussow –
die Zeile beweist nur, dass er nie etwas anderes wollte. Und schließlich, 1922, das leere Podest, und ringsum der Tumult der »Nitschewóki« – »Nichtsianer«, Nutzlosianer, Pfeifdraufianer. Die Besten waren von ihm abgefallen, hatten sich abgewandt. Der Abschaum, dessen Nähe er vergeblich suchte, witterte mit dem untrüglichen Instinkt der Gemeinheit seine Größe – und bespuckte ihn (»er gehört nicht zu uns! er ist gut!«). Brjussow war allein. Nicht über der Menge (der Traum des Ehrgeizigen), sondern außerhalb.
»Ich möchte ja auf neue Art schreiben – ich kann nicht!« Dieses Geständnis habe ich mit eigenen Ohren gehört, 1920, von der Bühne des Großen Saals im Moskauer Konservatorium. (Zu dem Abend dort später.) Ich kann nicht! Brjussow, dessen ganzer Sinn im »ich kann« lag, Brjussow, der für einmal etwas nicht schaffte!
Der diese Worte hervorstieß, schien – ein Wolf. Kein Mensch, ein Wolf. Als Mensch hatte Brjussow schon immer wie ein Wolf auf mich gewirkt. Ein unbestrafter – so lange! Zwischen 1918 und 1922 aber – ein in die Enge getriebener. Von wem? Von demselben Poetengelichter, das den sterbenden Blok (er starb einen Monat danach) anschrie: »Sehen Sie nicht, dass Sie längst tot sind? Eine Leiche sind Sie! Sie stinken! Ab ins Grab!« Von Kokainisten, die mit Skandalen und Sacharin spekulierten: demselben Poetengelichter also, mit dem er, der Maître, der Musensohn, der Inbegriff von Macht und Zauber, fraternisierte. Dem er – im Flur seiner Wohnung – erbärmlich-devot den Mantel reichte.
Seine Freunde, Mitstreiter, Zeitgenossen zurückstoßen – das hatte Brjussow geschafft. Sie waren nicht die Männer der Stunde. Anhänglichkeiten – darüber ging er hinweg. Aber diese Leute, die sich selbst »neue Dichter« nannten, waren ihm unentbehrlich: ihre Stunde hatte geschlagen!
Die Sucht nach Ruhm. Auch das ist – Rom. Wer von den bereits Genannten – Balmont, Blok, Wjatscheslaw, Sologub – wollte Ruhm? Balmont? Zu verliebt in sich und die Welt. Blok? Der nichts als Gewissen war? Wjatscheslaw? War ihm um Jahrtausende voraus. Sologub?
Ich steig in keinen Schlitten ein
Im Mondschein, ich fahr nirgends hin!
Sologub mit seiner grandiosen Verachtung?
Für einen Russen ist, wer zu Lebzeiten nach Ruhm strebt, entweder verächtlich oder lächerlich. Ruhmsucht: Selbstsucht. Der russische Dichter überlässt den Ruhm seit jeher den Militärs, und vor deren Ruhm verneigt er sich. – Puschkins »Denkmal«?[2] Ist eine Zukunftsvision, weiter nichts. Was den Ruhm zu Lebzeiten betrifft, sagt er dagegen:
Gelassen hör den Spruch des Lobes und des Spottes
Und lass die dummen Narren stehn –
die Narren, also die wichtigste – nämlich quantitative – Basis: des Ruhms. Ich kann mich nicht enthalten, den verzweifelten Seufzer des besten russischen Dichters der Gegenwart zu zitieren: »Ach, wie froh wäre ich, mich öffentlich für einen mittelmäßigen Autor zu erklären, wenn ich dafür auch mittelmäßig leben und arbeiten dürfte!«
Diese Verzweiflung kennt jeder Dichter, besonders – jeder russische, und je größer er ist, desto lauter seufzt er. Allein Brjussow verlangte nach Ruhm. Nach dem Flüstern hinter seinem Rücken: »Brjussow!«, nach dem gesenkten oder dem durchdringenden Blick: »Brjussow!«, nach der plötzlichen Kälte eines Händedrucks: »Brjussow!« Dieser steinerne Gast war voller Ruhmsucht. Eine uns fremde, in unseren Augen lächerliche Größe – wollte ich sie auf Russisch beschreiben, es klänge wie eine Übersetzung von une petitesse qui ne manque pas de grandeur.
»Annenskij war nicht der Erste, der Erste war Brjussow« (sagt derselbe Dichter). Ja, unnachahmlicher Dichter, Sie haben recht: der Einzige ist niemals der Erste. Der Erste ist ja ein Grad, er ist die letzte Stufe einer Treppe, deren erste Stufe – der Letzte ist. Der Erste ist etwas Relatives, Abhängiges, er steht in einer Reihe. Der Einzige steht außerhalb. Dem Unverwechselbaren folgt nichts nach.
Zweierlei Dichtung.
Die gemeinsame Sache, individuell betrieben.
(Das Werk der Einzelgänger. Annenskij.)
Die private Sache, gemeinsam betrieben.
(Der literarische Zirkel. Das Brjussow'sche Institut.)
Von einer Schwäche war Brjussow frei: von kleinlich bemessenen Schwächen. All seine Schwächen, die Kleinlichkeit selbst an erster Stelle, waren en grand. In Rom, möchte ich meinen, wären sie Tugenden gewesen.
Ruhm? Ruhm ist Liebe – in Milliarden von Herzen. Macht? Ist in Milliarden von Herzen – Angst.
Es war nicht der Ruhm, den Brjussow liebte, es war die Macht.
Für jeden Menschen gibt es ein Verb, das sein Handeln beschreibt. Bei Brjussow lautet es: forcieren.
Es hat etwas Perfides, die Karten eines Dichters so vor aller Augen auszubreiten. Literaturgemeinden (erbärmlich!) gibt es für mich nicht, wohl aber eine gemeinsame Verantwortung. Über einen Künstler urteilen kann – so die gängige Ansicht und Praxis – jeder. Einen Künstler richten kann – so behaupte ich – nur ein Künstler. Es muss ein kollegiales oder ein Höheres Gericht sein, das über ihn befindet – entweder seine Zunftgenossen oder Gott. Nur sie und Gott allein wissen, was das bedeutet: eine andere Welt zu schaffen – mitten im Diesseits. Der Spießbürger hat über den Dichter, wie auch immer dieser sich im Leben verhält, nicht zu richten. Seine Sünden sind etwas anderes als deine. Und seine Laster sind deinen Tugenden immer schon vorgezogen.
Avoir les rieurs de son côté wäre nur zu leicht, ein billiger Effekt. Ich will auf meiner Seite nicht die Lacher haben, sondern die Denker. Und das einzige Ziel dieser Notizen ist es, die Freunde zum Nachdenken zu bringen.
Walerij Brjussow ist auf die Welt gekommen, um den Menschen zu zeigen, was der Wille kann und was er nicht kann – doch was er kann, an erster Stelle.
In drei Worten steht Brjussow vor uns: Wille, Ochse, Wolf. Eine nicht nur lautliche, sondern auch inhaltliche Dreieinigkeit: der Wille – ist Rom, der Ochse – ist Rom, und auch der Wolf – ist Rom. Ein dreifacher Römer war Walerij Brjussow: in der Dichtung – mit seinem Willen und seiner Ochsenkraft, im Leben – als Wolf (homo homini lupus est). Und mein ungerechtes, aber nach Gerechtigkeit dürstendes Herz wird nicht eher zur Ruhe kommen, als in Rom – und sei es im abgelegensten Außenbezirk – ein Standbild – aus Marmor, was sonst? – errichtet wird:
DEM SKYTHISCHEN RÖMER
ROM
IIDie erste Begegnung
Das erste Mal begegnete ich Brjussow indirekt. Ich war sechs Jahre alt. Seit kurzem hatte ich Unterricht an der Musikschule Sograf-Plaxina (eine kleine alte Villa in der Mersljakowskij-Gasse, nahe der Nikitskaja). An dem bewussten Tag trat ich zum ersten Mal auf, mit einem Stück zu vier Händen (dem ersten in der Sammlung von Lebert und Stark) – meine Partnerin war Jewgenija Jakowlewna Brjussowa, das Kleinod der Schule und meines Herzens. Die älteste Schülerin mit der jüngsten. Die eine – mit allen musikalischen Wassern gewaschen, die andere – ein unbeschriebenes Blatt. Nach meinem (etwas kuriosen) Triumph gehe ich zu meiner Mutter. Sie sitzt im Publikum, mit einer mir unbekannten älteren Dame. Die beiden unterhalten sich über Musik, über die Kinder, die Dame erzählt von ihrem Sohn Walerij (eine meiner Schwestern hieß Walerija, deshalb prägte der Name sich ein), der »so begabt und so leicht entflammbar« sei, der Gedichte schreibe und Differenzen mit der Polizei habe. (Offenbar die Studentensache von 98-99? Ob Brjussow zu dieser Zeit Student war, und welcher Art die Differenzen waren, weiß ich nicht, ich erzähle die Geschichte, wie sie mir im Gedächtnis geblieben ist.) Ich weiß noch, dass meine Mutter ihr Beileid bekundete (wegen der Gedichte? – die ja kein geringeres Unglück waren als Differenzen mit der Polizei). Die stürmische Jugend, etwas in der Art. Meine Mutter fühlte mit, die andere Mutter klagte und schwärmte. »Er ist so begabt und so leicht entflammbar.« – »Er ist so leicht entflammbar, eben weil er so begabt ist.« Das Gespräch zog sich hin. (Es war in der Pause.) Beide Mütter klagten und schwärmten. Ich hörte zu.
Die Polizei – wozu sich mit Politik befassen – ebendarum leicht entflammbar.
So ist mir der Klang seines Namens zum ersten Mal begegnet.
IIIDer Brief
Die erste indirekte Begegnung – mit sechs, die erste direkte – mit sechzehn.
Ich wollte Bücher kaufen bei Wolf, auf dem Kusnezkij Most – Rostands »Chantecler«, der aber nicht vorrätig war. Ein nicht erhaltenes Buch, das man kaufen wollte, ist mit sechzehn dasselbe wie ein nicht erhaltener postlagernder Brief: man hat gewartet – auf nichts, man hätte etwas mitgenommen – und geht mit leeren Händen. Da stehe ich also, schon auf der Suche nach einem Ersatz, doch Rostand ist – mit sechzehn? nein, auch heute in manchen Stunden des Lebens – unersetzlich, ich suche also schon nicht mehr nach einem Ersatz, und plötzlich tönt hinter meiner linken Schulter, wo der Engel seinen Platz hat – ein abgehacktes Bellen, nie gehört und gleich erkannt:
»Die ›Lettres de femmes‹ von Prévost. Baudelaires ›Fleurs du mal‹, und vielleicht noch den ›Chantecler‹, obwohl ich kein großer Freund von Rostand bin.«
Ich blicke auf, ein Schlag ins Herz: Brjussow!
Da stehe ich also, und mein Ersatz ist gefunden, ich sehe die Bücher durch, mein Herz schlägt bis zum Hals – für solche Minuten würde ich – noch heute! – mein Leben geben. Und Brjussow, methodisch-unbeirrt, bellt weiter, Wort für Wort beißt er ab und stößt es aus: »Obwohl ich kein Freund von Rostand bin«.
Mein Herz schlägt bis zum Hals – gleich doppelt. Er ist es selbst, Brjussow! Der Brjussow der Schwarzen Messe, der Brjussow der Renata, der Brjussow des Antonius! Und – kein Freund von Rostand: dem Rostand – des »Aiglon«, dem Rostand – der Mélissinde, dem Rostand – der Romantik!
Während ich noch dabei war, dies letzte Wort zu Ende zu spüren, das sich nicht zu Ende spüren lässt, weil es ganz Seele ist, zog Brjussow mit einem trockenen Klacken die Tür hinter sich zu. Auch ich ging hinaus – nicht ihm nach, sondern ihm entgegen: nach Hause, um ihm einen Brief zu schreiben.
Lieber Walerij Jakowlewitsch,
(Ich rekonstruiere aus dem Gedächtnis.)
als Sie heute in Wolfs Buchhandlung den »Chantecler« verlangten, haben Sie hinzugefügt: »obwohl ich kein großer Freund von Rostand bin«. Nicht nur einmal, nein, zweimal haben Sie das gesagt. Drei Fragen:
Wie konnten Sie als Dichter Ihre Abneigung gegen einen anderen Dichter – einem Verkäufer anvertrauen?
Zweitens: Wie können Sie, der Schöpfer der Renata, Rostand nicht lieben, den Schöpfer der Mélissinde?
Drittens: Und wie konnten Sie den Vorzug vor Rostand – ausgerechnet Marcel Prévost geben?
Ich habe Sie nicht im Laden gleich angesprochen, weil ich fürchtete, Sie würden das nur als den prätentiösen Wunsch auslegen, »einmal mit Brjussow zu reden«. Auf einen Brief dagegen steht es Ihnen frei, nicht zu antworten.
Marina Zwetajewa
Meine Adresse fügte ich – um die Antwort nicht zu erleichtern – nicht bei. (Ich ging damals in die 6. Gymnasialklasse, mein erstes Buch erschien erst ein Jahr später, Brjussow kannte mich nicht, aber den Namen meines Vaters kannte er mit Sicherheit und konnte also antworten, wenn er wollte.)
Zwei Tage später kam – wenn ich mich nicht irre, an die Adresse des Rumjanzew-Museums, dessen Direktor mein Vater war (wir wohnten nicht dort, sondern in unserem Haus in der Trjochprudnyj-Gasse) – eine Karte im Umschlag. Keine Ansichtskarte – zu formlos –, kein Brief – zu förmlich –, sondern die goldene Mitte, der elegante Ausweg – eine Briefkarte. (Wieder Brjussows »nicht zu viel geben«.) Ich öffne sie:
»Sehr verehrte Frau Zwetajewa«
(NB! Ich hatte ihn mit »Lieber Walerij Jakowlewitsch« angeredet, dabei war er zwanzig Jahre älter als ich!)
– die Einleitung habe ich vergessen. Auf den Dichter und den Verkäufer ging er gar nicht ein. Marcel Prévost hatte sich in Luft aufgelöst. Zu Rostand aber schrieb er wörtlich:
»Rostand ist progressiv im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert und regressiv vom 20. Jahrhundert bis heute« (wir schrieben das Jahr 1910). »Dass ich Rostand nicht liebe, liegt daran, dass sich diese Liebe für mich nicht ergeben hat. Denn Liebe ist Zufall« (unterstrichen).
Einige weitere Worte, die vielleicht auf den Wunsch nach einem Treffen, vielleicht auch nach einer Fortsetzung des Briefwechsels hindeuteten, aber nicht offen, sonst hätte ich sie nicht vergessen. Und die Unterschrift.
Darauf antwortete ich natürlich nicht (weil ich es zu gern getan hätte!).
Denn Liebe ist Zufall.
Dieser Brief existiert noch, er liegt mit meinen übrigen Papieren bei Freunden in Moskau.
Der erste Brief ist auch der letzte geblieben.
IVZwei kleine Gedichte
Mein erstes Buch »Abendalbum« erschien, als ich 17 war – es enthielt Gedichte, die ich mit 15, 16, 17 geschrieben hatte. Veröffentlicht hatte ich es aus Gründen, die außerhalb der Literatur lagen, der Poesie aber nahestanden – anstelle eines Briefs an jemanden, mit dem ich anders nicht in Verbindung treten konnte. Eine Literatin ist auch später nicht aus mir geworden, der Anfang war bezeichnend.
Ein Buch veröffentlichen war damals einfach: Man stellte seine Gedichte zusammen, trug sie zur Druckerei, entschied sich für eine Gestaltung, bezahlte – fertig. Genau das hatte ich – eine Gymnasialschülerin der 7. Klasse – auch getan, ohne irgendwem etwas zu sagen. Als die 500 Bücher gedruckt waren, brachte ich die gesamte Auflage ins Magazin, in den gottverlassenen Laden von Spiridonow und Michajlow (wieso dorthin?), und beruhigte mich. Kein einziges Rezensionsexemplar hatte ich verschickt, ich wusste nicht einmal, dass man das so machte, und hätte ich es gewusst – ich hätte es nicht getan: sich einem Rezensenten aufdrängen! Mein Buch war außer bei Spiridonow und Michajlow nirgends zu finden, trotzdem erschienen Besprechungen – wohlwollende: ein langer Artikel von Max Woloschin, der den Grundstein zu unserer Freundschaft legte, einer von Marietta Schaginjan (ich nenne das, was für mich wertvoll war), und schließlich eine Notiz von Brjussow. Eingeprägt hat sich mir daraus dies:
»Die Gedichte Fr. Zwetajewas sind von einer beklemmenden Intimität, die bisweilen peinlich berührt, als hätte man durch ein Fenster versehentlich in eine fremde Wohnung geblickt …« (Ich, im Geist: keine Wohnung, ein Haus!)
Den mittleren Teil, wo von sicherer Beherrschung der Form, von Eigenständigkeit, von der für eine Debütantin ungewöhnlichen Originalität der Themen und ihrer Gestaltung die Rede war, habe ich wörtlich nicht in Erinnerung, deshalb lasse ich ihn weg. Zum Schluss hieß es: »Allerdings kann man schwer leugnen, dass es stärkere Gefühle und ernstere Gedanken gibt als:
Nein! zu verhasst ist mir der Stolz des Pharisäers!
Doch dann erfahren wir, dass die Autorin erst siebzehn Jahre alt ist, und sind entwaffnet …«
Für Brjussow war das eine ungewöhnliche Herangehensweise. Zu der Besprechung wurde mir, wie gesagt, gratuliert. Aber ich, die ich mir unter all den Erfreulichkeiten natürlich das Unerfreuliche gemerkt hatte, wehrte lachend ab: »Ernstere Gedanken und stärkere Gefühle? Na warte!«
Ein Jahr später erschien mein zweites Buch, »Die Zauberlampe« (danach, zwischen 1912 und 1922, kam eine Pause; ich schrieb, aber publizierte nicht) – und darin das Gedicht
AN W. JA. BRJUSSOW
Durchs »Fenster« gib mir deinen Segen
Oder sage: sie ist infantil –
Du änderst mich nie im Leben!
Einen »ernsten Gedanken«, ein »starkes Gefühl«
Hat der Herrgott mir nicht gegeben.
Von Stunden, die dunkel verschweben,
Von Nächten und Träumen so schwül
Muss ein Dichter heute reden –
Doch solch ernste Gedanken, solch starkes Gefühl
Hat der Herrgott mir nicht gegeben![3]
Mit einem Wort, die Truppen hatten die Grenze überschritten. An einem bestimmten Datum eines bestimmten Jahres hatte ich, ein Niemand, Kampfhandlungen aufgenommen – gegen Brjussow.
Mein Gedicht war nicht eben brillant, aber darum geht es hier nicht, sondern um Brjussows Reaktion.
»Fr. Zwetajewas zweites Buch, ›Die Zauberlampe‹, hat unsere Hoffnungen leider enttäuscht. Die allzu große, verhängnisvolle Leichtigkeit ihres Verses …« (es folgte eine Reihe von Unfreundlichkeiten, die ich vergessen habe, und am Ende:) »Aber was soll man auch erwarten von einem Dichter, der selbst einräumt, dass der Herrgott ihm keine starken Gefühle und ernsten Gedanken gegeben hat.«
Die Worte aus seiner ersten Besprechung, die ich, weil es seine Worte waren, in Anführung gesetzt hatte, standen hier ohne Anführungszeichen. Und ich stand als Dummchen da. (Walerij Brjussow, »Die Fernen und die Nahen«, Kritiken und Aufsätze.)
Die Riposte kam blitzschnell. Sehr bald im Anschluss an die »Zauberlampe« gab ich eine kleine Gedichtauswahl aus meinen zwei Büchern heraus, die auch so hieß, »Aus zwei Büchern«, und in diesem Band stand, schwarz auf weiß:
AN W. JA. BRJUSSOW
Ich vergaß: Ihr Herz ist ein kleines Licht,
Kein Stern! Eine Funzel!
Ihre Verse bestehen aus nichts als Papier,
Und aus Missgunst Ihre Kritik.
Früh vergreist, erschienen Sie einmal doch mir
Als großer Dichter, als Wunder!
Interessanterweise hatte ich das nicht auf seine Rezension hin geschrieben, sondern nach einem Traum, der von ihm und Renata handelte, einem magischen Traum, von dem er nie erfahren hat. Die Betonung des ganzen Gedichts liegt auf dem Ende, und ich an Brjussows Stelle hätte nicht mehr daraus gelesen als die letzten drei Worte. Aber Brjussow war ein schlechter Leser (von Seelen).
Diesmal folgte keine Besprechung, aber »auf den Gipfeln« (seiner steilen Seele) klang der »Widerhall« nach – ein Leben lang.
Ich mache mir keine Illusionen. Brjussow spielte für mein Gefühlsrepertoire, genauer: für meine jugendliche Vorstellung von Feindschaft eine ungleich wichtigere Rolle als ich für seine ermüdete Wahrnehmung. Erstens war er für mich Brjussow (eine feste Größe), der mich nicht leiden konnte, während ich für ihn eine namenlose Person war, die ihn nicht leiden konnte und nur dadurch und deshalb von Bedeutung war, dass sie ihn nicht leiden konnte. Ich konnte Brjussow nicht leiden, er konnte irgendwen von den jungen Dichtern nicht leiden, der zudem eine Frau war, und Frauen verachtete er generell. Das – Verachtung – habe ich nie für ihn empfunden, weder damals, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, noch später, unter dessen Trümmern. Ich erkenne das an der Bewegung, mit der ich diese Zeilen schreibe, einer Bewegung, die unfehlbar nur die Größe in uns auslöst. Keck war ich – das ja, frech – auch das, aber verächtlich – nein. Und wer weiß, vielleicht kamen die Keckheit und Frechheit auch nur daher, dass ich keine andere Form für mein ausgesprochen starkes Rangbewusstsein finden konnte (oder wollte?). Kurzum, auf eine Schulsituation übertragen, war ich nicht zum Klassenlehrer frech gewesen, sondern zum Rektor, zum Schulleiter. In meiner Keckheit lag Ehrfurcht, in seiner Kränkung – Gereiztheit. Wie bedeutsam eine Feindschaft ist, hängt aber unmittelbar von der Bedeutung ihres Objekts ab. Wenn in dieser Romanze des Nichtleidenkönnens also einer profitiert hat, dann war es (da der einzige Profit, den wir aus einem wie auch immer gearteten eigenen Gefühl ziehen können, dessen maximale Intensität ist) – ich.
V»Die Familie der Dichter«
Im selben Winter 1911-1912, zwischen meiner ersten gereimten Attacke und der zweiten, wurde ich zu einer Lesung eingeladen – ich glaube, es war in der »Gesellschaft für Freie Ästhetik«. (Auftreten sollten sämtliche jungen Dichter Moskaus.) Ich erinnere mich an ein grünes Zimmer – nicht das eigentliche, sondern das, wo man auf seinen Auftritt wartete. Die schwarze, kompakte Männergruppe der Dichter, und der sie um Haupteslänge überragende Brjussow – ein echtes Oberhaupt. Ich trete ein und bleibe stehen, warte, dass jemand den ersten Schritt tut. Was auch sofort geschieht – Brjussow tut ihn.
»Darf ich vorstellen, die Dichterin Marina Zwetajewa. Da ›in der Familie der Dichter alle Freunde sind‹, kommen wir (er dreht sich zu mir) wohl ohne Handschlag aus.«
(War das nicht die vorweggenommene sowjetische »Abschaffung des Händedrucks«, nur dass bei den Sowjets die Krätze dahintersteckte, bei Brjussow dagegen – was eigentlich?)
Ich nehme meinen einzigen Bekannten in der Gruppe – Rubanowitsch – ins Visier, gehe auf ihn zu und gebe ihm die Hand, dann seinem Nachbarn: »Zwetajewa«, dann dem Nächsten daneben, dem Übernächsten, und so einmal im Kreis herum, bis ich alle begrüßt habe – alle, außer Brjussow. Die ganze Runde – es waren ungefähr zwanzig Leute – nahm eine gewisse Zeit in Anspruch, zumal ich, von Natur aus schnell, hier Gefühl in die Formalität legte, aus der Konvention eine Zeremonie machte. Im Raum »herrschte Schweigen«. Ich stellte mich vor: »Zwetajewa«. Brjussow wartete. Nachdem ich die zwanzigste Hand geschüttelt hatte, trat ich bescheiden beiseite, unschuldig, fast wie eine Schülerin. Und im selben Moment ertönte, aus voller Kehle, Brjussows abgehacktes Bellen: »Na dann, meine Herren, können wir anfangen?«
Was hatte Brjussow gewollt mit dieser »Familie der Dichter«? Die so sehr Freunde waren, dass sie sich nicht einmal zu begrüßen brauchten? Wollte er mir die zwanzig fremden Hände in meiner einen ersparen? Oder sich selbst – fünf untätige Minuten? Schonte er die vermutlich schüchterne Anfängerin?
Vielleicht war es einer dieser Gründe, vielleicht alle zugleich, am wahrscheinlichsten aber seine unbewusste Abneigung gegen eine intime, menschliche (und darum nicht unverbindliche), händisch geschlossene Bekanntschaft. Das Zurückprallen des Wolfs vor einer anderen Rasse. Ein Gespür für Fremdheit. Ein Instinkt.
Dabei blieb es, wir nickten einander zu. Für einen Händedruck war es von Mal zu Mal mehr zu spät. Und wäre es nach zehn Jahren Begrüßung auf Abstand nicht auch wirklich irgendwie peinlich, irgendwie ungehörig gewesen, sich aus heiterem Himmel plötzlich die Hand zu geben?
So habe ich nie erfahren, wie sich Brjussows Hand anfühlte.
VIEin preisgekröntes Küken
»Il faut à chacun donner son joujou.«
Edmond Rostand
Heiligabend 1911 – ein Moskauer, schneestürmender Heiligabend, mit Sternen am Himmel und in den Augen. Am Morgen hatte ich von Sergej Jakowlewitsch Efron, den ich bald danach heiratete, erfahren, dass Brjussow einen Wettbewerb ausgelobt hatte, für ein Gedicht auf die folgenden zwei Zeilen von Puschkin:
»Doch Edmonde auch im Himmel
Lässt Jenny nicht allein.«
»Wie lustig, wenn Sie den Preis gewinnen würden! Ich kann mir vorstellen, wie gerührt Brjussow wäre! Angenommen, Brjussow ist Salieri, wissen Sie, wer sein Mozart ist?«
»Balmont?«
»Puschkin!«
Ein von Brjussow verliehener Preis, für ein am letzten Tag, in letzter Minute eingereichtes Gedicht (der Einsendeschluss war Heiligabend) – die Idee war verlockend! Aber – ein Gedicht mit vorgegebenem Thema![4] Ein Auftragsgedicht! Geschrieben auf einen Wink von Brjussow! Außerdem – und das war die zweite, hohe Hürde – wusste ich gar nicht, wer Edmonde war, ob Mann oder Frau, Freund oder Freundin. Wenn der Name im Akkusativ stand – wen oder was? –, dann ging es um einen Mann, den Jenny nicht allein ließ, stand er dagegen im Nominativ – wer oder was – dann gehörte er einer sie, die ihre Freundin Jenny nicht allein ließ. Die Hürde war leicht aus dem Weg geräumt. Lachend und an meiner Unwissenheit zweifelnd, schlug jemand Puschkins »Gelage während der Pest« vor mir auf, und damit stand Edmondes Männlichkeit fest. Aber ich hatte Zeit verloren: Auf Moskau senkte sich der in Sterne und Schneeflocken gehüllte Heiligabend herab.
Schon bei Einbruch der Dunkelheit, kurz vor dem Anzünden der Weihnachtskerzen, stand ich an einer Ecke des Arbatplatzes und übergab einem weißhaarigen Boten in roter Mütze einen Umschlag, in dem ein zweiter Umschlag lag, und darin noch ein dritter. Auf dem äußersten stand Brjussows Adresse, auf dem zweiten (der mein Gedicht enthielt) eine Chiffre (der Wettbewerb war anonym, der Name des Autors wurde erst nach Zuerkennung des Preises aufgedeckt), auf dem dritten – dieselbe Chiffre, und darin, auf einem Zettel: Name und Adresse. Ein bisschen wie in dem Märchen von Kaschtschejs Tod, der versteckt ist in einem Ei, und das Ei liegt auf der Insel Bujan, und die Insel liegt im weiten Ozean. Dieses »Billet« schickte ich Brjussow an seine Privatadresse am Zwetnoj-Boulevard, als Weihnachtsgeschenk.
Was für eine Chiffre ich wählte? Natürlich ein Rostand-Zitat:
Il faut à chacun donner son joujou.[5]
Und was für ein Gedicht war es? Natürlich kein Auftragsgedicht über Puschkins Edmond, sondern eines, das ich ein halbes Jahr zuvor geschrieben hatte, für meinen eigenen Edmonde, und es handelte auch nicht vom vorgegebenen Thema, sondern vom Gegenteil – so sehr, dass es wieder passte. Hier ist es:
»Doch Edmonde selbst im Himmel
Lässt Jenny nicht allein.«
Zu schwer liegt das, was war, mir auf den Schultern,
Ich weine noch im Himmel um mein Glück
Und treff ich dich dort, sind die alten Worte
Schnell zurück.[6]
Im Paradies, in himmlisch goldner Ruhe,
Umgeben von Gesängen, Düften, Licht,
Wo alles ruht, dort werd ich unruhig suchen
Deinen Blick.
Im Kreis der strengen Jungfern seh ich spöttisch,
Wie Engelsbild auf Bild vorüberzieht,
Ich singe, eine Fremde, laut und störrisch
Ein Diesseitslied!
Zu schwer liegt das, was war, mir auf den Schultern,
Ich halte meine Tränen nicht zurück,
Es gibt kein Wiedersehn, und unsere alten Worte
Sind stumm in all dem Auferstehungsglück!
Ich hatte das Gedicht meiner »Zauberlampe« (Die Zauberlampe, S. 75) entnommen, die damals schon im Druck war; sie sollte noch vor der Verleihung, aber nach der Zuerkennung der Preise erscheinen.
Etwa einen Monat später – ich war frisch verheiratet – schauten mein Mann und ich bei dem Verleger Koshebatkin vorbei.
»Marina Iwanowna, ich gratuliere!«
Ich, im Gedanken an die Hochzeit:
»Danke.«
»Eigentlich hatten Sie den ersten Preis, aber als Brjussow erfuhr, dass Sie es sind, hat er beschlossen, Ihnen lieber den ersten von zwei zweiten Preisen zu geben, weil Sie noch so jung sind.«
Ich musste lachen.
Die Preisverleihung fand in der »Gesellschaft für Freie Ästhetik« statt. Die Einzelheiten habe ich vergessen. Ich erinnere mich nur noch an das Befremden im Saal, als Brjussow verkündete: »Der erste Preis wurde nicht vergeben; von zwei zweiten Preisen geht der erste an Frau Zwetajewa« – und an mein eigenes spöttisches Lächeln. Dann wurden die Gedichte verlesen, ich glaube, von Brjussow selbst; auf die »preisgekrönten« (Chodassewitsch, Rafalowitsch, ich) folgten die »lobend erwähnten«, die Namen weiß ich nicht mehr. Übergeben wurden die Preise nicht auf der Bühne, sondern an einem Tischchen am Eingang, wo Brjussows reizende, schüchterne Frau Shanna Matwejewna, deren ausgleichende Art sich so vorteilhaft von der Härte ihres Mannes abhob, irgendwelche Einträge machte und Urkunden ausstellte.
Den Preis – eine goldene Plakette mit Namen und schwarzem Pegasus – überreichte Brjussow persönlich – von Hand zu Hand. Wenn auch nicht in einem Händedruck, aber die Hände waren sich begegnet! Ich, während ich die Plakette an meinem Armband festmache, laut und fröhlich:
»Dann bin ich jetzt ein preisgekröntes Küken?«
Gelächter im Saal, und ein plötzliches – gutmütiges – wölfisches Lächeln Brjussows. »Lächeln« der Form nach, es war einfach ein plötzliches Freilegen und ebenso plötzliches Verschwinden der Zähne. Kein Lächeln also? Doch! Aber nicht von unserer Art, ein Wolfslächeln. (Gähnen, Grinsen, Zähnefletschen.)
In diesem Moment begriff ich zum ersten Mal, dass Brjussow ein Wolf war.
Wenn ich mich nicht irre, habe ich an diesem Abend zum ersten (und einzigen) Mal die Dichterin Lwowa gesehen. Eine kleine Person in einem schlichten dunkelblauen Kleid, mit schwarzen Augen, Brauen, Haaren, mit hochroten Wangen, sehr Studentin, sehr junges Mädchen. Aufwärtsgereckt, kam sie Brjussows Abwärtsneigung zu ihr entgegen. Ein perfektes Bild von Mann und Frau: aufblickender Stolz auf ihn – und herablassender Stolz auf sich selbst. Mühsam im Zaum gehaltenes Rundum-Glücklichsein.
Er – machte ihr den Hof.
Zweiter Teil Revolution
ILITO[7]
Mit dem Preisküken endet meine Jugendepisode mit Brjussow. Zwischen 1912 und 1920 lebte ich außerhalb des Literaturbetriebs, und wir begegneten uns nicht.
1919 – das schwärzeste, tödlichste Pestjahr von all diesen Moskauer Jahren. Jemand, ich weiß nicht mehr wer, es war wohl Chodassewitsch, brachte mich auf die Idee, ich könnte einen Gedichtband bei der LITO einreichen. »Die LITO druckt nichts, aber sie kauft alles.« Ich: »Perfekt.« – »Der Leiter der Abteilung ist Brjussow.« Ich: »Schon weniger perfekt. Er kann mich nicht ausstehen.« – »Sie nicht, Ihre Gedichte schon. Er wird sie kaufen, keine Frage. Das sind immerhin fünf Tage Brot.«
Ich machte eine Abschrift meiner »Jugendverse« (1913-1916, sie sind bis heute unveröffentlicht) und des ersten Teils der »Werstpfähle« (er erschien 1922 im Staatsverlag), nahm das Fünfjährigenhändchen meiner Tochter Alja in die Rechte, das Manuskript in die Linke und ging zur LITO, mein Glück versuchen. Ich glaube, in die Nikitskaja-Straße? Brjussow war nicht da, dafür jemand anders, dem ich mein Manuskript übergab. Und im selben Moment war alles vergessen – sowohl die Gedichte als auch ich selbst.
Etwa ein Jahr verging. Ich lebte, die Gedichte warteten. Ich dachte mit gleichbleibendem Widerwillen an sie, wie an etwas, das man verliehen und nicht rechtzeitig zurückgefordert hat und das einem deshalb schon nicht mehr gehört. Trotzdem raffte ich mich eines Tages auf. In der LITO herrschte Leere: nur Budanzew war da. »Ich wollte mich nach zwei Gedichtbänden erkundigen, die ich vor etwa einem Jahr eingereicht habe.« Leichte Verlegenheit, der ich rasch abhelfe: »Ich hätte das Manuskript gern zurück – offensichtlich hat sich ja nichts ergeben?« Budanzew, freudig: »Richtig, richtig, es hat sich nichts ergeben, unter uns gesagt – Walerij Jakowlewitsch ist stark gegen Sie eingenommen.« – »Auch schwach wäre schon viel. Aber die Abschriften existieren noch?« – »Selbstverständlich, ich bringe sie gleich.« – »Perfekt. Das ist mehr, als ein Dichter heute verlangen kann.«
Und ab nach Hause mit dem Manuskript. Dort angekommen, packe ich es aus, blättere, und siehe da – das zweite Brjussow-Autograph meines Lebens! Ganze drei Zeilen Rezension – in seiner Handschrift!
»M. Zwetajewas Gedichte sind, da zu ihrer Zeit unveröffentlicht, ohne aktuellen Bezug und Nutzen.« Nein, das war nicht alles, aber gemerkt habe ich mir wie immer den Höhepunkt – das Ende. Visuell sind mir exakt drei Zeilen in Brjussows gedrängter, sparsamer, sorgenvoller Handschrift in Erinnerung. Was stand wohl in den restlichen anderthalb? Ich weiß es nicht mehr, aber schlimmer war es nicht. Die Rezension liegt, zusammen mit meinen übrigen Papieren, bei meinen Freunden in Moskau. Näher ausgeführt wurde Brjussows römisch-knapper Satz in der russisch-weitschweifigen (maschinenschriftlichen) Reaktion seines Verehrers, Anhängers und Jüngers Sergej Bobrow: »Bis zum Erbrechen ausgewalztes, hochtrabendes Geschwätz vom eigenen Tod …« Das bezog sich auf die »Jugendverse«, über die »Werstpfähle« habe ich nur noch ein Wort in Erinnerung, und auch das nur verschwommen, ich sehe es geschrieben vor mir, kann es aber nicht entziffern, es ist etwas wie »gnoseologisch«, hat aber mit Rhythmus zu tun. »Die Gedichte sind in einem schweren, unverdaulichen, ›gnoseologischen Jambus‹ verfasst« … Brjussow hatte das Thema geliefert, Bobrow die Variationen, und im Ergebnis hielt ich mein Manuskript in der Hand.
Der Staatsverlag, repräsentiert durch den kommunistischen Zensor Meschtscherjakow, verhielt sich 1922 sowohl kulanter als auch großzügiger.
(Da ich das Wort »Zensor« schreibe, wird mir plötzlich klar: wie sehr allein der römische Klang schon Brjussow entsprach! Zensor, Mentor, Diktator, Direktor, Zerberus …)
Bei einer späteren Begegnung bat Budanzew mich rührend inständig, ihm die Rezensionen zurückzugeben:
»Sie hätten sie gar nicht lesen dürfen, das war meine Unachtsamkeit, und die werde ich büßen müssen!«
»Ich bitte Sie, das ist doch mein titre de noblesse, mein Adelspatent im Tjuttschew'schen Sinn, mein Ehren-Entrée, wo immer man die Dichtung schätzt!«
»Dann machen Sie eine Abschrift, aber geben Sie mir die Originale!«
»Wie? Ich soll ein Autograph von Brjussow hergeben? Vom Autor des ›Feuerengels‹? (Pause.) Es einfach hergeben – wenn ich es auch verkaufen kann? Ich werde auswandern und es im Ausland verkaufen, das können Sie Brjussow von mir ausrichten!«
»Und Bobrows Besprechung? Geben Sie mir doch wenigstens Bobrow zurück!«
»Der wird die Dreingabe. Soundso viel für drei Zeilen von Brjussow, und die vier Seiten Bobrow gibt es umsonst dazu. Das können Sie Bobrow von mir ausrichten.«
Ich machte Witze und blieb unerbittlich.
IIEin Abend im Konservatorium
(Aufzeichnungen meiner damals siebenjährigen Tochter Alja)[8]
Nikitskaja 8
Ein Abend im Großen Saal des Konservatoriums
Eine dunkle Nacht. Wir gehen die Nikitskaja entlang zum Großen Saal des Konservatoriums. Marina soll dort lesen, und viele andere Dichter auch. Endlich sind wir da. Wir irren erst lange herum, auf der Suche nach dem Dichterlein Wadim Scherschenewitsch. Dann trifft Mama einen Bekannten, der uns zu einem kleinen Zimmer führt, dort sitzen schon alle, die auftreten sollen. Auch der alte Brjussow saß dort mit steinerner Miene (nach der Lesung habe ich unter seinem Mantel geschlafen). Ich habe Marina gebeten, etwas auf dem Flügel zu spielen, aber sie wollte nicht. Gleich beim Hereinkommen habe ich angefangen, Mamas Verse an Brjussow aufzusagen, aber sie hat mich zurückgehalten. Dann kam ein Mann mit lockigen Haaren und blauem Hemd auf Mama zu. Ein unverschämter Kerl, so sah er aus. Er sagte: »Ich habe gehört, Sie werden bald heiraten.« – »Richten Sie denen, die so gut informiert sind, aus, dass ich schlafe und im Traum Aljas Vater Serjosha treffe.«[9] Der Kerl zog ab. Kurz darauf kam das erste Läuten. Budanzew ging mit Mama aufs Podium. Ich ging mit. Das Podium war eine Art Bühne. Eine Reihe Stühle stand da. Darauf saßen Marina, ich und eine Menge anderer Leute. Als Erster trat Brjussow auf. Er las eine Einführung, aber ich habe nicht zugehört, weil ich nichts verstanden habe. Als Nächster trat der Imaginist Scherschenewitsch auf. Er rezitierte etwas von einem Kopf, auf dem ein botanischer Garten steht, und auf dem botanischen Garten steht eine Zirkuskuppel, und obendrauf sitze ich und blicke in den Leib einer Frau wie in einen Becher. Arme Autos, sie sind wie ein Schwarm Gänse, das heißt ein Dreieck. Frühling, Frühling, freuen sich die Automobile. Lauter solche Sachen. Danach las Brjussow Gedichte. Nach ihm kam eine kleine Frau mit gebogenen Zähnen und sanftem Gesicht, in einer zerrissenen Wattejacke. Es war so, als hätte sie keine Flügel und kein Fell, noch nicht einmal eine Haut. Sie hält ihren mageren Körper in den Händen und schafft es weder, ihn zu zähmen, noch, ihn loszuwerden. Endlich war Mama dran. Sie setzte mich auf ihren Platz und ging ans Pult. Bei ihrem Anblick lachten alle. (Wahrscheinlich weil sie ihre Tasche dabeihatte.[10] ) Sie las ihre Gedichte über Stenka Rasin. Klare Verse und ganz ohne Fremdwörter. Sie stand da wie ein Engel. Die Leute im Saal haben die Dichter angestarrt, wie ein Habicht oder eine Eule einen wehrlosen Vogel anstarrt. Irgendein Imaginist sagte: »Sieh mal. Auf den oberen Rängen sitzen die ›Einsamen‹. Sie fliegen im Schwarm.« Marina sprach nicht sehr laut. Ein Mann ist sogar aufgestanden und näher zum Podium gekommen. Stenka Rasin, drei Gedichte über seine Liebe zu der kleinen Perserin. Dann über seinen Traum, in dem die Perserin ihren Schuh holen kommt, den sie auf dem Schiff verloren hat. Als Marina fertig war, hat sie sich verbeugt,[11] was außer ihr keiner tat. Der Applaus war kurz, aber alle haben geklatscht. Marina setzte sich wieder auf ihren Platz und nahm mich auf den Schoß. Nach ihr las ein schwarzhaariger junger Mann, der gleich neben uns gesessen hat, ein Drama. Der Anfang: ganz oben unter der Zirkuskuppel hängt an einem sehr dünnen Seil eine Tänzerin, und unten in der Arena steht ein buckliger Mann und lobt sie. »Lass uns gehen, Alja! Das wird lange dauern.« – »Nein, Marina, ich will wissen, wie es weitergeht.« Auf Marinas Bitten gab ich aber nach. Wir gingen von der Bühne zurück in das geheime Zimmer. Dort war es leer, nur eine Frau frisch vom Land war da. Ich setzte mich auf einen Stuhl, ich hatte schon ganz glasige Augen, und Mama sagte, ich soll mich hinlegen, solange keiner da ist. Das wollte ich gerne. Ich habe mich hingelegt. Die Frau vom Land sagte, man sollte mich zudecken, und Marina hat einen Mantel über mich gebreitet. Kurz danach kam die ganze Horde Dichter hereingestürmt. In dem Zimmerchen gab es nur vier Stühle. Die Leute haben sich auf die Tische und Fensterbretter gesetzt, und ich habe verschwommen gehört, dass sie sogar auf dem Flügel saßen, aber ich habe meine Beine nur noch weiter ausgestreckt. Ganz an die aufgeplatzte Armlehne gedrückt saßen Mama und die magere Dichterin. »Sie schläft.« – »Nein, sie hat die Augen offen.« – »Alja, schläfst du?« – »Nnnein.« Weiße Punkte, kleine Köpfe, Pferdchen, Bauern, Kinder, Häuser, Schnee … Ein runder Garten mit grauen Beeten. Das Gitter ist schwarz. Eine graue Zirkuskuppel mit Kreuz. Und unter dem botanischen Garten ein roter dreieckiger Becher. Ich träume von den Versen des verrückten Scherschenewitsch. Als ich aufwache, schiebe ich meine Decke aus dem Wolfsfellmantel weg. Mama kann kaum mehr atmen unter meinen Beinen. Überall laufen Dichter herum und sitzen auf dem Boden. Ich setze mich auf dem Sofa auf. Mama war froh, dass ich Platz für die anderen machen konnte. Am Tisch stehen zwei Männer. Der eine im kurzen Sommermantel, der andere im Winterpelz. Plötzlich stürmt der Kurze zur Tür, zu einem schlanken Mann mit langen Ohrenklappen,[12] der gerade hereinkommt. »Serjosha, lieber, guter Serjosha, wo kommst du denn her?« – »Ich habe seit acht Tagen nichts gegessen.« – »Aber wo warst du, Serjosha-Herz?« – »Einen halben Apfel haben sie mir gegeben. Nicht mal den Sonntag feiern sie dort. Und nicht das kleinste bisschen Brot gab es. Ich bin gerade noch davongekommen. Es war so kalt, ich habe mich acht Tage lang nicht ausgezogen. Mann, habe ich einen Hunger!« – »Du Armer, und wie bist du entkommen?« – »Jemand hat ein Wort für mich eingelegt.« – Alle umringten ihn und bestürmten ihn mit Fragen. Dann bekam Mama ihre zehn Sowjetrubel und wir brachen auf. Ich ging auf die Suche nach meinen Fäustlingen und meiner Kapuze. Endlich hatten wir unsere Ausrüstung beisammen und machten uns auf den Weg. Über eine gewundene Hintertreppe kamen wir in den dunklen Hof des Großen Konservatoriums. Dann auf die Straße. Die ganze Nikitskaja entlang stehen Laternen.[13] Irgendwo in einem Fenster brennt ein Petroleumkocher. Ein Hund bellt. Ich falle dauernd hin, und wir unterhalten uns im Gehen über Brjussow. Auf dem Weg hell erleuchtete Schaufenster[14] mit Puppen und Büchern. Ich sage: »Brjussow ist ein Stein. Er ist wie der Großvater von Lord Fauntleroy. Nur jemand wie Fauntleroy kann ihn lieben. Wenn er vor Gericht stünde, würden seine Lügen wie die Wahrheit klingen, und die Wahrheit wie eine Lüge.«
Moskau, Anfang Dezember 1920.
Einige Tage später, bei der Lektüre des »Dschungelbuchs«.
»Marina! Wissen Sie, wer Shir Khan ist? Brjussow! – Shir Khan ist auch lahm und einsam, und er hat auch seine Adalis. (Liest vor:) ›Shir Khan schritt stolz auf und ab, umschmeichelt von seinem Anhang …‹ Genau wie Brjussow! Und Adalis ist eine junge Wölfin, die ihm zugelaufen ist …«
Ich fülle die Lücken. Nachdem sie gemeinsam mit mir das Zimmer betreten und auf der Stelle, anhand meiner Beschreibung, Brjussow identifiziert hatte, dachte Alja an nichts anderes mehr. So galt ihre Bitte an mich, etwas auf dem Flügel zu spielen – ausschließlich ihm, er sollte in Angst gehalten werden: was würde ich spielen? Brjussow sah angestrengt weg, offensichtlich beunruhigt, er spürte, dass etwas im Busch war, und war unsicher, welche Formen das noch annehmen würde (telle mère, telle fille). Unter Umständen konnte er in eine äußerst peinliche Lage geraten: Mit siebenjährigen Kindern (und Alja sah dank der sowjetischen Unterernährung eher wie fünf aus) legt man sich nicht an. (Ich bin überzeugt, dass er auch mit Zweijährigen abrechnete!)
Und noch eine Anmerkung. Dass meine Verse an Brjussow vor Brjussow selbst rezitiert wurden, war nicht geplant, und mir wurde eiskalt dabei. Plötzlich schien das Zimmer eng geworden, kein Zimmer mehr, ein Käfig, in dem nicht nur ein Wolf saß – sondern ich mit ihm! Es war genau dieses Gefühl, mit einem Wolf zusammen eingesperrt zu sein, genau diese Verlegenheit von Tier und Mensch in den ersten Sekunden. Doch es kam auch noch etwas anderes ins Spiel. Hier in dieser stickigen Enge, fast Stirn an Stirn, vor so vielen Zeugen! von einem siebenjährigen Kind, und mit so wundervollen Augen! die Kampfansage der vor kurzem selbst erst siebzehnjährigen Mutter dieses Kindes zu hören, sie mit eigenen Ohren wahrzunehmen! Leibhaftig! Wäre Brjussow nicht so oberflächlich gewesen, hätte er stärkere Gefühle gehabt als immer nur: Brjussow! (an ernsten Gedanken fehlte es ihm nicht) – hätte er von sich selbst absehen können, dann hätte er diese außergewöhnliche Situation wohl zu schätzen gewusst …
Ich vergaß: Ihr Herz ist ein kleines Licht,
Kein Stern! Eine Funzel!
Ihre Verse bestehen aus nichts als Papier …
Sie machte eine Pause nach der zweiten Zeile, und noch eine nach der dritten. Doch auch in dieser Herausforderung lag, neben dem Wunsch, mich zu rächen, noch etwas anderes, was sie von mir geerbt hatte und was ich auf der Stelle wiedererkannte: die Feind-Verliebtheit. Und wenn das Gedicht nicht in einem überraschenden Kuss endete – so nur aus Schüchternheit. (Menschen dieser Sorte sind in der Liebkosung scheu, nicht im Schlag.)
Was dachte er? Ein ungezogenes Mädchen? Nein, wohlerzogen war sie. Von der Mutter angestiftet? Sicher nicht, er sah ja, wie ehrlich erschrocken ich war. Dass sie ihm nicht gefiel – äußerlich – kann auch nicht sein (Wjatscheslaw Iwanow: »Sie schließt einem das Herz auf und spaziert hinein«). Ich glaube, er dachte: »Wenn es nur schon vorbei wäre!«, weiter nichts. Aber da, wie furchtbar – er geht auf die Bühne, und sie (mit mir) – hinterher! Wir sitzen fast nebeneinander. Was kommt als Nächstes? Noch eine »Improvisation«?
Zu seiner Ehre sei gesagt, dass er ihr seinen Wolfspelz, unter dem sie schlief, nicht wegnahm, obwohl er es eilig hatte. Er räusperte sich nur und räusperte sich. Und zu meiner Rechtfertigung sei gesagt, dass ich nicht mit Absicht seinen Mantel genommen hatte. Es war einfach – ein Pelz! Unter Pelzen liegt es sich gut! Jetzt kann Alja sagen: »Ich schlief unterm Fell meines Feindes«.
Zur Hand schließlich, die den Mantel nicht wegzog:
Falls ich einst sterbe und werde gefragt,
»Was war deine gute Tat?«
Sage ich: »An einem Maitag, als Kind
War ich einem Schmetterling freundlich gesinnt.«
(Balmont)
IIIDer Abend der Dichterinnen
Geschneidert wurde dort nicht viel,
Die Kundschaft kam aus andern Gründen …
An einem späten Abend im Sommer 1920 bekam ich überraschenden Besuch von einer Frau … einer Frauenstimme mit riesigem Hut. (Ich hatte kein Licht, und sie kein Gesicht.)
An überraschende Besuche war ich gewöhnt – meine Haustür war nie abgeschlossen –, ich war überhaupt an alles Mögliche gewöhnt und hatte in den sowjetischen Jahren gelernt, niemals den Anfang zu machen, also drehte ich mich halb zu ihr um und wartete ab.
»Sind Sie Marina Zwetajewa?« – »Ja.« – »Sitzen Sie immer so im Dunkeln?« – »Ja.« – »Warum lassen Sie das Licht nicht reparieren?« – »Ich weiß nicht, wie man das macht.« – »Wie man es repariert oder reparieren lässt?« – »Weder noch.« – »Was machen Sie denn nachts?« – »Ich warte.« – »Dass es wieder angeht?« – »Dass die Bolschewiki verschwinden.« – »Sie werden nie verschwinden.« – »Nie.«
Eine kleine, doppelte Lachsalve. Im Sprechen klang ihre Stimme gedehnt, fast singend. Ihr Lachen verriet Geist.
»Ich bin Adalis. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört?« – »Nein.« – »Mich kennt ganz Moskau.« – »Ganz Moskau kenne ich nicht.« – »Die Adalis, mit der … die … Mir sind alle neueren Gedichte von Walerij Jakowlewitsch gewidmet. Sie mögen ihn nicht, richtig?« – »Genauso wie er mich.« – »Er kann Sie nicht ausstehen.« – »Das gefällt mir.« – »Mir auch. Ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie ihm nie gefallen haben.« – »Nie.«
Wieder Gelächter. Die Welle der gegenseitigen Sympathie wird stärker.
»Ich wollte Sie fragen, ob Sie bereit sind, bei einem Abend der Dichterinnen zu lesen.« – »Nein.« – »Das wusste ich, ich habe es W. Ja. gleich gesagt. Und ein Abend mit mir, wären Sie dazu bereit?« – »Nur mit Ihnen, ja.« – »Warum? Sie kennen meine Gedichte doch gar nicht?« – »Sie sind klug und geistreich, Sie können keine schlechten Gedichte schreiben. Und vortragen schon gar nicht.« – (Die Stimme, einschmeichelnd:) »Mit mir und Radlowa?« – »Einer Kommunistin?« – »Ach, der Kommunismus der Frauen …« – »Sie haben recht, mir ist der Monarchismus der Männer auch lieber. (Pause.) Der vom Don. Aber im Ernst, ist sie in der Partei?« – »Nein, gar nicht!« – »Und der Abend hat nichts damit zu tun?« – »Überhaupt nichts.« – »Sie, Radlowa und ich.« – »Sie, Radlowa und ich.« – »Gibt es ein Honorar?« – »Für Sie, ja.« – »Sagen Sie das nicht, mich liebt man, aber man bezahlt mich nicht.« – »Brjussow liebt Sie nicht, und er wird Sie bezahlen.« – »Wie gut, dass Brjussow mich nicht liebt!« – »Wie gesagt, er kann Sie nicht ausstehen. Wissen Sie, was er gesagt hat, als er Ihre Manuskripte in die Hände bekam? ›Als Dichter schätze ich sie sehr, aber als Frau ist sie unausstehlich, bei mir wird sie nie durchkommen!‹« – »Aber die Gedichte hatte doch der Dichter angeboten, nicht die Frau!« – »Ich weiß, das habe ich ihm auch gesagt, und ich war nicht die Einzige – er lässt sich nicht umstimmen. Was ist eigentlich gewesen zwischen Ihnen?«
Ich erzähle lachend, was der Leser schon weiß. Adalis: »Er ist rachsüchtig und nachtragend.« – »In meinen Augen war er nie ein Christ und auch kein Slawe.« – »Und er kann maßlos kleinlich sein.« – »Das ›maßlos‹ macht es für mich wieder gut.«
Die Dichterin Adalis und ich wurden nicht enge Freundinnen, aber doch Freundinnen. Sie kam oft zu mir, meist nachts, immer aufgeregt, immer hungrig, immer unangemeldet, unverändert geistreich.
»W. Ja. ist eifersüchtig auf Sie, ich spreche dauernd von Ihnen.« – »Mit oder ohne Absicht?« – »Mal so, mal so. Wenn er bloß Ihren Namen hört, verfinstert sich sein Gesicht.« – »Wozu noch verfinstern? Es ist ohnehin schon nicht hell.«
Brjussows Äußeres. An erster Stelle: das Steife, Starre an ihm, bis hinauf zu den stoppelig aus dem Schädel springenden Haaren (ein »Igelkopf«). Die Unmöglichkeit irgendeines Schwungs (unmöglich waren Humor, plötzliche Eingebungen, jedes imprévu – alles, was zur Anmut des Herzens gehört). Der Schnurrbart – wie zwei Reißzähne, das charakteristische französische en croc