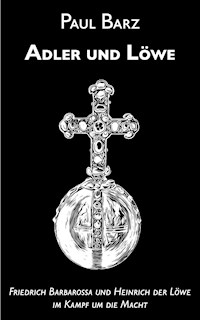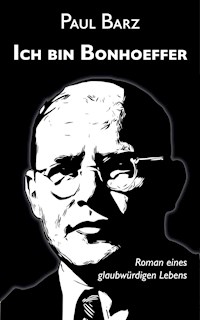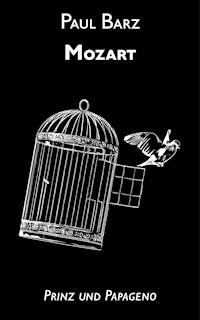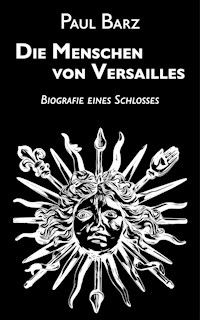Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
HEINRICH SCHÜTZ – Der große Diener JOHANN SEBASTIAN BACH – Das große Rätsel GEORG FRIEDRICH HÄNDEL – Der große Herr Im großen Jahr der Barockmusik 1985 blickte Paul Barz zurück auf 400 Jahre Heinrich Schütz sowie 300 Jahre Georg Friedrich Händel und Johann Bastian Bach. Daraus ist eine mitreißende, farbige Schilderung von drei Komponistenleben in bewegten Zeiten entstanden: Jeder von ihnen hat eine eigene Welt der Musik geschaffen, jeder findet auch heute noch ein begeistertes Publikum – und jeder hat uns heute noch eine aufregende Geschichte zu erzählen. Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 1984 erschienenen Buches von Paul Barz. Lediglich die Rechtschreibung wurde behutsam modernisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Bach, Händel, Schütz
Meister der Barockmusik
Musik her!
Im Frühjahr 1521 rumpelt quer durch Deutschland ein Wagen. Eigentlich ist es ein recht schäbiges Gefährt. Aber die Menschen am Wegrand sehen ihm mit größerer Neugier entgegen als der vielspännigen Prunkkarosse eines Fürsten oder Bischofs. Denn in diesem Karren sitzt Deutschlands populärster Mann: Martin Luther.
Begeisterung überall, wo er sich zeigt: Knapp vier Jahre ist es her, dass Luther in Wittenberg seine berühmten fünfundneunzig Thesen gegen den Ablasshandel verkündet hatte, und es war gewesen, als hätte endlich einer ausgesprochen, was alle schon lange dachten. Niemand mag davon überraschter gewesen sein als Martin Luther selbst. Und in der Folge wird es ihm ähnlich gehen wie dem Seefahrer Christoph Columbus. Der hatte den Seeweg nach Indien finden wollen und Amerika entdeckt. Luther will keine andere Kirche als die jetzige, nur die jetzige anders als bisher. Doch schafft er schließlich eine neue Kirche.
Zunächst ist Luther aber zum Reichstag nach Worms unterwegs, um sich vor Kaiser Karl V. zu rechtfertigen. Jubel begleitet ihn. Er ist nun schon ein Idol, der Held dieser Jahre. Immer wieder lässt er halten, geht in die Kirchen, predigt zu den Menschen. Die allgemeine Begeisterung erfasst schließlich auch ihn selbst. Nichts, meint er, könne ihm noch widerstehen: »Wenn noch so viele Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern, ich wollte doch hinein«, ruft er seinen Gefährten zu — und nur ganz heimlich stellen die Freunde sich die Frage, ob Luther auch wieder aus Worms herauskommt oder nicht kurzerhand verbrannt wird wie zahllose Ketzer vor ihm.
Luther wird nicht verbrannt. Er hält sich tapfer, widerruft nichts. Das Stoßgebet der Landsknechte schließt seine Rede: »Gott helfe mir. Amen.« Kaiser Karl, blutjung noch und mit den Gedanken mehr in seinen spanischen Stammlanden als bei deutschen Problemen, winkt ihn lediglich aus dem Saal. Dies ist eben schon eine andere Zeit als das Jahrhundert zuvor, als die Mächtigen mit widerspenstigen Rebellen wie dem Böhmen Jan Hus oder dem Italiener Savonarola kurzen Prozess machten. Eine neue Zeit hat angefangen. Oder eben auch: die Neuzeit.
Niemals wird man sich ganz einig sein, wann genau diese Neuzeit angefangen hat. Die einen nehmen Luthers Thesenanschlag aus dem Jahr 1517, andere die Entdeckung Amerikas von 1492. Dritte gehen noch weiter zurück, bis ins Jahr 1445, als in Mainz dem Drucker Johann Gensfleisch, auch Gutenberg genannt, die Erfindung beweglicher, gegossener Bleibuchstaben gelang und der Siegeszug der Druckkunst begann. Und Pessimisten meinen schließlich, so richtig hätte die Neuzeit bis heute nicht begonnen. Fest steht aber in jedem Fall: Spätestens vom frühen 16. Jahrhundert an wird Europa nie mehr sein, was es die Jahrhunderte zuvor gewesen war. Der große Zweifel am gültigen Weltbild ist unübersehbar geworden.
Gott über alles, die Kirche seine Vertreterin auf Erden, der Glaube das umfassende Gefühl und der Mensch ein Nichts, das einzig im Jenseits auf Erlösung hoffen darf — so lässt sich dieses Weltbild mit wenigen Strichen umreißen. Es war nicht von heute auf morgen entstanden und wird auch nicht von einem Tag zum anderen abgeschafft. Aber mit den Jahrzehnten zeichnen sich in seinem Fundament feine Risse ab, und schließlich kommt es zum großen Einbruch. Auf einmal werden Strömungen sichtbar, die bisher nur heimlich im Untergrund gewühlt hatten. Der naive Zeitgenosse um 1600 reibt sich die Augen: Das ist ja nicht nur ein neues Jahrhundert. Das ist auch eine völlig neue Zeit. Obgleich die Erkenntnisse dieser Zeit so neu gar nicht mehr sind.
Als beispielsweise Columbus nach Amerika aufbricht, glaubt niemand mehr ernsthaft, die Erde sei eine Scheibe und keine Kugel. Wenigstens die Gebildeten kennen sehr wohl die Überlegungen der alten Griechen, die schon mehr als tausend Jahre zuvor das Sonnensystem zu ergründen begonnen hatten. Aber sie haben ihr Wissen für sich behalten. Bis es eben nicht mehr zu verbergen ist. Ein Columbus tritt vor und zieht nur noch die praktische Konsequenz. Astronomen wie Tycho Brahe und später Kepler oder Galilei führen die Erkenntnisse ihres Kollegen Kopernikus von der Sonne als Mittelpunkt des Planetensystems weiter. Die Kirche reagiert entsetzt, gerade weil sie sehr genau weiß, wie richtig solche Überlegungen sind. Kopernikus hatte man noch übergehen können. Zu seiner Zeit war noch niemand an seinen Gedankengängen interessiert. Aber ein Galilei wird vor die Inquisition zitiert. Doch ist nichts mehr rückgängig zu machen. Die Zeit ist reif.
Auch für einen Mann wie Luther ist sie überreif. Denn eigentlich weiß jeder, allen voran die Kirche selbst, dass eine Reformation überfällig ist, und nicht wenige Katholiken flüstern hinter vorgehaltener Hand, diesen Luther hätte der Himmel geschickt. Denn nachdem sich der Schock erstmal gelegt hat, entschließt sich der Katholizismus zu einer eigenen, seiner »Gegenreformation«, und sie rettet sehr wahrscheinlich die katholische Kirche vor ihrem Untergang.
Suche nach neuen Wegen, Suche nach sich selbst: Das ist das Motto dieses neuen Zeitalters. Es ist ein Zeitalter des Übergangs — und eine Zeit der großen Hoffnungen. Ihre Kinder geben sich so optimistisch wie noch nie: »0 Jahrhundert, o Wissenschaften«, jauchzt der Dichter Ulrich von Hutten und fährt begeistert fort: »Es ist eine Lust zu leben!« Dabei ist für zahllose Menschen dieser Zeit das Leben gar nicht lustig.
In Deutschland werden die im Zug der Reformation ausgebrochenen Bauernkriege mit unvorstellbarer Grausamkeit niedergeknüppelt. In England lässt Heinrich VIII. die Köpfe rollen, schickt seine Tochter Maria, auch »die Blutige« genannt, Anhänger des neuen Glaubens zu Tausenden aufs Schafott. In Spanien wütet die Inquisition. In Frankreich kommt es zur Bartholomäusnacht, bei der binnen weniger Stunden mehr als zwanzigtausend Protestanten hingemetzelt werden. Und in ganz Europa schichten die Hexenjäger ihre Scheiterhaufen. So ist es wohl mehr ein grundsätzlicher Optimismus, der einen Mann wie Hutten beflügelt, seine prinzipielle Hoffnung auf einen Neubeginn, aus dem sich irgendwann einmal eine neue, bessere Welt herausschälen wird. O Jahrhundert, o Wissenschaften …
Wie immer ist Kunst der große Spiegel für alles andere. Auch sie steht über Jahrhunderte hin ganz im Dienst von Kirche und Glauben, kreist einzig um Gott und seine Herrlichkeit. Erst allmählich ändert sich das. Große Dome werden nicht mehr gebaut, dafür umso größere Paläste. Die Architekten erproben neue Formen und Techniken. Die Maler und Bildhauer — sie schauen in die Antike zurück. Sie sehen, wie dort der Mensch gezeigt wurde. Die sogenannte »Renaissance« ist nicht nur die Wiedergeburt antiker Kunst. Ihre Künstler meinen das Heute, wenn sie sich nun mit dem Vorgestern beschäftigen. Die Kunst der alten Griechen dient nur als Modell.
Wie verhält es sich denn wirklich mit dem Menschen? Ist er tatsächlich nur der armselige Wurm und sein Körper nur eine klägliche Hülle? Die Bildwerke der Antike sprechen eine andere Sprache. Ihre vollendeten Linien künden von der Schönheit des Menschen und verherrlichen Macht und Kraft seines Körpers. Und die Künstler der Renaissance heben nun ihrerseits an, diesen Körper zu preisen. Ihre Werke geben dem Menschen sein im Halbdunkel des Mittelalters verloren gegangenes Selbstgefühl zurück: Sieh dir diese Statuen, diese Gemälde an! Dann weißt du, wie schön du bist …
Venus, schaumgeborene Liebesgöttin der Antike, steigt auf einem Gemälde des Malers Botticelli in strahlender Nacktheit aus der Flut. Michelangelo meißelt seinen nackten David. Und auch wo Kunst weiterhin im Dienst des Glaubens steht, gewinnt sie irdische Züge: Raffaels Madonnen sind nicht mehr weltentrückte Himmelsgeschöpfe, sondern bildhübsche junge Frauen, wie man sie in jedem Dorf der Toskana sieht. Und Jesus, der abgezehrte Heiland früherer Zeiten, wird zum blond gelockten Schönheitsideal.
Im Mittelpunkt all dieser Kunst steht aber die Musik. Kein Künstler dieses Jahrhunderts, der nicht wenigstens die Grundregeln der Komposition beherrscht. Kein Gebildeter, der nicht mehrere Instrumente spielt. Vielleicht hat zu keiner anderen Zeit Musik so sehr in der Mitte aller Kultur gestanden wie zu Beginn der Neuzeit. Und auch das ist kein Zufall. Gerade in der Musik tastet sich der Mensch noch zögernd an sich selbst heran. Worte können Gedanken fassen, Bilder Oberfläche zeigen. Aber Musik drückt Empfindungen aus, für die es weder Worte noch Bilder gibt. An solch unbestimmten Empfindungen, die sich dennoch ausdrücken wollen, ist beim Menschen dieser Zeit kein Mangel. Und sein neugewonnenes Selbstgefühl macht ihn mutig genug, nach dem Ausdruck dieser Gefühle zu suchen.
»Musik her …« heißt es in William Shakespeares Märchenspiel vom »Sommernachtstraum«. Feenkönig Oberon ruft es aus, als Worte allein die überwältigende Fülle des überquellenden Gefühls nicht mehr fassen können. Also, Musik her: Es ist ein Motto dieser Zeit.
Wieder geht eine lange Entwicklung voraus. Irgendwann vor der Jahrtausendwende ist ein unbekanntes Genie auf den Gedanken gekommen, Musik brauche nicht nur aus einer Stimme zu bestehen, sie könne sich auch aus verschiedenen Stimmen zusammensetzen. Und diese Stimmen brauchen nicht nur miteinander, sie können auch gegeneinander eingesetzt zu werden. Die sogenannte »Polyphonie«, die Mehrstimmigkeit, ist entdeckt und in der Folge die Kontrapunktik, die Kunst musikalischer Gegensätzlichkeit. Die Musik hat ihre eigene Sprache mit ganz neuen Ausdrucksmöglichkeiten gefunden, und wieder wird es Jahrhunderte dauern, bis der Mensch zu ahnen beginnt, was sich in dieser Sprache alles sagen lässt: Sehnsüchte und Hoffnungen, Ängste und Verzweiflung, Lebensmut und Todesfurcht, stille Demut und stolzes Aufbegehren, Verzicht und Begierde, Liebe und Hass. Dann aber ist der Ruf nicht mehr aufzuhalten: Musik her …
Die neue Sprache hat ihre neuen Formen gefunden. Schon vom 12. Jahrhundert an werden Motetten gesungen, geistliche Texte noch ohne Instrumentalbegleitung. Die Kantate entwickelt sich, die Verknüpfung von Einzel- und Chorstimmen mit Musikinstrumenten. Diese Instrumente werden immer vielfältiger und ausgeklügelter. Schon kommt der Gedanke auf, sie allein, ohne Gesang, spielen zu lassen. Das Konzert kommt auf, die Komposition für mehrere Instrumente. Und Musik kann nun auch festgehalten und weitergegeben werden. Vom 14. Jahrhundert an ist die noch heute gebräuchliche Notenschrift entwickelt worden. Auch hier bringt Gutenberg die Revolution. Melodien werden nun tausend- und schließlich millionenfach vervielfältigt und verbreitet. Musik ist eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen geworden.
Auch sie wird zunächst noch ganz von der Kirche beherrscht. Es gibt die höfische und die Volksmusik. Aber im Mittelpunkt hat weiterhin der Lobgesang auf Gott zu stehen. Jetzt aber schickt der Mensch sich an, auch die Musik als seinen ganz ureigenen Ausdruck zu erobern. Es wird ein stiller, aber umso nachdrücklicherer Eroberungszug.
Mit all den neuen Techniken und Formen ist kirchliche Musik immer raffinierter und ausdrucksvoller, kurz: »weltlicher« geworden, zum Entsetzen frommer Seelen, die Welt und Kirche streng getrennt sehen wollen. Selbst noch im 18. Jahrhundert hat das seinen Nachklang, als Thomas-Kantor Bach bei Amtsantritt ermahnt wird, seine Musik dürfe nicht zu »opernhafftig« klingen, und bei seiner Matthäus-Passion ein altes Weiblein schaudernd ausruft, dies gehöre wohl eher aufs Theater als ins Gotteshaus. Andererseits aber: Warum, könnte sich schon im 16. Jahrhundert mancher gefragt haben, kirchliche Musik, wenn sie doch »weltlich« klingt? Warum nicht weltliche Musik? Warum ihre Ausdrucksformen in den Dienst Gottes stellen und nicht in den des Menschen, der sie schließlich geschaffen hat?
Noch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein rangiert weltliche Musik deutlich an zweiter Stelle. Sie wird vom Komponisten geliefert, aber nicht ernstgenommen. Noch bei einem für seine Zeit so modernen Komponisten wie Heinrich Schütz fällt auf, dass er zwar seine großen kirchlichen Kompositionen sorgsamst drucken und verbreiten lässt, sich aber um Schicksal und Bestand seiner zahllosen weltlichen Kompositionen kaum gekümmert zu haben scheint. Seine Passionen sind erhalten geblieben, nicht aber seine einzige Oper, von seinen ungezählten Ballett- und Schauspielmusiken ganz abgesehen. Aber hundert Jahre nach Schütz ist für seinen Kollegen Händel der Notendruck all seiner Werke schon ganz selbstverständlich und ihr Verkauf ein blendendes Geschäft — zwei Stationen, die den Weg der Musik in die Freiheit weltlicher Kunst innerhalb von nur hundert Jahren kennzeichnen.
Aber auch schon zur Schütz-Zeit ist diese Entwicklung längst nicht mehr aufzuhalten. Immer schon hat sich kirchliche Musik kräftig bei der weltlichen bedient. Noch der Choral »0 Haupt voll Blut und Wunden«, den Bach in seine Matthäus-Passion übernimmt, ist eigentlich ein populäres Tanzlied. Aber nun hält sich die weltliche Musik auch kräftig an kirchliche Formen. Dem geistlichen Konzert steht das weltliche gegenüber. Es gibt kirchliche und weltliche Kantaten. Und aus der Kantate mit ihren verschiedenen Stimmen entwickelt sich schließlich die Oper. Sie ist die nachdrücklichste, ganz und gar weltliche Antwort auf den sakralen Meßgesang, die Hohe Messe des Theaters.
Es klingt wie ein Widerspruch und ist doch logisch, dass auf diesem Weg in den katholisch beherrschten Ländern rascher vorangeschritten wird als in protestantischen Bereichen. Denn der Katholizismus dieser Zeit lehnt Musik als selbstständigen Bestandteil des Gottesdienstes ab. So entwickeln Komponisten im Süden rascher als im Norden ihre weltlichen Alternativen.
Die venezianischen Kirchenkonzerte des Schütz-Lehrmeisters Gabrieli sind schon mehr künstlerische als religiöse Ereignisse, und die Heimat der Oper ist nicht zufällig Italien, ihr erster Meister Monteverdi nicht zufällig Italiener. Im protestantischen Norden sieht es anders aus.
Wir müssen noch einmal in das Jahr 1521 und zu Martin Luther zurückgehen. Nach dem Reichstag zu Worms dürfte ihm klar geworden sein, dass eine umfassende Gesamtreform der bestehenden Kirche nicht durchzusetzen ist. Es wird also eine neue Kirche kommen müssen. Das hat viele Folgen, in der Politik wie in der Kunst.
Politisch bindet sich diese neue Kirche nicht mehr an den Papst in Rom. Sie wählt die Fürsten in den zahllosen deutschen Kleinstaaten zu ihren weltlichen Schutzherren. Diese Fürsten begrüßen den unverhofften Machtzuwachs begierig und machen rasch noch ihren Reibach mit dem beschlagnahmten Kirchengut. Deutschland aber, als »Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation« immer schon ein Wirrwarr unterschiedlichster Staatsformen vom Mini-Fürstentum bis zur Freien Reichsstadt, wird für weitere dreihundert Jahre der wild zerzauste Flickerlteppich sein, auf dem ein natürlich gewachsener Nationalstaat nie gedeihen kann.
Soweit das politische Konzept dieser neuen Kirche. In der Religion stellt sie aber ganz das Wort in den Mittelpunkt. Für jedermann soll es verständlich sein. Er soll glauben, indem er begreift. Aber Luther weiß zugleich, was Menschen eigentlich wollen und brauchen. Er selbst ist schließlich kein weltabgewandter Asket. Er liebt gutes Essen und Trinken. Er schafft den Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester, ab und preist in deftiger Deutlichkeit die Wonnen ehelicher Liebe. Und er, selbst ein Genie des Wortes, weiß auch, wo Worte ihre Grenzen haben und der Mensch nicht nur verstehen, sondern auch fühlen will. Was aber spricht das Gefühl stärker an als Musik?
So ist der hochmusikalische Luther eigentlicher Vater der protestantischen Kirchenmusik. Für den gläubigen Protestanten muss sie den äußeren Glanz katholischer Gottesdienste, den Prunk seiner Gemälde und Skulpturen ersetzen: Choräle statt Weihrauch, aufrauschende Orgelmusik statt Gold- und Seidenglanz der Priestergewänder — und die großen Passionen, die musikalische Schilderung von Christi Leidensweg, sind die Deckengemälde des Protestantismus.
Im beginnenden 17. Jahrhundert ist das für die großen Komponisten von entscheidender Bedeutung. Der Katholizismus duldet sie gerade noch. So gehen sie ihren eigenen, schließlich weltlichen Weg: Im katholischen Frankreich gilt ein Mann wie Lully, der Komponist des Königs, als der große Musiker. Im katholischen Italien bringt Komponisten wie Monteverdi oder Scarlatti nicht kirchliche, sondern weltliche Musik den Weltruhm. Im anglikanischen England, dessen religiöse Ausdrucksformen mehr dem Katholizismus als dem Protestantismus deutscher Art gleichen, ist der Opernkomponist Henry Purcell größter Musiker seines Jahrhunderts. Im protestantischen Raum bleibt aber Kirchenmusik noch die große Herausforderung. Dort treffen wir Männer wie Schütz oder Bach. Vielleicht haben sie ebenso viel weltliche wie geistliche Musik komponiert. In der Erinnerung bleiben sie aber die Kirchenmusiker.
Erst bei Georg Friedrich Händel verkehren sich die Verhältnisse. Auch er schreibt kirchliche Musik. Aber im Mittelpunkt seines Schaffens und auch seines Erfolgs steht sein weltliches Werk. Allerdings: Händel stammt zwar aus dem protestantischen Mitteldeutschland. Doch seine Schule ist Italien, seine große Lehrmeisterin die italienische Oper. Protestantische Musik ist für ihn keine Herausforderung mehr. Der Schritt in den Freiraum der Weltlichkeit ist endgültig vollzogen.
Es ist ein langer Weg von Heinrich Schütz bis zu Georg Friedrich Händel, vom letzten großen Diener der Musik bis zu ihrem ersten großen Herrn, mit dem großen Rätsel Bach dazwischen. Und dieser Weg beginnt an jenem Tag des ausgehenden 16. Jahrhunderts, als vor einem Gasthaus des sächsischen Städtchens Weißenfels eine Kutsche hält und ihr Insasse, ein Graf aus Hessen, die Fassade betrachtet. Hier wird man also die Nacht verbringen, im Weißenfelser Gasthaus »Zum Schützen«. Und damit der Abend nicht zu lang wird, winkt der Graf den Musikanten: Musik her …
HEINRICH SCHÜTZDer große Diener
O, du Orpheus unserer Zeiten,
Den Thalia hat gelehrt,
Dessen Lied und goldne Saiten
Phoebus selbst mit Freuden hört …
Martin Opitz über Heinrich Schütz
Reise in eine andere Welt
In den schmalen Straßen rasselt und rattert es. Pferdehufe schlagen auf das Buckelpflaster. Wagenräder schieben sich durch Kot und Dreck. Behäbig schaukelnde Karossen ziehen lange Staubfahnen hinter sich her. Ein großer Herr hält seinen Einzug ins sächsische Weißenfels.
Mitten in der Stadt, vor einem ausladend stattlichen Gebäude, kommt der Zug zum Stehen. In diesem Gasthof mit der breiten Toreinfahrt und seinem vorspringenden Erker will man übernachten. An der Mauer glänzt ein Schild mit einem Esel und einer Sackpfeife darauf. Das stammt noch aus der Zeit, als dieses Gasthaus »Zum goldenen Esel« hieß und Herberge für vorüberziehende Musikanten war. Aber das ist lange her. Inzwischen hat der Besitzer gewechselt. Und nach diesem neuen Besitzer Christoph Schütz heißt jetzt der Gasthof »Zum Schützen«.
Christoph Schütz, eigentlich Jurist, weiß, was sich gehört. Höflich erwartet er seine Gäste in der Toreinfahrt und tritt ihnen mit tiefer Verbeugung entgegen. Denn immerhin handelt es sich bei diesem Herrn, der gerade aus seinem Wagen steigt, um den Landgrafen von Hessen. Aber Christoph Schütz versinkt auch nicht in Demut. In seinem Haus ist man gottesfürchtig und obrigkeitstreu. Aber man kennt auch seinen eigenen Wert.
Die Familie Schütz kommt eigentlich aus dem Fränkischen. Doch schon um 1470 geht ein Schütz nach Sachsen, in das Land mit Deutschlands reichsten Silbervorkommen. Mit Silber macht denn auch dieser Ulrich Schütz sein Glück. Um 1448 gehört er zu den wohlhabendsten und angesehensten Bürgern seiner neuen Heimat Chemnitz. Er wird in den Rat der Stadt und schließlich zum Bürgermeister gewählt.
Glück gehört zum Haus Schütz. Bürgerliche Tüchtigkeit ist sein Wappenzeichen. Jahrhunderte hindurch sind seine Mitglieder erfolgreiche Kaufleute, wohlhabende Grundbesitzer, Männer in angesehenen öffentlichen Ämtern. Ehen verbinden sie mit vielen Familien des niederen Adels, so dass sie fast schon selbst dazu gehören. Und auch Christoph Schütz, Urenkel des Chemnitzer Bürgermeisters, ist ein ehrenwerter Spross dieses wohlgeformten Stammes.
Von Chemnitz war er zuerst nach Gera und dann nach Köstritz gezogen. Schon in Köstritz hatte er einen Gasthof geführt, den »Goldenen Kranich«. In seiner späteren Heimat Weißenfels lebte aber sein älterer Bruder Albrecht, Besitzer des »Goldenen Esel«. Albrecht stirbt 159o. Sein Bruder ist Erbe und Nachlassverwalter. Er zieht nach Weißenfels und mit ihm seine Jahr um Jahr umfangreicher werdende Familie. Aus einer ersten Ehe hat er bereits zwei Kinder. In zweiter Ehe heiratet er Euphrosyne, die Tochter des Bürgermeisters von Gera. Gemeinsam haben sie neun weitere Kinder, und jedem einzelnen scheint von Geburt an sein künftiger Lebensweg vorbestimmt: ein guter Bürger wie die Vorfahren zu sein.
So begegnen sich in diesem Jahr 1598 zwei Welten: der Bürger Christoph Schütz, redlich, tüchtig, ohne Ehrgeiz, mehr zu werden, als er ist, und Landgraf Moritz von Hessen, ein Mann Mitte zwanzig. Sein Porträt zeigt ein glattes, offenes Gesicht mit klarem, intelligentem Blick. Sorgsam ist der Schnurrbart in die Höhe gezwirbelt, glatt das Haar über der hohen Stirn zurückgekämmt. Hier steht kein finsterer Despot vor uns, sondern ein liebenswerter Mann von Welt, hochgebildet, hochmusikalisch. Stets führt er auf Reisen sein eigenes Orchester mit.
Solche zwei Männer verbindet eigentlich nichts. Ihre Begegnung müsste ohne jede Folge bleiben.
Und doch wird an diesem Tag des Jahres 1595 Geschichte gemacht: Musikgeschichte.
Wir wissen nicht im Einzelnen, wie das vor sich ging. Wir kennen nur die Folgen. Aber stellen wir uns vor: Musikliebhaber Moritz sitzt bei Tisch. Er wünscht musikalische Unterhaltung. Seine Musikanten spielen auf. Kinder singen, vielleicht Choräle oder ein Volkslied. Der Graf in seinem Sessel lächelt liebenswürdig: Alles sehr hübsch, sehr nett, wirklich! Er nimmt noch einen Zug aus seinem Glas und wischt sich die vom Essen fettigen Finger an einem Tüchlein ab. Und dann horcht er auf. Denn dort singt eine Knabenstimme, bei der sein geschultes Ohr gleich erkennt: Dieser Junge singt nicht nur hübsch. Dieser Knabe kann noch mehr. Er besitzt eine natürliche Begabung für Musik schlechthin. Wie schade, dass solch ein Talent in einem Nest wie Weißenfels verkümmern muss!
Frage an den Hausherrn: Wer ist der Junge? Christoph Schütz: Mein Sohn! Ein schmaler Knabe steht vor dem Landgrafen, gerade dreizehn Jahre alt. Er ist der drittälteste Sohn aus des Vaters zweiter Ehe, geboren am 14. Oktober 1585 in Köstritz. Sein Vorname: Heinrich.
Der Landgraf nickt vor sich hin: Heinrich Schütz also — fast schon etwas alt, der Junge. Spätestens in zwei, drei Jahren hat ihn der Stimmbruch eingeholt. Dann ist es um seinen silberhellen Knabensopran geschehen. Doch geht es nicht nur um seine Stimme. Wer so musikalisch ist wie Heinrich Schütz, kann auch Instrumente spielen und am Ende selber komponieren. So häufig sind echte Talente schließlich nicht, dass man an dem hier achtlos vorübergehen sollte. Also wird man etwas für den begabten Jungen tun. Wozu ist man schließlich Landgraf?
Der Graf wendet sich wieder dem Vater zu: Ob der wohl bereit wäre, ihm den Sohn anzuvertrauen. In Kassel gibt es eine Schule, das Mauritianum. Erst vor drei Jahren hat sie der Landgraf selbst gegründet. Acht Freiplätze stehen dort zur Verfügung. Heinrich Schütz könnte einen solchen Freiplatz bekommen.
Der Vater müsste begeistert sein. Er ist es nicht. Er zögert. Er bittet sich, können wir vermuten, Bedenkzeit aus. Der Landgraf lässt sie ihm, nickt ihm ein letztes Mal zu. Sein Wagenzug setzt sich wieder in Bewegung, rollt aus Weißenfels hinaus und mit ihm der höfische Glanz, der sich für einen Tag über Heinrich Schütz’Vaterhaus gelegt hat. Die fremde, so ganz andere Welt, die hier für wenige Stunden eingekehrt war, verschwindet in Staubwolken am Horizont. Für den Landgrafen ist es keine große Sache gewesen. Solche Einladungen spricht er öfter aus. Der Vater muss die Dinge ernster sehen.
Wie schon gesagt: Im Haus Schütz hat man nichts gegen die Obrigkeit. Man ist ihr treu, Sohn Heinrich ist sogar nach dem sächsischen Landesherrn benannt. Aber man hält sie sich doch auch in respektvoller Entfernung. In Weißenfels geben Kaufleute und Handwerker den Ton an. Hier wird in klaren, vernünftigen Ordnungen gedacht. Und nun fällt in diesen überschaubaren, innen wie außen abgesicherten Umkreis ein Strahl flimmernder Verlockung aus einer ganz anderen Welt. Vater Schütz seufzt tief auf und wird sehr nachdenklich.
Es ist nun nicht so, dass ihm nichts an einer guten Ausbildung seines Sohnes liegen würde. Im Gegenteil: Bildung wird in seinen Kreisen sehr hochgehalten, höher als an manchem Fürstenhof, wo sich Adlige genieren, in ihrem Leben je ein Buch zu lesen. Von Heinrich Schütz wird hingegen berichtet, wie viel gute Lehrer ihm und seinen Geschwistern die Eltern gegeben haben und wie umfassend seine Bildung war. Nur bleibt das eben im Weißenfelser Rahmen und überschreitet seine Grenzen nicht. Jetzt aber die Reise in eine andere Stadt, ein anderes Land, dieser Wechsel in eine der gefährlich funkelnden Residenzen ...
Viel Zeit vergeht. Erst dann hat sich der Vater entschieden: Ja, Heinrich soll nach Kassel ziehen. Er selbst wird den Sohn dorthin begleiten. Sie brechen auf. Wir schreiben nun schon das Jahr 1599.
Knapp 200 Kilometer liegen zwischen Weißenfels und Kassel. Für den Knaben Heinrich Schütz ist es jedoch die Reise in eine ganz andere Welt. Die Weißenfelser Enge scheint vergessen. Jetzt nimmt den vierzehnjährigen Jungen hier an der Fulda eine der schönsten deutschen Residenzstädte auf. Denn immer schon hatten die hessischen Landesherren versucht, aus ihrem kleinen Fürstenhof ein leuchtendes Juwel zu machen. Ihre Untertanen belegen sie denn auch in Dankbarkeit mit den schmeichelhaftesten Beinamen.
»Der Großmütige« wurde beispielsweise Philipp, Großvater des jetzigen Landgrafen, genannt. »Der Weise« hieß sein Vater Wilhelm. Er selbst trägt den Beinamen »der Gelehrte«. Zunächst braucht das nicht viel zu sagen. Denn bei der verwirrenden Fülle damaliger Fürsten und ihrer häufigen Namensgleichheit wird oft nach solchen beschreibenden Beinamen gegriffen, ohne dass ihre Aussage auch wirklich zutrifft. So kann ein ausgemachter Dummkopf »der Kluge« heißen, ein Raufbold »der Friedliche« oder ein berüchtigter Geizhals »der Großzügige«. Landgraf Moritz trägt jedoch seinen Beinamen zu Recht.
Dieser Mann ist eine Ausnahme unter den rotgesichtig daherpolternden, ihre Humpen voll Bier und Wein schwenkenden, sich in Jagd und Raufereien austobenden Fürsten seiner Zeit, die oft kaum lesen und schreiben können. Moritz schreibt und liest. Er übersetzt die Schriften aus der Antike. Er verfasst ein Bühnenstück, »Die Belohnung der Gottesfurcht«. Er beherrscht eine Unzahl von Sprachen, und seine Umwelt hört mit offenem Mund, wie er selbst eine persische Gesandtschaft in ihrer Muttersprache begrüßt. Ob sie ihn verstanden haben, weiß man nicht. Aber fest steht jedenfalls, dass die Bildung dieses Grafen fast grenzenlos ist. Und seine ganze Liebe gilt dabei der Musik.
Schon sein Vater hatte den bedeutenden Komponisten Georg Otto von Dresden nach Kassel kommen lassen. Otto wird auch der Lehrer von Moritz, der bald selbst mit beträchtlichem Geschick und einiger Begabung komponiert. Ein Künstler also, der seine Residenzstadt wie ein Kunstwerk behandelt: Er hat den Marstall ausbauen lassen, und der Volksmund hält für den langgestreckten Bau seinen Spottnamen bereit. »Musis et Mulis« müsste er heißen, meint man in Kassel: »Für die Musen und die Maulesel«. Denn hier sind nicht nur die Pferde des Landgrafen untergebracht. Hier richtet der Graf auch seine Bibliothek ein, eine Münzwerkstatt, ein Laboratorium.
Aber auch ein anderes Bauwerk entsteht in dieser Zeit in Kassel, Deutschlands größtes Zeughaus mit zweihundert Geschützen und Waffen für fünfundzwanzigtausend Soldaten. Denn auch Moritz ist nicht nur der feinsinnige Gelehrte. Notfalls herrscht er auch mit harter Hand, und zu seiner Residenz gehören Schloss und Marstall ebenso wie der düstere Zwehrenturm, das Gefängnis für hochgestellte Feinde des Landesherrn, »eng, stinkend und unflätig«, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt.
Hier leuchtende Pracht, dort düster drohende Gewalt, hier Kunst, Musik, Wissenschaft, dort klirrende Ketten, modrige Gewölbe, nackte Macht — solche Widersprüche bestimmen die Welt, in die der junge Schütz eintritt. Er wird Schüler im »Collegium Mauritianum«, kurz das Mauritanum genannt.
Auch das ist eine Schöpfung des Landgrafen. Dort sollten eigentlich nur seine Söhne in der Gesellschaft hochgestellter Gleichaltriger unterrichtet werden. Doch unversehens war aus der kleinen Fürstenschule ein Bildungsinstitut geworden, auf das ganz Kassel stolz ist. Im Mauritianum werden nun nicht nur die Pagen des Hofs, sondern auch die jungen Chorsänger ausgebildet, und Musik ist das eigentliche Hauptfach.
Der Landgraf geht auf Entdeckungsfahrt. Überall spürt er Talente für Chor und Orchester auf, in Dresden ebenso wie in Paris. Er holt sie nach Kassel, sie bekommen ihre Freistelle im Mauritanum. Wobei es manchmal auch zu einem Fehlgriff kommen kann. Einen jungen Franzosen schickt man zum Beispiel bald wieder zurück. Denn man denke, sein Großvater ist ein Schweineschlächter gewesen! Der arme Junge kann zwar nichts dafür, aber irgendwo hat auch die Toleranz des Landgrafen ihre Grenze. Aus gutem Haus muss schon sein, wer in den Genuss seines Collegiums kommen will. Heinrich Schütz droht solche Gefahr nicht. In Ruhe kann er einige Jahre lang die bunte, reiche Welt der Residenzstadt auf sich wirken lassen.
Man weiß hier Feste zu feiern, und dann leuchtet aller Glanz eines jungen, lebensfrohen Jahrhunderts auf, dessen kommende Katastrophen sich noch nicht am Horizont abzeichnen. Es geht zu Reiterspielen auf die Rennbahn hinaus, die der Landgraf neben seinem Schloss anlegen ließ. Oder die Musikanten streifen die Kostüme von Faunen und antiken Helden über und tollen im farbenfunkelnden Mummenschanz durch die Stadt. Viele Gäste kommen nach Kassel, darunter auch die berühmtesten Musiker dieser Zeit. Der Landgraf ist ihnen stets der großzügige Gastgeber.
Schüler Schütz, ein halbes Kind noch, wird von diesen Besuchern nicht viel mitbekommen haben. Vielleicht, dass er sie zuweilen an der gräflichen Tafel sieht, wenn er dort bedienen muss. Denn auch das gehört zum Unterricht der jungen Chorsänger: der Pagendienst bei Hof. Und so mag denn Schütz in ehrfurchtsvoller Nähe sein, wenn etwa neben dem Landgrafen John Lowland Platz nimmt, der berühmte Lautenspieler aus England. Oder die Pagen mögen sich angestoßen haben: Sieh nur, der Herr dort, das ist Alessandro Orologio, der große Musiker, der im Dienst des Kaisers steht. Oder der andere da, das ist der noch berühmtere Michael Praetorius, nimmermüder Herold neuer Kirchenmusik.
Das sind nur Augenblicke und kurze Eindrücke, vielleicht nicht weiter wichtig für den jungen Mann aus Weißenfels. Aber immerhin bringen sie ihn in Berührung mit der großen Welt der Musik, und in solchen Augenblicken mag auch die unbestimmte Sehnsucht entstehen, selbst einmal zu dieser Welt zu gehören. Aber wer kümmert sich schon um die Träume eines Halbwüchsigen, der aus großen Augen die Berühmtheiten seiner Zeit anstarrt? Noch ist Schütz der kleine Unbekannte am landgräflichen Hof.
Ein anderer Magnet dieser Jahre wird das Theater. Komödienspiel gehört zum höfischen Leben, der Landgraf selber führt Regie, und eines Tages mag ihm der Gedanke kommen: Warum immer nur in den Sälen oder Zimmern des Schlosses spielen, im Garten oder auf den Treppen seiner Residenz? Warum nicht dem Theaterspiel einen eigenen festen Raum geben oder besser noch: ein eigenes festes Haus?
Die Idee eines feststehenden Theaters ist geboren. Nur hundert Jahre später wird fast jeder Fürstenhof und auch manche Stadt, deren reiche Bürger es den adligen Herren gleichtun wollen, ein solches Theater haben. Eine Tradition entsteht, die bis heute anhält: die des festen Hof- oder Staatstheaters. In Kassel wird der Anfang gemacht. Das Ottoneum, benannt nach Moritz’ältestem Sohn, entsteht.
Dort drängt sich nun der Hof auf den vier steil ansteigenden Rängen, wenn zur Vorstellung gerufen wird. Der Landgraf sitzt in seiner Loge, umgeben von seiner Familie. Irgendwo hockt aber auch der junge Schütz. Er starrt auf die weit ins Parkett vorspringende Bühne, wo nun die Komödianten mit ihrem Spiel begonnen haben. Sie kommen aus England, und sie spielen Stücke, wie man sie bisher in Deutschland nicht gekannt hat, voll wilder Leidenschaft und maßloser Gefühle, von Menschen, deren Seele bis in ihre letzte Faser aufgerissen wird, so dass der Zuschauer schaudernd erkennen kann, was sie denken und fühlen, wie sie lieben und hassen können. Im Ottoneum wispert es: Was sind das für Stücke, wer ist ihr Dichter? Ein gewisser William Shakespeare soll es sein, Theaterdirektor in London und Lieblingsdichter der englischen Königin. William Shakespeare — der größte Dramatiker aller Zeiten zieht in Deutschland ein. Und der junge Mann dort oben im vierten Rang des Ottoneum empfängt Eindrücke, die ihn ein Leben lang begleiten werden.
Das sind die Sonntage im Leben des jungen Heinrich Schütz. Der Alltag sieht anders aus. Da findet er sich in einer strikt und streng arbeitenden Unterrichtsmaschinerie wieder, die ihn kaum zu Atem kommen lässt.
Denn auf dem Mauritianum geht es nur selten festlich-fröhlich zu. Regeln diktieren das Leben bis in jede Kleinigkeit, und der Landgraf selber wacht darüber. Ein jeder Schüler muss stets sauber gekleidet sein. Jeder trägt als Einheitstracht den gleichen schwarzen Rock. Auch privat darf man sich nur französisch oder lateinisch unterhalten. Über die Gesundheit der Chorsänger wacht der Leibarzt des Landgrafen und verordnet Bier, wenn einmal die Stimme versagt. Vom Landesherrn kommt aber immer wieder die Ermahnung: Übt eure Stimmen, vergesst nicht die Musik! Jeden Tag wird eine Singstunde abgehalten, die Chorsänger bekommen noch Extra-Unterricht, und viermal in der Woche ist Dienst in der Kirche, am Mittwoch, Sonnabend und gleich zweimal am Sonntag.
Es ist eine harte Fron, in die diese noch ganz unausgereiften Halbwüchsigen genommen werden. Aber sie hat auch ihr Gutes. Eine Bildung wie hier kann nur eine solche Schule vermitteln, und nur sie hat solche Lehrer, allesamt Spitzenkräfte ihres Fachs. Für neuere Sprachen hat der Landgraf sogar einen Franzosen engagiert, Monsieur Le Doux, der auch Komödien schreibt. Die Schüler haben gelegentlich die Ehre, sie aufzuführen.
Immer wieder aber die Musik: Der junge Schütz wird in ihre feinsten Einzelheiten, in alle Raffinessen damaliger Kompositionstechnik eingeführt. Material gibt es genug. Jedes Jahr schickt der Landgraf seine Beauftragten nach Italien oder zur Messe nach Frankfurt, um neue Instrumente und Noten zu kaufen. Im Marstall stapeln sich die Schätze. Und der Junge sitzt davor oder hockt im Orchester, das bei großen Anlässen bis zu hundert Musiker beschäftigt. Er nimmt die seltenen Instrumente in die Hand: Das also ist ein Fagott, und das sind Schnabelflöten, so unterscheiden sich deutsche von englischen Gamben, und solche Klangbilder lassen sich aus einer Violina di brazzio locken … Schütz sieht, hört und lernt.
Und sonst? Gibt es noch anderes im Leben des Jungen außer Musik, der Schule und der strengen Disziplin im Mauritianum? Freunde etwa, eine Freundin vielleicht, ein junges Mädchen, das seine erste Liebe ist? Wir wissen es nicht. Nur einige Verse finden sich, die allererste Schütz-Komposition, wo rührend holprig von einer Herzliebsten Abschied genommen wird: »Ach, wie soll ich doch in Freuden leben, weil ich von der muss sein, die mir allein tut Freude geben …« Wer damit gemeint ist, wird man nie erfahren.
Wir wissen nicht einmal, wie lange Schütz in Kassel lebt. Er selbst nennt später den Zeitpunkt seines Stimmbruchs. Doch muss sein Aufenthalt wenigstens einige Jahre gedauert haben. Leichten Herzens geht er jedenfalls nicht von Kassel fort. Denn nun kommt die Entscheidung auf ihn zu, wohin er eigentlich gehört: in die Welt von Musik und Kunst im Glanz fürstlicher Gönner — oder in die bürgerliche Welt seiner Eltern in Weißenfels.
In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts verlässt also Schütz Kassel. Aber seine Lehrzeit ist noch nicht zu Ende, die endgültige Richtung seines Wegs noch lange nicht festgelegt.
»Welch ein Mann, ihr Götter, war das!«
Vor dem jungen Mann liegt ein Ring. Er kennt das Wappen auf seinem Stein. Und er sieht auf den Besucher, der ihm diesen Ring gebracht hat. Auch er ist ihm bekannt. Es ist der Beichtvater des Komponisten Giovanni Gabrieli. Gabrieli selbst hat nicht kommen können. Er liegt im Sterben. Und als letzte Gabe vom Totenbett schickt er seinen Wappenring: ein Gruß für den jungen Henrico Sagittario. Sagittario ist kein anderer als Heinrich Schütz.
Drei Jahre lebt er nun schon in der Lagunenstadt Venedig. 1609 war er dorthin gekommen.
Jetzt nähern sich die schönen Jahre ihrem Ende, und der Gedanke fällt ihm schwer. Denn hier am Lido mag Schütz erkannt haben, wer er ist und was er will. Die Stadt ist ihm eine zweite Heimat geworden, und der Weg zurück über die Alpen kann nichts als Ernüchterung bringen. Und nun liegt auch noch dieser Ring vor ihm wie die Mahnung an ein Erbe, das er eigentlich antreten müsste.
In diesem Jahr 1612 ist Schütz nicht mehr der naive Knabe seiner Kasseler Jahre. Er ist ein Mann von bald schon 27 Jahren, beinahe zu alt, um noch nicht zu wissen, wohin ihn sein Weg führen soll. Aber da sind immer noch die beiden Welten, zwischen denen er sich hin-und hergezogen fühlt. Und bis zu seinem Aufbruch nach Venedig schien die bürgerliche Welt der Eltern in diesem inneren Kampf Siegerin zu sein.
Der Vater hat den Sohn nach Kassel ziehen lassen. Das war gut und nützlich so. Der Sohn konnte davon nur profitieren. Aber danach wird es Zeit, dass er etwas »Richtiges« wird — kein Musikus, kein Künstler. Etwas Richtiges — das ist beispielsweise ein Jurist. Schon Vater Schütz hatte Jura studiert, warum nun nicht auch der Sohn? Dann kann er Stadtschreiber werden oder vielleicht Bürgermeister, und die gute alte Tradition im Hause Schütz würde würdig fortgeführt.
Also Jura: Das Studium beginnt. Über seinen Anfängen liegt Dunkel. Wir wissen nicht, wann Schütz Kassel verlässt. Wir wissen ebenso wenig, wohin er danach gegangen ist, vielleicht an die Universität von Leipzig, vielleicht nach Frankfurt. Das Dunkel lichtet sich erst wieder 1608. Da findet sich im Eintragungsregister der Marburger Landesuniversität unter dem Datum des 18. April die Notiz: »Henricus Schütz, Weißenfelsiensis, Misnicus«.
Er ist nicht der einzige seiner Familie, der um diese Zeit in der Stadt an der Lahn Wohnort nimmt. Auch sein Bruder Georg lässt sich dort im gleichen Jahr immatrikulieren und später noch ein weiterer Henricus, sein Vetter. Praktische Gründe, ein Zufall? Oder auch, mehr insgeheim, der Wunsch der Eltern, den in höfische Fernen entschwundenen Sohn wieder kräftig in die Mitte seiner Familie zu stellen? Jedenfalls scheint sich Schütz in Marburg nicht unwohl zu fühlen. Er legt eine Disputation über die Gesetze vor und ist ein fleißiger Student. Doch die Musik?
In dieser musizierfreudigen Zeit hat auch das kleine Universitätsstädtchen seine musikalische Szene. Doch im Vergleich zu Kassel, selbst zu Weißenfels nimmt sie sich bescheiden aus. Einige Orgeln stehen in den Kirchen, eine auch im Marburger Schloss. Ob Schütz je daran gesessen hat? Seine Welt sind jetzt Akten und Studierbücher, und an dieser Stelle könnte die Geschichte des Musikers Schütz zu Ende sein: Die Kasseler Jahre werden mit der Zeit ferne Erinnerung, Landgraf Moritz und sein Hof entschwundene Gestalten aus fernen Jugendtagen. Schütz disputiert über die Gesetze. Sie sind jetzt sein Notenblatt.
Doch kommt es anders. Zwar hat Schütz Kassel hinter sich gelassen. Aber Kassel holt ihn wieder ein.
Es beginnt damit, dass Schütz zwei prominente Kommilitonen bekommt, Moritz und Wilhelm, die Söhne des Landgrafen. Der Vater hat sie zum Studium an die Lahn geschickt und spendet zugleich sechshundert Gulden für den Ausbau der Universität. Die gelehrten Herren wissen es dem spendablen Grafen zu danken. Seine Söhne — man staune! — werden prompt Ehrenrektoren der Universität. Erfreut greift der Graf gleich ein zweites Mal in die Tasche und spendiert den Professoren neue Talare und Barette aus feinstem Samt. Aber er belässt es nicht bei Geld.
Im Juni 1608 kommt der Landgraf selbst nach Marburg, mitsamt Hofstaat und Familie. Ein halbes Jahr lang wird das Städtchen seine Residenz und erstrahlt im landgräflichen Glanz. Aber auch Moritz strahlt: In Marburg wird ihm eine Tochter geboren. Da soll denn die ganze Stadt mit dem Vater fröhlich sein, und Marburgs Studentenschaft strömt herbei, schwingt die Becher und labt sich an den Köstlichkeiten, die auf schwerem Silber serviert werden. Einige laben sich besonders gründlich. Sie lassen nicht nur die Köstlichkeiten, sondern auch das Silber mitgehen. Es kommt zu Beschuldigungen, Untersuchungen, Ehrenerklärungen. Die Universitätsstadt hat ihren Skandal.
Bei diesem Fest könnte es gewesen sein, dass der Landgraf seinen früheren Günstling wiedersieht: Sieh an, der junge Schütz — das ist also aus ihm geworden, ein angehender Jurist. Aber die Musik, für die der junge Mann doch so begabt war? Fast vergessen, keine Zeit mehr und kaum noch Gelegenheit dafür, nicht hier in Marburg und auch nicht später in Weißenfels, wohin Schütz zurückkehren wird. Der Landgraf wird wieder einmal äußerst nachdenklich: wirklich ein Jammer um dieses Talent …
Wir können uns vorstellen, was in Moritz von Hessen vor sich geht: Da mischen sich Besitzerstolz und Entdeckerfreude mit ganz nüchternen praktischen Überlegungen. Schließlich wird die Position des Hofkomponisten irgendwann einmal neu zu besetzen sein. Georg Otto, der altbewährte Lehrmeister aus Moritz’Jugendtagen, ist schließlich schon fast sechzig Jahre alt.
Ein weiteres Mal spielt der Landgraf Schicksal. Wieder wird um Heinrich Schütz gerungen, heftiger noch als das erste Mal. Denn die Eltern setzen sich jetzt in aller Entschiedenheit zur Wehr: Ihr Sohn soll kein Musikus werden! Doch hält der Landgraf einen Trumpf bereit, gegen den schließlich auch Vater Schütz machtlos ist: Venedig!
Von keiner anderen Stadt Europas geht um diese Zeit ein solcher Goldglanz aus wie von der »Königin der Adria«. Ihr Reichtum scheint unermesslich, ihre Macht fast unbegrenzt. Sie kontrolliert die Märkte, beherrscht das Mittelmeer. Und längst Legende ist die Geschichte, wie auf seinem Sterbebett ein venezianisches Stadtoberhaupt die Lippen im halblauten Gemurmel bewegt. Er spricht nicht Gebete, sondern sagt Zahlenreihen auf: »Wir haben dreitausend Fahrzeuge stehen, unser Arsenal kann in vierzehn Tagen fünfundzwanzig Galeeren ausrüsten, unsere Staatseinkünfte sind höher als die von Frankreich, England, Spanien, Mailand, Florenz und der Kurie, es sind die höchsten Staatseinkünfte der Welt. Wir sind die Herrscher über das ganze Gold der Christenheit …«
Aber die Serenissima, die »Durchlauchtigste«, wie die Venezianer ihre auf Pfählen ins Meer hinausgebaute Stadt nennen, verdient nicht nur Geld. Sie gibt es auch aus. Und sie hat Geschmack dabei. Venedig wird eine Hauptstadt der Künste. Ihre Maler, Bildhauer, Architekten — sie haben Weltruf. Vor allem ist aber venezianische Musik weltberühmt. Sie hat ihren Tempel in der Kirche von San Marco, dem gewaltigen Kuppelbau mitten in der Stadt, wo die angeblichen Gebeine des Evangelisten Markus begraben liegen. Hier in San Marco lebt und lehrt als Erster Organist Giovanni Gabrieli. An Europas Musikhimmel ist Gabrieli der hellste Stern.
In dieser Zeit ohne Massenmedien lässt sich der Weltruhm dieses Mannes kaum vorstellen. Selbst wer in Dänemark, in Spanien oder in irgendeinem Winkel deutscher Provinz lebt, hat den Namen wenigstens gehört. Fürsten, die es mit ihren Musikern gut meinen, schicken sie zu Gabrieli in die Lehre. Und nun soll auch Schütz, wenn er nur will, Gabrieli-Schüler werden. Diese Verlockung ist zu groß. Dafür nimmt Schütz selbst Streit mit den Eltern in Kauf. Seufzend geben sie schließlich nach. Und ihr Sohn zieht ein weiteres Mal in eine andere Welt, hin nach Venedig, nach San Marco, hin zu Gabrieli.
1557 ist Gabrieli als Spross einer alten venezianischen Musikerfamilie geboren worden. Sein Onkel Andrea Gabrieli ist bereits Organist an der Markuskirche. Er nimmt den Neffen in die Schule und erzieht ihn zu seinem Nachfolger. Von 1584 an, nach einigen Jahren in München, wird dann Gabrieli selbst Erster Organist. Das ist nun schon eine allererste Position in der damaligen musikalischen Welt, und die Schüler aus allen Ländern drängen zu Gabrieli, wie sie zuvor zu seinem Onkel gedrängt sind. Er ist ein guter Lehrer. Denn auch das gehört zum Wesen dieser Zeit: dass die großen Künstler nicht eifersüchtig über ihr Werk wachen, sondern ihr Wissen und Können weitergeben. Der Künstler, selbst ein so berühmter wie Gabrieli, ist ein Diener seiner Kunst. Seine eigene Persönlichkeit hat gänzlich hinter seinem Werk zu verschwinden. So ist nicht einmal ein Bild von Gabrieli erhalten geblieben. Allein seine Musik zählt. Sie wird nun die große Lehrmeisterin für Schütz.
Der junge Mann aus Deutschland sitzt im Markusdom. Die Klangmassen Gabrielischer Tonschöpfung durchfluten das feierliche Halbdunkel, ihr warmer Goldglanz breitet sich aus. Der junge Mann horcht in sie hinein und überlässt sich diesen musikalischen Fluten, wie er sie so noch nie gehört hat. Nicht, dass sie ihm im Prinzip gänzlich unbekannt sind. Venedigs Musik macht schließlich in ganz Europa Schule. Aber das hier ist doch noch etwas anderes als in Kassel die Rückgriffe Georg Ottos auf venezianische Klangfarben und Kompositionstechniken. Sie waren Kopie gewesen. Jetzt erlebt Schütz das Original. Und es mag ihm ähnlich gehen wie einst bei den Shakespeare-Aufführungen im Ottoneum: Eine neue Welt tut sich ihm auf. Er schreibt dem Landgrafen: »Sie haben mir den Anstoß gegeben, nach Italien zu gehen und mich in jene Woge zu stürzen, die ganz Italien mit höherem Rauschen als jede andere dahin reißt, dass sie der Himmelsharmonie ähnelt …«
Aber Schütz ist auch schon Fachmann genug, um sich nicht allein schwelgerischem Schwärmen zu überlassen. Er genießt nicht nur. Er lernt auch. Und ein wacher Kopf wie der seine begreift bald, was Reiz und Besonderheit venezianischer Musik ausmacht.
Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach: In San Marco stehen sich zwei Orgeln gegenüber, neben jede kann ein Chor gestellt werden: Stimmen und Instrumentalklang treffen sich also im Raum und zaubern jene Echo-Wirkung, die bald schon als typisch für Venedigs Musik gilt. Dabei war es eigentlich kein Venezianer, sondern der Niederländer Adrian Willaert, der im frühen 16. Jahrhundert diese Technik für ganz neue Effekte einsetzte. Sie hatten Schule gemacht. Willaerts Nachfolger Cyprian van Rore, Guiseppe Zarlino und schließlich die beiden Gabrieli verfeinerten und erweiterten sie. Schließlich werden bis zu vier Chöre eingesetzt und dazu noch ein Chor aus Instrumenten. Eine Musik entsteht, die die gesungenen Texte nicht nur untermalt, sondern in ihren weichen, satten Farben selbst schon ein Gemälde ist.
So hört nun Schütz, wie Gabrieli hohe Stimmen von hochklingenden Instrumenten, dunkle Töne von dunklen Klängen untermalen lässt, wie er mit Steigerungen und Gegensätzen arbeitet. Musik hebt zu »sprechen« an, und Schütz beginnt diese Sprache zu verstehen. Er weiß jetzt, woher Gabrielis Musik ihren feierlichen Schmelz, ihre Klangbilder den inneren Glanz bekommen. Das ist zunächst hohe, kaum begreifliche Kunst. Aber dahinter steht präzise ausgetüfteltes Handwerk. Ein Musiker, ahnt Schütz, muss ebenso Schwärmer wie Techniker sein. Und erfüllt von solchen Erkenntnissen mag er dann in Venedigs Farbenwelt hinausgehen, in die Straßen dieser Stadt, die von Musik wie durchzogen sind. Unendlich fern mag ihm dann die Welt seiner Kindheit und der europäische Norden in all seiner spröden Strenge vorkommen.
Der Landgraf ist großzügig gewesen. Er zahlt Schütz nicht nur die Reise, sondern auch zweihundert Taler im Jahr, viel Geld um diese Zeit. Davon lässt sich bequem leben. Schütz kann sich ganz auf seine Studien konzentrieren. Er braucht sich auch nicht einsam zu fühlen. Schließlich kommen Menschen aus aller Welt in die Lagunenstadt, und zumal aus Deutschland reißt der Strom nie ab. Die Deutschen haben in Venedig ihre eigene kleine Kolonie und im »Fondigo« am Rialto ihren ständigen Treffpunkt. In diesem »Haus der Deutschen«, mit vollem Namen »Fondaco dei Tedeschi«, verkehren Künstler ebenso wie Kaufleute, eben alle, die nach Venedig kommen, und auch Schütz dürfte dort oft anzutreffen sein. Im Mittelpunkt dieser venezianischen Jahre stehen aber allein die Musik und Gabrieli.
Zwar hält er auch zu anderen Musikern freundschaftliche Verbindung, so zum gleichaltrigen Giulio Cesare Martinengo, einem früh Vollendeten und früh Verstorbenen, der um diese Zeit schon Kapellmeister von San Marco ist. Aber nichts geht über den Meister selbst. Schütz verehrt diesen Mann abgöttisch, »der mich zum Teilhaber des Goldes seiner Künste gemacht hat«. Und noch lange nach Gabrielis Tod schwärmt er: »Welch ein Mann, ihr Götter, war das! Hätte ihn das wortreiche Altertum gekannt, den Amphionen würde es ihn vorgezogen haben; oder wünschten die Musen Vermählung, so besäße Melpomene keinen anderen Gemahl als ihn, solch ein Meister des Gesangs war er …«
Schütz verehrt Gabrieli. Aber auch Gabrieli wird allmählich auf ihn aufmerksam: Wie dieser hochgeschossene junge Deutsche mit dem hellwachen Blick aufzugreifen weiß, was man ihm beibringt; wie er es auf seine ganz eigene Weise umzusetzen versteht; wie er nicht in sklavischer Phantasielosigkeit nachahmt, sondern seine eigenen und zum Teil ganz neuen Vorstellungen einbringt. Mit wachsender Neugier sieht Gabrieli auf Schütz. Landgraf Moritz hat recht getan, gerade ihn nach Venedig zu schicken. Denn der Altmeister von San Marco, der Magister nationum, wie er schmeichelnd genannt wird, ein Lehrer der Welt, bestätigt das landgräfliche Urteil. Hier ist eine ganz große Begabung, vielleicht größer als Gabrielis eigenes Talent.
Ein Konflikt könnte sich anbahnen: Alt gegen Jung, Neues gegen Tradition. Doch nichts davon in der Beziehung zwischen Gabrieli und seinem Schüler Schütz. Hier bewährt sich das Gesetz des Meister-Schüler-Prinzips, dass ein Schüler eines Tages dem Meister auch überlegen sein kann. Gabrieli zeigt weder Neid noch Eifersucht. Im Gegenteil: Er fördert den jungen Schütz, lässt sich von ihm an der Orgel vertreten — und seine Gedanken könnten auch schon weitergehen.
Er ist nicht mehr jung. Sein Haus will bestellt sein. Ein Erbe muss gefunden werden, einer, der ihm so folgt, wie er einst seinem Onkel Andrea gefolgt ist. Und warum könnte nicht dieser Erbe Henrico Sagittario heißen, der Deutsche Heinrich Schütz? Er ist zwar Protestant und San Marco ein katholisches Gotteshaus. Doch noch herrscht zwischen den Religionen friedliches Nebeneinander, und in Venedig, wo das Rechnungsbuch die eigentliche Bibel ist und nur zählt, was sich in Zahlen ausdrücken lässt, gibt man sich doppelt tolerant. Zudem dürften auch schon im alternden Gabrieli Gedanken an eine Ablösung der Musik von rein geistlichen Aufgaben spuken. Seine »Symphoniae sacrae«, die »heiligen Symphonien«, hören sich in ihrer kompositorischen Raffinesse schon recht weltlich an. Und Gabrieli ist nicht nur der Schüler seines konservativen Onkels Andrea. Zu seinen Lehrmeistern aus Münchner Tagen gehört auch der Flame Orlando di Lasso, ein in allen musikalischen Sätteln gerechter Abenteurer und Kavalier, der feierliche Motetten ebenso schreiben konnte wie spritzige Chansons und deftige Gassenhauer.
Das alles lehrt einen Mann wie Gabrieli weltläufige Toleranz. Ein deutscher Protestant als künftiger Erster Organist von San Marco — dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig.
Viel spricht dafür, dass Gabrieli Heinrich Schütz tatsächlich solch ein Angebot gemacht hat. Das aber ist nun eine ungeheure Versuchung. Man denke: Aus einem unbekannten jungen Mann wird gleichsam über Nacht ein Musiker von Weltrang. Und doch widersteht Schütz. Die Gründe sind kaum nachzuvollziehen: Fühlt er sich überfordert? Ist es der Gedanke an die Eltern, der ihn zurückhält? Oder fühlt sich der Sachse aus dem Norden im südlichen Venedig eben doch nicht heimisch? Schütz wird sich selbst dazu nie äußern.
Gabrieli dürfte von Schütz’Ablehnung rief enttäuscht sein. Und noch auf seinem Sterbebett mag den alten Mann der Gedanke leiten, den Meisterschüler vielleicht doch noch umzustimmen. Er zieht den Wappenring vom Finger und reicht ihn dem Beichtvater: ein letzter Gruß, ein Abschiedsgeschenk für Heinrich Schütz — und vielleicht die allerletzte Mahnung, Gabrielis Erbe in San Marco anzutreten.
So liegt nun dieser Ring vor Henrico Sagittario, wie sie ihn hier am Lido nennen. Er betrachtet ihn, dreht ihn zwischen den Fingern. Sein Leben lang wird er dem verstorbenen Lehrmeister das ehrende Andenken bewahren. Aber zugleich weiß er auch, dass seine Zeit hier in Venedig zu Ende ist. Sie ist ein schöner, bunter Traum gewesen. Der Traum ist nun vorbei.
Giovanni Gabrieli stirbt 1612. Im gleichen Jahr müsste Schütz eigentlich in seine Heimat zurückkehren. Denn nur drei Jahre Aufenthalt hat ihm der Landgraf bewilligt. Aber Schütz will noch nicht zurück. Er schreibt an die Eltern. Für sie muss es ein Schlag sein: Der Sohn will noch ein weiteres Jahr an der Lagune bleiben — ob sie ihm nicht das nötige Geld schicken könnten? Christoph Schütz begreift jetzt wohl, dass er diesen Sohn in seine eigene Welt nicht mehr zurückholt. Mag er also noch ein weiteres Jahr dort unten bleiben. Schließlich ist der Vater ein wohlhabender Mann. Er kann es sich leisten.
Doch ist es nur ein letzter Aufschub. Das Jahr vergeht. In dieser Zeit verstirbt auch Schütz’anderer großer Freund Martinengo, und so liegen düstere Schatten über seinem Abschied, als der junge Musiker 1613 nach Deutschland zurückkehrt. Aus Henrico Sagittario wird wieder Heinrich Schütz. Und doch ist er ein anderer geworden. Kassel hatte ihn zum Musiker gemacht. In Venedig wird er Komponist. Und in seinem Gepäck befindet sich ein Notenbündel, säuberlich gedruckt und dem Herrn Landgrafen gewidmet: Es ist seine erste größere Komposition, seine italienischen Madrigale.