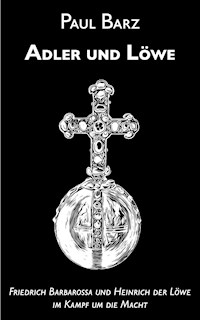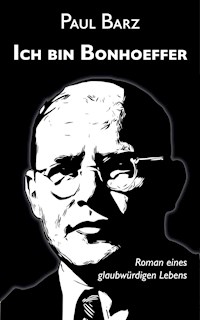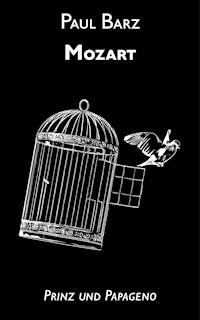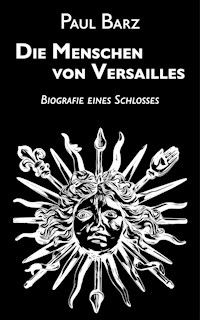Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung eines Lebens – von "Immensee" bis zum "Schimmelreiter" Zwar schuf er die meistgelesene Novelle Deutschlands — dochTheodor Strom war weit mehr als der "Dichter der Friesen". Paul Barz begleitet den Dichter und Juristen von seiner Kindheit in der Enge seiner Heimatstadt über die Studienzeiten und seinen Widerstand gegen die dänische Herrschaft über Schleswig-Holstein, die Storm ins preußische Exil führte, bis hin zu seiner Rückkehr und seinen letzten Lebensjahren, in denen er – von Krankheit gezeichnet – sein bekanntestes Werk schuf. Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 2004 erschienenen Buches von Paul Barz auf Basis des Originalmanuskriptes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Theodor Storm
Wanderer gegen Zeit und Welt
Zurück in die graue Stadt
»Wohin wollen Sie? Nach Husum?Liegt da vielleicht eine größere Stadt in der Nähe?«
Auf die Frage nach einer Bahn-Verbindung nach Husum
Ächzend knarrt der Wagen durch den Schneeschlamm. Immer wieder knicken die Pferde ein, die Fahrt stockt, die Peitsche knallt. Die Pferde stemmen sich in die Riemen. In allen Fugen quietschend geht es weiter voran. Verloren hängt der Klang des Posthorns in der grauen Nebelluft.
Immer noch ein Rumpler, ein Schlagloch. Die Kutsche neigt sich bedenklich zur Seite, scheint schon in den Graben abzurutschen. Die Insassen, wohl so vier bis sechs, die dichtgedrängt in der offenen Karre mit den korbgeflochtenen Seitenwänden hocken, schreien auf, und einer spricht vom Unfall an der gleichen Stelle vor genau drei Jahren: Zwei Tage hatte man warten müssen, bevor es weitergehen konnte.
Nein! Nur das nicht! Nicht noch weitere zwei Tage in dieser elenden Karre auf dieser elenden Straße unterwegs sein!
Sie ist keine Freude, eine solche Fahrt in der Postkutsche durchs Schleswig-Holsteiner Land und schon gar nicht hier oben im gottverlassenen Norden der Schleswiger Westküste mit ihrem eisig pfeifenden Winterwind und dem knietiefen Schlamm auf den Straßen.
Straßen? Kann man das hier »Straßen« nennen?
Im Sommer, hin über die trockenen Marschböden, mag es noch gehen. Da braucht man beispielsweise von Husum bis ins nahe Friedrichstadt gerade mal anderthalb Stunden. Aber nun in Winter und Frühjahr, wenn es regnet oder schneit oder, am schlimmsten, zu tauen anfängt und die Wege nur noch ein einziges Schlammloch sind …
Wieder ein Rumpler. Wieder legt sich der Wagen schief.
»Wenn wir nur endlich da sind«, murmelt einer. Die anderen hören kaum hin. Tote Gesichter, knurrende Mägen, die Glieder wie gelähmt – das ist der Zustand bei diesen Reisen: »Wer acht Tage so gefahren ist, wird fast ein anderer Mensch geworden sein«, wie es in einem »Rathgeber für junge Reisende« heißt. Das war anno 1793.
Ein knappes halbes Jahrhundert später – so ab 1830 – geht man im Schleswig-Holsteiner Doppel-Herzogtum endlich daran, die Straßen zu »chaussieren«, also begradigte Wegstrecken mit leidlich starker Steinschicht zu schaffen, und schon 1832 war die erste dieser Chausseen eingeweiht worden, von Kiel nach Altona. Aber hier oben im Friesischen folgen die meisten Wege immer noch der von der Natur vorgezeichneten Schlangenlinienspur, und hierüber knarren die Wagen hinweg, immer schön Schritt um Schritt. Zu Fuß würde es nicht wesentlich langsamer gehen.
Immerhin kann man sitzen, das Gepäck ist wohlverwahrt, und einer der Reisenden hat seine kurzstielige Pfeife hervorgeholt. Scheele Blicke der anderen, nachdrückliches Hüsteln: Muss der hier noch rauchen, wo es schon miefig genug ist bei der drangvollen Enge?
Der Pfeifenraucher lässt sich nicht stören, spricht in stockend schwerfälligen Worten vom neusten Wunderwerk der Technik, das manche schon zum puren Teufelswerk erklärt haben, diese sogenannte »Eisenbahn«: zwei bis drei Wagen hintereinander, noch einer dran fürs Gepäck, voran die Dampflok – pfeilschnell, jawohl, geht es damit durchs Land.
Die anderen können es kaum glauben. Aber es ist schon richtig, was der mit der Pfeife zwischen zwei behäbig hervorgestoßenen Dampfwolken erzählt.
Gerade sechs Jahre ist es her, da hatte ein weitschauender Mann namens Friedrich List eine erste solche Eisenbahnstrecke geschaffen.
Ob das denn nicht gefährlich sei? wendet einer ein, und ein anderer wird eifrig: Stimme es denn nicht, dass bei diesem ungeheuerlichen Tempo der Luftdruck die Insassen töten würde? Jawohl, so war das schon irgendwo zu lesen gewesen, ganz im Ernst …
Der Mann mit der Pfeife lacht. Ammenmärchen! Niemand stirbt an dieser neuen Erfindung. Und bald auch, mal abwarten, würde sie hier im friedlich stillen Schleswig-Holstein eingeführt werden. Die ersten Pläne liegen schon vor. Dann würde – wiederum von Kiel nach Altona – die sogenannte »Ostseebahn« fahren.
Da blicken denn die anderen ganz zufrieden, sie wiegen bedächtig den Kopf: Ja, die Zukunft lässt sich nun mal nicht aufhalten, auch hier im Norden nicht, und wer weiß? Vielleicht würde sogar schon bald eine Linie bis hinauf nach Husum führen.
Das glaubt allerdings keiner so ganz. Die hier kennen schließlich dieses Land oben an der Küste. Die wissen, in welch schwerem Trott hier jede Veränderung vor sich geht, und einer wird gleich die alte Scherzfrage stellen: Warum sich denn wohl ängstliche Gemüter bei einem Weltuntergang gerade nach Husum zurückziehen werden, na?
Keiner lacht. Alle kennen die Pointe: Weil in Husum alles fünfzig Jahre später geschieht als anderswo.
Damit ist das Gespräch wieder vorüber. Jeder kriecht in sich hinein und starrt ins Grau der Winterlandschaft hinaus, wo sich Raben wie schwarze Totenvögel auf den längst leergepickten Äckern niedergelassen haben.
Weiter ächzt und quietscht das Gefährt diesem »Husum« entgegen, was so viel wie »Häuserstelle« heißt, und sehr viel mehr als eine »Häuserstelle« ist dieses Husum auch nicht. Das gotteinsame Kaff irgendwo in nordfriesischer Weite, wo es tatsächlich noch zehn Jahre dauern wird, bis dort eine Eisenbahn über den Marschboden dampft, von Husum über Tönning nach Flensburg hinüber.
Einstweilen schreibt man den Winter des Jahres 1843.
Möglich, dass man um diese Zeit in einer dieser durch die Landschaft holpernden Postkutschen einen jungen Mann entdeckt, von Kiel aus unterwegs nach Husum. In eine Ecke gedrückt, den Blick wie die anderen hinaus in die graue Weite gerichtet, die Kleidung etwas bunter und salopper als bei den übrigen. Ein Studiosus vermutlich, einer aus der Stadt.
Blasses Gesicht. Fast weiblich weich, erst die Jahre werden ihm Härte und Festigkeit geben. Braun das Haar und braun der kleine Schnurrbart, der über die Mundwinkel hängt und dort das gelegentliche leicht verächtliche Lächeln verdeckt: was die da nur reden, diese guten Leute, in ihrem heimatlich breiten Platt!
Das war auch mal seine eigene Sprache gewesen, damals in der Kinderzeit. Ach, Jugend, wie weit liegst du zurück …
Der junge Mann seufzt auf.
Mitte Zwanzig müsste er sein. Eher schmächtig, keine sehr eindrucksvolle Erscheinung. Mittelgroß, schmalbrüstig, die Schultern eingezogen. Erhebt er sich, fällt eine kleine Schiefe in seiner ganzen Erscheinung auf, jetzt wie in späteren Jahren, als wolle er sich stets höflich zu einem anderen herabneigen.
Das Schönste an ihm sind die Augen.
Sehr blau, sehr klar, mit eher weichem Blick, doch es kann kommen, dass es in ihrer Tiefe stolz und zornig aufblitzt, und mancher ahnt dann, zu welch eisigem Hochmut dieser sonst so freundlich zurückgenommene, dieser leise und feine Mann fähig ist: »Hunde! schrie er, und seine Augen sahen grimmig zur Seite, als wolle er sie peitschen lassen«, wird es vom Hauke Haien im »Schimmelreiter« heißen, seiner einmal berühmtesten Novelle.
Dann die Stimme.
Ein natürlicher Tenor, sehr klar und fest von schöner Biegsamkeit. An einem mittleren Stadttheater könnte man damit durchaus Karriere machen, und vielleicht hat der junge Mann zuweilen diesen Traum geträumt, einen von so vielen in seinem Leben, die sich alle nicht erfüllen werden. Doch bleibt es bei Aufführungen im Freundeskreis, wo der Mann schon mal den Tamino in Mozarts »Zauberflöte« übernimmt oder Pylades in Glucks »Iphigenie« oder den Max im Weberschen »Freischütz«.
Er ist kein Sänger, aber er will Dichter sein, und was hat ein Dichter gemein mit den Leuten hier, ja, mit dieser ganzen Zeit, unter deren brüchigen Strukturen schon die kommenden Veränderungen knacken?
Technik drängt vor. Industrie breitet sich aus. Schon massiert sich in den immer größer werdenden Städten das Proletariat. Es ist eine Zeit relativen Friedens, die letzten ganz großen Völkerkämpfe liegen fast drei Jahrzehnte zurück, doch es knistert und kracht schon wieder von neuer Aggression zwischen den Mächtigen Europas. Ewig unruhiger Kontinent, der nie zu Frieden und Eintracht findet. Laute Zeit, die alle Ohren voll dröhnt mit ihrem Kolbengestampfe und Maschinenlärm. Da kann denn einer wie der hier in seiner bunten Studententracht, der es mit Gedichten hat und feinen, leisen Gefühlen, nur leise seufzen und sich mit kostbarer Trauer in Blick und Haltung abwenden.
Es ist so still; die Heide liegt
Im wahren Mittagssonnenstrahle,
Ein rosenroter Schimmer fliegt
Um ihre alten Gräbermale;
Die Kräuter blühn; der Heideduft
Steigt in die blaue Sommerluft.
Ja, das ist eher schon die Welt, in der sich dieser junge Mann wiederfindet, und er malt sie mit feinstem Pinsel in allen liebenswerten Kleinigkeiten, mit den durchs Gesträuch hastenden Laufkäfern, den in den Zweigen hängenden Bienen und einer Luft voll Lerchenlaut.
In der miefigen Enge eines Postgefährts mag er dann leise lächeln, in sich hinein träumen, in diesen Träumen ein »verfallen niedrig Haus« sehen, den Kätner davor, »behaglich blinzelnd nach den Bienen«, während ein »Junge auf dem Stein davor« sich Pfeifen schnitzt aus Kälberrohr.
Kaum zittert durch die Mittagsruh
Ein Schlag der Dorfuhr, der entfernten;
Dem Alten fällt die Wimper zu,
Er träumt von seinen Honigernten.
– Kein Klang der aufgeregten Zeit
Drang noch in diese Einsamkeiten.
»Abseits« wird dieses Gedicht heißen, um 1847 geschrieben werden. Im Jahr 1843 jedoch, hier in dieser Kutsche, weiß davon noch niemand, und niemand merkt auf, wenn sich dieser junge Mann auf die höfliche Frage eines Mitreisenden ebenso höflich vorneigt und sich mit seinem unverkennbar dänisch eingefärbten S-Lispler in der Tenor-Stimme vorstellt: »Theodor S-torm!«
Hans Theodor Woldsen Storm, um genau zu sein.
Freunde nennen ihn nur Theodor. Auch ihm selbst ist dieser von den drei Vornamen am liebsten. Sechsundzwanzig Jahre alt, seit letztem Herbst wohlbestallter Advokat nach elfsemestrigem Jura-Studium in Kiel, Berlin und wiederum in Kiel. Gerade jetzt von Kiel aus unterwegs ins heimatliche Husum, wo er Notar und Advokat sein wird wie schon der Vater Johann Casimir Storm, Husums angesehenster Anwalt – er hat eine große Kanzlei, ist dazu Sekretär der Ständeversammlung, königlich bestallter Administrator der Fürstlich Reußischen Güter in den Herzogtümern, Koogschreiber, Syndicus für die Südmarsch, noch manches mehr …
Ach, dann würde wohl der Sohn so wie der Herr Vater werden wollen und einmal seine Nachfolge antreten?
Da weicht der Sohn zurück, verweigert die Antwort, drückt sich in seine Ecke, schweigt.
Nicht, dass er ungern von sich selber sprechen würde. Im Gegenteil, es gibt Stunden reger Mitteilsamkeit, da er nichts lieber tut als das, und mancher Brieffreund späterer Zeiten wird beim Empfang von Storm-Episteln vor der kleinen Flut intimer und intimster Bekenntnisse leicht zurückschrecken. Denn ganz so genau, so ausführlich hatte man es nun wieder auch nicht wissen wollen!
Das aber sind dann Freunde in den großen Städten. Hier, in diesem Kreis bäurisch schlichter Provinzgemüter, verstummt der junge Mann.
Kein Blick in seine Seele bitte, das Innerste bleibt verschlossen, die Sehnsüchte und Träume dort gehen keinen etwas ab. Vorerst jedenfalls. Und der blaue Blick schweift ab, verfolgt den Flug einer Saatkrähe, wie sie sich dem Nebelgrau des Horizonts entgegenschwingt.
Einsam wie sie. So ist er immer gewesen. Obwohl es Geschwister, Familie, Freunde genug gegeben hat. Und er war auch kein Stubenhocker, kein Drückeberger. Aber er ist noch etwas anderes. Ein Dichter. Da muss man denn einsam sein in diesem Friesenland.
Vielleicht hatte er zunächst noch bei der Frage des Mitreisenden die Hand in der Rocktasche gehabt, hatte ein Blatt Papier hervorziehen wollen mit einem seiner Gedichte darauf, hätte es gern vorgetragen. Denn darauf versteht er sich mit melodiöser Stimme meisterhaft.
»Hin gen Norden zieht die Möwe« etwa, oder Verse aus der »Morgenwanderung«, und mit bescheidenem Stolz hätte er gern noch hinzugesetzt, dies alles sei schon veröffentlicht, jawohl, an gar nicht so unprominenter Stelle, wie beispielsweise im »Album der Boudoirs«.
Die anderen würden staunen, würden leise den Kopf schütteln, diesen jungen Mann dort etwas näher betrachten.
Der also will ein Dichter sein! Was ist das überhaupt, ein Dichter? Lebt einer davon, dass er Tag um Tag Worte findet, die sich hinten reimen irgendwie? Ist so was schon ein Broterwerb? Ein so ganz ehrlicher dazu, von dem ein Mann Frau und Kind ernähren kann? Denn das ist schließlich Aufgabe eines jeden redlichen Mannes in der Welt.
Nein, diese Leute hier würden gar nicht begreifen, wovon der junge Mann überhaupt redet. Sie würden ihn belächeln, sich wieder abwenden, in friesisch sturer Toleranz, die leben lässt, solange einer Ruhe gibt und nicht die eigenen Kreise stört. Dann mag er gar ein Dichter sein, warum auch nicht?
Also verschwinden die Verse in der Tasche. Die hier interessieren sich hier für den Butterpreis und vielleicht für das, was im Rathaus passiert. Sie interessiert diese neue Wunderwerk, die Eisenbahn, und wann es denn soweit damit in Husum sei. Alles Weitere kann ihnen eigentlich gestohlen bleiben.
»In der Landschaft, wo ich geboren wurde, liegt, freilich nur für den, der die Wünschelrute zu handhaben weiß, die Poesie auf Heiden und Mooren, an der Meeresküste und auf den feierlich schweigenden Weideflächen hinter den Deichen; die Menschen selber dort brauchen die Poesie nicht und graben nicht danach …«
Theodor Storm wird siebzig sein, als er das ausspricht. Aber er weiß es auch schon vierzig Jahre vorher und wird sich nie ganz sicher sein, ob es nun Fluch oder Segen sei, jene Wünschelrute zu besitzen.
Jetzt aber, an diesem Februartag, da es so unaufhaltsam hingeht nach diesem Husum, mag ihm seine Geburtsstadt so vor Augen stehen, wie er sie in Erinnerung aus den Jahren vor seinem Aufbruch in die fröhliche Studentenzeit hat.
Düsteres Husum. Kaum Bildung, wenig Kultur. Nur geistige Hausmannskost. Wie es da schon Gipfel aller literarischen Bildung war, irgendwann von einem Goethe gehört zu haben, und als mal dem jungen Storm die Balladen eines gewissen Ludwig Uhland zwischen die Finger geraten waren, hatte er zunächst noch diesen Zeitgenossen in unbefangener Ahnungslosigkeit für irgendeinen Barden des Mittelalters gehalten.
Dieses Husum also, trostlos grau, schiebt sich wieder auf ihn zu. Mit Teestunden im immer gleichen Kreis, wo über das immer gleiche gesprochen wird, zu braunem Kuchen bei zugezogenen Gardinen mit dem immer gleichen grauen Licht dahinter.
Der junge Mann ächzt auf.
Besorgte Mitreisende könnten sich erkundigen, ob ihm wohl was fehlte, und er schüttelt nur den Kopf. Dann hat er sich wieder gefangen. Nur ein leiser Druck im Magen bleibt. Sein lebenslanger Gefährte bis in den Tod hinein wie manches andere Leiden auch. Rückenschmerzen, Nervenkrämpfe, häufiges Kopfweh, fiebrige Stirn. Schließlich das schlimmste aller Leiden, diese rätselhafte Trauer, die ihn plötzlich überkommt, nicht mehr weichen will, den ganzen Menschen packt und niederdrückt. Die ihn schließlich nur noch blick- und tatenlos hinausstarren lässt in ein Dasein ohne Trost und Wärme. »Depression« nennt man das wohl.
Der junge Storm muss lachen.
Wie nicht depressiv werden in diesem Husum, wo sich in all den langen Jahren nichts geändert haben dürfte und noch immer alles so schwarz und tot ist wie zu seiner Kinderzeit mit dem ewig schwappenden Meer als monotoner Einheitsmelodie im Hintergrund? Wo Poesie nicht gebraucht wird und ein Poet schon gar nicht …
Aber er selber braucht die Poesie. Sie wird ihm helfen müssen, die eine eigene, ganz und gar seine Welt zu erschaffen, in der es sich selbst in der Welt von Husum leben lässt. Nur gut, dazu jene Wünschelrute zu haben!
Friedrichstadt wird passiert, die kleine Holländergründung aus dem 17. Jahrhundert, mit ihren Grachten und Spitzgiebelhäusern und den so holländischen Straßennamen, dass man sich mitten in Nordfriesland unverhofft in ein Klein-Amsterdam versetzt fühlt.
Wenig darunter, wo die Treene in die Eider mündet, fängt aber sozusagen feindliches Ausland an.
Dort stößt ans Nordfriesische Dithmarschen, wofür ein Friese allenfalls ein scheeles Grinsen hat: Alles Barbaren dort unten, stolz auf ihre im Dunst der Zeit vergangene sogenannte freie Bauernrepublik, bei der man lieber nicht fragt, was daran je so frei und Republik gewesen war. Und Poesie blüht dort schon gar nicht.
Doch wird um diese Zeit auch aus Dithmarscher Nebeln ein Dichter hervorgehen, dessen Werke einmal die Bücherschränke deutschen Bildungsbürgertums ebenso füllen werden wie die von Storm. Einer allerdings, der im Jahr, da Kollege Storm seiner alten Heimat entgegenkarrt, schon auf der Flucht vor dieser Heimat ist: Friedrich Hebbel aus Wesselburen, um drei Jahre älter als der Husumer und gerade nach Paris unterwegs, wo er das norddeutsch finsterste seiner Werke schreiben wird, die wie von Dithmarscher Nebeln durchzogene »Maria Magdalene«.
Friedrich Hebbel wird nie mehr ins Dithmarsische zurückkehren, und den Dichter wird es nach diesem einzigen Drama im Kleine-Leute-Milieu in die historischen Höhen hinaufziehen, zu Judith und Holofernes, Herodes und Mariamne, zu den Nibelungen und Gyges samt Ring.
Storm bleibt mehr in den Niederungen, am Immensee und draußen im Heidedorf. Er hat es mit Bürgermädchen und Senatorensöhnen, verliebten Hauslehrern und Eiderstedter Deichgrafen. Das Hebbelsche Titanenringen liegt ihm nicht. Und ein Leben lang, trotz aller Widerstände von außen wie innen, zieht es ihn nach Husum zurück.
Er hängt, man kann fast sagen: Er klebt an dieser Stadt. Wie diese Stadt an ihm.
Husum ist erreicht.
Vielleicht, dass die Eltern den ältesten Sohn von der Poststation abholen oder wenigstens der Vater. Doch kein Kuss, keine Umarmung. Das ist nicht Sitte im Haus Storm. Ein Händedruck muss reichen. Danach geht es hinein in die nur allzu vertraute Welt.
Wieder durch die engen Straßen mit den schwärzlich angerußten Häusern, zum Marktplatz hin und am Rathaus vorbei. Vielleicht auch mal zum klebrig grauen Strand hinunter, gegen dessen Sand in immer gleicher Monotonie die Nordsee schwappt, im immer gleichen Spiel von Ebbe und Flut.
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt …
Acht volle Jahre werden nach seiner Rückkehr vergangen sein, als Theodor Storm diese ersten Zeilen seines bekanntesten Gedichts schreibt. Acht Jahre, in denen er sich ihr so bedachtsam, so zögernd und mühevoll genähert hat, über so holprig-umständliche Pfade hinweg wie einst in der Eilpost von Kiel nach Husum.
Nun erst, acht Jahre später, ist er so weit, ihr Bild in Worte von lakonischer Klarheit zu fassen, zupackend und schnörkellos.
Er schont darin die Heimat nicht, setzt in gnadenloser Genauigkeit eine Hässlichkeit neben die andere, spart nicht aus, was alles diesem Husum fehlt an romantisch blühender Harmonie.
Es rauscht kein Wald. Es schlägt im Mai
Kein Vogel ohne Unterlass …
Hier mag er gestockt, mag an einen anderen gedacht haben, Dichter wie er. Im Lübeck der mittleren dreißiger Jahre hatten sie sich kennengelernt.
Dort war schon dieser andere, obgleich nur zwei Jahre älter, der Abgott der literarischen Salons gewesen. Einer, der keine Mühe zu haben schien, für alles die richtigen Worte zu finden, sie in Reime zu gießen und glatt und gefällig unter die Menschen zu bringen, ob er nun neckisch den bloßen Po der sieben Sandsteinfiguren auf der Lübecker Puppenbrücke besingt oder in düsteren Patriotismus ausbricht: »An deutschem Wesen soll die Welt genesen …«
Dieser Emanuel Geibel! Dieser fingerfertige Dichtersnob aus dem piekfeinen Lübeck!
Der hat es so leicht, macht es sich einfach. Braucht nicht groß auf Inspiration und Gefühle zu achten, zückt nur die einmal gefundene Form immer gleicher Reimeschmiederei, geht damit an einem strahlend grüngoldenen Maientag hinein in die Krempelsdorfer Allee bei Lübeck, und schon strömen ihm die Verse zu, perfekt wie stets und in der Tiefe, meint Storm, ganz seelen- und empfindungslos: »Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat …«
Alles singt mit.
Wer aber stimmt bei einem Storm ein? Woher kann er schon seine Inspiration beziehen? Woraus könnten seine Empfindungen ihre dichterische Kraft gewinnen? Hier in diesem Husum, am grauen Strand, am grauen Meer …
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras …
Recht böse das alles. Ein schwarzes Idyll, aber so ist sie nun mal, die Welt eines Theodor Storm. Und es ist, als würde er sich gegen den harten Nordsee-Wind stemmen, nur mühsam Schritt um Schritt vorankommen, um endlich doch noch im Besitz dieser Heimat sein.
Dann gehört sie ihm ganz. Dann ist sie Teil von ihm und seiner Dichtung. Und er weiß nun, was sie ihm bedeutet, weiß, was er daran so liebt, trotz allem.
Ihn mag dabei frösteln. Er duckt sich nahezu unter allen kleinen Schrecklichkeiten dieser grauen Stadt. Und doch …
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.
Nochmals Friedrich Hebbel, dieser andere Poet aus dem Grau des Nordsee-Heimatlandes. Der wird einmal behaupten, bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr alle entscheidenden Eindrücke empfangen und sich danach nicht mehr im Kern verändert zu haben.
Anders Storm. Der wird sich noch oft ändern, reifer, härter, bewusster werden. In diesem einen Punkt allerdings nicht. Der Jugend Zauber für und für – er wird für immer wie ein sanfter Schimmer über seinem Werk liegen, und die Geister jener Zeit, die guten wie die bösen, verlassen ihn sein Lebtag nicht.
Geister aus jenen Jahren, da er noch kein Advokat war und auch noch kein Dichter, sondern nur der Junge aus Husum, eingesponnen in seine Welt kindlicher Phantasien voller Schatten und Gespenster. Und er wird noch keine dreißig sein, da er schon mit kleinem Seufzer im Unterton und in unverhohlener Nostalgie schreibt:
»Mir war’s, als stände ich im Abendschein auf einem Berg und sähe von oben hinab tief in den Garten meiner Jugend …«
Husum – Tal der Jugend
»Ich wüsste nicht,dass bis zu meinemachtzehnten Lebensjahrirgendein Mensch …Einfluss auf mich geübt,dagegen habe ichdurch Örtlichkeitenstarke Eindrücke empfangen.«
Theodor Storm
Königreich in der Tonne
Das ist schon ein prachtvoller Fund, der dem Knaben Storm irgendwann in seinen ersten Jahren gelingt. Diese Tonne dort in einer Ecke der Husumer Hohlen Gasse Nummer drei. Fast so groß wie ein eigenes Zimmer. Fast schon das kleine Haus. So steht sie auf der steingepflasterten Diele im »Packhaus« gleich neben dem eigentlichen Elternhaus, und der Sekretär seines Vaters im nebenanliegenden Schreibzimmer weiß bald schon in der ganzen Stadt von seltsamen Dingen zu erzählen.
Wie es da aus dieser Tonne wispert und flüstert! Und schwacher Lichtschein dringe an dunklen Herbst- und Winterabenden aus den Fugen, kurz: Hier spukt es, ganz klar. Geister gehen um.
Keine Geister, nein. Nur kleine Jungs und Mädchen, die sich dort an trüben Regentagen verkrochen haben. Da hocken sie nun, haben den Deckel über die Tonne gezogen und die kleine mitgebrachte Handlaterne entzündet: Los mal! Vertell mal was! – Was denn? – Ach, irgendwas …
Nur spannend muss es sein und richtig schön gruselig, damit man noch enger zusammenkriechen, sich so richtig heimelig-geborgen fühlen kann. Die Kinder kuscheln sich wohlig aneinander.
Einer versteht sich auf »Vertell«-Stücke besser noch als alle anderen. »Hans Räuber« heißt er allgemein, sein richtiger Name interessiert keinen, und Waise ist er, Sohn irgendeines armen Flickschusters und eigentlich kein Umgang für den Patrizierspross Storm, doch um so was schert sich keiner hier. Hans ist willkommen als einer »der wackersten Spielkameraden« und seine Geschichten noch mehr.
Das ganze Nordfriesland mit seinen Sagen und Märchen spukt darin. Nies Puk natürlich, der Hausgeist der Friesen, der Ruhe gibt, solange man ihn nur mit kräftiger Grütze und guter Butter darin mästet. Von hoher See her, mit rotem Haar und grünen Zähnen, zieht der Klabautermann heran, drüben im Eiderstedter Westerhever schleifen die auf ewig untoten »Wogemannen« ihre Schwerter, um neuerlich auf Raubzug zu gehen, und über die Deiche marschiert der »Dränger« heran, jener Unsichtbare, der sich dem Wanderer entgegenstemmt und ihn abdrängt den Deich hinunter ins aufgewühlte Wasser.
Die »Erntekinder« sind dabei. Die »Sargfische«. Luftgeister schweben heran. Vielleicht ist auch schon das Wasserweib darunter, das arme Geschöpf ohne Seele im beschwänzten Fischschuppenleib, das im Netz der anderen zappelt und wimmert. Und die Toten des Meeres, vor denen Hauke Haien erschauert, »gnidderschwarz«, ohne Kopf, mit einem Strunk Baumwolle im Hals – auch sie gehören dazu.
Herrliche Geschichten! Immer noch mal kann man sie hören. Und irgendwann nach Hans Räuber – die Handlaterne flackert im Luftzug – ist der junge Storm mit dem Erzählen an der Reihe.
Auch er lässt sich nicht lumpen. Er weiß von der dreibeinigen Totenlade zu berichten, die gelegentlich die Treppe im Elternhaus herunterpoltert und von baldigem Tod und Verderben kündet. Auch will er schon mal in der verlassenen Zuckerfabrik des Urgroßvaters gleich hinter dem Elternhaus den dortigen Hausgeist trübe aus einer Dachöffnung starren gesehen haben, die Zipfelmütze auf dem Kopf. Und ganz gewiss hat er oben im Schloss vor Husum vor jenem Bild im Rittersaal gestanden, das bei schärferem Hinsehen, warum auch immer, schamhaft errötet.
Das ist das andere, das heimliche Husum, ganz aus der Phantasie derer geboren, die dort in dieser Tonne hocken oder in anderen verborgenen Winkeln der Stadt, und in diesem geheimen, nur von ihm geschauten Husum findet Storms eigentliche Kindheit statt. Hier empfängt er Eindrücke fürs Leben und wird sie in seiner Dichtung immer wieder anklingen lassen. Schreckliches. Schönes.
Das mit dem »Unnererschen«, einer Art hilfsbereiter nordfriesischer Heinzelmännchen, erzählt sich zum Beispiel recht nett. Netter jedenfalls als Scheußlichkeiten wie diese Sache damals mit dem Husumer Witwenmörder, der um die Jahrhundertwende fünf ehrbare Matronen gemeuchelt hatte und dafür hingerichtet worden war draußen auf dem Galgenberg. Und dann gibt es noch dieses eine Haus, dessen Original sich nicht mehr ausmachen lässt und am Ende nur in Storms Phantasie seinen Standort hatte.
Die Geschichte darum scheint aber seine Lieblingsmär gewesen zu sein, und sie hat ihn sein Leben lang begleitet mitsamt allem Märchengespinst rund um »Bulemanns Haus«.
Es klippert auf den Gassen im Mondenschein;
Das ist die zierliche Kleine,
Die geht auf ihren Pantöffelein
Behend und mutterseelenallein
Durch die Gassen im Mondenscheine.
Sie geht in ein verfallenes Haus;
Im Flur ist die Tafel gedecket,
Da tanzt vor dem Monde die Maus mit der Maus,
Da setzt sich das Kind mit den Mäusen zu Schmaus,
Die Tellerlein werden gelecket.
So geht es immer weiter, neun Strophen lang. Die Kleine wird sich selber im Spiegel sehen, wird mit sich selber zu tanzen versuchen, und sie tanzt die ganze Nacht im Mondenschein, sinkt schließlich todmüde beim ersten Sonnengefunkel ins Gras.
Nun liegt sie zwischen den Blumen dicht
Auf grünem, blitzendem Rasen;
Und es schauen ihr in das süße Gesicht
Die Nachtigall und das Sonnenlicht
Und die kleinen neugierigen Hasen.
Storm berauscht sich nahezu an diesen Versen. Er singt sie mehr mit seiner hohen Tenorstimme, als dass er sie spricht, und seine Zuhörer, reichlich in der Runde, schmunzeln ein wenig, stoßen sich an: Er ist eben doch etwas wunderlich, dieser komische Kerl dort oben aus Husum! Aber Phantasie hat er ja, und sie in Verse kleiden wie kein anderer kann er auch.
Die da aber leise lächeln, sind nicht mehr Hans Räuber und Konsorten. Es sind nun Herren wie Adolph Menzel, Theodor Fontane, Franz Kugler, und man befindet sich bereits im Berlin der fünfziger Jahre.
Aber der Storm dort, obgleich ein Mann um die vierzig und als Dichter längst anerkannt, wird immer noch etwas vom kleinen Theodor aus der Tonne haben, der dem Freund Hans und den anderen die Geschichte vom Bulemannschen Schreckenshaus erzählt, und 1864 wird er die Geschichte, nun in Prosa, noch einmal erzählen.
Wie also dieses Haus zu Bulemanns Haus wurde. Wie es vereinsamte und verödete. Wie die halbnärrische Haushälterin des übergeizigen Herrn Bulemann in rasender Angst vor dem Hungertod die Brötchen stapelt über Jahre hin und dort schließlich zwei Katzen, riesig wie Tiger, die Herrschaft antreten. Nachts hört man sie die Treppen hinauf und hinunter springen, und draußen plärren die Kinder ihren Reim: »In Bulemanns Haus, in Bulemanns Haus …«
Diese Novelle, so gruselig, so sehr am Geschmack eines auf liebenswürdige Lektüre eingestimmten Lesepublikums vorbei, dass sie sieben Verlage schaudernd zurücksenden werden, wird bis heute eines der wenigen Beispiele großer deutscher Horror-Literatur sein, als vielleicht einziges Werk den »Gothic Novels« der Engländer vergleichbar und in der Nachbarschaft anderer Großmeister des Genres angesiedelt, von denen Storm sehr wohl gelernt haben dürfte.
Er kennt schließlich E. T. A. Hoffmann. Er hat Edgar Allan Poe gelesen, dessen Gesammelten Werke in seinem Bücherschrank stehen. Er wird aus beider Arbeiten gern zitieren und die eine und andere Gestalt an die von Hoffmann anlehnen, die eine und andere Situation recht kräftig dem großen Grusel-Amerikaner nachempfinden.
Aber was wären diese Einflüsse allesamt gegen die Erzählstunden damals in der Tonne?
Storm ist im Zuhören ein Nimmersatt, und genügen ihm Hans Räubers Vertellstücke nicht, hastet er hinüber zur Langenharmstraße 9.
Gar kein so gemütlicher Weg, auch wenn er nur um die nächste Straßenecke führt. Denn es ist schon Abend, herbstlich kühl, es dunkelt heftig. Dem immer eiliger dahinhastenden Jungen klopft das Herz bis zum Halse, und eigentlich hat er Angst, würde lieber wohlgeborgen am heimischen Ofen sitzen, wäre nicht der Hunger auf immer neue Geschichten da.
Die aber bekommt er hier wie nirgendwo anders erzählt. Nicht einmal daheim in der Tonne.
Die Tür mit den grünen Scheiben ist endlich erreicht. Das Schild daran verkündet, dass hier gutes, schwarzes Brot gebacken wird. Storm tritt ein. Hund »Perle« kläfft (»Perle« wird nicht zufällig im »Schimmelreiter« der vor dem Opfertod im Deich gerettete Hund heißen), und noch ganz außer Atem stößt der Junge hervor: »Ist Lena da?«
Lena Wies nämlich, deren eigentlicher Name Sophia Magdalena Jürgens lautet, die Tochter des Bäckermeisters Johann Wies, damals eine noch junge Frau in den zwanzig, ledig bis an ihr Ende.
Nein, Lena ist nicht da. Sie ist im Stall, melkt die Kuh. Storm geht nach hinten, atmet tief den Geruch aus Milch und frischgebackenem schwarzen Brot. Und dann hört er auch schon aus der Tiefe der Stallung die vertraute Stimme: »Stripp, strapp, stroll – is de Amer nich bald voll?«
Lena Wies soll einmal sehr schön gewesen. Dann haben die Blattern ihr Gesicht zerstört. Ihr blieb jedoch ein scharfer Geist, gepaart mit viel gesundem Menschenverstand und einem robusten Selbstbewusstsein voll zupackender Herzlichkeit. Und ihr blieb ein nie erschöpfter Vorrat aus Sagen, Märchen, Volkslegenden oder auch nur irgendwelcher Nachrichten aus der Zeitung.
Dies alles wusste sie aber vorzutragen wie keine andere, »plattdeutsch, in gedämpften Ton, mit einer andachtsvollen Feierlichkeit«, wie Storm später in seiner »Lena Wies«-Skizze festhält, eine nordfriesische Scheherezade, die ihren Sultan wohl noch länger als nur 1001 Nacht hätte unterhalten können.
In diesem »Lena Wies«-Porträt spricht Storm aus, wie viel er denn von ihr gelernt hat, »nicht nur die Kunst des Erzählens, auch die Achtung vor ernster, bürgerlicher Sitte«, und war ihm mal ein ordinäres Wort entfahren wie auf der Gasse üblich, war darüber die Bäckerstochter mit so viel damenhafter Souveränität hinweggegangen, dass sich noch der reife Mann beschämt fühlt.
Aber meistens spricht der Junge nicht. Er hört nur zu, unermüdlich, und der Abend wird immer später.
Draußen ist es schon ganz finster. Kein Mond scheint, keine Laterne verbreitet noch so spärliches Licht. Dem Jungen gruselt es nun wirklich, und Lena Wies erbarmt sich, greift zu Handlaterne und Umhängetuch, führt den Jungen wenigstens bis zur nächsten Ecke durchs düstere Husum, dessen Horrorgestalten an jeder Biegung und in jedem Torbogen zu lauern scheinen.
Splittern da nicht Fensterscheiben? Schlägt dort nicht wieder im Vollrausch jener Mann die Fenster ein, der es so gern klirren hört, wie bei Silbertalern im Beutel? Und kommt nicht plötzlich der andere, noch Schrecklichere heran, der Hundefänger mit dem blutigen Knüppel in der Faust und seinem Bündel gemeuchelter Hunde über der Schulter?
Storm junior bebt vor Angst und genießt sie kräftig.
Aber sein Husum kann auch anders sein. Bunt und duftig. Ein blühender Garten im hellen Sonnenlicht, und das Kind hat einen Schlüssel dafür, es tritt ein in die kleine Wunderwelt an der Husumer Au gleich unten am Hafen.
Apfelspaliere, Bienengesumm, das sanfte Gelb der Zitronenbäume, tiefes Grün der Zypressen, Muskathyazinthen, und an der Seite ein verrammelter kleiner Teepavillon aus Rokoko-Tagen, als sei man plötzlich nicht mehr in Husum, sondern irgendwo fern zu Versailles im Trianon der Pompadour.
Dorthin setzt sich nun der Junge auf die Stufen, späht kurz durch die Ritzen aufs gestapelte Rokoko-Mobiliar, stützt dann den Kopf auf, atmet Geißblattduft, hört das Hafenwasser hinter der Mauer plätschern, sieht Schmetterlingen nach und träumt, nein, nun nicht von irgendwelchen Gruseleien und Schauerstücken.
Er mag jetzt an Sonne denken und Wärme und immer blauen Himmel, und alles atmet Frieden hier. Alles verströmt die von ihm ein Leben lang so ersehnte »Behaglichkeit« des Daseins, die ihm selten genug zuteilwird und ganz und gar vielleicht nur hier als Kind in Urgroßmutters Garten. Denn ihr gehört dieses kleine Wunderreich, in das der Urenkel hineinschlüpft wie in ein kleines Paradies vor dem Sündenfall. Der verwitweten Frau Senator Elsabe Feddersen. Eine der großen Damen der Stadt in ihrem Haus aus dem Jahrhundert zuvor an der Ecke Twiete/Schiffbrücke, keine hundert Meter von ihrem Garten entfernt, kurz das »Urgroßvaterhaus«. Storm-Leser werden diesen Patriziersitz mit seinem Spitzgiebel und der dekorativ ausladenden Front in Novellen wie »Von heut und ehedem«, in »Carsten Curator« und vor allem »Immensee« so gründlich kennenlernen, als hätten sie dort selber mal gelebt.
Sie kennen das Guckfenster zur Diele hin mit dem grünen Vorhang dahinter, die weite Hausdiele, den Pesel mit seinen Eichenschränken voll erlesener Porzellanvasen und den kleinen Flur, »von wo aus eine enge Treppe zu den oberen Zimmern des Hinterhauses führte«.
Ihre Stufen steigt in »Immensee« bedächtig der alte, wohlgekleidete Herr auf der Suche nach seiner Jugend hinauf. Den kleinen Storm können wir uns eher vorstellen, wie er keineswegs bedächtig, zwei Stufen zugleich nehmend die gleiche Treppe zur Urgroßmutter hinaufhastet, den Schlüssel zum Garten wieder abzugeben.
Dort sitzt dann die alte Dame in schwarzseidener Pracht, ganz lächelnde Güte, eine kluge, belesene Frau, die wissen will, wie es denn draußen so in der Welt zugeht. Weshalb sie auf die »Leipziger« oder »Pappes Hamburger Lesefrüchten« in ihren steifblauen Pappeinbänden abonniert ist.
Der Urenkel wird sich für ein Lesestündchen dazusetzen, wird nach den Journalen greifen und dort unter anderem ein erstes Mal der Geschichte vom »Gespenstigen Reiter« begegnen, aus der bald sechs Jahrzehnte später sein »Schimmelreiter« werden wird. »Noch fühl ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über Achtzigjährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels glitt.«
So heißt es gleich im ersten Absatz der »Schimmelreiter«-Novelle. Ein schönes Bild.
Doch stimmt es auch? Oder hat Storm, wie er in seinem »Lena Wies«-Porträt schreibt, nicht eher bei ihr ein erstes Mal von jenem Deichgrafen gehört, »der bei Sturmfluten nachts auf dem Deiche gesehen wird und, wenn ein Unglück bevorsteht, mit seiner Mähre sich in den Bruch stürzt«? Oder hat er – noch früher – davon »in der Tonne« erfahren, von Hans Räuber vielleicht?
Alles drei ist möglich. Alles drei ist falsch. Dennoch stimmt es auf vertrackt übertragene Weise. Denn was immer Storm dichten wird, bis hin zum »Schimmelreiter«, wird hier in diesen seinen jüngsten Husumer Jahren seinen Ursprung haben, und Bäckerstochter Lena Wies ist allemal eine Schlüsselfigur zu Storm-Werk und Storm-Verständnis.
Ihr Ende im Jahr 1868 wird schrecklich sein.
Der Dichter ist nach langen Jahren im Exil in sein Husum zurückgekehrt, und sie selbst ist nun eine Frau an die siebzig, »die Tant«, Respektsperson und unermüdliche Geschichtenerzählerin noch immer. Brav hat ihr der gelehrigste ihrer Schüler alles zugeschickt, was so von ihm gedruckt worden war, und sie hatte dazu genickt, hatte gelächelt: »Das hast du von mir gelernt!«
Dann wütet der Krebs in ihr, »eine jener Krankheiten … die sich an den Menschen anhaften wie ein fressendes Tier, das er nicht abschütteln, noch ausreißen kann, sondern jahrelang mit sich herumtragen muss, bis er ihm endlich erlegen ist«, und man spürt in diesen Worten Storms ganze Angst vor einem eigenen ähnlichen Ende.
Schweigend steht er an ihrem Sterbelager.
Lena Wies wird nichts erspart bleiben. Keine Qual, kein Schmerz. Er sieht auf sie voll Bewunderung in ihren letzten Tagen, hört den Arzt noch sagen, sie »stirbt wie ein Held«. Er ist dabei, wie sie sich – fast schon jenseits der Grenze – ein letztes Mal erhebt und etliche dort unten auf der Straße lärmende Gassenjungen zur Ruhe mahnt.
Ihre junge Pflegerin nickt. »Se hebben noch immer so väl Respekt vor Tant.«
Ein Geistlicher stellt sich ein, der Herr Propst, der die Freidenkerin in den einzig rechten christlichen Glauben heimholen will. Ihr Mund wird schmal, die Stimme streng: »Hm, Herr Propst! Se kriegen mich nich!« Auch das erfüllt Storm voll Bewunderung.
Viel hat er von dieser Frau gehört, manches von ihr gelernt. Religion hat nicht dazu gehört. Und auch sonst finden sich wenige Spuren christlicher Unterweisung in der Kindheit dieses Mannes.
Ihm bringt der Mann am Kreuz weder Trost noch Erlösung, bis zu seinem eigenen Ende nicht. Und auch das hat schon hier im Husum seiner frühen Jahre angefangen. Wie auch anders in dieser nur »spät und oberflächlich christianisierten Sphäre«, wie später Storm-Kenner Thomas Mann mit feinsinniger Prägnanz die Storm’sche Friesenheimat nennen wird?
Hier, wo um die Jahrtausendwende das Christentum nur zögernd Eingang fand, wo im Februar entlang der Küste die Bijkenfeuer aufflammen und der Ruf hinauf zum Winterhimmel erschallt: »Wotan, nimm unser Opfer an!«, herrschen immer noch heimlich die alten Götter. Und wie schreit doch Storms »Schimmelreiter« Hauke Haien in seiner letzten Stunde, bevor er sich mit seinem Ross in die kochenden Fluten stürzt?
»Herr Gott, nimm mich! Verschon die anderen!«
Welcher Gott denn, bitte, soll ihn nehmen? Der Christengott am Kreuz, der so wenig ausrichtet allen Predigten von Nächstenliebe zum Trotz? Oder nicht doch eher der finstere, alte Wotan, der zwar keine Ethik kennt, nichts von Nächstenliebe predigt, am Ende aber doch, wenn man ihm nur gebührend opfert, sein göttliches Erbarmen hat mit aller geschundenen Kreatur auf Erden?
Tiefheidnische Gedanken. Sie gehören zu Storm. Und auch sie sind Teil seiner Husumer Kindheit.
Hier ist man nun mal nicht fromm, und nur die Mutter, die anderen Frauen sieht er gelegentlich zur Kirche gehen, nie den Vater. Die Heilige Schrift muss der Sohn allerdings oft und innig gelesen haben. Seine Novellistik bemüht immer wieder Motive daraus, doch in die Tiefe geht das alles nicht. Man bleibt im Friesenherzen dem Christentum so fern wie Lena Wies.
Storm wird zwar getauft, konfirmiert. Er selbst wird es bei seinen eigenen Kindern nicht anders halten. Er lässt auch die christliche Trauung zu, allerdings nur zu Hause, nicht in der Kirche. Und natürlich wird Jahr um Jahr mit allem ausgiebigen Prunk das Weihnachtsfest gefeiert, nach immer gleichem Ritual.
Wie das mal wieder abgelaufen ist, erfahren nicht nur die Storm-Freunde so oft in seinen Briefen, dass sie schließlich kaum noch lesen können, wie wieder mal Tannenduft durchs Haus zog, alle Kinderaugen glänzten und wie die Sippe wieder so richtig schön beisammensaß. Am Ende darf auch noch seine Leserschaft, in der kleinen Erzählung »Unter dem Tannenbaum«, ausgiebig Weihnacht in der Art des Hauses Storm mitfeiern.
Nichts wird da ausgelassen. Nicht der Duft nach feinstem Tee und braunem Kuchen, nicht, wie schon mal der Kutscher ins Weihnachtszimmer tritt, um die Kerzen am Baum zu entzünden. Dann, heftig ersehnt, kommt der Augenblick der Bescherung.
Die Türen öffnen sich. Aller Glanz dieser Welt strömt hinaus in die eben noch finstere Diele, und da steht er dann in seiner ganzen Pracht, »der brennende Baum mit seinen Flittergoldfähnchen, seinen weißen Netzen und goldenen Eiern, die wie Kinderträume in den dunklen Zweigen hängen«.
Die Familie staunt.
Diese Familie ist des Friesen wahrer Glaube, sein eigentliches Heiligtum. Auch für einen Storm. Und es ist eine große Familie, in der er als ältester Sohn aufwächst, mit vier Generationen unter einem Dach und rundum in der Nachbarschaft. Urgroßmutter, Großmutter, Mutter. Dann der Vater, dazu zahllose Onkel und Tanten, Vettern und Cousinen. Denn wenigstens von einer gewissen sozialen Höhenlage an ist in Husum jeder mit jedem irgendwie verwandt.
Schließlich die Geschwisterschar. Sechs sind es, von denen der jüngste, Bruder Aemil, sechzehn Jahre jünger sein wird als Storm. Der ist allen ein guter Bruder, und doch hängt er an der einen Schwester mehr noch als an allen anderen.
An Lucie, fünf Jahre jünger als er: »Nicht war sie klug, nicht schön«, beschreibt er sie später in einem zärtlich erinnernden Gedicht, um zur brüderlichen Huldigung auszuholen: »Mir aber war ihr blass Gesichtchen und ihr blondes Haar, mir war es lieb; aus der Erinnerung Düster schaut es mich an …« Und, schlicht: »Wir waren recht Geschwister …«
Lucie ist ihm alles in diesen frühen Jahren. Vertraute, Spielgefährtin, kleiner Kamerad. Und in aller Unschuld so was wie eine aller erste Liebe.
Die beiden scheinen unzertrennlich. Sie teilen ein Zimmer, schlafen im selben Bett: »Ein Streifen Mondlicht fiel auf das Gesichtchen, das nahe an dem meinen ruhte; die schwarzen Augenwimpern lagen wie seidene Fransen auf den Wangen, der kleine rote Mund atmete leise, nur mitunter zuckte noch ein kurzes Schluchzen aus der Brust herauf …«
Im »Pole Poppenspäler« wird diese wohl keuscheste und schönste aller Storm’schen Liebesszenen nachzulesen sein, wo der Erzähler als halbwüchsiger Junge eine Nacht lang eingeschlossen ist mit Lisei, der Puppenspieler-Tochter, und unschwer kann man darin die Gefühle des Bruders für die kleine Schwester aufschimmern sehen: »Wenn ich auch nach Brüdern kein Verlangen trug, so hatte ich mir doch oft das Leben mit einer Schwester in meinen Gedanken ausgemalt, und konnte es nie begreifen, wenn meine Kameraden mit denen, die sie wirklich besaßen, in Zank und Schlägereien gerieten.«
Dann ist dieses Idyll vorbei. Die Schwester, gerade sieben, ist gestorben.
Ein Ende kam; – ein Tag, sie wurde krank
Und lag im Fieber viele Wochen lang;
Ein Morgen dann, wo sanft die Winde gingen,
Da ging sie heim; es blühten die Syringen.
Storm »lief ins Feld hinaus und weinte laut; dann kam ich still nach Haus …« Man schreibt das Jahr 1827, und es dürfte nicht das erste Todeserlebnis für den Zwölfjährigen gewesen sein.
In einer kleinen Kommune wie Husum ist das Sterben ziemlich öffentlich. Die Familie schart sich immer wieder um einen sterbenden Verwandten, Leichenwagen rollen in düsterer Pracht durch die Gassen zum Friedhof hin. Einen Vetter hatte mal der Vater zum Sarg des Großvaters hochgehoben und nur barsch gesagt: »Heule nicht, mein Junge! So sieht ein braver Mann aus, wenn er gestorben ist!« Und ihn selber, unvergesslich, hatte eines hellen Sonnentags die Großmutter an der Hand gefasst, hatte ihn hinausgezogen zum Familiengrab auf dem Friedhof von St. Jürgen.
Dort waren sie in die Gruft hinabgestiegen, hatten vor den verfallenden Särgen gestanden, und die Großmutter hatte das morsche Holz des einen Sarges beiseitegeschoben, hatte einen Totenschädel hervorgezogen.
»Das war mein kleiner Simon«, hatte sie unter Tränen geflüstert und den toten Knochen immer wieder gekost, während es dem danebenstehenden Knaben grauste, ganz anders und schrecklicher als bei allen Geschichten eines Hans Räuber oder einer Lena Wies.
Aber das hier, dieser Tod der Schwester, ist doch noch etwas anderes. Hier sieht er ein erstes Mal das Leben wie eine Blume aufblühen und dann gleich wieder vergehen. Danach kommt das totale Dunkel, das völlige Verlassensein. Und der Bruder setzt sich hin, schreibt das aller erste Gedicht seines Lebens.
Sprache als Möglichkeit, Empfindungen Wort werden zu lassen, sie damit auch überwinden, sich von ihnen befreien zu können – das ist etwas ganz Neues für ihn und noch etwas anderes als das Geschichten erzählen in der Tonne. Lehrmeister hat er aber, anders als beim Erzählen, dafür nicht gehabt.
Woher auch in Husum?
Zweimal im Jahr poltert ein Bücherkarren heran, bietet auf dem Michaelismarkt seine Ware feil und später in der von Storm besuchten Gelehrtenschule. Die Nachfrage dürfte sich in Maßen gehalten haben.
Im Vaterhaus daheim stauben in einer Ecke etwas Goethe vor sich hin, etliche Rokoko-Dichter, der »Wandsbecker Bote« mit Chodowieckis schönen Illustrationen. Storm wird sein Lebtag Matthias Claudius-Verehrer und ein Bewunderer des genialen Illustrators Daniel Chodowiecki sein. Und auf dem Dachboden finden sich Schillers Dramen. Dessen heißes Pathos nimmt der Junge mit glühenden Augen in sich auf, ohne sich groß infizieren zu lassen.
Das sind schon die wichtigsten äußeren Bildungseinflüsse des jungen Storm, während sich zur gleichen Zeit drüben in Wesselburen der angehende Dichterkollege Hebbel durch die bald tausend Bände in der Bibliothek seines ersten Gönners, des Kirchspielvogts, erbarmungslos durchfressen und alles in sich hineinschlingen wird, was ihm nur irgendwie vor die Augen kommt, Philosophisches und Gedichtetes, Feuerbach und Schiller, Hegel wie Uhland.
Eine solche Schule, ohne Lehrer und Anleitung, nur auf den eigenen geistigen Heißhunger gestellt, durchläuft Theodor Storm in Husum nicht. Zwischen Tonne und Urgroßmutters Garten, zwischen Elternhaus und Lena Wies hat er dafür, was man eine schöne Jugend nennen kann. Ungebunden, ungegängelt, frei.
Ein kleiner Prinz in seinem Reich. Das ist der Theodor Storm seiner ersten Jahre. Daheim in einer Traumstadt, die mehr durch Zufall »Husum« heißt.
Daneben gibt es noch das andere, das »wirkliche«, nicht nur zusammengeträumte Husum. Dieses andere, reale Husum prägt ihn aber ebenso wie die kleinen Paradiese seiner Kindheit.
Schmuckloses Städtchen in baumloser Ebene
Ein Kloster und zwei Dörfer, die mit der Zeit zusammenwachsen. So fängt um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert Husums Geschichte an. Und die Mönche in ihren grauen Franziskanerkutten hatten rund um ihr Kloster Krokusse gepflanzt. Die blühen jedes Jahr einmal. Das zartlila Wunder pünktlich zu jedem Osterfest. Das bleibt bis heute so.
Alles andere an Husum ändert sich beträchtlich.
Die Reformation kommt. Die Mönche verschwinden. Ihr Kloster wird abgerissen. Nur die Krokusse blühen weiter, nun rund ums Schloss, das am Ende des 16. Jahrhunderts Herzog Adolf aus dem Haus Gottorp an der Stelle des Klosters errichten lässt. Einen prächtigen Renaissance-Bau, kostbar ausgestattet. Denn er soll künftiger Witwensitz des Hauses Gottorp sein. Auch sonst zeigt sich der Herzog großzügig. Er stattet die Husumer mit Stadtrecht und Handelsprivilegien aus, und Husum blüht auf, wird Handelszentrum, eine Stadt nicht nur der Fischer und Schiffer, sondern auch klug rechnender Unternehmer und Kaufleute. Im Hafen dümpeln vierzig eigene Schiffe oder sind nach Holland oder England unterwegs. Husum wird reich dabei. Schon geht das stolze Wort um, hier und im Umland der Marschen gäbe es mehr Silber als gewöhnliches Erz.
Graue Stadt am Meer? Die Husumer des frühen 17. Jahrhundert hätten über dieses Storm-Wort nur den Kopf geschüttelt. Was soll denn grau sein an ihrer Stadt, die selbst schon Hamburg Konkurrenz zu machen droht?
In farbenfroh barocker Lebendigkeit gehört das Husum dieser frühen Jahre zu den leuchtendsten Metropolen entlang der gesamten Nordsee-Küste. Ein neues Rungholt fast, die wiedererstandene Traumstadt aus dem Mittelalter, die damals in den alles verschlingenden Wogen der großen Manndränke, jener »menschenertränkenden« Sturmflut von 1362, untergegangen war.
Und nicht nur Husum blüht. Auch draußen am Meer geht es in diesen Jahren rege zu. Eine wahre Goldgräberstimmung herrscht in den sogenannten »Utlanden«. Noch nie wurde dort so heftig gedeicht und immer neues Land dem Meer entrissen. Nicht von den Friesen. Deren große Deichbau- und Landgewinnungszeit liegt lange zurück, und das stolze Friesen-Wort »Deus mare, Friso litera fecit« (Gott schuf das Meer, der Friese das Land) blieb wehmütige Erinnerung ans ferne Mittelalter, als noch die Friesen trotzig auf den selbst gewonnenen Marschboden stampften und ihr »Trutz, Blanker Hans!« dem Meer entgegenschrien.
Nun sind die vom Fürsten ins Land gerufenen Holländer dran. Hasardeure, Abenteurer, Spekulanten – und gute Deichbauer dazu mit allen Erfahrungen ihres heimatlichen Deichbaus im Gepäck. Sie führen in Nordfriesland als neues technisches Hilfsmittel die Schubkarre ein, die sie von den Gespannen der einheimischen Bauern unabhängig macht. Sie erproben das schon in ihrer Heimat bewährte abgeflachte Deichprofil, dessen Erfindung Storm dann seinem Hauke Haien zuschreiben wird. Jan Koot Rollwagen heißt der Mann, der es ein erstes Mal im nordfriesischen Raum ausprobiert haben soll.
Immer noch ein Koog entsteht. Immer weiter schiebt sich das Festland ins Meer hinaus. Man kann nahezu von einer »Deich-Gründerzeit« sprechen, und wie manch andere Gründerzeit endet sie im Desaster. Die Vorzeichen dafür mehren sich. Schreckliches würde geschehen, raunen die alten Weiber und flüstern sich grauselige Geschichten zu: Schon soll Blut vom Himmel geregnet, ein an der Küste vorübergeisterndes Gespensterschiff gesichtet worden sein, und ein Pfarrer will blutige Totenköpfe, jawohl, Totenköpfe in Erbsengröße in seinem Waschbecken entdeckt haben.
Böse Omen. Zweifellos. Doch wer nimmt sie schon ernst? Einige schlimme Stürme in den letzten Wintern sind rasch wieder vergessen. Im Jahr 1634 verspricht es ein schöner, warmer Herbst zu werden.
Dann kommt der 11. Oktober und über Nordfriesland der große Schrecken wie seit dreihundert Jahren nicht mehr. Sechstausend Menschen wird die Flut in dieser einen Nacht verschlingen und das Land danach nie wieder sein, was es einmal gewesen war.
Die Insel Strand, die friesische Kornkammer und damit einer der Gründe für den Husumer Reichtum, ist praktisch bis auf einen kümmerlichen Rest verschwunden. Einzelne Landstümpfe, die »Halligen«, ragen nur noch aus dem Wasser auf, und die Landgewinnung wird für wenigstens hundert Jahre unterbrochen sein. Husum aber, die eben noch so blühende Stadt, geht zwar nicht unter wie Rungholt, doch sein Lebensnerv ist getroffen, seine Blütezeit vorbei.
Storm beschäftigt sich nicht erst während der Vorbereitung auf seinen »Schimmelreiter« mit der Zeit um 1634. In seiner Bibliothek findet sich alles an alten Chroniken und Sagensammlungen, was sich dazu nur auftreiben lässt. Und das auch aus einem ganz persönlichen, sozusagen familiären Grund. Denn bald nach der Großen Flut von 1634 scheint es gewesen zu sein, dass sich ein erster seiner Vorfahren in Husum niedergelassen hatte. Ein Niedersachse vielleicht, »Wold« geheißen, was im Niedersächsischen so viel wie »Wald« bedeutet, bis dahin ansässig in einem der Dörfer, die von der Sturmflut verschlungen worden sind.
Nun also kommt er auf einem Halligschiff nach Husum, bleibt dort, wird herzoglicher Verwalter eines Staatsguts und vor allem Stammvater der Familie Woldsen, die im 18. Jahrhundert zu den angesehensten Sippen der Stadt gehört. Sie stellt Bürgermeister und Senatoren. Sie bestimmt den Ton in Handel und Gesellschaft. Friedrich Woldsen, Storms Urgroßvater, gilt als letzter großer Handelsherr der Stadt, noch einer mit eigenen Schiffen unten im Hafen. Sein Porträt, strenger Mund, klarer blauer Blick, hängt an der Wand des Dichters, und Storm ist stolz auf diesen Vorfahren, um den noch einmal der Glanz eines »königlichen Kaufmanns« leuchtet. So wird er denn auch in der Storm-Novelle »Die Söhne des Senators« beschrieben.
Streng in Haltung und Lebensführung. Unerbittlich gegenüber den Söhnen. Aber auch mildtätig und großzügig gegenüber allen Bedürftigen, die mit manchem Gulden zu Fest oder Jahreswechsel beglückt wurden. Und »so stand denn nicht zu verwundern, dass die Mitbürger des alten Herrn, wenn sie ihm bei seinen seltenen Gängen durch die Stadt begegneten, stets mit einer Art sorglicher Feierlichkeit ihren Dreispitz von der Perücke hoben, auch wohl erwartungsvoll hinblickten, ob bei dem Gegengruße ein Lächeln um den streng geschlossenen Mund sich zeige …«
In diesem 18. Jahrhundert vollzieht sich zugleich Husums allmählicher Niedergang. Nicht dröhnend und aufschäumend binnen einer Nacht, sondern gleichsam etappenweise, Fuß um Fuß in kleinen Schritten.
Zwar ist der Hafen seit der Großen Flut immer mehr verschlickt. Kaum noch ein Schiff fährt von hier aus nach Übersee. Es reicht gerade noch für etwas Küstenschifffahrt, doch noch immer wird Handel getrieben. Es wird Gold geschmiedet und Bier gebraut und viel Geld damit verdient, so vom Urgroßvater Feddersen, der sich davon sein schönes Haus baut, und in den Fassaden solcher Bauten spiegelt sich später, was einmal die »gute alte Zeit« war, als noch alle Dienstmädchen Line oder Trine hießen, niemand schlauer als sein Fürst sein wollte und nur einer von Adel einen Schnurrbart tragen durfte.
Storm ironisiert das in einer seiner frühen Erzählungen, »Im Saal«, hübsch, mit einem zärtlich boshaften Lächeln für die Großmama, die dort ganz entsetzt den Enkel nach seinem sündhaft demokratischen Verlangen ausfragt: »Was wollt ihr denn? Wollt ihr alle mitregieren?«
Darauf der Schnösel, ganz frech und unbekümmert: »Ja, Großmutter!«
Die neue Zeit lässt sich eben nicht aufhalten, selbst in Husum nicht. Und sie ist gleichbedeutend mit immer weiterem Niedergang.
Einen letzten Aufschwung hatte noch die napoleonische Ära gebracht, als Husum während der Kontinentalsperre zum Anlaufhafen für geschmuggelte Waren aus England wurde. Aber dann ist auch dieses kurze Strohfeuer erloschen. Die Bevölkerung sinkt von den sechstausend ihrer Glanzzeit auf dreitausend Einwohner ab. Immer mehr wird Husum das »Landstädtchen«, das gerade noch als Verwaltungs- und Handelszentrum für die Bauern der Umgebung von Bedeutung ist und zu jenem »schmucklosen Städtchen in baumloser Ebene« verkommt, als dass es der erwachsene Storm bezeichnet.
Noch immer blühen zu Ostern die Krokusse rund ums Schloss in ihrer lila Pracht. Sonst jedoch wird es spätestens von der Jahrhundertwende an immer stiller und ziemlich dunkel um dieses Husum. Ein Dunkel, das nachts gerade eine einzige Laterne unten am Hafen erhellt, während die vom Abendschoppen heimkehrenden Husumer Bürger sich ihren Weg durch die verkoteten, stockfinsteren Gassen mit den üblichen kleinen Handlaternen suchen müssen. Und durch die Stille klappern allenfalls noch die Holzschuhe der jütländischen Viehhüter, wenn sie von Dänemark ihre Rinder herantreiben.
Denn wenigstens als größter Viehmarkt der Westküste hat sich Husum behaupten können, und wolkenschwer hängt an solchen Markttagen der Viehdunst über der Stadt.
Ist aber dieser Markt vorbei, das Geschäft gemacht und das verdiente Geld in den schweren eisenbeschlagenen Kisten verstaut, geht es hin zu einer der zahllosen Kneipen. Davon gibt es hier mehr als irgendwo sonst an der Westküste.
Die feineren Husumer Herren sind dort natürlich nicht zu finden. Die lenken die Schritte zu einer der besseren Weinstuben, besonders gern am Feiertag zur Mittagsstunde, bevor es heimgeht zum sonntäglichen Festtagsbraten im Familienkreis. Dort sitzen sie dann hinter ihrem Glas Bordeaux, seufzen ein bisschen über die Obrigkeit, die wieder einmal neue Verfügungen über sie niederregnen lässt, sie schütteln den Kopf dazu und fragen, wo eigentlich die schon seit Langem angekündigten Staatsreformen bleiben.
Dann auch schweifen sie schon mal in Worten und Gedanken hinaus ins übrige Europa jenseits von Husum und Nordsee. Sie mögen über die Revolution drüben in Frankreich sprechen, wo man einen von Gott gewollten König zu köpfen gewagt hatte, ohne dass sich der Himmel auftat und Feuer und Schwefel regnen ließ. Vom Napoleon ist die Rede, der gerade auf einem Eiland namens St. Helena seinem Magenkrebs erlegen war, und von den Feldherren, die diesen Adler erlegten, Blücher, Wellington, wie sie alle hießen.
Große Männer. Gewaltige Ereignisse. Zugleich aber unendlich fern von Husums Wirklichkeit. Sie scheinen die friesischen Lande kaum zu berühren, und viel von Politik wird auch nicht ins großelterliche Haus der Woldsens gedrungen sein.
1820 stirbt Simon Woldsen, letzter männlicher Vertreter der Familie. Die Söhne sind schon vor ihm dahingegangen. Es bleiben drei Mädchen, Magdalena, Elsabe und Lucie, und zwei davon heiraten »Aufsteiger« aus dem aufstrebenden neuen Bürgertum. Elsabe, die ältere, einen Ernst Esmarch, den künftigen Bürgermeister von Segeberg. Die jüngere Lucie 1816 dessen engsten Freund, den erst im Jahr zuvor nach Husum gezogenen Advokaten Johann Casimir Storm.
Eigentlich eine Ehe unter Lucies Stand. Denn in der Ahnenreihe dieses Johann Casimir aus dem Dorf Westermühlen bei Rendsburg finden sich keine Bürgermeister oder Senatoren, und von königlicher Kaufmannschaft kann in einer Sippe von Müllern und Bauern keine Rede sein.
Johann Casimir Storm leugnet diese Herkunft nicht.
Gewiss, er braucht für seinen beruflichen Ehrgeiz die Verbindung zu den Patrizierfamilien. Doch bleibt er der trotzig aufstampfende Außenseiter, der zutiefst wohl ahnt, bei aller Tüchtigkeit nie von ihnen voll anerkannt zu sein. Und wie ein kleiner Protest gegen alle patrizisch standesbewusste Snobberei wirkt es denn auch, wenn er zunächst mal mit seiner jungen Frau kein »standesgemäßes« Herrenhaus bezieht, sondern ihr ein Leben im eher bescheidenen Bürgerhäuschen am Großmarkt 9 zumutet.
Dort, in der Nacht vom 14. auf den 15. September 1817, kommt der erste Sohn zur Welt, Hans Theodor Woldsen Storm, während zur selben Stunde hochdekorativ ein Gewitter – die Natur lässt sich bei der Geburt eines Genies nie lumpen – auf Husum niedergeht.
Es bleibt nicht lange bei dieser bescheidenen Behausung. Schon im ersten Lebensjahr von Theodor Storm ist ein erster Umzug fällig, nun in die Neustadt, zu schon etwas größeren Komfort. Und dann, im Jahr 1821, hat den knorrig bauernstolzen Advokaten doch noch die patrizische Vergangenheit seiner Frau eingeholt.
Der Schwiegervater ist gestorben. Die vereinsamte Witwe bittet die Familie Storm so herzlich, zu ihr ins viel größere Haus zu ziehen, dass ihr die Storms das schlecht abschlagen können, und Vater Storm fügt sich seufzend drein.
Also neuerlicher Umzug in die Hohle Gasse 3, und der alte Glanz ist wieder da, samt zwei prächtigen Rappen im Stall und stets abrufbarer Kutsche mit Kutscher. Viel Raum, viel Personal. Lucie Storm ist in ihre Welt zurückgekehrt. Ehemann Johann Casimir verzieht sich hinter seine Arbeit, wird weiterhin tüchtig und fleißig sein und hier in diesem Weiberhaushalt keine allzu große Rolle spielen.
Es ist also eine von Frauen beherrschte Welt, in der das Kind Theodor Storm aufwächst. Und es ist eine Welt, über die wie ein sanfter Schleier das Vergangene liegt, die Erinnerung an ein besseres Gestern. Denn wenn diese Frauen zu erzählen anfangen, die Mutter, die Großmutter oder drüben in ihrem Prachthaus die Urgroßmutter Frau Senator Feddersen, schwirrt und surrt es nur so von vergangener Pracht. Wie schön es damals war und wie glanzvoll alles zuging, was für Feste man feierte, weil man damals noch Feste zu feiern verstand, und wie Ahnherr Friedrich es sich jede Weihnacht nicht nehmen ließ, für die Armen der Stadt einen Marschochsen zu schlachten.
Ja, so waren deine Vorfahren, mein Junge! Und so vorausschauend wie dein Großvater Simon, der auf den Handel allein nicht länger setzen wollte und daher eine Zuckerraffinerie gründete! Schade nur, dass diese Zuckerraffinerie nicht recht gedeihen wollte und kurz nach Großvaters Tod wieder geschlossen werden musste!
Der Junge hört zu, atemlos, und er wird wissen wollen, wo denn das alles geblieben ist, der Glanz und all die Herrlichkeit, von der die Damen schwatzen.
Sie heben dann die Schulter, blicken traurig und seufzen leise: Dahin, mein Kind, dahin! Und wenn du sehen willst, was aus jener Zuckerraffinerie wurde, geh nur hinters Haus in der Hohlen Gasse! Die leeren Hallen dort mit ihren toten Fenstern, diese ganze verlassene Bauruine – das ist von Großvaters kühnem Plan geblieben.
Der Junge schweigt. Das große Gefühl ewiger Vergänglichkeit, wie beim Tod der Schwester, wie beim Besuch in der Woldsen-Gruft, überkommt ihn auch hier beim Blick in Husums frühere große Zeit.
Nichts also bleibt. Höchstens ein paar Gegenstände als stumme Zeugen längst vergangener Pracht. Die alte Uhr hier, ein Möbelstück, ein Treppenaufgang, der Pavillon im Garten der Urgroßmama. All das, was einmal die Requisiten seiner Novellenwelt sein werden, wo die Vergangenheit stets so gegenwärtig ist wie in den Erzählungen der Damen aus dem Haus der Woldsens und der Feddersens.
Das Kind Storm sieht zugleich, wie diese Stadt, gleich einer alt und faltig gewordenen Beauté, die sich für keinen mehr pflegen und herrichten zu müssen meint, auch noch ihre restlichen Schönheiten abstreift.
Die alte Marienkirche am Markt, so stattlich groß fast wie ein Dom, wird mitsamt ihrem über neunzig Meter hohem Turm ebenso gleichmütig abgerissen, wie sich ungefähr zur gleichen Zeit die Hamburger drüben in ihrer Freien und Hansestadt ihres baufälligen Doms kurzerhand mit der Spitzhacke entledigen.
Spitzhacken schlagen auch immer häufiger gegen die brüchigen Fassaden alter, von der Zeit geschwärzter Patrizierhäuser, und hässliche Neubauten entstehen, flach, eingeschossig, mit Strohdach darauf statt mit Ziegeln oder Schiefer. Und nicht einmal vor dem Schloss, einst Husums Stolz mit seinen trutzigen zwei Löwen als steinernen Wächtern davor, macht die städtische Zerstörungswut halt.
Man reißt den Renaissance-Bau nicht ab, aber man baut ihn zu einem Amtsgebäude um, verschleudert die kostbare Einrichtung, und Storm kann nur den Kopf schütteln. Immer weiter entfernt sich dieses sein Husum von »seiner« Stadt, rückt immer weiter weg von der Welt seiner Kindheit. Von jenem Husum, durch dessen Gassen sich einst die Großmama – alte Dienstboten erinnern sich noch recht genau daran – in einer Kutsche von zwei Ziegenböcken ziehen ließ.
Diese Großmama und nicht die eigentliche Hausfrau, die Mutter, ist Mittelpunkt im Haus in der Hohlen Gasse. Nicht sehr klug, auch der Enkel bemerkt das. Dafür übersprudelnd lebhaft und warmherzig, wohl immer mit einer Liebkosung, einem Stück Zuckerwerk für den ältesten Enkel in der Hand. Eben die typische »Großmama«. Storm liebt sie mehr als die eigene Mutter.
Als junges Mädchen muss seine Mutter mit ihrem braunen Haar und den tiefgrauen Augen sehr hübsch gewesen sein. Der Sohn liest später, was zu ihrer Schulzeit drei Freundinnen über sie schrieben: »Zartgefühl, Sanftmut, Liebreiz sind die Tugenden Lucies.« Da lächelt denn der Sohn und nimmt das nicht ohne kleinen Stolz in seine Erinnerungen »Aus meiner Jugendzeit« auf. Und er hört beim Besuch des alten Eduard Mörike in Stuttgart den Dichterbruder nicht ungern sagen, die noch immer ansehnliche Mama hätte »so etwas Klares, Leuchtendes, Liebe Erweckendes« in ihrem Wesen.
Dazu mag er dann nicken. Aber in ihm selbst scheint diese Mutter nicht viel Liebe erweckt zu haben.