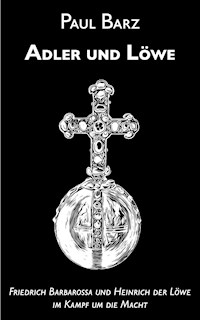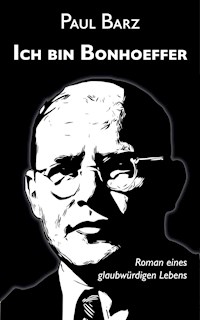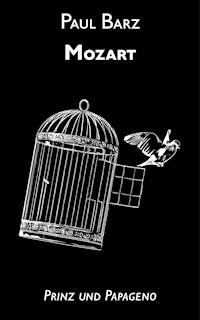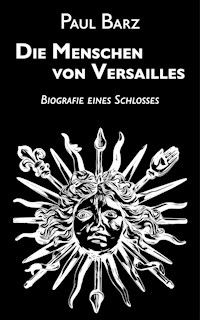Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Georg Friedrich Händel oder auch "the charming brute"Händel befreite sich mit unbändigem Ehrgeiz aus den Fesseln seines bürgerlichen Elternhauses in der sächsischen Provinz und kämpfte sich bis in die Opernmetropole London vor. Dort stellt er sich dem großen "Opernkrieg", immer Sieger und Verlierer zugleich, ein Superstar von Weltruhm, reich und gefeiert wie kein anderer, in tiefster Seele jedoch einsam und zwiespältig.Dieser biografische Roman zeichnet das facettenreiche Portrait einer spannungsvollen Persönlichkeit: Zwischen höchstem Glanz und krassem Elend spielt das Leben eines der widersprüchlichsten Repräsentanten seiner Zeit: Georg Friedrich Händel, "Mr. Handel" oder auch "the charming brute" (das charmante Ungeheuer), wie ihn seine Verehrer (und Feinde) genannt haben.Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 2008 erschienenen Buches von Paul Barz auf Basis des Originalmanuskriptes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Händel
Das schöne Ungeheuer
Biografischer Roman
London, im Herbst 1755
»Schmidt! Schmidt …«
Georg Friedrich Händel hebt die Arme und greift ins Dunkel, als wolle er jemanden festhalten. Noch einmal sein Ruf, gellend, böse, befehlend: »Schmidt!«
Johann Christoph Schmidt. Jugendfreund. Studienfreund. Jetzt Sekretär. Faktotum. Notenkopist. Alles eigentlich. Einst dem Herrn Händel nach London gefolgt, dort zum ›Smith‹ geworden wie Händel selbst zum ›Handel‹.
Wieder dessen Ruf, nun bittend, ängstlich: »Schmidt!«
Erst jetzt fällt Händel auf, dass er »Schmidt«, nicht »Smith« gerufen hat wie sonst. »Nicht einmal meinen Namen haben Sie mir gelassen, nicht einmal mein Volk!«
Hatte das nicht eben Schmidt zu ihm gesagt? Waren sie deshalb in Streit geraten?
Nein. Schon vorher. Obgleich sie eben noch ganz friedlich die Straße hinuntergegangen waren und Schmidt Händel leicht am Rockärmel gefasst hatte, wie immer bei gemeinsamen Ausgängen, seit Händel blind geworden ist. Und Schmidt hatte von einem Arzt gesprochen, wie hatte der geheißen?
Taylor, richtig. Von dem, hatte Schmidt gemeint, müsse sich einmal der Herr Händel behandeln lassen, das soll ein wahrer Wunderdoktor sein: »Dem Herrn Bach drüben in Deutschland hat er wohl auch sehr schön geholfen!«
»Wem?«
»Dem Herrn Bach aus Leipzig. Sie werden doch den Herrn Bach kennen!«
»Ich kenne keinen Herrn Bach!«
War es dieser Name gewesen, mit dem dann der Streit begonnen hatte? Vielleicht. Obgleich Händel keinen Streit hatte anfangen wollen und lediglich gesagt hatte: »Dein Herr Taylor, Smith, mag für einen Bach aus Leipzig gut gewesen sein, nicht für einen Händel.«
»Natürlich«, Schmidts Stimme war giftig geworden, »für den Herrn Händel ist ja gar nichts gut genug.« Und da hatte es angefangen.
Immer schriller. Immer heftiger. Menschen waren vorüber gekommen, und Schmidts Stimme hatte sich gesenkt, aber nicht ihr Gift verloren: »Nichts ist Ihnen gut genug, von allem wollen Sie nur das Beste, und Sie bitten nicht lange darum, oder? Sie nehmen sich einfach, was Sie haben wollen, Herr Händel, nicht wahr? Mir meinen Sohn, meinen Namen, mein Vaterland. Sie reißen an sich, was Sie gerade brauchen, im Leben wie in der Kunst.«
»Ich brauche nichts! Gar nichts!«
Das hatte nun Händel geschrien.
»So? Bin ich ein Nichts für Sie? Denn mich brauchen Sie ja wohl. Mich brauchen Sie!« Schmidts Stimme war noch giftiger geworden: »Aber ich bin ja nur ein Nichts, aha. Dann versuchen Sie mal, ohne dieses Nichts nach Hause zu kommen.« Er musste sich von Händel abgewandt, ihm den Rücken zugekehrt haben. Denn die Stimme hatte plötzlich leiser geklungen, wenn auch ungemindert giftig: »Einen angenehmen Abend noch, Mister Handel!«
Händel hatte einige Augenblicke gebraucht, um zu begreifen, dass es Schmidt ernst gemeint hatte. Dann aber hörte er die sich rasch entfernenden Schritte des anderen, da hatte er die Arme gehoben, hatte gerufen, geschrien: »Schmidt! Schmidt!« Hatte er richtig gehört? Hatte in der Ferne jemand gelacht, höhnisch und böse?
Händel steht da. Allein. Blind. Wenn er wenigstens wüsste, in welche Richtung sie gegangen sind! Waren sie nur ein paar Minuten vom Haus entfernt oder eine halbe Stunde? Er reißt die blinden Augen auf, als wolle er mit Gewalt Licht in sie hineinlassen. Aber alles verschwimmt in ihm.
Bilder seiner Erinnerung verschieben sich ineinander. Er sieht Häuserzeilen, Hauseingänge vor sich, Bruchstücke von Fassaden, hier eine Säule, dort ein Portal. Er kann nichts einordnen, weiß nicht, wo etwas seinen Platz haben könnte, weiß nicht, wo er ist.
Wenn er nur irgendetwas sehen könnte …
»Wie hart, wie dunkel, Herr, ist dein Beschluss …«
Der Chor aus »Jephta«. Er hatte die Zeile gerade aufs Notenblatt schreiben wollen, hatte schon den Federkiel ins Tintenfass getaucht, als es ihm, schwarz vor Augen geworden war, ganz kurz nur, aber heftig, und er hatte hochgesehen, hatte nach den Augen gefasst. So hatte er dagestanden, nur eine Sekunde, und sehr ruhig, ganz leise gesagt: »Ich werde blind«.
Blind wie schon die Mutter. Er hatte sie vor sich gesehen, wie sie dalag, als er sie ein letztes Mal daheim in Halle besucht hatte, und sie hatte nicht den hellen Blick ihrer jungen Jahre gehabt. Das hier war ein anderes Gesicht gewesen.
Kühl. Streng. Die blinden Augen geschlossen. So sieht er auch jetzt die Mutter vor sich, und es ist, als sehe sie durch ihn hindurch, während sich zugleich ein anderes Gesicht daneben schiebt, ein Mann, der Vater. Auch er scheint ihn nicht zu sehen, scheint einen Arm um die Mutter zu legen und sie sachte fortzuführen, weg vom Sohn, in den Nebel der Erinnerungen.
»Sie sind der Stolz unserer Familie!«
Das hört er so laut, dass er unwillkürlich zusammenfährt. Aber auch das kommt aus seinem Inneren, mit der Stimme des Schwagers Michaelsen aus Deutschland. Guter Schwager! Er mag diesen Mann recht gern, mit einem kleinen Hauch Verachtung dabei. Der Bürger. Der Biedermann. Ob ihn der Schwager seinerseits ein wenig verachtet, den Musikus dort hinter dem Meer, den Mister Handel in England?
Andere Stimmen. Lauter. Fröhlich. Sie kommen nun nicht aus seinem Inneren, sondern müssen Passanten auf der anderen Straßenseite gehören, und er will rufen, lässt es aber. Sie sollen ihn nicht so sehen, blind, allein, sie würden gar nicht wissen, wer er ist, würden ihn nicht kennen.
Hier in London kennt keiner keinen.
In Halle hat jeder jeden gekannt. Dort wüsste jeder, wer er ist. Der kleine Händel, Sohn vom Herrn Wundarzt Händel. Oder auch, vielleicht: Der Herr Händel, der Herr Organist am Haller Dom! Das wäre er dort wohl, wenn er in der Heimat geblieben wäre. Und wieder eine Stimme, hanseatisch nasal: »Sie ein Organist? Ausgerechnet Sie spielen Kirchenmusik zum Lobe des Herrn, wo Sie nur sich selbst als Herrn anerkennen?«
»Hallelujah. …«
Verdammter Johann Mattheson dort drüben in seinem Hamburg! Hat der dort je seinen »Messias« gehört, den Chor dort mit diesen auftrumpfend siegesfrohen Hallelujahs, dem großen Lob des Herrn? Und das soll einer schreiben können, der nur sich selbst das Hallelujah singt?
Er und kein Kirchenmusiker!
Alles kann ein Händel sein. Alles! Nicht in Halle vielleicht, nicht in Hamburg. Aber hier. In London. Hier ist er, was immer er sein will.
Hier ist er Händel.
Er atmet tief die Londoner Luft ein, dieses Gemisch aus Gossengestank, Moderdunst und leisem Salzgeruch. Er liebt diese Luft. Er liebt auch den Lärm in den Straßen, das Rasseln der Wagen, das Geschrei der Stimmen. Er liebt diese ganze Stadt, ihre Paläste und Elendshöhlen, die dunklen Winkel und weiten Plätze, die Parks, die Theater, sie vor allem.
Er liebt das ewige Auf und Ab von Erfolg und Niederlage, Triumph und niederschmetternder Katastrophe, den ständigen Wechsel und immerwährenden Strudel, in den ein jeder eintaucht, wenn er sich erst einmal auf dieses London eingelassen hat.
Er liebt das. Er braucht es.
Eigentlich mag er mehr das Land, die Ruhe dort, das Grün. Einige Male hatte er schon erwogen, fort aus der Stadt zu ziehen, auf einen kleinen Landsitz vielleicht, wo es nach Heu und Pferden riecht. Zugleich hatte er aber gewusst: Würde er erst mal dort sein, würde es ihn gleich wieder hinziehen zu diesem Schlachtfeld London, auf das er sich fünfzig Jahre zuvor gestürzt hatte, ein Kämpfer, ein Jäger, rücksichtslos gegen andere, ohne Rücksicht auf sich selbst.
Wie hatte Schmidt gesagt? Er nehme sich stets, was er brauche? Das stimmt. Aber nur eine Stadt wie London, ein solcher Moloch, solch ein Monstrum, hat das auch bieten können, was ein Händel braucht.
Er spürt die klebrige Nässe der Londoner Herbstluft auf seinem Gesicht. Es könnte Nebel sein. The fog. Dieser berüchtigte Londoner Nebel, der schon Menschen aufgesogen haben soll, ohne sie je wieder herzugeben, verschollen auf immer. Und das kann nun sein eigenes Schicksal werden? Der Herr Händel verschwunden, für ewig!
Nein! Ein Georg Friedrich Händel verschwindet nicht. Der hat schon in dichteren Nebeln gestanden, ohne jedes Zeichen, das ihm den Weg gewiesen hätte, und dennoch hat er seinen Weg gefunden. Allein und ohne einen Schmidt an seiner Seite. Das wird jetzt nicht anders sein.
Er horcht in den Abend hinein, ob sich Schmidt vielleicht nicht doch besonnen hat, zu seinem Herrn zurückzukehren und ihn sicher nach Hause zu geleiten. Vielleicht auch wartet er an der nächsten Straßenecke auf ihn, wird ihm dort am Ärmel zupfen, ihn an der Hand nehmen, sie werden gemeinsam zum Haus an der Lower Brook Street zurückkehren.
Händel macht einige tastend zögernde Schritte, hält wieder inne, horcht.
Kein Schmidt. Nur das Geräusch eines sich rasch nähernden Wagens. Und jetzt meint Händel Gelächter zu hören, hell und unbekümmert.
Das Lachen sehr junger Menschen, die irgendetwas sehr komisch finden.
Ein schöner Kerl
1685 bis 1703
»Georg Friedrich Händel ist am 24sten Februar 1684,
zu Halle, einer in Obersachsen gelegenen Stadt,
aus zwoter Ehe seines Vaters geboren,
welcher daselbst ein wohlangesehener Wundarzt,
und zu der Zeit schon über 60 Jahre alt war.«
Lebensbeschreibung von John Mainwaring,
übersetzt von Johann Mattheson (Hamburg 1761)
Die Zukunft hockt auf keiner Orgelbank
Das Gelächter schwillt an, klingt ab, bricht noch einmal aus. Die Kutsche auf ihrer Fahrt von Lübeck nach Hamburg erbebt geradezu unter diesem Lachsturm.
Die Insassen, Musikus Johann Mattheson und Musikus Georg Friedrich Händel, lehnen jeder in seiner Ecke, die Gesichter gerötet, Händel tupft sich einige Schweißtropfen von der breiten Stirn. Draußen ist es heiß, ein schwüler Augusttag. An den Wagenfenstern zieht Holsteins sommerliche Landschaft vorbei, von den Getreidegarben auf den gemähten Feldern weht süßlich schwerer Duft herüber.
Ein Rumpler lässt die beiden zusammenfahren, die Räder sind wohl über eine Baumwurzel hinweggepoltert. Mattheson ächzt über die schlechten Straßen, Händel über die schlechten Kutschen, so etwas wie Federung ist noch nicht erfunden. Dann bricht Mattheson gleich noch einmal in prustendes Gelächter aus.
»Was sich der Alte nur denkt!«
Sie waren von Hamburg nach Lübeck gefahren, weil es geheißen hatte, der alte Dietrich Buxtehude würde bald von seinem Organistenposten an der Marienkirche zurücktreten. Da hätte sich denn die Frage seiner Nachfolge gestellt, und der Geheime Ratspräsident Magnus von Wedderkopp hatte den allseits geschätzten Herrn Mattheson aus Hamburg lockend angesehen. »Nun, werter Herr Mattheson? Wäre das nicht genau das Richtige für Sie? Ist das nicht doch noch etwas Erhabeneres als die Oper, mögen Sie noch so köstliche Werke vorlegen und mit Ihrer herrlichen Stimme die Helden der Vergangenheit zu neuem Leben wecken?«
Mattheson, Sänger an der Oper am Gänsemarkt, dort auch gelegentlicher Kompositeur und Kapellmeister sowie erklärter Liebling des Publikums, das schon beim Knaben dessen Engelsstimme bestaunt hatte, schien zunächst noch zu zögern. Dafür hatte der vor wenigen Wochen zuvor in Hamburg eingetroffene Händel leuchtende Augen bekommen: »Nachfolger des großen Buxtehude …«
»Dann können ja Sie sich um seinen Posten bewerben.« Das hatte scherzhaft klingen sollen. Aber Matthesons Lächeln geriet etwas schräg.
Sie waren dann gemeinsam aufgebrochen, und in Lübeck war ihnen Dietrich Buxtehude entgegengetreten, die leibhaftige Legende. Aber der alte Herr hatte sich gar nicht legendär, nicht einmal norddeutsch steif gegeben, hatte sie aus wasserblauem Blick herzlich angelächelt und sie hin zu Orgel und Cembalo gezogen.
Sie hatten vorgespielt, erst Mattheson, dann, auf Drängen des Freundes, auch Händel. Der alte Herr hatte in der ersten Bankreihe gesessen, immerzu »Wundervoll!« gemurmelt und am Ende nur gesagt: »Sie beide, meine Herren, beide, jawohl, müssten meine Nachfolger werden.«
»Warum nicht? Der Herr Händel spielt die Orgel, und ich werde am Klavicimbel sitzen!« Mattheson hatte gelacht und Händel die Orgel noch einmal kurz aufdröhnen lassen.
Es war eine angenehme Zeit in Lübeck geworden, mit viel Musik auf allen Kirchenorgeln, und am Abend vor der Abreise – noch war die Nachfolge Buxtehudes nicht entschieden – hatte sie der alte Herr zu sich ins Haus gebeten: »Machen Sie mir die Freude, liebe junge Herren, und teilen Sie das Nachtmahl mit uns!«
Ein großes, etwas blasses Mädchen, wohl schon um die Mitte zwanzig und von mehr eckiger Anmut, hatte aufgetragen. »Meine Tochter!«, hatte Buxtehude die junge Frau vorgestellt und eifrig hinzugesetzt, »ein wahres Wunder an Tugend und hausfraulicher Geschicklichkeit. Glücklich, wer eine solche Frau wie meine Anna Margareta an seiner Seite weiß!« Das Mädchen war rot geworden.
Später, die junge Dame hatte noch den Kaffee gereicht und sich dann zurückgezogen, waren die kurzstieligen Tabakpfeifen hervorgeholt worden, und Buxtehude hatte nach kurzem heftigem Schmauchen mit einem Räuspern eingesetzt: »Meine Nachfolge also, die Herren! Ich wäre glücklich, wenn sich einer von Ihnen dazu entschließen könnte. Ich wüsste keine Würdigeren als Sie.«
Sie schwiegen geschmeichelt. Buxtehude, immer noch an der Pfeife saugend, sah von einem zum anderen: »Auch mein Fräulein Tochter schien sehr zufrieden zu sein und gar nicht zu wissen«, er schickte seinen Worten ein behagliches Lachen voraus, »wen von Ihnen beiden sie mehr mit ihren Blicken verschlingen sollte.« Die beiden verstanden nicht. »Nun, Sie wissen ja wohl, dass mein Nachfolger zugleich mein Schwiegersohn werden wird.«
Jetzt war ihr Schweigen mehr erschrocken als geschmeichelt, und Buxtehudes Blick war streng geworden: »Sie sind dazu doch wohl bereit, die jungen Herren. Oder?« Seine Augen gingen von Mattheson zu Händel und wieder zu Mattheson zurück, dessen hübsches Mädchengesicht sehr rot angelaufen war, während Händel gerade etwas sehr Spannendes in der Tiefe seiner Kaffeetasse entdeckt zu haben schien.
»Nun nicht so zaghaft, die Herren«, jetzt bemühte sich Buxtehude um einen väterlich neckenden Ton, »habe doch auch ich die Tochter meines Vorgängers Franz Tunder zur Frau genommen, wie das hier so Sitte ist, und diese Wahl, ich schwöre, nie bereut. Nun? Wie steht es, lieber Mattheson?«
»Ich … ich …«, stammelte Mattheson und suchte vergeblich nach einem passenden Wort. Der Blick des Alten wurde schmal: »Sie sind doch nicht etwa schon verlobt?«
»Doch … ja … genau …« Mattheson war unendlich erleichtert, vom anderen die einzig mögliche Ausrede in den Mund gelegt zu bekommen.
»Und der Herr Händel?«
Der hatte geschwiegen, während über sein Gesicht eine leise Röte gezogen war, hatte ein paar Mal stumm die Lippen geöffnet wie ein nach Luft schnappender Fisch, dann wieder in seine Kaffeetasse gestarrt: »Ich auch«, kam es endlich. Matthesons Brauen waren bei diesen Worten sehr steil in die Höhe gewandert.
Der Abend war nicht mehr sehr lang geworden.
»Und mit wem, Herr Händel, sind Sie verlobt?« Das hat Mattheson am nächsten Tag in der Kutsche gefragt, die sie zurück nach Hamburg brachte, und Händel hat nur erwidert: »Und Sie, Herr Mattheson? Wer ist denn wohl, bitte, Ihre liebreizende Braut?«
Da haben sie dann zu lachen angefangen, erst noch kichernd, dann immer toller, lauter, brüllender. »Ich Ehemann von diesem alten Mädchen«, jappst Mattheson, »oder Sie, mein guter Freund. Ausgerechnet Sie …«
»Wieso ›ausgerechnet ich‹?«
Ihr Gelächter setzt aus, und im Wagen ist es sehr still. Mit langem Blick mustern sie sich gegenseitig, als wolle jeder etwas sagen und wage nicht es auszusprechen.
Matthesons Hand wischt durch die Luft, als würde er eine Fliege verscheuchen.
Endlich lehnt er sich aus dem Kutschfenster und blickt auf Lübecks Kirchtürme zurück, die dort im graugoldenen Dunst eines norddeutschen Sommerabends verschwimmen: »Schade um den schönen Organistenposten! Obwohl …« Mattheson zögert, dann: »Man sollte die Zukunft der Musik sowieso nicht in der Kirche suchen. Die hockt auf keiner Orgelbank …«
»Wo sonst? Im Opernhaus?«
»Il dramma per musica.« Genießerisch lässt sich Mattheson das welsche Wort auf der Zunge zergehen.
Händel hebt die Schultern in die Höhe: »Meine Mutter, glaube ich, würde mich lieber auf der Orgelbank von St. Marien sehen.« Und nicht einmal der Vater, denkt er zugleich, hätte etwas gegen den Sohn als Nachfolger des großen Buxtehude einzuwenden gehabt.
Matthesons Brauen sind wieder sehr steil in die Stirn gezogen: »Dann hätten Sie doch die Stelle antreten können, lieber Händel. Oder«, mit einem Lächeln, »hindert Sie Ihre Liebe zum schönen Fräulein Sbüllens daran?«
Das Fräulein Sbüllens ist ein hübsches Hamburger Patriziertöchterchen, von dem die beiden wechselseitig behaupten, der andere sei in sie verliebt, und zuweilen wirkt der Name wie ein Schutzschild, ohne dass sie so genau wüssten, wovor sie eigentlich das Fräulein Sbüllens schützen sollte.
Jetzt bleibt Händel stumm.
Draußen blökt Vieh. Eine Herde schwarz-weiß scheckiger Rinder schiebt sich dem Wagen entgegen, die Fahrt kommt in Stocken, wird erst nach einer Weile holpernd fortgesetzt. Drinnen sieht Mattheson auf den Freund, der den Blick gesenkt hält, als schäme er sich für irgendwas, und schlägt einen betont spielerischen Ton an: »Sie haben doch nicht grundsätzlich etwas gegen die Ehe?«
Händel wirft den Kopf zurück: »Was soll ich gegen die Ehe haben? Wenn sie einem einen schönen Posten bringt …« Und mit Trotz in der Stimme: »Auch mein Vater hat nur seine Praxis als Chirurgus bekommen, weil er die Witwe eines anderen Chirurgus geheiratet hat.«
»Ich denke«, Mattheson blickt erstaunt, »die Frau Mama ist Tochter eines Pfarrers.«
Händel schüttelt den Kopf: »Meine Mutter ist seine zweite Frau. Die erste starb an der Pest. Und die …«
»Die hatte Ihr Herr Vater gefreit, um sich als Chirurgus niederlassen zu können, ich verstehe«, ergänzt Mattheson, und lässt im Wort »Chirurgus« eine kleine Herablassung mitschwingen, als rede er von einem niederen Bedienten. Händel meint wie so oft, den Vater verteidigen zu müssen.
»Ein sehr guter Chirurgus«, ereifert er sich, »dem Herrn Kurfürsten hat er einen Beinbruch geheilt und einem Jungen, den alle schon aufgegeben hatten, ein Messer aus dem Magen geholt, das der im Spiel verschluckt hatte, und …«
Und viel Geld hat der Vater damit verdient, hundert Taler allein für die Rettung des Jungen, denkt er im gleichen Atemzug, und auf diese hundert Taler war der Herr Chirurgus Georg Händel wenigstens so stolz gewesen wie auf seine medizinische Leistung.
»Keinen anderen als ihn hat der Herr Herzog zum Leibarzt haben wollen«, fährt der Sohn fort und will noch erzählen, wie in jenem dreißig Jahre wütenden fürchterlichen Krieg der Herr Papa als überall gefragter Feldscher durch ganz Europa gereist war, im Dienst der Kaiserlichen ebenso wie im Dienst der Schwedischen bis hin nach Portugal. Doch sieht er, dass der Freund die Augen geschlossen hat und nun wie schlafend in seiner Wagenecke lehnt. Der Herr Mattheson langweilt sich.
Da schweigt auch Händel, wendet sich wieder dem Kutschfenster zu und sieht in Holsteins vorüberziehendes mildes Grün hinaus.
Es ist der 17. August 1703 und Georg Friedrich Händel achtzehn Jahre alt.
Willst du ein Bierpfeifer werden?
Ein schöner Kerl, denkt Mattheson, während er Händel durch halbgeschlossene Lider betrachtet. Ein Apoll, nein, eher ein Herkules mit seinem Riesenwuchs. Nur fett werden darf er nicht, er isst zu viel. Und mit einem Lächeln denkt er an die Austern, die Händel schon zum Frühstück im Dutzend hinunterzuschlürfen pflegt, an die Berge Pasteten, die er in sich hineinschiebt, um Ströme von Bier und Champagner hinterher zu schütten. Ein rastloser Esser mit nie versiegendem Appetit. Ja, das ist Händel wahrlich.
Auch jetzt kramt er im mitgeführten Reisekorb, zieht endlich ein gebratenes Huhn hervor. Er schlägt die Zähne ins weiße Fleisch, schlingt es herunter, als sei er tagelang nacktem Hunger ausgesetzt gewesen, entkorkt die mitgeführte Weißweinflasche, trinkt in gierigen Schlucken.
Ein Herkules, denkt Mattheson gleich noch einmal. Der passt auf keine Orgelbank. Und das Gleiche hatte er schon gedacht, als er den Freund zum ersten Mal gesehen hatte, damals im Hamburger St. Magdalenen-Kloster. Angelockt vom rauschenden Orgelspiel zur mittäglichen Stunde war er zur Empore hinaufgestiegen, und dort, ein gewaltiger Schatten gegen das einfallende Mittagslicht, hatte der junge Mann aus Halle gesessen.
Ein Bär, dachte Mattheson, aber von musikalischem Genie. Man müsste ihn nur zähmen. Und der Ältere hatte den Jüngeren gleichsam an die Hand genommen, hatte ihn hinausgeführt aus allem Kirchendunst, hinein in die Salons der feinen Gesellschaft, wo Mattheson als Sohn eines reichen Steuereinziehers von Kindheit an zu Hause war.
Amüsiert hatte er beobachtet, wie rasch sich Händel nach ersten tapsenden Versuchen in dieser zunächst noch ungewohnten Welt zurechtgefunden hatte und bald schon ein Liebling der Hamburger Kaufmanns- und Geldaristokratie geworden war. Mein Werk, dachte Mattheson mit kleinem, feinem Stolz und einer seltsamen, ihm selber rätselhaften Zärtlichkeit.
So waren sie denn Freunde geworden.
Ja, wir sind Freunde, denkt Mattheson. Nur gut, dass uns die Nachfolge von Buxtehude nicht zu Rivalen gemacht hat. Wieder sieht er zu Händel hin.
Der hat sein Huhn verzehrt, spült den Weißwein hinterher, beißt jetzt noch kräftig in einen Apfel, sieht wieder ins Land hinaus und ist mit den Gedanken bei einer ganz anderen Fahrt durch eine ganz andere Landschaft.
Rund zehn Jahre ist das wohl her, und diese andere Fahrt damals hatte ihn durch seine sächsische Heimat von Weißenfels zurück nach Halle geführt, mit dem Vater neben sich.
Der hatte gerade als Leibchirurgus des Herzogs seine allwöchentliche Visite in der herzoglichen Residenz gemacht, und der Knabe hatte so lange gebettelt, bis ihn der Vater mitgenommen hatte. Vielleicht zehn, nein, noch jünger muss er gewesen sein, als sich ihm ein erstes Mal aller Glanz eines Fürstenhofs geöffnet hatte, und dann war noch der Gottesdienst in der herzoglichen Kapelle gewesen.
Der war vorübergegangen, der Herzog, nach allen Seiten huldvoll nickend, hatte schon dem Ausgang zugestrebt, als noch einmal die Orgel voll aufgebraust war, gefolgt von einem wunderbar notenreichen, kunstvoll geschnörkelten Spiel, und die Fürstlichkeit war stehen geblieben, hatte den erlauchten Kopf hinauf zur Empore gedreht: »Wer, um Himmels willen, spielt denn da so überaus köstlich?«
»Wohl mein Bruder, Ihro Gnaden!« Das war Carl gewesen, der Halbbruder aus des Vaters erster Ehe, nun Medicus am Hof zu Weißenfels.
»Ihr Bruder? Hol Er ihn her!« Und der Herzog hatte noch mehr gestaunt, dass ein Kind vor ihm gestanden hatte. Er hatte ihm den Blondkopf getätschelt und sich dem Vater zugewandt: »Dass Ihr euch aber dem Himmelsgeschenk dieses Sohnes würdig zeigt und einen recht anständigen Musikus aus ihm macht, der einmal musikalische Zier meines Hofes werden könnte!«
Ein Kopfnicken. Allgemeine Verbeugung. Der Herzog war davon geschritten, einer Gottheit gleich, die kurz hinter einer Wolke hervorgelugt und huldvoll auf die Erdenkinder dort unten herniedergeblickt hatte. Diese Gottheit hatte also befohlen, dass der Georg Friedrich Händel ein Musikus zu werden hätte.
»Schlag dir das aus dem Kopf, mein Sohn!«
»Aber der Herzog hat es doch gewünscht …«
»Fürsten wünschen viel. Und ebenso schnell haben sie es vergessen.«
Vater und Sohn hatten wieder im Wagen gesessen, der sie zurück nach Halle führte, und der Vater, mit schwarzsamtener Krawatte im tadellos blütenweißen Spitzenkragen, hatte seltsam umwölkt dreingeblickt, als sei ihm eben höchste Ungnade widerfahren.
»Hofmusikus beim Herzog. Was ist das schon? Ein anderer Lakai, der am untersten Ende der fürstlichen Tafel Platz nehmen darf.«
»Aber Sie, mein Vater, stehen doch auch im fürstlichen Dienst …«
»Unter anderem. Und gewisslich beziehe ich nicht daher mein Geld.« Der Vater hatte aufgelacht. »Ich war sehr zufrieden, jawohl, als damals anno 1680 unser gnädiger Herr Landesvater seine Residenz von Halle in dieses Weißenfels zu verlegen geruhte, von uns schön weit entfernt. Ich bin nun mal kein Höfling, nur ein ehrlicher Bürger. Das, mein Sohn, solltest du auch sein.« Und der Vater war unverhofft eifrig geworden, hatte sich vorgeneigt und den Jungen am Arm gefasst: »Sieh dir deinen Bruder an, den Hofmedicus! Ein aufgeputzter Papagei, der kein eigenes Wort wagt, das nicht der Fürst zuvor gebilligt hat. Du aber …«
Was war mit ihm?
Der Sohn wartete. Sein Vater schwieg. Erst nach einer Weile setzte er wieder ein: »Du hast es gut, Junge, sehr gut sogar, viel besser als ich in deinem Alter. Du darfst aufs Gymnasium, nicht nur zwei Jahre wie ich damals, als dein Großvater gestorben war, der Kupferschmied. Danach durfte ich glücklich sein, wenigstens ein ganz guter Wundarzt zu werden. Du aber wirst einmal Jura studieren können, wie ich es immer wollte. Danach, ja, steht dir die Welt offen, du kannst Großes, Größtes werden.« Er stockte. Dann, sehr leise: »Ich glaube, ich beneide dich …«
Nie hatte der Sohn den Vater so reden hören und nur schüchtern zu fragen gewagt: »Ich soll kein Musikus werden?«
»Ein Bierpfeifer?« Der Vater spuckte fast das Wort.
Der Junge kannte Bierpfeifer. Fröhliche Gesellen, oft mit einem dressierten Murmeltier dabei. So zogen sie durchs Land, spielten in Schenken und auf Jahrmärkten, und sicher ging es in deren Welt lustiger zu als in dem mitten in Halle hingestellten Vaterhaus in der Nikolaistraße am Schlamm. Wenn dort aber zur Weihnachtszeit die kleinen Currende-Singer von Haus zu Haus gewandert waren und die Mutter zu ihm getreten war, ihn fest in den Arm geschlossen, dankbar geseufzt hatte: »Sieh die armen Kinder, wie sie für ihr bisschen Brot singen müssen!«, hatte er nicht verstanden, was die Mama eigentlich meinte.
Der Junge, jawohl, wäre mehr als froh gewesen, zu den Kindern dort draußen zu gehören, mochten sie nun arm sein oder nicht. Nur gar zu gern hätte er mit ihnen für die Leute gesungen, nicht nur in der Lateinschule oder sonntags im Gottesdienst.
Arme Kinder! Er selbst kam sich viel ärmer vor.
Aber das sagte er jetzt dem Vater natürlich nicht und schüttelte nur brav den Kopf, als der Vater seine Frage bohrend wiederholte: »Du willst doch kein Bierpfeifer werden?«
»Nein, Herr Vater!«
»Na also!«
Der Vater hatte sich zurückgelehnt und etwas ängstlich um sich geblickt, da im Waldstück, das sie gerade durchquerten, neuerdings eine Bande Wegelagerer hausen sollte.
»Der Fürst hat praktisch befohlen, dass du die Musik studierst«, nahm er wieder das Gespräch auf, »wir werden unserem Fürsten gehorchen. Aber wenn es denn sein muss, wird der Sohn vom Hofchirurgus Händel den besten Lehrer bekommen, den es gibt. Du wirst zum Friedrich Wilhelm Zachow gehen, dem Organisten an der Marktkirche. Das ist ein trefflicher Mann, heißt es allgemein. Der versteht sich auf Kontrapunkt und Komposition und alles, was du wissen musst.«
Der Vater nickte leicht: »Ja, der Zachow soll dich unterrichten. Denn es ist nicht so«, fast vertraulich neigte er sich dem Sohn zu, »dass ich Musik nicht leiden könnte. Sie ist etwas Wundervolles. Nur sein Brot sollte man damit nicht verdienen wollen. Und du musst mir eines versprechen, Junge …«
Erwartungsvoll sah der Sohn den Vater an.
»Versprich mir, dass du auf alle Fälle Jura studierst!«
»Wie?«
In der Kutsche von Lübeck nach Hamburg ist Händel zusammengefahren. Was hat eben Mattheson gesagt?
»Ich fragte Sie, ob Sie Ihren Herrn Vater eigentlich geliebt haben. Oder gehasst.«
Ich bin frei, ein Künstler
Händel hat nicht gleich geantwortet. Er denkt nach. Ob er den Vater geliebt hat?
Wohl kaum. Er liebt die Mutter Dorothea, deren Schwester Anna, die das kleine Clavichord ins Haus gebracht hatte, mit dem er oben auf dem Dachboden manche selige Musizierstunde hatte verbringen dürfen, wenn der Vater nicht zu Hause war. Er liebt seine beiden jüngeren Schwestern Dorothea Sophie und Johanna Christina, als deren eigentlicher Vater er sich manchmal fühlt.
Denn der »richtige« Vater, nun ja, er war alt, zu alt, schon über sechzig, als sein Sohn Georg Friedrich geboren wird. Viel auf Reisen ist er auch, über Land oder zum Hof des Herzogs. Die Familie sieht ihn kaum, und so sind es überwiegend Frauen, in deren Kreis der Junge aufwächst. Sie bewundern, sie verwöhnen ihn, für sie ist er ein Prinz, der Fürst und nur fürs Allerhöchste bestimmt. Gierig hat Händel diese Bewunderung von früh an in sich aufgeschlürft.
Der Vater aber?
Der ist allenfalls stolz, in seinen hohen Jahren noch einen Sohn gezeugt zu haben. Und zuweilen hatte ihn der Junge wirklich gehasst, wenn er ihn mal wieder vom Clavichord weggescheucht oder mit barschem Griff in seinen Nacken vom Fenster fortgezerrt hatte, wo der Sohn nur allzu sehnsüchtig den Currende-Sängern dort draußen hinterher gehorcht hatte. »Träum nicht!«, hatte der väterliche Befehl geheißen.
Als sei diese Welt ohne Träume zu ertragen! Oder gar ohne Musik!
Eigentlich ist er mir immer fremd gewesen, denkt Händel jetzt, so fern wie an jenem 11. Februar 1697, als er an seinem Totenbett gestanden und in das spitze, strenge Gesicht gesehen hatte, mit dem seltsam abweisend hochmütigen Zug darin: »Dass du mir kein Bierpfeifer wirst!« Das schien dieses Gesicht selbst noch im Tod zu befehlen, der Sohn las die Botschaft wohl. Hinter ihm schluchzten die Frauen.
»Ich werde, was ich will. Du hast mir nichts mehr zu sagen«, hatte er in diesem Augenblick gedacht, und es dürfte ein erstes Mal gewesen sein, dass er den Vater geduzt hatte. Er war dann in die Stadt zu einem Schulmeister gegangen, hatte ihn gebeten, gegen gute Taler in seinem Namen einige Verse auf den Toten zu schreiben, wie das damals Sitte war.
»Ach, Hertzeleid! Mein liebstes Vaters Hertze/Ist durch den Todt von mir gerissen hin/Ach, Traurigkeit! Ach, welcher grosser Schmertze!/Trifft mich itzend/da ich ein Weyse bin …«
Er zitiert das jetzt aus dem Gedächtnis zum erstaunt aufblickenden Mattheson hin. Aber er sagt ihm nicht, wie er damals dem Schulmeister den Federkiel aus der Hand genommen, den eigenen Namen unter die Verse gesetzt und dann noch hinter den Namen, nach kleinem Zögern, geschrieben hatte: »Den freyen Künsten ergeben.«
Ja, das wollte er von nun an sein. Frei. Ein Künstler. Der freie Künstler Georg Friedrich Händel.
Am Tag der Beisetzung des Vaters hatte ihn im Haus an der Nikolaistraße die Mutter heftig umarmt und dabei sehr klein und hilflos gewirkt: »Du bist jetzt unser Bester, Georg Friedrich, bist jetzt Vater der Familie«, und er hatte in dieses Gesicht gesehen, das ihm immer so schön und ewig jung vorgekommen war.
Nun sah er tiefe Falten und nackte Angst im weit aufgerissenen Blick dieser Frau, die nie richtig jung hatte sein dürfen und die ganze Jugend ihrem eigenen, ewig kränkelnden Papa, dem Herrn Pastor aus Giebichenstein, geopfert hatte, um schließlich mit beinahe dreißig froh zu sein, dass sie wenigstens noch ein zwar schon ältlicher, aber halbwegs angesehener und vermögender Mann wie der verwitwete Wundarzt Georg Händel zur Frau nehmen wollte.
Und nun?
Man besaß das Haus hier, man hatte ein wenig Vermögen. Würde das für ein leidlich bequemes Leben reichen?
Ein starkes, stolzes Verantwortungsgefühl erfüllte den Sohn. Insgeheim, wie viele einzige Söhne, hatte er sich immer schon für den eigentlich besseren Mann seiner Mutter gehalten, und nun würde eben er es sein, der für sie und die Familie sorgte, besser, als es je der Herr Papa vermocht hatte. Kräftig erwiderte er die mütterliche Umarmung: »Habt keine Furcht! Ihr werdet keine Not leiden müssen!« Sie sah ihn ängstlich an: »Aber du besuchst doch weiter das Gymnasium? Und studierst später Jura?«
Das hatte er schon dem Vater versprochen. Das versprach er nun der Mutter. So wechselte er denn um 1702 vom Gymnasium auf die nur wenige Jahre zuvor gegründete Hallenser Universität über, die damals beste und modernste in ganz Deutschland, und um die Mutter nicht weiter zu belasten, hatte er zugleich am Dom zu Halle um fünfzig Taler im Jahr eine Aushilfsstelle als Organist angenommen, was einiges Aufsehen erregt hatte, da er selber lutherisch, die Gemeinde aber deutsch-reformiert war.
Händel lächelte dazu. Musik war Musik. Sie kannte keine Glaubensgrenzen. Und er saß an der Orgel, ließ sie brausen, jubilieren und flüstern, auftrumpfen und trauern. Das waren Stunden, in denen der junge Mann aus Halle rundum glücklich war.
Er hatte beim Zachow sein musikalisches Handwerk gründlich gelernt, beherrschte den Kontrapunkt und mancherlei Instrumente, neben der Orgel die Oboe vor allem. Die war zu dieser Zeit sein Lieblingsinstrument.
Er hatte auch viele lange Stunden in der Zachowschen Bibliothek gehockt, sich eingewühlt in deutsche, französische, italienische Musik. Nein, auch hier gab es keine Grenzen. Und er hatte die Werke anderer rastlos abgeschrieben, hatte schließlich selbst zu komponieren angefangen, »wie der Teufel«, wie er sich später erinnern sollte, nur für sich, noch ohne Ehrgeiz, es je andere hören zu lassen.
Es brach aus ihm einfach hervor, musste sich befreien, was sich in ihm an Musik angestaut hatte. Und daneben studierte er ein wenig Jus.
Es war aber eine Zeit in Halle, da ein frischer Wind durch die Stadt an der Saale strich. Die Abwesenheit fürstlicher Hoheit hatte bürgerlichen Freisinn gestärkt, und von Leipzig her, wo er den tollkühnen Mut gehabt hatte, zum allerersten Mal ein Kolleg auf Deutsch und nicht auf Latein abzuhalten, kam der Philosoph und Staatsrechtler Christian Thomasius gezogen. Der verkündete so unerhörte Dinge: Dass nicht jede Majestät gleichsam von Gott gewollt und der Mensch zunächst einmal frei sei. Dazu nickte dann Studiosus Händel.
Frei war der Mensch, frei er selbst, die Zeile unter dem Totengedicht auf den Vater stand ihm stets vor Augen. Doch frei wofür, wenn das kein Gott und König vorschrieb? Wer war dieser Georg Friedrich Händel, der sich so rasch in keine aufgesetzte Ordnung fügen wollte? Diese Frage blieb ohne Antwort. Und wieder ließ er unter seinem Prankengriff die Orgel aufbrausen.
Noch ein anderer Mann gab im Halle dieser Zeit den Ton an, der Theologe August Hermann Francke mit seiner Lehre, erst im guten Werk, nicht nur in guten Gedanken äußere sich wahres Christentum. Und Francke hatte ein Waisenhaus, eine Schule gegründet, er schuf Werkstätten und legte Gärten an, die Francke’sche Stiftung, die für Jahrhunderte noch Bestand haben sollte.
Für Händel wurde das erst einige Jahrzehnte später wichtig. Damals in Halle mochte er diesen Francke und seine Lehre nicht, zumal durch dessen Einfluss Halles Theater allesamt geschlossen worden waren und der junge Mann nicht mehr Stücke seines Lieblingsdichters, eines Engländers namens Shakespeare, sehen konnte.
Ihm lagen auch Franckes Anhänger nicht, diese »Pietisten« mit ihrem ewig frommen Getue, den immerzu gefalteten Händen und zum Himmel verdrehten Blick. In ihrem Kreis fühlte sich der Student ebenso unwohl wie zwischen seinen anderen Kommilitonen mit ihren Sauf- und Rauftouren durch Halles Wirtshäuser und Kneipen.
Überhaupt war ihm die Heimatstadt zu eng geworden und wurde immer enger. Unruhe befiel ihn schon, wenn er nur auf die Straße trat und die immer gleichen Menschen in den immer gleichen Häusern sah.
»Man müsste zu den großen Städten hinziehen, nach Paris oder London oder Rom«, meinte er einmal zu Johann Christoph Schmidt, einem Mitstudenten aus dem Fränkischen und einem der wenigen, zu denen er so etwas wie freundschaftlichen Kontakt gefunden hatte. Schmidt bewunderte den um so vieles Größeren, Schöneren, Stärkeren sehr und fürchtete ihn zugleich ein wenig. Auch jetzt starrte er den anderen halb erschrocken, halb bewundernd an: »Gleich nach Rom? Nach Paris oder London …«
»Oder wenigstens nach Leipzig, nach …«, schränkte Händel ein. »Oder nach Hamburg«, kam es von der Tür her. Barthold Heinrich Brockes war eingetreten, ein anderer Kommilitone aus reicher Hamburger Kaufmannsfamilie, der sich selbst für einen Dichter hielt und die anderen gelegentlich zu kleinen Konzerten in seine recht üppig ausgestattete Studentenwohnung bat.
Händel griff zur Geige: »Oder Hamburg«, nickte er. Und zu Schmidt: »Sie aber, Schmidt, hole ich nach, wo immer ich bin.« Schmidt nickte dankbar und gläubig. Sie fingen zu musizieren an.
Matthesons helles Lachen schreckt jetzt Händel aus allen Erinnerungen.
»Sehen Sie nur den Burschen dort! Der will sicher auch zum Meister Buxtehude«, Mattheson zeigte auf einen einsamen Wanderer, der ihnen gerade mit übergehängtem Reisebündel und Wanderstab entgegenkam: »Na ja, der wird für des Alten Angebot schon aufgeschlossener sein, wenn er nicht einmal das Geld für die Postkutsche hat.« Worauf er sich wieder Händel zuwendet: »Ich muss Sie bald einmal mit unserem Ersten Kapellmeister Reinhard Keiser bekanntmachen, dem neuen Leiter unserer Oper. Das ist der rechte Mann für Sie. Und Sie genau der Richtige für ihn. Kirchenmusik, nein«, er lacht noch einmal auf, »die schlagen Sie sich besser aus dem Kopf. Sie gehören der Welt, Händel. Dieser Welt hier.« Den Wanderer hat inzwischen eine Staubwolke verschluckt.
Noch manche ziehen hin nach Lübeck zur Marienkirche, und zwei Jahre nach den Freunden Mattheson und Händel wird es ein Mann sein, der um diese Zeit Organist im kleinen Arnstadt ist. Auch er kann sich keine Kutsche leisten, wandert zu Fuß in die Travestadt, hört, was ihm der alte Buxtehude anzubieten hat, und anders als die beiden damals stottert er nicht verlegen, sondern wird sehr nachdenklich.
Das alte Mädchen Buxtehude freien um des Organistenposten an der Marienkirche? Warum nicht? Die Versuchung ist groß. Aber daheim wartet schon eine andere Braut, Cousine Maria Barbara. Die kann und will er nicht im Stich lassen.
Er schüttelt also den Kopf, sagt Nein und kehrt zurück ins kleine Arnstadt, wo ihn ein Donnerwetter erwartet, da er den gebilligten Urlaub weit überzogen hat. Um Hamburg, wo in diesem Jahr 1705 gerade Händels erste Oper »Almira« uraufgeführt wird, hat er einen Bogen gemacht.
Der Mann heißt Johann Sebastian Bach.
Am Operntor zur Welt
1703 bis 1706
»Es ist die krumme Opernschlange
dergestalt tief in unsere Gotteshäuser
zu solcher heyligen Zeit eingedrungen,
dass man mehr Acht und Andacht hat
gegen dieselbe und ihre Diener,
als auf Cristum
und seiner Gläubigen Gemeinde.«
Joachim Gerstenbüttel,
Hamburgs Musikdirektor von 1675 bis 1721
Den Teufel werde ich tun!
Händel, im Rücken das Gemurmel des Publikums im leidlich gut besuchten Opernhaus am Hamburger Gänsemarkt, sitzt am Cembalo und sieht zu den wohl fünfzig anderen Musikern hin. Noch vor Kurzem hatte er selbst zu ihnen gehört, als zweiter Geiger in der zweiten Reihe. Aber das ist kein Platz für einen Händel.
Operndirektor Reinhard Keiser hat das als erster gespürt und ihn mit freundschaftlichem Klaps zum Cembalo geschubst: »Unser Mann dort ist krank. Sie können ihn vertreten.« Dort sitzt Händel nun. Dort bleibt er. Hebt die Hand, Musik setzt ein, der Vorhang rollt hoch.
Ist dies noch der lang gezogene, leicht windschiefe Bau am Gänsemarkt mit dem spitzen Giebeldach? Haben die Menschen da drinnen eben noch auf dem Markt um den Fleischpreis gestritten und während der Andacht in den fünf Hauptkirchen unauffällig die jüngsten Börsenkurse registriert?
Jetzt finden sie sich im alten Ägypten wieder oder im alten Rom. In Zauberhöhlen glimmern Goldschätze, Geister fliegen durch die Luft, auf wogender See rollt und stampft ein Dreimaster durch das Bühnenbild. So was lockt das Publikum ins Theater. Die Geschichten um vergessene Helden und Herrscher wie Samson oder Nebukadnezar nimmt man mit, ebenso die Musik, die nur nicht zu lang und langweilig werden darf.
Händel hört scharrende Schritte hinter sich. Er weiß, dass jetzt die Menschen durch den überdeckten Gang vor dem Orchester in den Saal nebenan drängen und sich dort mit Erfrischungen versorgen, statt weiter der Musik zuzuhören. Er nickt in sich hinein: »Die Arie ist zu lang. Mattheson hat das gleich gesagt.«
»Eine Arie soll erzählen, was sie zu erzählen hat. Dann mag Schluss ein.« Auch das Matthesons Worte. Er hat recht. Er hat eigentlich immer recht. Das sind so Augenblicke, in denen Händel kleinen Hass auf den allwissenden Freund fühlt.
»Zufrieden heute?«
Ein Feuerwerk in blau, rot und golden aufspritzender Pracht hat wie stets die Vorstellung beschlossen. Draußen drängen die Leute ins Freie. Händel hört sie im deftigen Hamburger Platt schnacken, Hafenarbeiter, kleine Kaufleute, Dämchen vom leichten Gewerbe, durchzogen von den noblen Nasalen der feineren Hamburger Kreise. Diese »Bürgeroper«, wie sie 1678 als erste dieser Art nach venezianischem Muster in Deutschland gegründet wurde, ist für alle da. Und Händel sieht hinter der Bühne auf den Mann, der sich die dicke Schminke aus dem Gesicht wischt und wieder zu Johann Mattheson wird. Er hat an diesem Tag die Hauptrolle gesungen.
»Zufrieden?« Mattheson hebt die Schultern: »Wie soll man zufrieden sein, wenn man mit Menschen auf der Bühne steht, die sich nicht bewegen, nicht spielen können? Oper«, seine alte Litanei, »ist kein Konzert im Kostüm. Sie erzählt von Menschen, mit denen man lachen, weinen, trauern kann.«
»Das tun die Leute doch bei Ihnen!«
»Bei mir schon!« Bescheidenheit gehört nicht zu Matthesons Tugenden. Er neigt sich zum Spiegel vor und reibt das Rot von den Wangen. »Was für ein Wunderwerk ist uns mit der Oper geschenkt! Die Kunst aller Künste, ihre Vereinigung zu einem Gesamtwerk. Aber wir werden uns dieses Geschenk noch verdienen müssen.«
Sie treten auf den Theaterhof hinaus. Ein Schwein quiekt in seinem Verschlag, auf kreuz und quer gespannten Leinen hängt die Wäsche des Theatervolks. Alle Herrlichkeit ist verflogen. Es stinkt nach Unrat, Schweiß und Jauche.
»Gut gespielt, liebe Freunde.« Ein jüngerer Herr hastet vorbei, elegant im silbergestickten Frack, eine junge Dame am Arm. Mattheson sieht ihm nach. »Unser Herr Direktor Reinhard Keiser. Immer mit einer neuen Eroberung dabei.« Er beneidet und bewundert ihn, nicht zuletzt der charmanten Schamlosigkeit wegen, mit der Keiser aus seinem üppig ausschweifenden Lebenswandel nicht den geringsten Hehl macht.
Auch Händel bewundert Keiser. Für seinen Fleiß, seinen Mut, seinen Spürsinn. Er erst hat aus einer schlichten Erbauungsstätte ein Erstes Opernhaus gemacht, zu dem die Leute sogar aus Kopenhagen anreisen, allen giftigen Anfeindungen durch die Pastorenschaft und selbsternannte »Fachleute« wie den erzreaktionären Herrn Musikdirektor Joachim Gerstenbüttel zum Trotz.
Nein, die Oper, in den Augen ihrer Feinde eine »diabolische Kunst«, ist nicht nur beliebt. Mancher wie dieser Gerstenbüttel hätte der »Schlange Oper« nur allzu gern den Kopf abgeschlagen und sie für immer aus Hamburgs sittsamen Mauern vertrieben. Keiser bleibt unbeirrt.
Er schult das Orchester, baut ein Ensemble auf, kümmert sich um Verwaltung und Finanzen, schreibt überdies selbst Oper um Oper, deren Melodienseligkeit in allen Straßen nachhallt, und »wenn ich je ein eigenes Theater habe«, denkt Händel jetzt, »will ich wie Keiser sein.« Dabei verdrängt er alle Gedanken an Keisers Schuldenberg. Denn das Haus am Gänsemarkt steht fast ständig am Rand der Pleite.
»Sie sollten sich einmal selbst an einer Oper versuchen«, unterbricht Mattheson seine Gedanken, »Sie könnten das, das spüre ich. Sie müssten nur noch lernen, wie man Melodien findet. Doch keine Sorge«, wieder der leise herablassende Ton, der den anderen zuweilen aufs Blut reizt, »das bringe ich Ihnen schon bei.« Und er pfeift Takte eines Motivs, in dem Händel die Hauptarie aus Matthesons eigener Oper »Die Plejaden« wiedererkennt.
»Ich möchte gern eine Passion schreiben.« Händels Stimme klingt trotzig. Mattheson verdreht die Augen himmelwärts: »Eine Passion! Warum denn das?« Er winkt dem in einer offenen Kutsche mit seiner Dame davonfahrenden Keiser nach: »Ich wette, er will zu John Wyche. Der hat zu einer Gesellschaft geladen. Wollen wir nicht auch hingehen?«
Händel ist schon oft im Haus des englischen Gesandten John Wyche gewesen. Mattheson hat ihn dort eingeführt und ihm gleich auch Wyches Sohn Cyril als Schüler vermittelt. Danach war es in Hamburgs feinen Kreisen Mode geworden, seinen Nachwuchs vom Herrn Händel unterrichten zu lassen, und das bringt ihm, der bis dahin von der kargen Unterstützung seiner Mutter gelebt hat, gutes Geld.
Händel ist dem Freund dankbar und kann zugleich ein kleines Unbehagen nicht unterdrücken, wenn ihn der andere zu gönnerhaft als einen Schutzbefohlenen behandelt. Wie jetzt wieder, da er mit kleiner Herablassung im Unterton den Arm unter Händels Ellbogen schiebt: »Nun? Kommen Sie mit zu Wyche? Sein Champagner ist ganz ausgezeichnet …«
»Nein danke«, meint Händel nur und zieht sachte den allzu vertraulich umfassten Arm zurück, »ich will nach Hause, muss meiner Mutter schreiben.« Auch sie schreibt ihm oft, immer mit der Frage: »Isst du auch genug, mein Junge?« Geld liegt regelmäßig dabei, er schickt es regelmäßig zurück und legt eigenes dazu. Ja, das kann er sich schon leisten.
Er reckt sich stolz.
Ein hübscher Kerl, denkt Mattheson wieder einmal. Ihn wundern nicht die Blicke der Damen und mancher Herren, die dem Hünen mit dem ungepuderten Blondhaar folgen, fühlt er dabei auch stets so was wie eine unbestimmte Eifersucht. Laut sagt er: »Und was wollen Sie der Frau Mama schreiben?«
Das weiß Händel selbst nicht so genau. Was ihr erzählen von Hamburg, dieser quirligen Hafenstadt mit ihren bald fünfzigtausend Einwohnern, die von allen Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs weithin verschont geblieben war und sich nun selbst als »Tor zur Welt« versteht? Was vom Opernbetrieb, wo Menschen singend behaupten, Caesar oder Kaiser Claudius zu sein?
Anfangs hatte Händel Schwierigkeiten mit dieser Stadt an der Elbe gehabt und mit der Oper auch.
Halle war ihm plötzlich weniger eng und drückend, dies alles hier zu groß und zu kühl erschienen. Aber allmählich hatte er es lieben gelernt. Den grauen Dunst zwischen den Kirchtürmen an Regentagen und bei Sonne den Silberglitzer auf der Alster. Die schlanken Villen hinter den gestutzten Hecken, die von Linden gesäumte Prachtpromenade des Jungfernstiegs und hinter dem Opernhaus das Gassengewirr des Gängeviertels mit seinem Ruch von Laster und Unterwelt.
Er liebt auch das Opernvolk, sein Keifen und Streiten, die Liebeleien und Intrigen. Aber wie davon einer Chirurgenwitwe erzählen, die nur ihr Halle kennt?
Aus Hallenser Sicht war Hamburg vor allem die Stadt großer Kirchen und Kirchenmusik gewesen, der Orgelwunderwerke eines Arp Schnittger und bedeutender Organisten wie Jan Adam Reincken an St. Katharinen oder Vincent Lübeck an St. Nikolai. Voll Ehrfurcht sieht ihnen Händel hinterher, wenn sie im wogenden Gewand mit pathetisch steifer Halskrause das Kirchenschiff durchschreiten, wagt nicht, sie anzusprechen, hat Angst vor ihrem milden Spott im Blick, wenn er sagen würde: »Ich bin der Herr Händel vom Opernhaus«. Dann drückt er sich rasch beiseite, horcht aus dem hintersten Kirchenwinkel auf den Orgelklang, denkt nur: Ja, das ist wohl die wahre Musik! Das müsste meine Musik sein!
»Dass Sie mir in meiner Abwesenheit aber ja keine Passion schreiben, lieber Freund«, ruft ihm noch Mattheson zu, als der in diesem Frühjahr 1704 zu Konzerten in Holland und England aufbricht. »Ach, England«, hatte er geseufzt, »das ist das Land der Zukunft. Nicht das müde Italien, nicht das Frankreich des alten Sonnenkönigs. Nein, England wird künftiger Herr der Welt sein, auch in der Kunst. Dort entsteht einzig ihre Zukunft.« Händel hatte sich wieder seinen Opernpflichten zugewandt.
Im Opernhaus hat ihn aber bald nach Matthesons Abreise ein älterer Herr unter leisem Hüsteln am Ärmel gezupft. Händel kennt ihn. Advokat Christian Postel, Verfasser ebenso zahlreicher wie mittelmäßiger Libretti. Was will dieser Mann? Ihn um die Musik zu einem seiner Operntextbücher bitten? Nein, Postel hat anderes im Sinn.
»Sie wissen vielleicht«, hüstelt er, »ich bin recht krank und werde wohl bald vor das Angesichts unseres Herrgotts treten. Dann aber möchte ich nicht nur Opernbücher als mein Lebenswerk vorweisen müssen, sondern etwas zum Lobe des Herrn, eine Passion.«
Händel merkt auf. Postel hat indessen ein dickes Buch hervorgezogen, blättert eifrig darin: »Sehen Sie nur, eine Passion nach unserem Apostel Johannes! Und lesen Sie, wie schön das ist! Wie ich hier unseren Herrn Jesus mit einer Rose vergleiche, jawohl, mit einer Rose.« Und er liest mit vor Erregung heiserer Stimme: »Sollen denn heilen die Wunden der Sünden, müssen uns einzig die Blätter verbinden …«
Händel unterdrückt ein Lachen und sagt zu, die Musik zu schreiben. Eine Passion! Kein Herr Mattheson wird ihm dabei dreinreden.
Als Mattheson von seiner Konzertreise zurückkehrt, die ihn zwar nicht bis England, wohl aber durch Holland führte, hat die Johannes-Passion schon ihre Uraufführung gehabt, bei flauer Resonanz. Händel aber will einzig wissen, was Mattheson dazu sagt. Der ist noch ganz von seinen Erfolgen in Holland erfüllt: »Ein Publikum ist das, vor allem die Juden. Niemand versteht mehr von Musik. Keiser sollte endlich sehen, die Juden ins Theater zu bekommen …« Und im plötzlichen Wechsel: »Sie aber, höre ich, haben nun doch eine Passion geschrieben? Zeigen Sie her!«
Herrisch greift er zum Manuskript, blättert mit spitzen Fingern darin, als ekle es ihm, zeigt dazu sein von kleiner Bosheit durchtränktes Lächeln, das Händel mehr fürchtet als jedes noch so beißende Wort. Und dann der Seufzer am Schluss: »Alles schon tausendmal gehört, lieber Freund. Keine Note, die ich nicht von irgendwoher kennen würde. Nur das hier, nun ja«, er blättert noch einmal zurück, »das hier ist gut. Der Part des Pilatus. Das ist Theater. Gutes Theater. Ich rate Ihnen nochmals: Schreiben Sie endlich eine Oper, Teuerster!«
Er klappt das Buch wie endgültig zu: »Vergessen Sie alles fromme Gesinge! Das Lob des Herrn singen andere weit besser als Sie!« Der Hieb hat gesessen und hinterlässt eine Wunde, die sich so rasch nicht schließen will.
Händel und Mattheson bleiben Freunde. Aber es stimmt zwischen ihnen nicht mehr wie früher. Die nie ausgesprochene Meister/Schüler-Beziehung ist gestört, allzu dreist hat sich der Schüler über den Meister hinweggesetzt. Das gibt ihrem Verhältnis eine neue Spannung. Jedes Wort scheint jetzt einen Widerhaken zu haben, jeder Satz einen doppelten Boden, und Händel wagt kaum dem anderen zu erzählen, dass er tatsächlich an einer Oper schreibe.
Keiser selbst hat ihm das Buch in die Hand gedrückt: »Ich muss für einige Zeit in die Provinz. Meine Freunde, die Gläubiger, fragen etwas sehr hartnäckig nach ihrem Geld. Ich werde nach Weißenfels gehen, in unsere alte Heimat.« Er wie Händel stammen aus dem Sächsischen und genießen es, untereinander in den breiten Dialekt ihrer Heimat verfallen zu dürfen, ohne dass jemand darüber kichert.
»Hier ist ein Text aus dem Venezianischen. Der Friedrich Christian Feustking hat ihn ins Deutsche übertragen, nun ja.« Er wie Händel halten nicht viel von diesem schreibenden Theologen. »Ich habe mich schon selbst darum bemüht, aber es gelang nicht recht. Versuchen Sie es einmal, Händel!«
Händel vertieft sich in diese Geschichte von der unstandesgemäßen Liebe der kastilischen Königin Almira zu ihrem Sekretär, er seufzt mehr als einmal: »Wie soll ein Musikus was Schönes suchen, wenn er keine schönen Worte hat?« Und denkt lieber nicht an seinen Liebling Shakespeare. Dafür, nach kleiner Überwindung, bittet er schließlich Mattheson um seine Unterstützung, obwohl der gerade an einer eigenen Oper, »Cleopatra«, arbeitet.
Der scheint die unselige Passion vergessen zu haben, lässt sich fast täglich bei Händel sehen, prüft das Entstandene, verbessert, regt an. Die Spannung zwischen ihnen will jedoch nicht schwinden, und fast scheint ein jeder nur darauf zu warten, dass sie sich irgendwann entlädt.
»Sehr schön«, nickt schließlich Mattheson, als er die Arie des Liebhabers Fernando liest, den er selber singen soll, »fast so schön wie mein Marc Anton«. Diesen Part will er in seiner »Cleopatra« übernehmen. »Ich möchte Ihnen übrigens noch danken, dass Sie die ›Cleopatra‹ dirigieren wollen«, setzt er hinzu und wendet sich zum Gehen, »wer könnte das besser? Allenfalls ich selbst.«
Händel kennt Mattheson zu gut, um das als Scherz zu nehmen. Er lacht lediglich: »Sicher könnten Sie das. Wer wenn nicht der Komponist? Aber Sie stehen ja nun schon als Antonius auf der Bühne.«