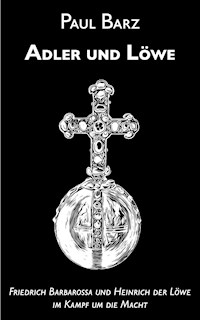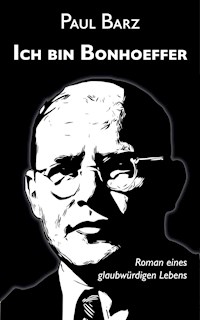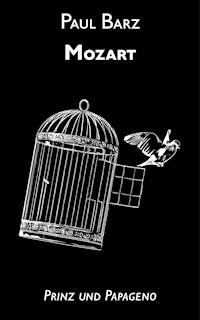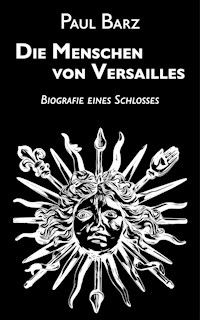Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geschichte und Landschaft der bekanntesten deutschen ErzählungWussten Sie dass der "Schimmelreiter" ursprünglich an der Weichsel galoppierte? dass Theodor Storm seine letzte Novelle wie einen "bösen Block" vor sich herschob? dass der "Schimmelreiter" auch in Japan und China gelesen wird?"Der Schimmelreiter", Theodor Storms umfangreichste und letzte Novelle, ist seit ihrem Erscheinen eine der beliebtesten deutschen Erzählungen geworden, erfolgreich auch im Ausland. Doch wie ist diese Novelle entstanden? Wo liegen ihre historischen und landschaftlichen Wurzeln? Und nicht zuletzt: Wer war der Mensch, der sie erschaffen hat als Mensch und als Dichter?In diesem erstmals 1982 erschienen Buch verknüpft Paul Barz europäische Geschichte mit Regionalhistorie, Literaturanalyse mit Biografie zu einer einzigartigen Erzählung einer Landschaft und ihres Dichters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Der wahre Schimmelreiter
Die Geschichte einer Landschaftund ihres Dichters Theodor Storm
Inhaltsverzeichnis
Begegnung mit dem Schimmelreiter
Nationalepos wider Willen
Der alte Mann von Hademarschen
Ein Leben lang »Husumerei«
Von Hauke Haien — und anderen Wiedergängern
Land aus Schlick und Wasser
Partner, Gegner: Blanker Hans
Götter sterben langsam
Im grauen Röcklein nickt der Puk
Das Geschäft mit den Deichen
Wer nicht will deichen …
Ein Mann, genannt Rollwagen
Sechstausend in einer Nacht
Die Welt des Hauke Haien
»Irgendwo hinter den Deichen«
Ein großer Herr aus Frankreich
Der kleine Mann von Fahretoft
Gespenstige Reiter
Galopp ins 19. Jahrhundert
Was ist des Friesen Vaterland?
Der Gast von der Weichsel
Der wahre Schimmelreiter
Hauke Haien — das bin ich
Der Ritt um die Welt
Die Erben Hauke Haiens
Zeitleiste
Theodor Storm und »Der Schimmelreiter«
Literatur
I. Theodor Storm
Gesammelte Werke (Auswahl)
Über Theodor Storm
Briefwechsel
II. »Der Schimmelreiter«
Einzelausgaben (Auswahl)
Über den »Schimmelreiter«
III. Nordfriesland
Herkunft der Nordfriesen
Geschichte der Nordfriesen
Deichbau, Landgewinnung, Sturmfluten
Recht, Wirtschaft, Verwaltung
Kulturgeschichte und Volksbrauchtum
Religion, Mythologie/Aberglauben
Nordfriesland und die Niederlande
Nordstrand
Husum
Coott/Rollwagen
Jean Henri Desmercieres
Hans Momsen
Anmerkungen
Über den Autor
Paul Barz
Helmut Barz
Impressum
Begegnung mit dem Schimmelreiter
Noch einmal ein Gang über die Deiche … Ein Geräusch inmitten der großen Stille, man wird überholt, sieht ein blasses Gesicht, ein schwarzer Mantel flattert: Schimmelreiter 1974. Nur ist das Weiße, auf dem er dahinjagt, kein Pferd. Es ist ein knatterndes Mofa …«
Mit diesen Sätzen schloss vor bald zehn Jahren eine Reportage in »Westermanns Monatsheften«. Sie hatte über Nordfriesland berichtet. Ihr Autor war ich.
Ich hatte den Auftrag nicht zufällig übernommen. Für mich war es auch die Wiederbegegnung mit einer Landschaft gewesen, in der ich fünfzehn Jahre zuvor längere Zeit gelebt hatte. Aus dieser Zeit waren Bilder geblieben: eisige Leere über winterlichem Watt; Herbststürme, mit denen eine wütende Natur dem Menschen ihre ganze Verachtung ins Gesicht zu klatschen schien; die tödlich sanfte Umklammerung der plötzlich am Strand aufsteigenden Nebelschwaden.
Doch gab es auch ganz andere Bilder: das milchige Pastell eines Sommermorgens, die friedvolle Weite der Marschweiden, den Blick über Vorland, Strand und Wasser mit seiner Ahnung von Unendlichkeit.
Fünfzehn Jahre später hatte ich überprüfen wollen, welche Bilder nun gültig waren für das Land zwischen Geest und Meer, die schönen oder die schrecklichen. Heute weiß ich: Die einen sind von den anderen nicht zu trennen. Beide gehören zu diesem Land. Und noch eine andere Erfahrung kam hinzu: Dieses Land lässt den nicht los, der sich einmal darauf eingelassen hat.
»In der Landschaft, wo ich geboren wurde, liegt, freilich nur für den, der die Wünschelrute zu handhaben weiß, die Poesie auf Heiden und Mooren, an der Meeresküste und auf den feierlich schweigenden Weidenflächen hinter den Deichen; die Menschen selber dort brauchen die Poesie nicht und graben nicht danach …«
Das stellt Storm an seinem siebzigsten Geburtstag fest. Auch ihn hat dieses Land nicht losgelassen, auch wenn seine Liebe zu ihm spröde war. Und das Meer, aus dem einst dieses Land hervorging, scheint er sogar gehasst zu haben. Zumindest hat er es gefürchtet. Dennoch ist er der größte Dichter dieser Landschaft geworden. Und in seinen letzten Jahren führt ihn die Wünschelrute sogar zu seinem größten Stoff, zur Geschichte vom »Schimmelreiter«, die ihn fast ein Leben lang begleitet hat und der er sich dann doch erst am Ende seines Lebens, fast schon zu spät, stellen sollte. Sie wurde nicht nur seine bekannteste Dichtung, sondern die meistgelesene deutsche Novelle schlechthin. Und sie ist zugleich auch die Geschichte dieser Landschaft.
Storm ist kein Historiker. Seinem Historiker-Freund Theodor Mommsen gegenüber zieht er im Jahr 1885, als sich bereits die Spuk- und Deichgeschichte ›mächtig‹ in ihm rührt, die Grenze zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung: »Historiker müssen auf das Ganze blicken; dem Dichter darf das einzelne nicht entgehen …«
Nicht anders verfährt Storm im »Schimmelreiter«. Er findet das Ganze im Einzelnen, im Schicksal des friesischen Kleinbauernsohnes und späteren Deichgrafen Hauke Haien, der im Deichbau seiner Heimat die entscheidende Neuerung des abgeflachten Deichprofils durchsetzt und schließlich in einer Sturmnacht zugrunde geht. Eine solche Geschichte hat nie stattgefunden, und einen Hauke Haien hat es nie gegeben. Dennoch spiegelt sich hier in poetischer Konzentration und bei aller Freiheit im Umgang mit historischen Details eine Landschaft mitsamt den Hoffnungen und Ängsten ihrer Menschen in einer so lupenreinen Genauigkeit, wie sie in der gesamten Literatur einzig sein dürfte.
Wir wissen, wie Storm gearbeitet hat. Wir kennen weitgehend seine Quellen. Sie führen durch wenigstens drei Jahrhunderte nordfriesischer Deichbaugeschichte, und wenigstens vier verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Zeiten haben für die Gestalt des Hauke Haien Modell gestanden. So ist die Geschichte vom »Schimmelreiter« eigentlich eine Montage, deren Rückführung auf ihre historisch gesicherten Momente zu einer anderen Geschichte hinführt, zum tausendjährigen Kampf des Menschen mit dem Meer, dem ›Blanken Hans‹. Diese andere Geschichte erzählt dieses Buch.
Es geht hier um den ›wahren Schimmelreiter‹, nicht im Sinne einer Enthüllungsstory oder beckmessernden Storm-Korrektur. Es geht um die Wechselbeziehung zwischen Literatur und historischer Entwicklung. Und es geht um den Dichter, dessen größtes Werk diese Wechselwirkung exemplarisch aufzeigt, auch in den Widersprüchen zwischen poetischer Erfindung und geschichtlicher Wirklichkeit.
Ich bin vor diesem Buch gewarnt worden. Dem Fremden von der Geest, hieß es, würde sich in Storms Heimat keine Tür öffnen, er würde keinen Gesprächspartner finden. Das Gegenteil, bis auf wenige Ausnahmen, war die Regel. Nur einigen kann ich an dieser Stelle für ihre Unterstützung danken: den Leitern und Mitarbeitern in Archiv und Museum des Schlosses vor Husum, denen der Theodor-Storm-Gesellschaft sowie des Nordfriesland-Museums im Husumer Nissen-Haus und schließlich den Mitarbeitern des Nordfriisk Instituuts in Bredstedt, ferner, über Nordfriesland hinaus, dem Landesarchiv Schleswig, dem Reichsarchiv Kopenhagen und dem Archiv des Braunschweiger Georg Westermann Verlags, dessen Briefwechsel mit seinem einstigen Autor Storm recht amüsante Einblicke in die eher robusten als lyrisch versponnenen Geschäftspraktiken des Husumer Dichters gibt.
Doch hat das Material zu diesem Buch nicht allein aus Archiven bezogen werden können. Wenigstens so wichtig war das persönliche Gespräch, nicht nur mit Historikern, Naturwissenschaftlern und Lokalpolitikern, sondern auch mit Lehrern, mit Pastoren, mit Bauern und Gastwirten. Nicht alle diese Gespräche wurden in Nordfriesland geführt. Ich denke an Unterhaltungen mit gebürtigen Ostpreußen zurück, die mich mit dem Schimmelreiter-Kult ihrer Heimat vertraut machten, an Diskussionen mit dem Berliner Schriftsteller Peter Baumann, der am Hauke-Haien-Koog einen sehenswerten Film zu Naturschutz-Problemen gedreht hat, an einen Abend mit der Schauspielerin Vera Tschechowa, die mir von der Arbeit an der (zweiten) »Schimmelreiter«-Verfilmung berichtete, und ich höre noch ihr herzliches Lachen, als sie von ihrer Darstellung der (bei Storm nur kurz erwähnten) Vollina als einem Marschen-Vamp, einer Deich-Magnani erzählte: »Ich musste so richtig die Böse sein …«
Wiederum nur einigen, stellvertretend für alle anderen, kann ich an dieser Stelle ausdrücklich danken: vor allem Reimer Kay Holander, Lektor am Nordfriisk Instituut und Autor einer eigenen, für die Vorarbeit zu diesem Buch ganz unentbehrlichen »Schimmelreiter«-Dokumentation, sowie Karl Ernst Laage, dem Sekretär der Theodor-Storm-Gesellschaft, ohne dessen unermüdliche Initiative und Einfallsfreude diese Gesellschaft mit ihren heute 1200 Mitgliedern aus über zwanzig Ländern kaum die zweitgrößte und sicher rührigste literarische Vereinigung in Deutschland geworden sein dürfte.
Es war nach einem Gespräch mit Laage über die Storm-Renaissance der letzten Jahre, als ich noch einmal ins sogenannte ›Hademarschen-Zimmer‹ des Storm-Hauses in der Husumer Wasserreihe 31 ging. Dort steht der Schreibtisch, an dem 1887/88 Storm seinen »Schimmelreiter« vollendet hatte, nicht hier in Husum, sondern rund achtzig Kilometer weiter südlich in Hademarschen. Jemand tritt an mich heran, einer der über zwanzigtausend alljährlichen Besucher der Storm-Gedenkstätte. Er fragt: »Können Sie mir vielleicht sagen, wo nun wirklich der ›Schimmelreiter‹ gespielt hat? Ich meine: Wo genau fand das alles eigentlich statt?«
Ich denke nach. Ich tippe schließlich auf das Braun der Schreibtischplatte: »Vielleicht hier, am ehesten …«
St. Peter-Ording, im Mai 1982
Paul Barz
Nationalepos wider Willen
»Jetzt aber rührt sich
ein alter mächtiger Deichsagenstoff
in mir, und da werde ich
die Augen offenhalten …«
Theodor Storm an Erich Schmidt
am 3. Februar 1885
Der alte Mann von Hademarschen
Der alte Mann ist krank. Nie ist er sehr gesund gewesen. Zu seinem Leben haben immer schon Beschwerden vieler Art gehört, »krampfige Nervenzustände«1, Herzschmerzen, allgemeines Unwohlsein. Aber dieser infernalische, dieser »vernichtende«2 Druck in der Magengegend, gegen den keine Hoffmannstropfen, kein Natron helfen, keine Hausmittelchen wie »Rothwein (mit einer auf der Apotheke vorhandenen Wurzel)«3 – es ist doch noch etwas anderes, eine furchtbare Drohung im eigenen Leib.
Weiß Theodor Storm, dass er Krebs hat?
Schon 1882 hatten sich erste Symptome gezeigt, ein Magenkatarrh, und binnen Kurzem war Storm so abgemagert, »dass ich Mützen auf meine Knochen hängen können«.4 Gegen Jahresende 1886 mehren sich die Anzeichen. Noch ist Storm mutig, verlangt eine schonungslos ehrliche Diagnose. Anfang 1887 wird sie gestellt: Magenkrebs.
Der Patient gibt sich gelassen.
Seinem Sohn Karl schreibt er: »Laß dich das häßliche Wort nicht erschrecken, viele Menschen haben es viele Jahre lang und sterben schließlich an einer anderen Krankheit …« Er tröstet sich selbst: »Das Beste ist, dass meine Muse mir treu geblieben ist und auch vormittags die Kräfte noch zur Arbeit reichen und hoffentlich noch lange reichen werden …«5 Doch der Optimismus ist gespielt. Der Lebensmut bleibt Schein. Den alten Mann packt Todesangst. Er versinkt in tiefster Resignation.
Ohnehin hat seine Schaffenskraft nachgelassen. Immer schwerer fällt es ihm, die richtigen Stoffe zu finden, so ängstlich er auch danach Ausschau hält. Kaum eine Reise — und sei es auch nur ein Besuch beim Sohn Ernst »in seiner spukhaften Amtswohnung auf der nordschleswigschen Heide«6 — vergeht ohne Hoffnung auf ein neues Novellensujet, und schon 1882 hatte er den Freund Paul Heyse um ein aufgespürtes »Novellenmotiv-Nest«7 beneidet. Doch jetzt scheint es auch für Storm soweit zu sein. Jetzt liegt auf seinem Tisch im resedagrün tapezierten Arbeitszimmer von Hademarschen Material zu einer neuen Arbeit. Da bricht nun diese niederschmetternde Diagnose über ihn herein. In ihrem Schatten scheint Storm alle neugeschöpfte Kraft zu verlieren. Er verbringt Tage im Bett, verharrt in dumpf-düsterer Apathie.
Die Familie, zahlreich und allgegenwärtig, entschließt sich zum frommen Betrug. Neue Untersuchungen finden statt. Im Haus des Dichters tritt ein Ärztekonsilium zusammen. Die Diagnose: kein Krebs, keine Lebensgefahr. Unendlich erleichtert schreibt Storm ein weiteres Mal an seinen Sohn: »Mich anlangend, so haben Onkel Aemil und sein kindlich liebenswürdiger Schwiegersohn Glaevecke, die ja Pfingsten bei uns waren, mich genau untersucht und mir gesagt, ich könne sicher sein, es sei kein Magenkrebs, habe mit dem Magen überhaupt nichts zu tun. Krebsartig sei die glatt anzufühlende Geschwulst überhaupt nicht. Sie halten es für eine Ausdehnung der Aorta, die in den Unterleib hinabgeht. Sie hatten zwar kein Hörrohr, dennoch meinten sie, angeben zu können, dass diese Ausdehnung schon mit geronnenem Blut gefüllt sei, wo sie nichts mehr bedeute, denn sonst müssten sie auch ohne Hörrohr das Geräusch hören können, das des sich durchdrängenden Blutes …«8
Glaubt er selbst, was ihm wohlmeinend vergegaukelt wird?
Er will es wohl glauben. Seine Angst bleibt. Und die Geschichte, an der er nun weiterarbeiten wird, enthält wenigstens einmal, an unauffälliger Stelle, eine bemerkenswerte Passage. Da spricht der Vater der Hauptgestalt von einer alten Frau und erwähnt, sie hätte Krebs, »die Krankheit unserer Marschen«.
Eine seltsame, geradezu verräterische Wendung: Schon das Wort ‚Krebs’ ist ein Ausdruck, der erst zu Storms Zeiten üblich wird. Seine Erzählung spielt aber im 18. Jahrhundert, als man nur von ›bösen Geschwüren‹ sprach. Wieso unterläuft ihm, der sonst so exakt in historischen Einzelheiten ist, gerade hierbei dieser verbale Anachronismus? Und warum, wichtiger noch, soll Krebs »die Krankheit unserer Marschen« sein?
Kirchenbücher, Vorläufer der Standesamtsregister bis 1874, weisen ›böse Geschwüre‹ keineswegs als besonders häufige Todesursache in Nordfriesland aus, viel seltener als beispielsweise die ›Auszehrung‹, die Schwindsucht. Warum also, ohne erkennbare Notwendigkeit, diese Verallgemeinerung?
Der Gedanke an eine typische Fehlleistung liegt nahe: Einer weiß, wie es um ihn steht. Er wird seinem Schicksal nicht entkommen können, auch das ist ihm bewusst. Doch will er im Sterben nicht allein sein. Seine Sprache sendet ein Signal.
Zum Typischen hin wird verallgemeinert, was sein ganz persönliches Schicksal ist. Ein Todkranker sucht Halt in der imaginären Gemeinschaft von Todkranken.
Um diese Zeit befindet sich Theodor Storm in seinem siebzigsten Lebensjahr: Ein gut aussehender alter Herr, nur mittelgroß, eine sehr gepflegte, man darf sagen: ansprechende Erscheinung. Zu seinem siebzigsten Geburtstag wird er sich fotografieren lassen: in ernster Pose, der Blick streng, fast bohrend. Doch andere Bilder aus dieser Zeit zeigen auch einen anderen Storm: heiterer, entspannter, Lachfältchen im Gesicht, voll ungeleugneter Lebenslust. So merkt denn auch sein Freund Wilhelm Jensen zu diesem ›offiziellen‹ Storm-Bild an: »Doch fehlt mir in allen das Eigentliche an ihm, das seelische Gepräge; wenigstens kenne ich keines, das den weichen Ausdruck der Züge, die Freundlichkeit des Blickes wiedergibt; sie erregen sämtlich die fälschliche Vorstellung einer eher zum Strengen neigenden Physiognomie …«9
Es ist also kein Spökenkieker und Misanthrop, kein grübelnd ernster Denker, der 1887 mit scheinbar neu gewonnenem Lebensmut zu seinem letzten Werk antritt und Freunden freudig meldet, er könne nun wieder einige Stunden am Schreibtisch ausharren. Seine Umwelt ist angenehm: »Mein Zimmer liegt oben in der Nordostecke; es würde sehr hell sein; aber mattresedagrüne Tapete und schwere Jutevorhänge geben dem Ganzen ein behaglich gedämpftes Licht. Nach Norden nur ein schmales Fenster — ich wollte die schöne Fernsicht auf den vorstoßenden Wald im Mittelgrund und weiterhin auf das im Spätherbst oft prächtig überschwemmte Tal der Gieselau nicht missen; ich sitze … an einem der Ostfenster, und, wenn ich aufblicke, schaue ich in die mit weichen Nebeln überdeckte Frühlingsferne. Ich bekenne: mir ist in diesem Augenblick recht wohl zu Sinne …«10 Das hatte er schon »am letzten April« 1881 geschrieben, als er gerade das neue Haus, seinen Alterssitz, das »Tuskulum«, bezogen hatte. Eigentlich ist es ein eher hässlicher Kasten, jedoch weiträumig und von einem besonders schönen Garten umgeben. Ihm gilt Storms ganze Liebe. Immer wieder berichtet er von Beeten, die er anlegt, von Bäumen, die er pflanzt. Schon während der Bauarbeiten war er jungenhaft vergnügt auf dem Gerüst herumbalanciert und hatte sich nur für Augenblicke schaudernd vorgestellt, er könne abstürzen, würde dort unten liegen, zerschmettert — vage Unsicherheiten, hinter denen sich die eine große Unsicherheit verbergen mag: Was macht er eigentlich hier, in Hademarschen, von Husum achtzig Kilometer weit entfernt?
Denn Husum bleibt die eigentliche Heimat.
In der Stadt hatte es Staunen, fast Entsetzen, »viel Geschrei«11 gegeben, als Storm mit seiner Familie nach Hademarschen übersiedelte, und auch auswärtige Freunde hatten gefragt, was denn den Erzhusumer Storm fortzieht aus seiner Heimatstadt. Er hatte als Amtsgerichtsrat um seine vorzeitige Pensionierung gebeten, das sah man ein. Er wollte nur noch Dichter sein, das verstand man gerade noch zur Not. Doch warum nun gleich weg aus Husum, wo in der Wasserreihe sein Haus stand und einen Straßenzug weiter, in der Hohlen Gasse, das Haus der Eltern, das er kurz zuvor geerbt hatte?
Die Eltern waren gestorben, 1879 die Mutter, vier Jahre zuvor der Vater. Für den Sohn war es ein Schock. Selbst schon ein Mann Anfang sechzig, gehörte er nun zur Generation, die als nächste ins Grab folgen würde. Der Lebenskreis schien ausgeschritten, Husum hatte am Anfang gestanden und würde nun am Ende stehen. Durch die »graue Stadt am Meer« geisterten jetzt die »Gespenster der Vergänglichkeit«.12
Storm wehrt sich. Dies soll noch nicht das Ende sein. Er probt den Ausbruch. Weit führt er ihn nicht, doch immerhin über Husumer Grenzen hinaus. Dort ist er der Herr Amtsgerichtsrat gewesen, der Honoratior, der Gründer eines angesehenen Gesangsvereins. Den Dichter Storm kennt man jedoch in Husum kaum. Zwar stehen seine Bücher in den Leihbibliotheken. Doch fraglich bleibt, ob sie auch jemand liest. Und noch nach seinem Tod wird ein Buchhändler seiner Heimat dem Freund Jensen versichern, dieser Storm hätte niemals in seinem Leben irgendwelche Gedichte geschrieben.
Jetzt aber will Storm nichts als Dichter sein. Die verbleibenden Jahre sollen ganz dem Werk gehören. Storm beschwört es geradezu: »Ich hoffe eine Verjüngung meines Lebens von diesem Vorhaben; vielleicht erstarkt dann auch der Poet noch wieder …«13 Und, geradezu auftrumpfend: »Man darf nicht in Erinnerungen schwelgen, wenn man noch etwas leisten will. Vorwärts!«14
Vorwärts — doch wohin?
Die erste Zeit von Hademarschen scheint noch wie von einem großen Aufatmen durchzogen. Die »bittre Sehnsucht nach etwas ruhigem Sonnenschein noch in dem eignen Leben«15 scheint erfüllt zu sein. Storm richtet sich ein, in jeder Hinsicht. Freunde finden sich, ein Kreis entsteht, der »club«. Man trinkt Tee, schlürft Punsch, man schwelgt in Literatur. Goethe ist der Favorit, mit »Faust«, mit »Iphigenie«. Aber auch Kleist wird gelesen, der »Michael Koolhaas«, und Lessings »Laokoon«. Neuerscheinungen treffen ein und werden diskutiert. Und dann liest der Meister selber vor, aus anderen und eigenen Werken.
Storm ist ein ›Erzähler‹ im eigentlichen Sinn. Stets schwingt in seiner Prosa der Duktus dessen, der sich da in seinem Stuhl zurücklehnt und zu erzählen anhebt, von Menschen, Landschaften, Stimmungen, plaudernd fast, zuweilen weitschweifig, ins sorgsam ausgekostete Detail verliebt. Besonders mag dieser Erzähler Spukgeschichten. Da erreicht dann seine Erzählkunst ihre Meisterschaft: Die Stimme sinkt ins geheimnisvolle Raunen, kunstvoll werden Spannungspausen gesetzt, der Blick aus den tiefblauen Augen weitet sich ins Visionäre — den einen schaudert’s angenehm, anderen kommt solches Wohnstubentheater eher komisch vor. Doch in Hademarschen hat Storm sein stets dankbar aufgeregtes Publikum.
Es ist also ein schönes Bild, das sich da bietet: der alte Dichter im Kreis der Freunde, im Schoß der Familie, wohlgeborgen im neugewonnenen Idyll, abgesichert durch Erfolg und Anerkennung.
Storm ist nicht geworden, was man einen ›Erfolgsautor‹ nennen könnte. Die ganz große Resonanz findet sein Werk erst nach seinem Tod. Doch immerhin ist er nun schon ein angesehener, auch ein gefragter und entsprechend gut bezahlter Autor, der Verleger gegeneinander auszuspielen und Honorare in die Höhe zu treiben weiß. Die größten Zeitschriften bewerben sich um seine Mitarbeit, er kann wählen, wo er publizieren will. Und so müsste Storm eigentlich zufrieden sein.
Seltsamerweise ist er es nicht.
Immer wieder zieht es ihn hinaus aus der Hademarschener Enge. Er geht auf Reisen, besucht Kollegen und Verleger, er fordert sie immer wieder auf, doch einmal auch ihn zu besuchen. Er wirbt geradezu um Gäste in sein ›Tuskulum‹. Im ungeliebt preußischen Berlin, wo er sich 1884 vier Wochen aufhält, bereitet ihm die noch weniger geliebte Presse einen festlichen Empfang, und Storm darf sich angenommen, geehrt, umschmeichelt fühlen. Er gesteht: »Nicht leugnen kann ich, auf dem Fest selbst war es sehr nett …«16 Und als 1880 zu seinem Geburtstag Glückwünsche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eintreffen: »So etwas freut einen doch«. Er darf feststellen: »Am Ende meines Lebens sehe ich denn doch, dass ich mich zwar langsam, aber allmählich denn doch wirklich in das Herz unseres Volkes hineingeschrieben habe …«17
Genau das ist es, was Storm sucht und braucht: nicht nur als reputabler Bürger geachtet, sondern als Dichter geliebt zu werden. Das hat ihm sein Husumer Umkreis nicht geboten. Das bietet ihm auch Hademarschen nicht. Unruhe befällt ihn: War es richtig, sich ausgerechnet hierher zurückzuziehen? Er ist doch frei, endlich ungebunden, an kein offizielles Amt gefesselt. Er könnte nach Kiel, Lübeck oder Hamburg ziehen. Doch bleibt es beim Gedankenspiel. Nur eines führt ihn wirklich über Hademarschen hinaus: die Arbeit.
Vor allem Lyrik, neben seiner Erfolgsnovelle »Immensee«, hat ihn bekannt gemacht. Er selbst empfindet sich vorrangig als Lyriker. Doch jetzt schreibt er keine Lyrik mehr. Dafür entstehen neue Erzählungen, und man könnte meinen, ihren Themen müsse sich der fröhliche Elan dieser ersten Hademarschener Jahre mitteilen. Doch das Gegenteil trifft zu.
»Der Herr Etatsrat« zum Beispiel, die erste in Hademarschen geschriebene Novelle, die später noch im Zusammenhang mit dem »Schimmelreiter« eine Rolle spielen wird: die wüste, allenfalls komisch-groteske Geschichte eines despotischen Trinkers und seiner »Familie in der Zerstörung«.18 Oder »Ein Doppelgänger«, deren Hauptgestalt das wohl grausigste Ende aller Storm-Helden nimmt: John Hansen, genannt Glückstadt, stürzt in einen Brunnen, bricht sich die Gliedmaßen und verendet elendig. Und schließlich »Ein Bekenntnis«, zu einer Zeit geschrieben, da sich bei Storm schon das Material zum »Schimmelreiter« häuft: Ein Arzt tötet aus Mitleid seine krebskranke Frau und erfährt erst danach, dass diese Art von Krebs hätte geheilt werden können. Man denke: Ein Krebskranker schreibt über das eigene Leiden — wie es zuweilen scheinen will, als schreibe sich der Storm dieser Hademarschener Zeit alle persönlichen Ängste und Schreckgesichte vom Leib. Allmählich aber, wie in großen, zögernden Bögen, nähert er sich dem einen Stoff, dem »Schimmelreiter«.
Das erste erkennbare Zeichen erhält schon im Februar 1885 der Freund Erich Schmidt: »Jetzt aber rührt sich ein mächtiger alter Deichsagenstoff in mir, und da werde ich die Augen offenhalten; aber es gilt vorher noch viele Studien zu machen …«19 Bereits eine längere Weile scheint sich in ihm dieser Deichsagenstoff gerührt zu haben. Denn als Storm dies schreibt, hat er mit den ›vielen Studien‹ schon angefangen und wird bald darauf die Frau eines Freundes bitten: »Zu einer neuen Arbeit, die sich in meinem Kopf festsetzen will, möchte ich gern eine kleine, nur ganz flüchtige Skizze der Landtheile von Nordstrand, Husum, Simonsberg haben, wie es eben vor der großen Fluth von anno 1634 war. Die Deiche, wenn solche angegeben sind, möglichst deutlich, sowie die Ortsnamen …«20
Dieser Freund heißt Christian Hinrich Eckermann, ist Bauinspektor in Heide und wird später eine Reihe von Aufsätzen über den Deichbau und seine Geschichte verfassen, die lange Zeit als das Standardwerk zum Thema gelten. Für Storm wird diese Freundschaft zum Glücksfall, denn ohne Eckermann hätte es wahrscheinlich keinen »Schimmelreiter« gegeben. Besuche bei Eckermann werden getreulicher Turnus, noch im Dezember 1887 holt er seinen Rat ein, erfährt alles über Deichbau und Landgewinnung und wird sich schließlich vom Freund geschmeichelt bestätigen lassen, allmählich könne er nun schon selbst einen Koog eindeichen.
Dennoch aber, trotz dieser Beratung: Dem an sich rasch schreibenden Storm, der in der Regel für eine längere Novelle nur wenige Wochen ansetzt, geht gerade dieser Stoff auffallend langsam von der Hand. Nicht weniger als anderthalb Jahre braucht er allein für die Vorbereitung, eine lange, eigentlich schon überlange Zeit, und sie wird nicht nur durch Storms anfällige Gesundheit erklärt. Er scheint geradezu Angst vor diesem Stoff zu haben. Einmal, dem Freund und Kollegen Paul Heyse gegenüber, gibt er es offen zu: »Vor der Deichnovelle habe ich einige Furcht!«21 Und dabei hat er doch »große Lust, eine Deichnovelle zu schreiben …«22 Woher also die Furcht, bei gerade diesem Stoff?
Die Thematik steht fest. Es wird um einen spukenden Deichgrafen gehen. Auch der Titel ist gefunden. Und dennoch zögert Storm. Dabei ist es schon verwunderlich genug, dass er, ständig auf Stoffsuche, überhaupt erst jetzt und nicht schon viel früher auf diese Materie gekommen ist, auf die Welt unmittelbar an der Küste und ihre Probleme des Deichbaus und der Landgewinnung.
Schon als Kind hatte er die erste große Sturmflut erlebt. Das Reich der Köge und Deiche liegt vor Husums Tür. Der Vater ist Koogschreiber gewesen. Er selbst, als Amtsrichter, dürfte oft genug Deichproblemen begegnet sein. Und hat er, als Dichter, nicht schon oft aus persönlichem Erleben geschöpft, hat Vertrautes, Menschen wie Hintergründe, in seine Novellen eingehen lassen? Seine Heimatliebe wird geradezu sein Etikett, sie trägt ihm, zu Lebzeiten und eigentlich bis heute, den Stempel eines Heimatdichters ein — doch zu diesem zentralen Thema seiner Heimat findet er nun erst in seiner allerletzten Schaffensphase.
Und mehr als das: Storm hat diese Thematik nicht nur ausgespart. Er scheint sie sogar bewusst gemieden zu haben. Denn dem Stoff selbst begegnet er nicht erst in Hademarschen. Schon lange vorher ist er ihm vertraut. Seit wann aber genau: Das ist die große Frage bei der Entstehungsgeschichte des »Schimmelreiters«.
Die Tochter Lisbeth erfährt im Februar 1885: »Jetzt spukt eine gewaltige Deichsage, von der ich als Knabe las, in mir …«23 Auch anderen gegenüber deutet er wiederholt an, dass er schon als Kind diese Deichsage kennenlernte. Und schon 1873 hatte er eine Studie einer wichtigen Gestalt seiner Jugend gewidmet, der Bäckerstochter Lena Wies. Von ihr, meint er, hat er erzählen gelernt: »Und wie erzählte sie! — Plattdeutsch, in gedämpftem Ton, mit einer andachtsvollen Feierlichkeit …«24 Es waren vor allem Spukgeschichten gewesen, die sie erzählte. Dazu aber, so Storm, hatte auch die Geschichte vom »Schimmelreiter« gehört, »der bei Sturmfluten nachts auf den Deichen gesehen wird, und wenn ein Unglück bevorsteht, mit seiner Mähre sich in den Bruch hinabstürzt …«25
Mehr als ein Dutzend Jahre später jedoch, als er nun selbst diese Geschichte zu erzählen anhebt, ist von Lena Wies keine Rede mehr. Die Tochter erfährt, dass sie der Vater als Knabe gelesen hat, und die ersten Sätze der Erzählung deuten auch gleich an, wo er sie las: »Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder Pappes Hamburger Lesefrüchten …«
Der Fall wird noch komplizierter.
Es war in den vierziger Jahren gewesen, als Storm gemeinsam mit seinem Studienfreund Theodor Mommsen Sagen und Märchen der Heimat gesammelt hatte. Auch schon damals spukte in ihm die Geschichte vom Schimmelreiter, er hatte danach gesucht, allerdings vergeblich. Und dem drängenden Mommsen teilte er schließlich mit: » … habe ich das Wochenblatt, worin er abgedruckt war, noch nicht gefunden …«26
Also diesmal nichts von seiner Knabenzeit, auch nichts von Lena Wies: Stattdessen erwähnt auch hier schon Storm, er hätte die Geschichte gelesen — und zwar in einem Wochenblatt.
Heute wissen wir, wo er sie gelesen hat: tatsächlich in den erwähnten »Hamburger Lesefrüchten«, und zwar im Jahr 1838. Hierauf bezieht sich Storm denn auch gleich im ersten Absatz seiner Novelle, wenn er dort ein rührendes Idyll zeichnet: Die Urgroßmutter im Sessel, er als Kind an ihrer Seite, sie streicht ihm mit sachter Hand über das Haar, während er in seine Geschichte vertieft ist …
Dieses Idyll hat einen Fehler: Es hat so niemals stattgefunden. Denn im Jahr 1838 ist Storm ein bereits recht ausgewachsener Mann von bald einundzwanzig Jahren, und seine Urgroßmutter, die »Frau Senator Feddersen«, seit bald neun Jahren tot — warum aber erwähnt er sie dann? Warum erweckt er von sich selbst den Eindruck eines Kindes, gibt sich der Tochter gegenüber als ein ›Knabe‹ aus, der die Geschichte las? Allein der rührenden Wirkung wegen? Und wieso erinnert sich der alte Mann noch halbwegs genau an die Quelle, während er sie nur fünf Jahre nach der Lektüre, in seinem Brief an Mommsen, bereits wieder vergessen zu haben scheint?
Auf all diese Fragen gibt es manche mögliche Antwort, und die nächstliegende ist zugleich auch die unwahrscheinlichste: dass Storm bewusst von seiner Quelle ablenken, ein Plagiat vertuschen wollte. Denn dann hätte er es bei dem Hinweis auf Lena Wies bewenden lassen können. Dann wäre der Hinweis auf die »Hamburger Lesefrüchte« doppelt ungeschickt. Erwägen wir eine andere, nicht rationale, doch zum Persönlichkeitsbild des alten Mannes von Hademarschen passende Möglichkeit: Ob bewusst oder unbewusst — bei gerade dieser Novelle, die »gut werden« muss, »da sie so heimathlich ist«27, vermag sich der schon vom Tode gezeichnete Dichter nicht von der Vorstellung zu lösen, es sei ein Teil seiner Kindheit, die er damit beschwört. Auch wider besseres Wissen muss es der Knabe Storm gewesen sein, der die Geschichte las. Und so setzt denn auch seine Erzählung ein:
Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte; ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den ›Leipziger‹ oder von ›Pappes Hamburger Lesefrüchten‹. Noch fühl ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über Achtzigjährigen über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben; vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen; nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe …
Also gleich zu Beginn sehnsüchtiges Moll, wehmütiges Erinnern, der Gedanke an Ende und Vergänglichkeit — und Storm ist mit dieser Eingangsreminiszenz gleich auch an den Ort zurückgekehrt, von dem er immer wieder fortging, um doch immer wieder heimzukommen in »die graue Stadt am Meer«. Sie hat ihn ein Leben lang nicht losgelassen.
Ein Leben lang »Husumerei«
Mit der Geburt fängt es an.
Es ist Mitternacht, als das Kind geboren wird. Die Kirchenbücher werden den 15. September als Datum nennen. Die Mutter besteht jedoch darauf, dass es noch der 14. September war. Storm selbst, da sie es »doch am besten wissen«28 müsste, schließt sich an, und seine Biografen folgen ihm. Also das Geburtsdatum: der 14. September 1817.
Ein Rest Ungewissheit bleibt.
Dieses Ungewisse scheint auch gleich symptomatisch, für Werk wie Person: Wer ist nun dieser Theodor Storm? Der Goldschnittlyriker, ein Spezialist für ›Stimmungen‹, ein ›Heimatdichter‹, achtbar zwar, doch tief provinziell? Oder einer, dem sich die Welt in der Nussschale bot und der gerade deshalb ›Weltliteratur‹ schaffen konnte? Wie steht es um seine Weltanschauung, seine soziale Position? Wie ernst sind sein Atheismus, seine Kirchenfeindlichkeit zu nehmen? Wie sind sein Preußenhass, sein demokratisches Engagement zu verstehen? Hat er wirklich in seinen letzten Jahren mit der aufkommenden Sozialdemokratie sympathisiert? Oder ist er ganz und gar der ›Bürger‹, auch in seiner Weltanschauung? Wie steht es überhaupt mit seinem politischen Bewusstsein, wie mit seinem Nationalismus?
Beginnen wir mit der Nation:
Er wird in Husum geboren, und dieses Husum gehört zu Schleswig, Schleswig wiederum zu Dänemark. Also ist er dänischer Untertan, wird sich jedoch nie als Däne fühlen und beim Schleswiger Kampf gegen Dänemark sogar ein entschiedener Dänengegner sein, Feind, der »kleinen Geßlers«29, die im dänischen Auftrag über seine Heimat herrschen — doch was ist er dann, dieser Spross sowohl einer friesischen wie einer niedersächsischen Familie? Kann man von einem Deutschen sprechen, da es doch um diese Zeit ein Deutschland als politische Einheit gar nicht gibt?
Auf dem Lübecker Gymnasium werden sie ihm ›Schuckelmeyer‹ hinterherrufen, den Spottnamen für Deutsche aus dem dänischen Bereich, und er selbst, seine Angehörigen sprechen vom ›Ausland‹, wenn sie Deutschland meinen. Er wird dann während der harten Potsdamer Jahre sehr böse Worte für den deutschen Nationalismus finden. Aber es gibt auch eine Zeit, da seine Einstellung als ›deutsch-national‹ umrissen werden kann. Die Ernüchterung bleibt nicht aus. Die Reichsgründung von 1871 wird in ihm keinen Barden haben. Schon zuvor hatte er festgestellt: »So einigt man Deutschland nicht!«30
Wo aber liegt sein Vaterland?
Man darf wohl sagen: letztlich nur in Husum selbst, in dieser Stadt mit ihren wenig mehr als dreitausend Einwohnern. Ihre große Zeit hat sie längst hinter sich, als Storm geboren wird. Nur noch als größter Viehmarkt an der Westküste spielt sie eine gewisse wirtschaftliche Rolle, und das Geblöke der über den Ochsenweg nach Husum getriebenen jütischen Herden, das Geklapper der hochhackigen Holzschuhe ihrer dänischen Treiber, das Rollen der Wagen, in denen die reichen Viehhändler mit ihren eisenbeschlagenen Geldtruhen den Herden folgen, durchhallen denn auch die Kindheit des Hans Theodor Woldsen Storm, der da im September 1817 zur Welt kommt, während gerade ein schweres Gewitter über seiner Heimatstadt niedergeht.
Den ersten Namen hat er nach dem Vater, den dritten, einen sogenannten ›Zwischennamen‹, nach der Familie seiner Mutter erhalten. Der zweite ist dazwischengerutscht, da er den Eltern ›zierlich‹ in den Ohren klang. Es ist aber dieser zweite Name, unter dem er bekannt wird, und so heilig wird er sein, dass später der eigene Sohn nicht wagen wird, Storms Enkel »deinen Poetennamen zu geben«31. Er bleibt dem Dichter vorbehalten.
Doch wie kommt ein Dichter in gerade diese Familie?
Der Vater stammt von einem Bauernhof in der Geest. Er selbst ist Advokat und so angesehen, dass er als ›de ole Storm‹ gleichsam zum Inventar der Stadt gehört, ein ernster, in sich versunkener Mann von solch umfassender Humorlosigkeit, dass sie selbst dem gleichfalls nicht sehr humorbegabten Sohn auffällt. Diesem Sohn wird ›de ole Storm‹ ein guter Vater sein, aber mehr auch nicht, und dass er da einen Dichter von Rang gezeugt hat, übersteigt entschieden sein Fassungsvermögen. Vielleicht weiß er auch gar nicht so genau, was eigentlich ein Dichter ist. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass Storm nicht von dieser Seite her die künstlerische Ader hat.
Anders die Mutter: Sie immerhin, will man Storm glauben, hat musische Neigungen. Doch ›Frohnatur und Lust am Musizieren‹ sind wohl auch bei ihr nicht vorhanden. Eine seltsame Kühle liegt über ihrer Beziehung zum Sohn, und wenigstens einmal — noch der alte Storm wird sich daran erinnern — kommt es zu einem bedenkenswerten Zwischenfall: Da gibt sich die Mutter ungewöhnlich herzlich, und prompt fragt sich der Sohn, was sie damit wohl bezwecke. Er ist gerade vier Jahre alt. Und dieser Vierjährige kommt zum Schluss, die Mutter tarne sich nur, tue nur so freundlich. In Wahrheit wolle sie ihn — ermorden.
Doch ist Lucie Storm, geborene Woldsen und Tochter eines der angesehensten Patriziergeschlechter der Stadt, nicht die einzige Frauengestalt in dieser Kindheit. Es gibt die Urgroßmutter, die Frau Senator Feddersen, eine grande dame der Husumer Gesellschaft. Es gibt die Großmutter, so überströmend herzlich wie die Mutter kühl-unnahbar. Diese drei Frauen bestimmen die Welt des Kindes, während sich der Vater mehr an die Peripherie verwiesen sieht. Er bleibt der ›Westermöhlner Burjung‹. So nennt er sich selbst. Und verzieht sich knurrend aus dieser Weiberwelt. In den Erzählungen dieser Frauen singt und schwingt sie aber mit: die Erinnerung an eine glanzvolle Vergangenheit. Denn auch die Woldsens haben ihre große Zeit längst hinter sich. Einst sind sie die reichste Familie der Stadt gewesen. Sie stellten Bürgermeister und ließen zur Weihnacht für die Armen einen Ochsen schlachten. Jetzt aber umweht auch sie der Hauch aller Vergänglichkeit, und diese Ahnung von Vergänglichem wird Storm ein Leben lang begleiten.
Noch der alte Mann von Hademarschen hört verzückt das Lied der Nachtigall und wird doch gleich auch an die Elstern denken, die schon auf den kleinen Sänger lauern. Er schmeckt noch den Erfolg seiner letzten Novelle und seufzt doch nur, dies sei zu spät. Und vornehmlich in der Vergangenheit wird er denn auch die Stoffe einiger seiner besten Novellen finden. Auch »Der Schimmelreiter« gehört dazu.
Dennoch hat Storm, was man eine ›schöne Kindheit‹ nennt.
Die Erziehung ist freizügig, die Schule keine Last. Storm darf sich seine Freunde selber suchen, in allen sozialen Schichten, und die Definition dessen, was er selbst nun ist: Patrizierspross, Bürgersohn, bäurischer Nachfahr— in diesem Kreis bleibt sie ihm erspart. Und ist der Himmel über Husum wieder einmal grau, tropft es trostlos auf das Buckelpflaster, so ziehen sich die Kinder in die große Tonne im Elternhaus an der Hohlen Gasse zurück, wohlgeborgen vor der Welt der Erwachsenen. Und dort werden dann Geschichten erzählt, am liebsten von Spuk und Gespenstern.
Wir sehen sie vor uns, diese Husumer Jungen und Mädchen mit der Handlaterne auf den Knien. Wir hören ihre plattdeutsch raunenden Stimmen, wie sie von Erntekindern und Sargfischen erzählen, von Luftgeistern und Klabautermännern — und aus dem Gespinst dieser Phantasien steigt ein anderes Husum herauf, nicht das des Viehmarkts und seiner zahllosen Kneipen. Dieses andere Husum ist eine Gespensterstadt, wo Hände aus den Wänden wachsen, Verstorbene an ihrem Todestag jämmerlich stöhnen, Spukgestalten durch die nächtlichen Gassen humpeln. Und auch das Stormsche Elternhaus ist nicht verschont. Dort rumpelt an bestimmten Tagen unsichtbar, doch nicht zu überhören eine Totenlade die morschen Stiegen hinunter und kündet von Tod und nahem Untergang …
So setzt sich diese Kindheit aus vielerlei zusammen, aus graugestrichelter Nostalgie, fröhlich-ruppigem Gassenjungentum, aus Husums nebelverhangener Gegenwart und doppelbödiger Vergangenheit — und dieses Husum ist es, von dem sich Storm nie mehr lösen wird. Er liebt es nicht nur, er leidet auch darunter, und schließlich wird er es in einem seiner schönsten Gedichte beschwören. Es ist sein wahrscheinlich bekanntestes Gedicht überhaupt, und mit ihm wird auch die Stadt berühmt, die es besingt. Am Ende kann man kaum noch ihren Namen nennen, ohne dass die Zeile von der ›grauen Stadt am Meer‹ zitiert wird, es ist geradezu Husums Nationalhymne geworden, so wie »Der Schimmelreiter« Nationalepos für ganz Nordfriesland wird. Doch empfiehlt sich genaue Lektüre:
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohne Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras …
Soweit die ersten beiden Strophen — und schon müssen wir uns fragen: Ist es eigentlich ein sehr schönes, gewinnendes, ein romantisch verklärendes Bild, das da Storm von ›seiner‹ Stadt entwirft? Schwingt nicht gar in der Zeile » … es schlägt im Mai kein Vogel ohne Unterlaß …« so etwas wie Ironie mit, die Parodie auf herkömmlich romantische Naturklischees? Und Storm fährt fort:
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, Du graue Stadt am Meer.
Auf dieses ›doch‹ kommt es an. Das setzt den bestimmenden Akzent. Storm verleugnet nicht die dumpfe Enge seiner Heimat. Er schönt sie nicht, im Gegenteil: Er überzeichnet noch ihre graue Hässlichkeit, stellt sie fast provozierend heraus. Dann erst setzt er zur Konfession an, hält fest, dass doch, trotz aller Hässlichkeit, sein Herz daran hängt, weil eben »der Jugend Zauber für und für« darüber ruht. Husum bleibt die Stätte seiner Kindheit. Sie ist das Paradies, aus dem er nicht vertrieben werden kann.
1835 ist diese Kindheit vorbei. Storm überschreitet erstmals Husumer Grenzen. Im ›Ausland‹, in Lübeck, besucht er zwei Jahre lang das dortige Katharineum.
Lübeck: Das ist nicht nur eine andere Stadt, sondern auch eine ganz andere Welt. Und wichtiger noch als das schließlich erteilte Abgangszeugnis, das Storm als einen eher mittelmäßigen Schüler ausweist, wird für den angehenden Dichter ein ihm völlig neuer Umgang mit dem Medium Literatur.
Schon der Halbwüchsige hatte seine ersten Verse gemacht, »eine inhaltslose Spielerei«32, wie der Siebzigjährige rückblickend meint. Doch nur einmal, am Ende seiner Schulzeit, war er mit einem eigenen Epos an die Öffentlichkeit getreten und vom Rektor mit dem solchen Herren zuweilen eigenen Scharfblick belehrt worden, »er sei kein Sänger«33. Erst in Lübeck »wird der Ton ein anderer«34. Hier findet er Zugang zu literarisch ambitionierten Salons des Großbürgertums, und dort wird Dichtung nicht nur gelesen. Sie wird auch kommentiert, diskutiert, kritisiert, wird ernstgenommen als selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens.
Storm lernt Eichendorffs Gedichte kennen, er liebt sie sein Leben lang. Er begegnet Goethes »Faust«, und der Eindruck wird sich selbst noch auf den »Schimmelreiter« auswirken. Und dann tun sich ihm »die Tore einer neuen Welt«35 auf: Er liest »Das Buch der Lieder« von Heinrich Heine.
Eine bemerkenswerte, wiederum lebenslange Affinität zeichnet sich ab: zum Weltmann aus Düsseldorf, zu diesem Juden, der in Deutschland als Franzose und in Frankreich als Deutscher, überall aber als Jude gilt, zum großen Heimatlosen, Unbehausten der deutschen Literatur. Storm wird kein Heine-Schicksal erleiden. Er endet nicht in der Matratzengruft — und doch besteht hier eine Form der inneren Verwandtschaft, die sich nicht nur in Storms Werk auswirkt. Heine ist für Storm das Ideal eines Dichters schlechthin. Und als ihn später der Freund Fontane in einer Rezension seine Lyrik zwischen Mörike und Heine stellt, wird Storm zwar über den Mörike-Vergleich geschmeichelt sein, zugleich aber beharren: »So rückt mich doch die große Reizbarkeit meiner Empfindung wieder näher an Heine …«36
Die ›reizbaren Empfindungen‹, die hier Storm für sich in Anspruch nimmt: Sie sind ihm gewiss eigen, machen den Bürger zum Künstler. Jedoch wird Storm den Absprung in eine Künstlerexistenz niemals wagen. Er wird äußerlich immer der Bürger bleiben und will dabei das eine wie das andere sein, der Bürger und ein Künstler, würdig sowohl der Welt, der er entstammt, wie der anderen, nach der er sich sehnt. Diesen Zwiespalt wird Storm nie verwinden, und noch nach seinem Tod findet sich ein Manuskript, wahrscheinlich das letzte, das er schrieb und in dem er trotzig darauf pocht, Schriftsteller könne schließlich ein ›richtiger‹ Beruf sein, so anständig wie jeder andere. Und er ist auch kein Thomas Mann, der zwei Generationen später diesen Konflikt zur Kunst- und Existenzform erhebt. Storms Zweifel bleiben frei von Selbststilisierung. Er empfindet sie ganz ursprünglich, geradezu im physischen Sinn, als er beispielsweise angesichts der lebenslangen Sorge um den alkoholsüchtigen Sohn Hans ernstlich fragt: »Sollte die künstlerische Anlage oder Tätigkeit die Nachkommenschaft beeinträchtigen, sollte da etwas verbraucht werden, was jenen zugute kommen müsste …«37
Wieder also der ungewisse Schatten über dieser Existenz: Wer ist Storm eigentlich? Was hält und führt ihn? Was gibt seinem Dasein die letzte innere Berechtigung?
Er studiert, ohne Eifer, Jura, zunächst in Kiel, dann in Berlin — und Berlin wird seine erste erschreckende Begegnung mit einer nun wirklich großen, einer Großstadt. Hier Berlin, hellwach, schandmäulig, aggressiv, dort der Ankömmling aus dem verschlafenen Husum, für den sich diesmal keine Welten auftun. Wir sehen ihn durch leere Straßen irren, sehnsüchtig zu hellen Fenstern hinaufstarren — sie bleiben ihm verschlossen. Er flüchtet nach Kiel zurück, findet im Brüderpaar Theodor und Tycho Mommsen Freunde, die ihm Partner sein können, Gefährten beim eigenen geistigen Höhenflug.
Solche Freunde, in dieser unmittelbaren Nähe, sind in seinem Leben selten. Sie durchziehen als Gäste seine Welt oder werden — wie Turgenjew oder der alte Wilhelm Raabe — von ihm selbst besucht, sie sind ihm Partner bei seiner selbst für das brieffreudige 19. Jahrhundert ungewöhnlich umfangreichen Korrespondenz. Den engeren Umkreis aber, den täglichen Umgang, bestimmen, ob in Husum, Heiligenstadt oder schließlich in Hademarschen, andere Freundschaften, mit liebenswerten Honoratioren, mit Bürgern eben. Sie achten den Dichter in ihrer Mitte, sind vielleicht stolz auf ihn. Aber wirkliche Gesprächspartner können sie ihm nicht sein. Bei aller Herzlichkeit solcher Beziehungen bleibt doch Storm in ihrem Kreis allein—und die Suche nach den anderen beginnt, nach jener anderen Welt, zu der er, der Künstler, doch viel eher gehört als nach Husum oder Hademarschen.
Der Strom seiner Briefe setzte ein, reißt nicht ab, an Fontane, Heyse, Emil Kuh, an Mörike, Erich Schmidt, schließlich an Gottfried Keller, dem er gleich in seinem ersten Schreiben beteuert: »Fürchten Sie nicht, liebster Keller, sich einem Schreibseligen verbunden zu haben …«38 Genau das ist aber Storm: schreibselig. Er muss es sein. Es ist seine Art, der eigenen Einsamkeit zu entkommen.
Dieser Einsamkeit wird sich Storm erstmals 1842 bewusst, als er sich nach überlanger Studienzeit als Anwalt im vertrauten Husum niederlässt, das ihm so vertraut inzwischen nicht mehr ist. Er schreibt an Mommsen: »Mir fehlen Freunde, ich habe hier keinen, der mir einigermaßen näherstünde; die jüngeren Leute sind zu verschieden von mir, namentlich Setzer, dass ich die kleinste meiner Handlungen grade vor Leuten, auf die ich durch die socialen Verhältnisse angewiesen bin, einer schonungslos mißkennenden Kritik ausgesetzt sehen muss …« Es folgt ein Hilfeschrei: »Ich habe eine rechte Sehnsucht, Sie wiederzusehn … um gut vierzehn Tage komme ich nach Hamburg. Sie müssen da sein!«39
Solchen Ruf wird er noch häufig ausstoßen, und oft wird er erhört. Oft muss er aber auch feststellen, dass diese andere Welt, wird sie Wirklichkeit wie bei seinem Treffen mit Iwan Turgenjew vor dem mondänen Hintergrund des Weltbads Baden-Baden, eben doch nicht seine Welt ist und er der Mann aus Husum bleibt, »im Anfang etwas ungewandt«40, wie ihn ein späterer Freund, der noch blutjunge Erich Schmidt, ebenso sachlich wie kaltschnäuzig beschreibt.
Dreierlei bestimmt diese seine zweite, bis 1853 dauernde Husumer Zeit: Dichtung, Ehe — und Politik.
Die Dichtung zunächst: 1852 erscheinen erstmals zum Buch zusammengefasst seine Gedichte und werden, sagen wir’s höflich, ein Achtungserfolg. Den Poeten kränkt das schwache Echo tief. Aber auch sein erster richtiger Erfolg macht ihn nicht recht glücklich. Er hat ihn mit seiner Erzählung »Immensee«, und tatsächlich wird gerade diese Novelle, wie der »Werther« für Goethe, der einzige wirklich populäre Großerfolg sein, den Storm zu Lebzeiten kassieren kann. Schon um die Jahrhundertwende liegen mehr als sechzig Auflagen vor, und Storm, dem »der übertriebene Wert … nicht angenehm«41 ist, läuft Gefahr, für alle Zeiten zum »Immensee«-Autor abgestempelt zu sein. Erst der noch erfolgreichere und vor allem dauerhaftere »Schimmelreiter« ändert das.
Aber nicht nur der Dichter, auch der Ehemann und Liebhaber durchleidet seinen Zwiespalt.
Storm ist kein Schönling, aber doch ein recht interessanter Mann. Und er ist der Typ des homme à femme. Er liebt Frauen, er braucht sie. Und noch der alte Mann sieht freundlich auf diese und jene und seufzt beim Auftritt einer katzenhaften Femme fatale während einer Hamburger Sardou-Aufführung: »Das Weib wird mir zu gefährlich.«42 Seine ihm 1846 angetraute Cousine Constanze setzt ihn solchen Gefahren seltener, wohl zu selten aus, und so findet er schließlich die bei seiner Frau vermisste »Leidenschaft«43 bei einer anderen, Dorothea Jensen. Ob nun aus übergroßem Edelmut, aus weiblichem Pragmatismus oder schlicht aus erotischem Phlegma heraus: Constanze macht den ernst gemeinten Vorschlag einer menage à trois. Sie will die Nebenbuhlerin als Freundin im eigenen Haus aufnehmen — und das vor Husums biederem Hintergrund!
Der sich anbahnende Skandal wird gerade noch abgewendet. Dorothea Jensen zieht entsagend davon, zurück bleibt das in seiner Beziehung gefestigte Ehepaar Storm, und der Vorgang könnte immer noch Wasser auf feministische Mühlen sein: Der Mann kommt davon, die Ehefrau steht brav in seinem Dienst, gebärt ihm sieben Kinder, ist das brave Hausmütterchen — und irgendwo in der Ferne verblüht die Freundin zum alten Mädchen, das keinen anderen Mann mehr lieben wird. Doch hat ihr Roman noch einen zweiten Teil.
Die Politik, ausgerechnet, stürzt den unpolitischen Poeten Storm in weitere Konflikte.
Es sind dies die Jahre, in denen die Schleswiger gegen die dänische Herrschaft aufbegehren, und Storm nimmt Partei, für seine Landsleute, gegen Dänemark. Zunächst siegen die Dänen, und Storm erhält die Quittung: Er kann nicht mehr Advokat in Husum sein. Vielleicht ließe sich das noch arrangieren, würde er nun seinen Kotau vor dem dänischen Geßlerhut machen. Aber Storm bleibt fest. In bemerkenswerter, gar nicht versponnen-poetischer Konsequenz zieht er die Emigration ins ›Ausland‹ vor. Sie führt ihn ins preußische Potsdam, in eine kärgliche, demütigende Position zunächst. Am eigenen Leib erleidet Storm den »Menschenverbrauch«44 des »preußischen Staatsmechanismus«45, und die Erfahrungen dieser Zeit werden geradezu traumatisch in ihm haften. Er verabscheut nun alles Preußische, und noch zu Beginn des Kriegs mit Frankreich wird er schreiben: »Niemand kann das spezifisch preußische Wesen mehr hassen als ich, denn ich halte es für den Feind aller Humanität …«46
Ein zweites Mal nun der Berliner Umkreis, dem Dichter gegenüber nicht ganz so verschlossen wie das erste Mal, doch spröde, kritisch, spottbereit noch immer: Der hauptstädtische Literaturbetrieb klopft ihm auf die Schulter, feiert ihn aber nicht, der Mann aus Husum sitzt da unter diesen kessen, wort- wie weltgewandten Großstadtliteraten, ein Provinzler in glanzleinener Weste, die »sehr leicht furchtbare Falten schlägt« (Fontane)47. Nur mit halbem Ohr wird zugehört, wenn er mit leiser, nicht recht tragender Stimme zu sprechen anhebt.
Freunde finden sich immerhin: der Maler Menzel, Paul Heyse und vor allem Theodor Fontane. Wieder Affinität und Gegensatz, auf der Basis wechselseitigen Respekts: Die Freunde spazieren gemeinsam durch die Stadt, hin zum eleganten Restaurant Kranzler, und mit den gleichen ›goldenen Rücksichtslosigkeiten‹, die auch Storm für sich in Anspruch nimmt, wird Fontane später die Erscheinung der ›komischen Kruke‹ Storm schildern, im grünen Röckchen, eine monumentale ›Talentwindel‹ um den Hals geschlungen, mit Schlapphut, eben so, wie man sich in Husum einen ›richtigen Künstler‹ vorstellen mag.
Kein ergötzliches Detail wird ausgelassen: nicht Fontanes verschämte Bitte, in diesem Aufzug nun nicht gerade in das mondäne Kranzler zu gehen, Storms unbeirrte Selbstsicherheit, des wackeren Dichters »lyrisches Verhältnis« zur »brunnhildenhaften Kontordame«, die seine »reichlich gestellten Fragen bis ins Detail erschöpfend« aushält, nicht Fontanes Manöver, den Freund in eine etwas unauffälligere Ecke abzudrängen. Ermattet schließt der Weltmann aus der Mark: »Ich war froh, als wir nach einer halben Stunde wieder heil heraus waren.«48
Storm revanchiert sich. Fontane liebt Preußen, er hasst es. Der Freund schwärmt vom liberalen Gehabe der Berliner Gesellschaft, Storm durchschaut den pseudoliberalen Bluff. In Potsdam wählt er einen geradezu demonstrativ »Husumer« Lebensstil mit abendlichem Tee bei braunem Kuchen, mit weidlich erzählten Gespenstergeschichten. Er schreibt »Bulemanns Haus« und trägt dieses Gedicht über das Horror-Husum seiner Kindheit im Berliner Freundeskreis vor. Das heißt: »Er sang es mehr, als er es las …«49 — auch hierüber kann Freund Fontane seine Späße nicht lassen. Und das alles, weniger sein Werk, trägt ihm schließlich den Stempel der »Husumerei« ein, ein böses Wort, natürlich von Fontane geprägt. Dennoch trifft es weit mehr den Menschen als den Dichter Storm.
Als er um 1850 noch daheim war, hatte er ›seinem‹ Husum das spröd-kritische Lied von der ›grauen Stadt am Meer‹ gesungen. Jetzt liebt er seine Heimat mehr denn je, und heimwehkrank findet er die vielleicht schönsten Zeilen, die er je schrieb. Er schickt sie an den Vater: »An’s Haf nun fliegt die Möwe und Dämmrung bricht herein, über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein …«50 Das ist nun schon die Welt des Hauke Haien, die hier aufscheint, mitten im »großen Militärcasino Potsdam«51.
Storm will fort. Er findet eine Anstellung in Heiligenstadt, einem Städtchen an der Leine, und mit einem trotzigen ›dennoch‹ im Unterton erklärt er: »Da ich nicht in Husum sein kann, so wünsche ich nur in Heiligenstadt zu sein …«52
Die Jahre in Heiligenstadt werden eine Zeit der Selbstbesinnung und der gezogenen Grenzen: gegen Preußentum und preußischen Adel, gegen Kirche und Glauben — und Storm legt fest, wie er einmal dahinzugehen wünscht: »Auch bleib der Priester meinem Grabe fern …«53
Das schreibt er 1863. Im Jahr darauf erfährt seine Husumerei ihre stolzeste Bestätigung: Er darf heimkehren. Mehr noch: Er wird geradezu im Triumph als neugewählter Landvogt zurückgeholt, nachdem der deutschdänische Krieg die Dänenherrschaft beendet hat. Die Heimat hat ihren Sohn wieder. Das ›Ausland‹ liegt hinter ihm. Das ist nun die große, glückhafte Wende für Theodor Storm.
Sie ist es nicht.
Zwar ist er zu Hause. Aber aus der Perspektive seines wohlerworbenen Preußenhasses erscheint ihm Schleswig-Holstein kaum anders als eine preußische Provinz. Die verachteten ›Junker‹ regieren. Das Amt des Landvogts wird abgeschafft. Storm findet sich, zu geringeren Bezügen, als Amtsrichter wieder, im preußischen Dienst. Tucholskys bittere Zeile: »Wir träumten unter kaiserlichem Zwange von einer Republik — und nun ist’s die …« — sie könnte in geringfügiger Variante auch von Storm gesprochen sein.
Zu politischer Enttäuschung und beruflicher Sorge kommt die private Krise. 1865 stirbt am Kindbettfieber seine Frau, zu einer Zeit, da Ignaz Semmelweiß schon seine epochemachende Erkenntnis traf und Constanze Storm hätte gerettet werden können: Die Erfahrung geht dann später in Storms Novelle »Ein Geständnis« ein. Constanze hinterlässt sieben Kinder, darunter die eben erst geborene Tochter Gertrud. Witwer Storm entsinnt sich eines »schon alten Mädchens«54, einer »verblühten Blondinen«55