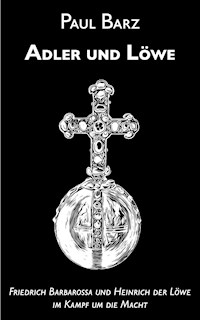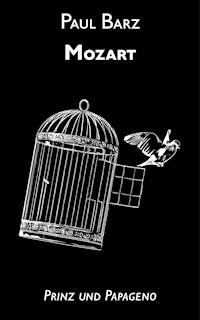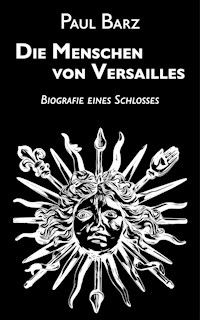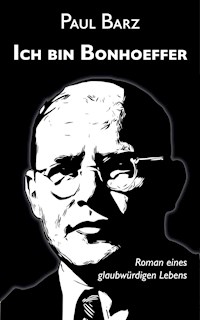
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer war Bonhoeffer wirklich? War er wirklich die Lichtgestalt, die Kultfigur, als die er sich heute darstellt? Und welchen Weg hat er genommen? Paul Barz folgt den Lebensspuren Bonhoeffers, dessen wechselnde Lebensmasken unter den zermürbenden Bedingungen der Haft zu fallen beginnen. In parallelen Erzählsträngen schildert Barz die Haftzeit sowie die Entwicklung Bonhoeffers vom kleinen Prinzen aus wohlhabendem Hause zum engagierten, aufrechten Christen. Dietrich Bonhoeffers Leben vollkommen neu erzählt – atmosphärisch dicht, facettenreich, bewegend. Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 2006 erschienenen Buches von Paul Barz auf Basis des Originalmanuskriptes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Ich bin Bonhoeffer
Roman eines glaubwürdigen Lebens
Für Rudolf Herrfahrdt
Superintendent i. R. und Pfarrer der Bekennenden Kirche, der auch in weiterer Zeit im Bonhoeffer-Geist tätiger Nächstenliebe gewirkt hat
Wer bin ich?
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß?
unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
Dietrich Bonhoeffer
(1944)
Ein kleiner Prinz
1912 - 1924
»Ihr habt ein Fundament,
ihr habt Boden unter den Füßen,
ihr habt einen Platz in der Welt«
(aus dem Tegeler Dramenfragment, 1943)
Gott liebt auch den Schornsteinfeger
Der Junge stirbt. Liegt flach hingestreckt, die Hände über der Brust gefaltet. Die helle Knabenstimme sinkt in greisenhafte Brüchigkeit hinab. Sie flüstert: »Und zu dir noch, lieber Vater, will ich sagen …«
»Was machst du da, Dietrich?«
Der Junge fährt hoch, ist wieder ein Bub von sieben und sehr lebendig. Verwirrt sieht er zur Schwester dort im Türrahmen hin.
»Spielst du mal wieder Sterben, Dietrich?«
Gerade hieran, an diese Szene aus Kindertagen, warum nur an sie?, musste Dietrich Bonhoeffer in seiner Haftzeit häufig denken, gleich schon in der ersten Nacht, als sie ihn im Tegeler Militärgefängnis abgeliefert hatten.
Wie er sich gern tot gestellt hatte damals im Elternhaus. Wie sich in seiner Phantasie die gesamte Familie um ihn geschart und er letzte bedeutende Worte gesprochen hatte. Aber nur Schwester Sabine durfte davon wissen.
Nur mit ihr sprach er über Dinge wie Sterben und Tod, und sie allein wusste von der Angst, die ihn jeden Morgen auf dem Weg zur Schule aufs Neue befiehl, unerklärlich, rätselhaft.
Über eine hohe Brücke musste er dort gehen, immer fürchtete er, durch ihre Ritzen hinunter in den Fluss zu stürzen, und ein schwarzer Mann kreuzte zuweilen seinen Weg, mit Zylinder und rußverschmiertem Gesicht, vielleicht der Tod, vielleicht der Teufel, und die Erklärung half nicht viel, dies sei doch nur der Schornsteinfeger und ganz harmlos.
Für das Kind war die Welt voller Schrecken, und einzig die Schwester wusste von all diesen Ängsten. Die anderen hätten ihn nur ausgelacht.
Die anderen, das waren die älteren Geschwister und die Eltern und mancher Vetter, der selbstverständlich Quartier bekam, wenn er in Berlin studierte, und manche ledige Verwandte auch, die anderswo keine Bleibe hatte. Sie alle fanden sich in diesem Haus im Grunewald mit seinen hohen Räumen, den sanft knarrenden Dielen und dem großen Garten rundum wieder.
Eine feine Gegend war das, die fast feinste im Millionengewirr von Berlin, mit viel Grün und den stuckbeladenen Fassaden matt schimmernder Herrschaftsvillen hinter den wohlgeschnittenen Buchsbaumhecken. Dort wohnten dann Gelehrte, Ärzte, Professoren, mal Theologen wie der berühmte Professor Harnack, mal Historiker wie der gleichfalls sehr bekannte Professor Delbrück, kurz: Berlins geistige Elite.
Auch die Bonhoeffers gehörten dazu.
1912 war Karl Bonhoeffer von Breslau nach Berlin gekommen, hier nun an der Universität Professor für Neurologie und Psychiatrie und gleich noch Leiter der Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten an der Berliner Charité. Einer aus dem Geist des 19. Jahrhunderts mit wenig Sinn für jene Richtung, die in Wien aufgekommen war und den Namen Siegmund Freud trug: »Also, ich halte ihn für einen Scharlatan. Meinst du nicht auch, Paula?«
Paula Bonhoeffer nickte, obwohl sie nicht so ganz seiner Meinung war und des Professor Freuds Ansichten zu Mutterbindung und Vaterkomplex eigentlich ganz interessant fand. Doch in den Jahren ihrer Ehe hatte sie zu widersprechen aufgegeben und sich allenfalls im Stillen ihren Teil gedacht, Tochter eines Hofpredigers und geborene von Hase, von deren adliger Ahnenreihe allerdings erheblich weniger Aufhebens gemacht wurde als von den Vorfahren der Bonhoeffers, deren Stammbaum schön gemalt im Treppenhaus hing.
Sie selbst hatte früher mal Lehrerin werden wollen, eine etwas andere als die anderen. Denn sie lehnte das preußische Erziehungsprinzip ab, einen jungen Menschen erst mal zu zerbrechen, um ihn dann wieder nach preußisch gültigem Muster zusammenzufügen, und ließ denn auch ihre Kinder bis zum Gymnasialeintritt zu Hause unterrichten. Den Religionsunterricht übernahm sie selbst.
Dazu holte sie dann die große Bilderbibel mit den prächtigen Illustrationen des Schnorr von Carolsfeld hervor, »schau mal, Dietrich«, und Dietrich rückte näher, schaute, staunte. Die blauen Augen wurden immer größer.
Hier Jakob an der Himmelsleiter, dort Absalom, dessen Haar sich gerade im Geäst eines Baums verfing, Simson, wie er den Tempel der Philister einriss, König Saul, wie er den Speer nach dem singenden David schleuderte. Dann das andere, das Neue Testament: Bethlehem, Bergpredigt, Golgatha …
»Das gefällt dir wohl?«
Dietrich nickte nur. Und dann, zurückblätternd:
»Wer ist das?«
»Der liebe Gott.« Gleich auf dem ersten Bild war er zu sehen im wallenden Gewand mit gewaltigem Bart, wie er die Wasserwüste unter sich mit beiden Armen segnete.
»Warum heißt er ›lieber Gott‹?«
»Weil wir ihn lieben müssen.«
»Liebt er uns denn auch?«
»Gewiss.«
»Auch mich?«
»Aber sicherlich.«
»Auch … auch …«
Der Junge grübelte.
»Auch den … den …«
Er sah den Mann mit rußverschmiertem Gesicht vor sich, den vom Schulweg, der aussah, als würde ihn keiner lieben, so finster, wie er war. Das Kind flüsterte ganz leise: »Auch den – Schornsteinfeger?«
Die Mutter lachte, erzählte das zu Mittag lachend den anderen. Selbst der Vater hob den dunklen Blick und schmunzelte, die anderen brüllten geradezu. Dietrich saß aber da und, schämte sich ein wenig. Die anderen waren bald bei anderen Themen.
Diese anderen. Drei ältere Brüder. Zwei ältere Schwester. Dann Dietrich und Sabine, Zwillinge, um zehn Minuten auseinander. »Ihr seid reich«, hieß es manchmal, dann lächelte Mutter Paula: »Ja. Kinderreich.« Schließlich wurde noch ein achtes Kind geboren, Susanne.
Zu dessen Taufe kam der Großvater angerückt, mit einem gewaltigen Fotoapparat: »Nun stellt euch mal schön in eine Reihe«, und sie standen hintereinander, den Blick seitwärts in die Fotolinse gerichtet, die drei älteren Brüder Karl-Friedrich, Walter und Klaus, die Schwestern Ursula und Christine, »jetzt noch ihr beiden, ihr Zwillinge«.
Es wurde ein schönes Bild.
»Was sind das nur für zwei bezaubernde kleine Mädchen, Ihre Zwillinge!« Das hatte beim Anblick des Fotos eine Freundin der Mutter ausgerufen, und Paula Bonhoeffer hatte erstaunt hochgeblickt: »Mädchen? Der eine ist ein Junge, unser Dietrich …«
Der sah zu dieser Zeit wirklich wie ein Mädchen aus, mit seinem weizenblonden, fast schulterlangen Haar, ein kleiner Prinz mit strahlend blauem Blick.
Aber er wollte kein Prinz sein und ein Mädchen schon gar nicht. Er wollte wie die älteren Brüder sein, drei richtige Jungs, kantig, stramm und forsch, und als die Weihnachtszeit kam, kritzelte er trotzig auf den Wunschzettel: »Soldaten. Eine Pistole.«
»Ich hatte gemeint, du würdest dir ein paar Noten wünschen.« Die Mutter blickte etwas traurig.
Ihr Dietrich spielte so wunderhübsch Klavier, und manchmal, heimlich, komponierte er sogar. Sein Blick ging aber zu den Brüdern hin und zum Vater, der zu ihnen so ganz anders war als zu ihm, viel lockerer, fast kameradschaftlich, während er seinen Jüngsten kritisch musterte: Eher weich, der Kleine, zu zart, zu verspielt, das Muttersöhnchen eben. Und Dietrich biss sich auf die Lippen, spürte den geheimen Tadel und entzog sich mit barschem Ruck aller mütterlichen Zärtlichkeit.
Nur nicht zu viel Gefühl! Nie zeigen, wer man innen drin war! Das sollte bei ihm fast bis zum Ende so bleiben, und es gab schon damals welche, die dieses Kind für reichlich verschlossen, seltsam kühl und etwas hochmütig hielten. Nur die Schwester Sabine wusste mehr von ihm.
Es waren aber dies nicht Zeiten, da man sich über Kinder groß Gedanken machte, auch bei den Bonhoeffers nicht. Sie waren eben da in diesem immer von Lärm und Gelächter erfüllten großen Haus, die Geschwister brachten ihre Freunde mit und die oft noch ihre anderen Freunde. Das machte nichts, im Gegenteil.
Man blieb ja unter sich, war in dieser feinen Berliner Gegend eigentlich wie eine einzige große Familie. Man kannte sich, mochte sich, feierte seine kleinen Feste zusammen, Bälle, Maskeraden. Man musizierte, spielte Theater, später heiratete man untereinander, die Bonhoeffers und die Delbrücks oder die Dohnanyis, wo es ein wenig freier und lustiger zuging als anderswo, fast etwas zigeunerisch, und dann gab es noch die Leibholz’, die reichsten von allen, mit Riesenvilla im Riesenpark mit eigenem Tennisplatz, Tuchfabrikbesitzer. Die waren Juden.
»Der Vater ist ja noch richtig in der jüdischen Gemeinde. Geht zwar nie in die Synagoge, gehört aber dazu.«
»Aber der Sohn doch nicht, der Gerhard. Der sitzt doch neben unserem Klaus im Konfirmandenunterricht wie der Hans von den Dohnanyis auch.«
»Tatsächlich. Der Hans auch. Obwohl die Dohnanyis eigentlich katholisch sind, komisch. Na ja, vielleicht will Hans nur seinen Vater ärgern, weil der Frau und Familie verlassen hat. Aber der Gerhard Leibholz war immer schon getauft und evangelisch.« Womit das Thema erledigt war.
Es war eine gute, eine reiche Zeit, wenigstens für Familien wie die hier im Grunewald. »Der Luxus der oberen Stände erregt die unteren.« Das sollte Dietrich Bonhoeffer später in einem Schulaufsatz schreiben, aber von der Erregung unterer Stände war in der begrünten Stille seiner ersten Kinderzeit herzlich wenig zu spüren.
Man freute sich am Luxus, der nur nicht protzig sein durfte. Das war verpönt und schlechter Stil. Jedoch hatte man Geld, Zeit, Personal genug, und ein Landhaus hatte man auch, die Bonhoeffers in Friedrichsbrunn im Oberharz, ein Häuschen nur, etwas windschief, doch kuschelig gemütlich, wohin es jeden Sommer ging, erst bis Thale mit der Bahn, dann weiter in Zweispännern. Am Ziel atmeten die Erwachsenen erst mal tief durch, während die Kinder fortstürmten zu wilden Spielen mit der Dorfjugend, Dietrich voran.
Der war dort nun kein Mädchen und kein feiner Prinz. Der lief schneller, kletterte höher als alle anderen. Keiner schmetterte beim Völkerball den Ball so kräftig, und einmal kam er nach Hause, einen Siegerkranz um den blonden Kopf. Die anderen lachten ihn aus.
Es war sommers auch Schützenfest mit einem Jahrmarkt dabei, mit bunten Zelten und wippenden Karussellpferden, und in den Zelten saßen die Dörfler, soffen Bier, klatschten mit, wenn die kleine Blaskapelle Märsche dröhnte und am Ende »Heil dir im Siegerkranz«. Dann standen alle auf, freundliche Begeisterung für den Kaiser im Blick.
Es kam aber der Tag, da jede Musik verstummte.
Die Karussells wurden abgeräumt, die Festzelte auch, keine bunten Wimpel mehr, keine Blasmusik. Und im Haus der Bonhoeffers sagte Fräulein Horn, die Erzieherin: »Packt rasch alle Sachen, Kinder! Wir müssen zurück nach Berlin.«
Im Nachbarabteil johlten Männer in grauer Uniform, das waren Soldaten. Sie schrien und winkten den Menschen am Wegrand zu, die jubelnd zurückwinkten und Blumen durchs offene Abteilfenster warfen.
»Warum freuen die sich denn so, Hörnchen?«
»Weil Krieg ist, Dietrich.«
Es war der 14. August 1914.
»Muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn …«
Es war also Krieg, und anfangs läuteten noch die Glocken und verkündeten immer neue Siege. In den Schulen steckten die Kinder auf der Landkarte den unaufhaltsamen Eroberungsmarsch deutscher Truppen ab, und daheim wurde fleißig der Ausruf der fortziehenden Soldaten wiederholt: »Wir sind wieder da, wenn das Laub fällt.«
Das Laub fiel. Doch niemand war von der Front zurück, und die Glocken läuteten immer seltener. Dafür sahen sich im Haus Bonhoeffer die Eltern immer häufiger mit grauen Gesichtern an: »Unser Neffe, Karl … auch er … der kleine Goltz … die arme Mutter …«
Man war inzwischen umgezogen, in ein noch größeres Haus in der Wangenheimstraße mit noch größerem Garten rundum, und dort wurden nun Kartoffeln angebaut und Gemüse gezogen, Hühner gehalten und sogar eine Milchziege, die bald schon ein wenig zur Familie gehörte und selbst in die Ferien nach Friedrichsbrunn mitgenommen wurde.
Die Kinder, die Zwillinge zumal, fanden das alles sehr spaßig. Sie hatten nichts gegen den Krieg und verstanden nicht ganz den häufigen Stoßseufzer »Wäre doch endlich wieder Frieden!« Vor allem für Dietrich konnte das alles gern noch ein wenig dauern. So lange wenigstens, bis er selbst alt genug sein würde, mit allen anderen ins Feld einzurücken. Das war sein sehnlichster Wunsch.
Aber erst mal – es war schon 1917 – waren die ältesten Brüder an der Reihe, Karl-Friedrich und Walter, und bei Tisch hatte die Mutter leise gefragt, ob ihnen denn nicht ihr Vater eine halbwegs sichere Stelle in der mehr hinteren Reihe verschaffen solle. Die beiden hatten bitter protestiert: »Wir sind doch keine Drückeberger!«, und ihr kleiner Bruder sah in noch größerer Bewunderung zu ihnen auf.
Sie rückten ein. Im Haus wurde es stiller. Die Geschwister hatten abends im Bett wieder lange Gespräche über Sterben und Tod, und dieser Tod war jetzt etwas anderes als früher, nicht ein irgendwie unerklärlicher Zufall wie damals, als in Friedrichsbrunn ein kleines Kind in einen Schacht gestürzt und dort ertrunken war.
Nein, das Sterben jetzt war etwas Feierliches und Erhabenes, der Dienst an einer größeren Sache, und die Kinder sagten nicht einfach »Tod«. Sie sprachen von der »Ewigkeit«, in die ein jeder einmal eingehen würde, und der Gedanke daran ließ sie zwar schaudern, barg jedoch zugleich sein kleines, sehnsüchtiges Glücksversprechen.
Im April 1918 kam ein Brief. Walter sei verwundet worden, hätte die Beine voller Granatsplitter, läge nach einer Operation im Lazarett, und die Mutter hatte zögernd gefragt: »Sollten wir ihn nicht besuchen, Karl?«
Der Vater überflog noch einmal den Brief: »Das wünscht er ausdrücklich nicht.«
»Natürlich wünscht er sich das. Das weißt du doch.«
Karl Bonhoeffer schüttelte den Kopf – und sollte sich dieses Kopfschütteln bis an sein Lebensende nicht vergeben: »Nein. Wir respektieren Walters Wunsch.« Dietrich sah sich aber selbst im Lazarett liegen, schwere Verbände um Kopf und Leib, wie er einer madonnenfromm dreinblickenden Krankenschwester mit rotem Kreuz auf weißer Haube letzte Worte diktierte, die dann in den unsterblichen Zitatenschatz eingehen würden wie Goethes »Mehr Licht!« oder Nelsons »England erwartet, dass jedermann seine Pflicht tut«.
Auch Walter hatte einen Brief diktiert und von einer wohl nötigen zweiten Operation gesprochen. Heiter klang das, fast verspielt, die Eltern hatten sich zugelächelt: »Unser tapferer Junge!«, und dann war der Tag gekommen, früher Nachmittag, da alles im Haus an der Wangenheimstraße still gewesen war. Nur die Türglocke hatte plötzlich schrill und scheppernd angeschlagen.
Der Telegramm-Bote.
Dietrich hatte zur Tür stürzen wollen. Aber der Vater war rascher gewesen. Der Junge hörte ihn mit dem Boten ein paar Worte wechseln, dann sah er ihn ins Arbeitszimmer hinübergehen und konnte von der Diele her durch die halb offene Tür beobachten, wie er Platz nahm, das Kuvert aufschlitzte, las, starrte, dann plötzlich mit einem trockenen Aufschluchzen den Kopf auf die Schreibtischplatte sinken ließ und so für Sekunden reglos sitzen blieb.
Nie hatte Dietrich den Vater so gesehen und wich scheu zurück, als nun Karl Bonhoeffer mit kleinen hölzernen Schritten wie blind an ihm vorüberging und die Treppe hinaufstieg, zum Zimmer der Mutter, die ihre Mittagsruhe hielt.
Dietrich stand da, starr, mit hängenden Armen. Endlich wagte er sich ins Arbeitszimmer, zu dem der Zutritt sonst nur mit Erlaubnis des Vaters gestattet war, hob das zu Boden geglittene Telegramm auf, las mit verschwimmendem Blick: »… muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn …«
Walter war tot.
Vom ersten Stock her kam ein Schrei wie von keiner menschlichen Stimme mehr, eher wie von einem in der Tiefe verwundeten Tier, und es war die Mutter, die schrie und sich in einem nicht endenden Weinkrampf schüttelte. Dietrich wäre gern zu ihr hinaufgestürzt, hätte sie gestreichelt, geküsst, sie liebkost, hätte ihr zugeflüstert, dass er bald selbst ins Feld ziehen und den toten Bruder rächen würde. Aber irgendwas hielt ihn zurück, und mit eingezogenen Schultern schlich er in sein Zimmer.
Tod war wohl doch nicht schön und erhaben.
Beim Abendbrot fehlte die Mutter, und der Vater meinte nur, er hätte die Mama für einige Zeit fort zu Verwandten gebracht, auf dass sie wieder Frieden finde in ihrem Herzen. Dann setzte er hinzu: »Wir wollen jetzt für unseren toten Walter beten!« Dietrich senkte den Kopf wie alle anderen und staunte zugleich, dies gerade vom Vater zu hören, der sonst nie richtig betete und bei Worten wie Gott und Religion gern ein schiefes Lächeln zeigte.
Der Krieg war zu Ende. Ein Frieden war es noch nicht. Durch die Berliner Straßen zogen Burschen mit roten Binden an Arm, sangen von der Internationale und Menschenrechten und nannten sich nach dem Sklavenführer Spartakus »Spartakisten«. Bis in den Grunewald hörte man das dumpfe Rattern ihrer Maschinengewehre, und die Mutter meinte zur Köchin Anna: »Halten Sie einen guten Kaffee und reichlich Kuchen bereit, damit wir etwas anzubieten haben!« Doch bis in den Grunewald kamen die Spartakisten nicht.
Hier blieb alles still und grün und eigentlich ganz unverändert.
Es gab keinen Kaiser mehr. Aber das trug man im Haus Bonhoeffer mit Fassung, da man vom zweiten Wilhelm nie eine besonders hohe Meinung gehabt hatte, und als sich herumsprach, er würde sich im holländischen Exil die reichlich freie Zeit mit Holzhacken vertreiben, lachte der Vater kurz auf: »Vielleicht versteht er wenigstens davon etwas!«
Andere Namen wurden mit größerem Respekt genannt und einer immer häufiger, der vom neuen Außenminister Walter Rathenau, einem Großindustriellen, der im Krieg die Heimatversorgung geleitet hatte: »Der ist einer von uns, aus unserem Stall, und gescheit ist er auch. Auf solche Männer dürfen wir hoffen«, hatte Karl Bonhoeffer gemeint und der Mutter aus der Zeitung vom Vertrag von Rapallo vorgelesen, wonach das Deutsche Reich und die junge Sowjetunion Diplomaten austauschen, sich gegenseitig Reparationen erlassen und wirtschaftlich unterstützen wollten: »Richtig so!«
»Aber, Karl! Ein Bündnis mit diesen schrecklichen Bolschewiken, die den Zaren mit seiner ganzen Familie ausgerottet haben!«
Karl Bonhoeffer blieb gelassen: »Die Russen nennen den Zaren ›Väterchen‹, und der großartige Professor Freud meint doch, ein jeder müsse irgendwann mal seinen Vater töten, um wirklich frei zu sein.«
Entsetzt hob seine Frau die Hand: »Charles, mon cher! Ne pas devant les enfants!«
Rathenau wohnte nicht weit von ihnen, in einer der schönsten Villen des Viertels mit überschmaler Eingangstür, durch die sich Politiker, Geistesgrößen, Künstler zwängten und zu späterer Stunden zuweilen auch junge Burschen mit muskelbepackten Körpern und kurz geschorenem Blondhaar über der nicht zu hohen Stirn.
Von dieser Vorliebe Rathenaus für tumbe Recken mit breiten Schultern und strammen Hinterbacken wurde viel gemunkelt. Die Öffentlichkeit kannte jedoch nur den stets tadellosen Herrn mit Spitzbart und melancholischem Blick, wie er sich jeden Morgen vom Grunewald zu seinem Ministerium chauffieren ließ. So auch an diesem 22. Juni 1922.
Sein Wagen fuhr an. Rathenau lehnte sich zurück, sein Blick streifte nur kurz den Wagen auf der anderen Straßenseite. Dann jedoch stockte er.
Burschen saßen dort, wie lauernd vorgebeugt, und den einen meinte er zu kennen. Hatte der nicht neulich zu denen gehört, die sich durch seine Haustür gezwängt hatten? Kern hatte der geheißen. Und hielt jetzt einen Revolver auf ihn gerichtet.
Dann fielen die Schüsse.
Ich schaffe diese Kirche neu
Die Schüler waren hochgefahren, hatten zum Fenster gestarrt. Vergessen die vor ihnen liegende Klassenarbeit. Das eben, trocken, bellend, müssen Schüsse gewesen sein. Ganz nah! »Nein, keine Schüsse. Ich war im Krieg, ich weiß das. Die hören sich anders an.« Aber auch der Lehrer war sehr blass geworden. »Schreiben Sie Ihre Arbeit weiter!«
In der Pause erfuhren dann die Oberprimaner im Grunewald-Gymnasium, dass soeben und nur wenige Straßen weiter Deutschlands Außenminister Walther Rathenau ermordet worden war. »Diese Schweine!« Das war Primaner Bonhoeffer, hochrot im Gesicht. »Irgendwelche Rechtsbolschewisten knallen die Besten ab, die wir haben. Selber sollte man die abknallen, wie tolle Hunde!«
Die anderen staunten. Der hier mit seinen sechzehn war der Jüngste unter ihnen, und so ganz nahmen sie das Bürschchen mit dem blanken blauen Blick nicht ernst. Aber dann wieder konnte er eine leidenschaftliche Klarheit zeigen, die ihn weit über Jahre und Statur hinauswachsen ließ.
»Unser Dietrich, der wird noch mal ein richtig großer Volkstribun.« Die anderen lachten.
In mancher Hinterstube wurde auf Rathenaus Ermordung und seine Mörder kräftig angestoßen. Aber die allgemeine Trauer um den toten Staatsmann war groß und echt, und zweihunderttausend Berliner hatten sich drei Tage später beim Schloss im Lustgarten zur Demonstration versammelt. Reden wurden gehalten, ein Meer von Fahnen wogte. Nie war der Ermordete zu Lebzeiten so populär gewesen wie jetzt.
Auch Bonhoeffer war unter den Tausenden, neben ihm Gerhard Leibholz, um vier Jahre älter und eigentlich mehr Freund seiner Brüder, mit Dietrich aber einig in der Bewunderung für den toten Rathenau. »Warum gerade so einer sterben muss?« Bonhoeffer schüttelte den Kopf, während der Redner oben auf dem Schlossbalkon von Rathenaus Friedenswillen sprach und seiner klugen Politik der Aussöhnung mit einstigen Feinden.
Feiner Regen hatte eingesetzt. Schirme wurden aufgespannt, Kragen hochgeschlagen. Auch Bonhoeffer zog fröstelnd die Schultern zusammen: »Warum nur er?«
»Vielleicht wird man jetzt erst erkennen, wer er war und was er wollte,« meinte Leibholz leise, »und wo unsere wahren Feinde stehen, vielleicht auch.«
Bonhoeffer wischte sich einige feuchte Strähnen aus der Stirn, starrte weiter zum Redner hin: »Du meinst, einer muss sich selbst zum Opfer bringen, damit die Menschen die Sache begreifen, für die er gestanden hat?«
»Möglich.«
»Wie Moses, der nie das Heilige Land betrat, in das er sein Volk hatte führen wollen …«
»Wie? Der ist selber nie dorthin gekommen?«
»Lies in der Bibel nach!«
Leibholz lachte: »Die kennst du besser als ich. Und die Geschichte der Juden offenbar auch.«
Die Versammlung war vorbei. Die Menge verlief sich. Schweigend gingen die beiden jungen Männer nebeneinanderher. Endlich fragte Leibholz, sehr leise, zögernd: »Meinst du wohl …«
»Was denn, Gerhard?«
»Ob sie den Rathenau erschossen haben, weil er Jude war?«
Bonhoeffer gab keine Antwort. Wie alle kannte er die an Häuserwänden hingeschmierten Parolen: Schlagt ihn tot, den Rathenau! Die gottverdammte Judensau!
»Es könnte für uns Juden wieder mal sehr gefährlich werden«, meinte Leibholz.
»Wieso ›uns Juden‹?« Bonhoeffer verstand nicht.
»Ich bin doch auch einer. Hast du das vergessen?«
»Aber getauft. Protestant.«
»Vielleicht zählt das bald nicht mehr.«
An diesem Tag hatte es schulfrei gegeben. Dann ging der Alltag weiter und machte Dietrich Bonhoeffer keine große Mühe. Er war zwar der jüngste, aber auch der beste in der Klasse und in den meisten Fächern so gut, dass man ihm sogar seine miserable Klaue nachsah.
»Wenn sich doch nur alles entziffern ließe, was Sie schreiben«, seufzte einmal sein Klassenlehrer, als er ihm einen Aufsatz über »Deutschland vor dem Krieg« zurückgab, »aber was Sie darlegen, die englisch-deutsche Rivalität auf den Meeren als eigentlichen Kriegsgrund – das also hat kein anderer so gesehen. Das ist sehr gut und klug.«
Der Lehrer hatte sich so tief zu ihm hinuntergebeugt, dass ihn die anderen nicht hören konnten: »Sie sind sehr begabt, fast zu begabt, Dietrich. Sie haben einmal alle Möglichkeiten. Allerdings«, ein kleines Seufzen, »so was ist auch eine große Last.«
Dieses Wort verfolgte Bonhoeffer. ›Alle Möglichkeiten‹, dachte er, wenn er daheim in der Wangenheimstraße am Klavier saß, ›aber welche ist denn die wahre, einzige für mich?‹ Die Finger glitten über die Tasten.
Pianist vielleicht, einmal hatte er einem sogar vorgespielt. Oder Arzt wie der Vater, im weißen Kittel, ernste Güte im Blick. Oder Professor, am Katheder hoch über den Häuptern der Studenten, ihr Lehrer, ihr Meister …
»Ich will Theologe werden.«
Das war bei Tisch. Man löffelte gerade die Suppe, und Dietrich Bonhoeffer wusste selbst nicht, warum er das ausgerechnet jetzt verkünden musste. Der Gedanke hatte sich schon seit Jahren in ihm festgesetzt, aber nie hatte er ihn anderen gegenüber so direkt ausgesprochen. Es wäre gewesen, als würde er ein schamhaft verborgenes Geheimnis seiner Seele preisgeben und sich den anderen nackt zeigen.
Jetzt kam es wie erwartet. Die Brüder brachen in Gelächter aus. »Zur Kirche willst du? In dieses schwächliche, kleinbürgerliche Gebilde?«
Der Vater hatte nichts gesagt. Der hatte nur den Löffel hingelegt und sah den Sohn an, dunkel forschend, wie es seine Art war. Der Sohn entdeckte darin aber noch etwas anderes, so was wie Sorge und einen Anflug Angst.
»Theologe wie der Großpapa und dein Onkel, nun ja«, meinte Karl Bonhoeffer schließlich, »aber die Kirche heute ist etwas anderes als zu deren Zeit. Nicht mehr die erste Macht am Thron, sie ist …«
»Hast du nicht selber mal erwogen, Theologe zu werden?« Das war die Mutter. »Eine kurze Zeit, ja.« Karl Bonhoeffer lachte auf: »Aber der Gedanke, jeden Sonntag auf einer Kanzel zu stehen und als Einziger zu reden, war mir einfach zu langweilig.«
Er hatte wieder zum Löffel gegriffen, energisch: »Langweilig, jawohl. Das ist die Kirche geworden, leider. Jedenfalls für einen so begabten Burschen wie dich.« Und sein Sohn hörte sich zum eigenen Staunen erwidern: »Dann muss ich sie eben wieder spannend machen, Vater.«
»Du, Dietrich?«
»Ja. Ich schaffe diese Kirche neu.«
Hastig, als sei ihm eine Blasphemie unterlaufen, aß er seine Suppe weiter.
Theologie macht einsam
Diese frühen Zwanziger waren wirklich keine Zeit, ausgerechnet Theologie zu studieren.
Die Jahre waren vorbei, da noch prominente Theologen wie Bonhoeffers späterer Lehrer Adolf von Harnack ihrem Kaiser die Reden schrieben und ihm so schöne Worte wie »Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche« soufflierten. Im August 1919 war die Trennung von Staat und Kirche vollzogen, und eine große Leere drohte, da nun der klassische »Bund von Thron und Altar« durchbrochen war.
Was war die Kirche noch jenseits des sanften Dämmers ihrer Gotteshäuser? Nur der Wahrer sonntäglicher Frömmigkeit, der Illuminator zu Hochzeit, Taufe und Begräbnis, da ihr nun die staatserhaltende Bedeutung genommen war?
Die Kirchenmänner sahen sich ratlos an. Viele schimpften auf die neuen Herren als »rote Afterpolitiker«, andere fragten, wohin das nun führen sollte. Wer aber – das vor allem – studierte da noch Theologie? Und warum?
So genau, wenn er ehrlich war, wusste das auch Bonhoeffer nicht. Stand am Fenster seiner Bude, rauchte, wie er es sich in Schultagen angewöhnt hatte, und sah zum eisig blauen Neckar hinunter.
Dies hier war nicht Berlin, der flirrende, kochende, von Inflation und Nachinflation geschüttelte Riesenkessel mit seinen Straßenkämpfen von links wie rechts. Dies war Tübingen, wo schon der Vater studiert hatte, alle Bonhoeffer-Kinder traditionell ihr Studium begannen und die Großmutter lebte, Frau Julie Bonhoeffer, 82 Jahre alt. Es war ein klirrend kalter Januartag des Jahres 1924.
Ihr Enkel trat hinaus, der Großmama drüben in der Neckarhalde einen Besuch abzustatten, die Schlittschuhe über der Schulter. Denn nach der Visite wollte er noch ein wenig auf dem zugefrorenen Fluss eislaufen. Leise pfiff er vor sich hin: »Jesus, geh voran …« Ein ›rotes‹ Lied, dachte er dabei. Das war so seine Unterteilung. In ›rote‹ Lieder wie dies hier, die standen für Leben und Glauben, ›schwarze‹ wie »Nun danket alle Gott« für Lehre und Kirche.
Was aber war die Lehre? Wofür war Gott zu danken? Dass er über alles wachte wie der getreuliche Hüter einer Herde? Ein anwendbarer Gott also, wie von Menschen gemacht – und was sollten seine Diener sein? Höhere Angestellte einer höchsten Macht, die über ihre Schöpfung wie über einen Großkonzern gebot?
Bonhoeffer wusste es nicht.
Die Neckarhalde 38 war erreicht. Vor der Tür in der freundlich stuckverzierten Fassade mit den Buntglasfenstern sah sich Bonhoeffer noch einmal um. Stets wollte ihm dieses Tübingen in aller biedermeierlichen Beschaulichkeit wie eine eigene, eigentlich schon vergangene Welt erscheinen. Und fast wie ein Stück Vergangenheit, er lächelte zärtlich, erschien ihm zuweilen die Großmama selbst.
Eine schöne alte Dame in der eisgrauen Pracht ihres sorgsam nach hinten gekämmten Haars, im Gesicht die klare Energie einer Frau, die stets am besten gewusst hatte, was für sie und andere gut sein würde. Der Enkel küsste ihr Hand und Wange. »Dein Anzug ist mal wieder schlecht gebügelt, und deine Krawatte sitzt schief«, tadelte sie.
»Du weißt doch, mit Kleidung komme ich nie zurecht«. Ordnung in allen Haushaltsdingen blieb seit seinem Auszug von Zuhause seine schwache Seite.
»Hilf mir hoch, mein Junge!« Bonhoeffer fasste sie unter. Sie ächzte: »Die Knochen. Sie wollen nicht mehr. Bald werde ich mir nicht mehr selbst behelfen können. Da werde ich wohl eures Vaters Angebot annehmen und zu euch nach Berlin ziehen.« Behutsam, Arm in Arm, gingen sie zum Teetisch hinüber. Bonhoeffer überlegte, wovon er sprechen sollte.
Vom »Igel« vielleicht, der studentischen Verbindung, der schon der Vater angehört hatte. Eine ohne Paukboden und Mensur, und statt der knallig bunten Mützen anderer Burschenschaften trug man demonstrativ eine stachelige Kappe, den »Igel«, auf dem Kopf.
»Karl-Friedrich und Klaus wollten ja hier in Tübingen dem ›Igel‹ nicht beitreten«, erzählte er jetzt, »die waren dagegen, dass die Studenten die Reichswehr gegen Aufständische von links wie rechts unterstützen sollten.«
»Und du? Denkst du anders als deine Brüder?«
Bonhoeffer hob die Schultern: »Ich finde das nicht so schlimm. Und war dabei, als sie uns für eine Wehrübung einberufen hatten, damit wir den Umgang mit der Waffe lernen. Mal eine Abwechslung, habe ich gedacht.«
»Und? Hat es Spaß gemacht? Hattest du nette Kameraden?« Sie schob ihm die Schale mit seinen Lieblingskeksen zu.
»Recht nett. Ziemlich reaktionär, na ja. Aber sonst …«
Sonst, wenn er ehrlich war, hatte er zu den anderen keinen echten Kontakt gehabt. Wie auch hier in Tübingen, wo er wieder »der Jüngste« war, wie schon in der Schule. Beliebt und immer mitten im Betrieb. Keiner tanzte so flott, sang so gut wie er. Beim Sport ganz vorn. Im Tennis ein Meister. Der kleine Stern, der kühl schimmernd um sich selbst zu kreisen schien.
Er hatte einen Freundeskreis. Er hatte keinen Freund. Und keine Freundin.
›Dafür bin ich noch zu jung‹, meinte er gelegentlich und dachte zugleich: Ursula ist nicht zu jung. Die hat sich schon mit ihrem Rüdiger verlobt, dem Juristen Schleicher. Und Christine wird wohl den Hans von den Dohnanyis heiraten. Das witterte er mit wachem brüderlichem Instinkt. Wie auch, mit kleinem eifersüchtigem Stich dabei, die Zuneigung Sabines zu Gerhard Leibholz. Die älteren Brüder, ein Trost, hatten es mit dem Heiraten nicht so eilig. Und er …
In der silbernen Teekanne konnte er das eigene Bild erkennen. Ein etwas dicklicher junger Mann mit leicht hochmütigem Blick sah ihn an. Er wusste nicht, ob er mit ihm, würde er ihn irgendwo treffen, gern befreundet wäre.
»Du bist ziemlich einsam, mein Junge, nicht wahr?« Die Großmutter, den Blick wie der Vater, dunkel, forschend, alles ergründend, sah ihn an. Er schob sich wie zur Antwort ein weiteres Plätzchen in den Mund. Ingwer-Kekse. Er schmatzte leicht dem Geschmack hinterher.
Ja, er war wohl einsam. Wie auch nicht? Wie hätte er anderen erklären sollen, was er gerade in der Theologie suchte, die er da studierte? Sicherheit? Gewissheit, wer er selber war? Wer hätte das verstanden?
»Theologie macht einsam, Großmama.«
Sie hatten dann von anderem gesprochen. Aber der Gedanke begleitete ihn hinunter zum Neckar, ließ ihn nicht los, als er die Schlittschuhe anschnallte, trieb ihn voran, als er übers Eis glitt, und vielleicht war er deshalb weniger achtsam als sonst.
Jedenfalls war ihm plötzlich, als öffne sich unter ihm der Boden und trage ihn nicht mehr. Er glitschte, schlidderte und meinte noch, es würden ihm ruckhaft die Beine nach vorn gerissen. Dann stürzte er, schlug mit dem Hinterkopf aufs Eis, sah nur Schwärze voll greller Blitze. Die Rufe anderer am Ufer, die wohl seinen Sturz beobachtet hatten, waren das letzte, was er für eine Weile hörte.
»Ja, mir geht es wieder ganz gut. Zu blöd, einfach so hinzustürzen.« Die Wintersonne schien ins Krankenzimmer, die Eltern, zu seinem Geburtstag aus Berlin angereist, hockten auf der Bettkante. Ihr Sohn aß mit demonstrativ gutem Appetit vom Geburtstagskuchen. Zu kräftig vielleicht, zu fröhlich sein Lachen. Der Vater machte sich Gedanken.
»Das war nicht der Körper. Das war die Seele. Darum ist er gestürzt«, meinte er später auf dem Flur vor dem Krankenzimmer, »er ist überfordert, eindeutig.«
»Du meinst«, ängstlich sah ihn die Mutter an, »unser Dietrich arbeitet zu viel?«
Ein Krankenbett wurde vorbeigeschoben. Sie warteten, bis es vorüber war.
»Es ist wohl nicht die Arbeit selbst. Da fällt ihm alles leicht, zu leicht am Ende, immer schon. Aber er sucht sich selbst darin und kann sich dort nicht finden. So hat er buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren.«
Karl Bonhoeffer hakte seine Frau unter: »Komm, Paula! Wir wollen überlegen, was wir unserem Jüngsten Gutes tun können.« Und nach einer kleinen Pause: »Ausland vielleicht. Italien. Rom. Da sieht er mal eine andere Welt.«
Tegel, Nacht vom 5. auf 6. April 1943
Die Zelle ist kalt und dunkel, sie stinkt, und der Wärter hat noch ein »Rein mit dir, du Strolch« geknurrt, bevor er Bonhoeffer in den Raum stößt. Dann fällt die Tür zu.
Dietrich Bonhoeffer ist allein.
Ein paar tappende Schritte hin zur Pritsche an der Wand. Er will sich setzen, die Decken darauf als Schutz gegen die Kälte um sich ziehen. Aber sie riechen zu scheußlich. Bonhoeffer würgt. Geht hinüber zur anderen Wand. Hockt sich hin.
Draußen ist Nacht.
»Zur Christenpflicht als Staatsbürger gehört auch, einmal eine Untersuchungshaft in Würde und sicherer Gewissheit seiner Unschuld zu ertragen.« Wer hatte das nur gelehrt? Harnack? Barth? Er selbst?
Schlatter war es. Adolf Schlatter, der Schweizer Bibeltheologe damals noch in Tübingen. Der hatte das gesagt. In Gewissheit seiner Unschuld …
Der Gedanke gräbt sich in Bonhoeffer ein.
Ist er denn so unschuldig? Und wird er das beweisen können?
»Sie haben nichts gegen uns in der Hand.« Wieder Dohnanyis scharfe Stimme.
»Wirklich nichts, Hans?«, hat er damals zurückgefragt, und der andere versuchte ein beruhigendes Lächeln: »Alle irgendwie kompromittierende Aufzeichnungen, unsere ganzen Pläne mit den Namen aller Mitwisser …«
»Ich bin auch darunter?«
»Natürlich bist auch du darunter. Bist du nicht Mitwisser und noch etwas mehr? Aber keine Angst! Das alles ist in einem hundertprozentig sicheren Safe verwahrt. Niemand findet es dort.«
»Aber warum überhaupt Aufzeichnungen? Warum ist nicht alles Material längst vernichtet worden?«
Der Schwager hob die Schultern: »Es wäre das Beste, vielleicht. Aber einige von uns«, er schien Namen nennen zu wollen, schluckte sie aber hinunter, »einige also meinen, wir brauchten für spätere Zeiten Belege, warum wir was geplant hatten und dass wir nicht einfach nur Verräter sind.« Dohnanyis Lächeln wurde schief: »So sind wir Deutschen nun mal. Korrekt selbst noch im Untergang. Ohne Papiere läuft nichts. Nicht einmal eine Katastrophe.«
Der Schwager!
Bonhoeffer sieht im Halbdunkel sein Gesicht vor sich, schmal, spitz, ein wenig hochmütig, als kenne er alle Rätsel dieser Welt und wüsste deren Lösung, und plötzlich packt ihn Wut, heftig und ungerecht.
Warum hat ihn nur der Schwager in alles hineingezogen, warum ließ er sich selbst hineinziehen?
Aus Eitelkeit? Wichtigtuerei? Haben ihn dieses Regime und seine Untaten wirklich so tief empört, oder ging es ihm nicht eben doch mehr um die uk-Stellung, um nicht hinaus ins große Sterben an die Front zu ziehen – oder in irgendeinem KZ zu verschwinden?
War am Ende alles nur Feigheit, Drückebergerei?
Nein! Nein! Nein!
Bonhoeffer rutscht noch mehr in sich zusammen, umschlingt die Knie. Seine Zähne schlagen aufeinander, aber nicht vor Kälte. Ihn schüttelt Angst. Was kommt auf ihn zu? Verhöre, immer böser, dringlicher? Nacht um Nacht in dieser kleinen Hölle hier?
»Sie haben nichts in der Hand«, wiederholen seine Gedanken mit der Monotonie einer tibetanischen Gebetsmühle. Er glaubt es, weil er es glauben will. Darüber geht die Nacht hin, und in das Dunkel vor dem Gitterfenster schiebt sich das Grau der ersten Dämmerung. Bonhoeffer ist in einen kleinen Schlummer gesunken.
Ein Schluchzen, erst ganz leise, dann immer lauter, klagender, schreckt ihn auf. Jemand weint dort hinter der Wand. Irgendjemand heult seine Angst vor dem heraufziehenden Tag ins Halbdunkel hinaus. Wird auch er bald so greinen, ein Kind, das nach der Mamma schreit?
Niemals!
Aber was wird sein Schutz bei allem Kommenden sein? Er sieht das höflich feixende Gesicht dieses Kriegsgerichtsrats vor sich – oder war es ein Oberstkriegsgerichtsrat? Roeder heißt er, und irgendwo, Bonhoeffer ist jetzt ganz sicher, hat er den Namen schon gehört …
Das Schluchzen nebenan verebbt, wird leiser, erstickt.
»Herr Pastor« hat ihn Roeder genannt. Das also ist ihm geblieben. Die Titel. Der Doktor. »Sagen Sie einfach ›Barth‹. Titel kann man mir nehmen. Aber ›Barth‹ heiße ich bis zu meinem letzten Atemzug«, hatte einmal Karl Barth zu ihm gesagt.
Also Bonhoeffer. Ganz einfach. Ohne ›Pastor‹ oder ›Doktor‹ davor. Und was bleibt ihm sonst in diesem stinkenden, nasskalten Verlies?
Seine Bildung. Sein Wissen. Die drei Sprachen. Hier spricht man nur eine, das reicht. Bildung und Wissen zählen nicht. Auch nicht der Bonhoeffer-Stammbaum an der Treppe im Elternhaus. Die Ahnenbilder an den Wänden, deren Seidentapeten. Die Goldschnittbände in der Bibliothek. Das Silber in den Schränken.
Vanity of vanities! Eitelkeit der Eitelkeiten! In seiner Londoner Zeit hat er darüber einmal gepredigt. Was hatte er damals nur gesagt?
Draußen Geschrei. Klappende Türen. Der Morgen scheint da. Gleich steht der Wärter vor ihm: »Komm, du Gauner!« Was wird er ihm entgegenhalten? Sein fließendes Latein wie einst dem »Reichsbischof«, dem Müller? Und dass er kein Gauner, sondern Christ sei, jawohl, einer aus der Bekennende Kirche? Er sieht den anderen grinsen.
Aber das bin ich nun mal. Ein Christ. Mein Glaube bleibt mir. Das Geschrei kommt näher.
Bonhoeffer presst den Hinterkopf gegen die Wand, sieht hinter geschlossenen Lidern schwarz vermummte Gestalten, Fackeln in den Händen, Kapuzen über dem Kopf. Sie werden ihn aufs Streckbett zerren, ihn seinen Glauben abschwören lassen. Was bleibt dann von ihm?
Ein blutender Leib. Das ist dann Bonhoeffer. Im Kopf nur noch Erinnerung. Die kann ihm keiner nehmen, selbst hier in dieser Kerkerzelle nicht. In jenes Paradies kann er sich noch immer flüchten, weit fort von allem hier.
Nach Barcelona vielleicht. In die feinen Staubwolken über den Ramblas. In Geschrei und Hitze der Stierkämpfe. Nur New York war heißer. Und Kuba. Wie war er nur nach Kuba gekommen?
Von New York aus, damals 1930. »Hörnchen, du hier …« Fräulein Horn, Erzieherin aus Kindertagen, stand plötzlich vor ihm, wie kam sie nur nach Kuba? Als Deutschlehrerin, ah ja. »Und noch immer vom Kaiser so begeistert, Hörnchen?« Wie sie damals, zum Amüsement des Vaters, zum Ärger der Mutter, immer aufgesprungen und zum Fenster gestürzt war, wenn man nur von Ferne das Tatütata der kaiserlichen Autohupe gehört hatte …
Das Geschrei ist jetzt ganz nah. Der Schlüssel dreht sich im Schloss. Bonhoeffer erwartet klirrende Schritte, verzerrte Gesichter, hört schon die bellende Kommandostimme. Aber die Tür wird nur einen Spalt geöffnet, etwas fliegt hinein. Dann ist wieder alles still. Das Geschrei zieht weiter.
Bonhoeffer tastet sich vor, spürt den Gegenstand zwischen den Fingern. Halbweich, krumig. Ein Stück Brot. Bonhoeffer riecht Schimmel, muss wieder würgen, beißt dennoch hinein. Nicht so sehr aus Hunger. Nur um irgendwas zu tun. Und zwingt wieder die Erinnerung heran.
Der bitter-scharfe Geruch eines frisch gebrühten Espresso. Früchte dabei, vielleicht Orangensaft. Die Sonne scheint. Er ist in Rom.
Was macht Kirche zur Kirche?
1924 bis 1929
»Ich fange an,
glaube ich,
den Begriff ›Kirche‹
zu verstehen.«
(Italienisches Tagebuch, 1924)
Auch Laokoon war Priester
Roms warme Sonne durchschien noch manchen Traum des Untersuchungshäftlings Bonhoeffer und hüllte ihn wie ein guter weicher Mantel ein.
Tatsächlich waren ihre Strahlen damals um Ostern 1924, als er mit Bruder Klaus nach Italien aufgebrochen war, hart und heiß gewesen. Doch das hatte Bonhoeffer kaum gespürt, als die Brüder durch die Straßen streiften, keine Kirche, keinen Palazzo ausließen oder einfach vor einer Trattoria saßen, am liebsten an der Fontana Trevi.
Dort hatten sie dann Landkäse gegessen, einen hellen weißen Wein getrunken und blinzelten nun, umtobt vom römischen Straßenlärm, in den Tag hinein.
Bonhoeffer reckte sich leicht, seufzte ein wenig und fühlte sich wohl.
»Nun, wovon träumst du gerade, Dietrich?« Das war der Bruder, noch ungeduldiger, neugieriger als er. »Wollen wir nicht wieder loswandern?«
»Ach, lass uns ein wenig weiterträumen …«
»Dann wollen wir wenigstens noch einen Kaffee trinken, einen Espresso, wie sie den hier nennen.«
Espresso für zwei. Bonhoeffer nahm einen Schluck.
Wie gut hatte er Italien zu kennen gemeint, bevor sie hierher aufgebrochen waren! Den Baedeker hatte er gründlicher gebüffelt als je ein Schulbuch, und »Wir brauchen kaum noch hinzufahren. Ich kenne ja schon alles«, hatte er noch auf der Zugfahrt über den Brenner gemeint.
Dann aber dieses Italien! Ganz anders als auf Ansichtskarten oder im Reiseführer! Viel bunter, lauter, manchmal unerträglich, zumal in Rom, wo die Menschen in den Straßen schrien, als würden sie ständig um Hilfe rufen. Kinder plärrten, Frauen mit Blumenkörben schoben sich durchs Gewühl der viel zu schmalen Straßen. Jeder war jedem irgendwie im Weg, und doch war Platz für alle.
Diese Gerüche! Diese Farben! Die Menschen mit ihrem dunkel blitzenden Blick und den schwarzen Locken! Der blonde Bonhoeffer warf einen neidischen Blick auf den dunkelhaarigen Klaus. Der fiel hier nicht so auf wie er. Und der Himmel über allem! So blau, so klar. Ohne den leisen, alles wie in einen Schleier tauchenden Nebeldunst des Nordens.
Bonhoeffer seufzte abermals.
»Woran denkst du?«
»An den Petersdom.«
Der hatte ihn zunächst enttäuscht. War kleiner als erwartet und bei Weitem nicht so grandios wie das begrünte Kolosseum, zwischen dessen Trümmern noch alle Pracht der Antike durchzuschimmern schien und Hirtengott Pan in heidnischer Fröhlichkeit schrill auf seiner Flöte blies.