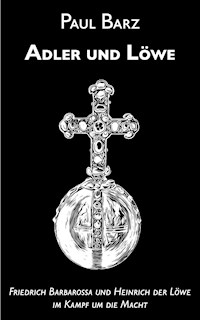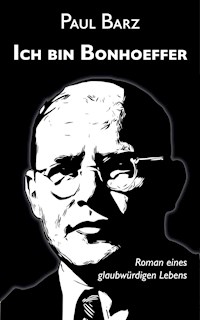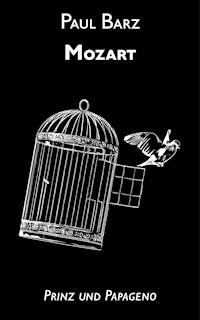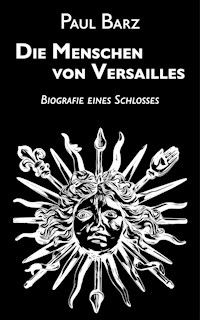3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
HEINRICH DER LÖWE IDOL SEINER ZEITGehasst und verehrt, ein moderner Politiker, ein erfolgreicher Geschäftsmann, Rechner und Planer, ein skrupelloser Stratege, der seine Rivalen in zahllosen Kriegen in Schach hält: Dieses in seinen Höhen und Tiefen einmalige Leben bestimmen die wichtigsten Strömungen seiner Epoche und kreuzen die interessantesten Persönlichkeiten seiner Zeit: Kaiser Friedrich Barbarossa, Englands König Heinrich II., dessen Gattin Eleonore von Aquitanien und beider Tochter Mathilde, die zweite Ehefrau Heinrich des Löwen wurde, sowie die vieldeutige Beatrix von Burgund, Gattin Barbarossas, und viele andere.Diese Zeit, dieses 12. Jahrhundert, ist eine der großen Schaltstellen der Geschichte. Hier entscheiden sich Entwicklungen, die bis auf den heutigen Tag nachwirken Paul Barz legte mit diesem Buch 1977 die erste moderne Biografie über Heinrich den Löwen vor, die jetzt eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage erfährt. Lediglich die Rechtschreibung wurde behutsam modernisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Barz
Heinrich der Löwe
Ein Welfe bewegt die Geschichte
Vorwort
Man darf nicht Fakten belehren wollen. Man muss sich von Fakten belehren lassen. Das ist der Realismus einer Biografie« — als Richard Friedenthal mir das im Frühjahr 1974 sagte, hatte ich das »Abenteuer Biografie« gerade zum ersten Mal hinter mir und wusste noch nicht, dass ich es kurz darauf ein zweites Mal auf mich nehmen würde. Beim ersten Mal war es um ein Schloss und seine Bewohner gegangen, um »Die Menschen von Versailles«. Das zweite Mal sollte es um einen Einzelnen gehen, um Heinrich den Löwen.
Ich weiß nicht, ob ich dabei je »Fakten belehren« wollte. Ich weiß aber, dass ich mich von Fakten belehren ließ. Denn natürlich hatte ich »mein« Heinrich-Bild, als ich mit den Vorarbeiten begann. Das war nach den zehn Jahren nicht ausgeblieben, die ich schon in »seiner« Stadt, in Braunschweig, lebte und in denen ich mich immer wieder mit diesem merkwürdigen, in keine Kategorie recht passenden Mann beschäftigt hatte.
Fakten belehrten mich, dass dieses Bild nicht unbedingt falsch, aber doch zu schmal und einseitig war, geprägt von der konventionellen Auffassung, Heinrichs historische Bedeutung vorrangig aus seiner Beziehung zu den Staufern abzuleiten. »Im Grunde ist ja Heinrich das große Alternativprogramm zu den Staufern samt ihren karolingisch-caesarianischen Vorstellungen«, schrieb ich in einem meiner ersten Briefe an meine Verlegerin. Heute würde ich das nicht mehr schreiben.
Nicht mehr nur als Alternative, sondern als originale Leistung sehe ich inzwischen das staatsmännische Hauptverdienst Heinrichs des Löwen, den Norden politisch wie kulturell-wirtschaftlich an das übrige Europa seiner Zeit angeschlossen zu haben. Entsprechend hat sich mein Bild von diesem Mann geformt als einem Rechner, Kaufmann und »Bürgerfürsten«, als der dann dieser Weife wirklich »die Geschichte bewegte« — in doppeltem Sinn.
Ich erhebe auch jetzt nicht den Anspruch, dass dieses Bild das einzig mögliche und richtige ist. Doch ist es »realistisch« im Sinn Friedenthalscher Definition. Für diese Definition und die darin enthaltene Lektion schulde ich dem Großmeister moderner Biografie meinen Dank und widme ihm dieses Buch in herzlicher Verehrung.
Wem wäre im Übrigen zu danken?
Meiner Frau für unentbehrliche Hilfe bei Materialbeschaffung und Korrektur; der Historikerin Ingrid Hammerstädt für gute und nützliche Gespräche im schwierigen Stadium der Vorbereitung; im besonderen Maß dem Historiker Gert Melville für die Durchsicht des fertigen Manuskripts und eine Fülle wichtiger Anregungen; meiner Sekretärin Else Stöcker, die bei der Endfassung zum kritisch-wachen Korrektiv wurde; den geduldigen und hilfsbereiten Mitarbeitern der Stadtbibliothek Braunschweig; dem Braunschweiger Fotografen Willi Birker für die Überlassung seltenen, noch nie veröffentlichten Bildmaterials von der Graböffnung im Jahr 1935; sehr vielen, die mir, oft unaufgefordert, gute Hinweise und interessantes Material gaben. Sie können hier nicht alle namentlich genannt werden, so wie nicht alle ihre Anregungen in das Manuskript eingehen konnten.
Dankbar bin ich einer Reihe von Historikern, die ich zwar persönlich nicht kenne, deren Arbeiten aber innerhalb der benutzten Sekundärliteratur ihren besonderen Rang für mich hatten: Karl Jordan sei stellvertretend genannt, auch Ruth Hildebrand, ohne deren in den Dreißigerjahren entstandenes Buch vom »Staat« Heinrichs des Löwen aller zeitbedingten Tendenz zum Trotz die Kapitel über Wirtschaft und Verwaltung nicht hätten geschrieben werden können. Für den Stand neuester Forschung gab mir Odilo Engels‘ »Staufer«-Publikation den besten Überblick.
Dank verdient schließlich der, der mir einmal sagte: »Über Heinrich den Löwen schreibst du? Über den weiß man doch schon alles. Dass der nach Canossa ging und so …«
Das hat Mut zu diesem Buch gemacht.
Braunschweig, im Mai 1977
Paul Barz
I. Teil:Begegnung mit dem Löwen
»Herzog Heinrich errichtete auf einem Sockel die Gestalt eines Löwen und umgab die Stadt mit Wall und Graben. Und weil er mächtig und reich war, erhob er sich gegen das Reich. Deshalb wollte ihn der Kaiser demütigen …«
Aus den »Annales Stadenses«, 13. Jahrhundert.
Heinrich — der Stein des Anstoßes
Im Dom ist noch Licht
Wahrscheinlich könnte man an diesem Abend noch hineingehen — zum Imerward-Kreuz und siebenarmigen Silberleuchter, auch zum Grabmal Herzog Heinrichs des Löwen und seiner Frau Mathilde. Doch wird man der Stadt gegenüber gleichgültig, in der man lebt, und nimmt als Teil des Alltags, was anderenorts als Sehenswürdigkeit gilt: den Dom und auch den Bronze-Löwen davor, diese Sinnbilder aus einer Zeit, in der noch Braunschweig die Stadt des Welfenherzogs Heinrich war und eine Weltstadt dazu, die große Metropole im Norden.
Noch immer nennt sich Braunschweig gern die »Löwenstadt«, und der Löwe auf dem Burgplatz ist ihr Wahrzeichen, dieses erste freistehende Standbild, das Herzog Heinrich 1166 aufstellen ließ.
Es ist mehr als ein Standbild. Es ist auch in Bronze gegossene Psychologie.
Den Schädel hochgereckt, die Zähne gefletscht, die angespannte Haltung mehr warnend als drohend — als »Imponiergehabe« würde heutige Verhaltensforschung diese Pose bezeichnen, als Signal für den anderen, nicht zu nahe zu kommen.
Dahinter wird aber ein Mensch sichtbar, nicht unbedingt brutal, doch robust wie dieser Löwe und »auf dem Sprung« wie er, stets bereit, allen Gegnern, tatsächlichen wie abgebildeten, sofort zu zeigen, wer man ist.
Das Grabmal im Innern des Doms zeigt einen anderen Heinrich.
Das Löwenbild entstand, als der Herzog Mitte dreißig war, also auf der Höhe seines Lebens. Dagegen wurde sein Grabmal über der Gruft im Dom erst einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte nach seinem Tod geschaffen, und ganz sicher hat der Künstler Heinrich den Löwen nicht mehr gekannt. Doch selbst wenn er sich sein Äußeres von anderen hätte schildern lassen, wäre es ihm auf Porträt-Ähnlichkeit nicht angekommen, denn ein Idealbild wollte er schaffen, harmonisch, entspannt: ein angenehmes Gesicht unter kurz gelocktem, sorgsam gescheiteltem Haar, eher durchschnittliche Züge bis auf den ausgeprägten Mund, die nicht zu große, doch wohlproportionierte Gestalt von einem Prunkgewand umwallt.
Im Arm hält dieser steinerne Heinrich Symbole seiner Macht und seines Reichtums, das herzogliche Schwert und ein Modell des Doms. Ganz scheint er dabei eins zu sein mit sich und seiner Welt, die er fast ein halbes Jahrhundert lang mitgeprägt hat. Darüber wurde dieser Herzog aber eine der vieldeutigsten, schillerndsten Gestalten deutscher Geschichte: Heinrich der Löwe, viel gelobt und viel gescholten.
Der Löwe dort, das Grabmal hier, dort aufbegehrende Gewalt, hier ruhevolle Macht — zwischen diesen Polen ist das wahre Bild des Mannes zu suchen, der wie kaum ein anderer seiner Zeit die unterschiedlichsten Urteile herausgefordert hat.
Heinrich der Löwe hat Geschichte gemacht. Er ist aber auch von der Geschichte gemacht worden und gehört zu seiner Zeit wie diese Zeit zu ihm. Der gleiche Heinrich zu einer anderen Epoche — sicher wäre er auch dann ein tüchtiger, erfolgreicher Fürst geworden. Doch das Phänomen »Heinrich der Löwe« samt allen Glanz- und Schattenseiten vermag man sich in dieser extremen Ausprägung vor keinem anderen Hintergrund vorzustellen als vor diesem 12. Jahrhundert.
Es war eine der merkwürdigsten, auch folgenreichsten Epochen in der gesamten europäischen Geschichte.
Noch durchschnitten den Kontinent keine klaren Grenzen. Noch wurde nicht in Nationen gedacht. Das Wort »Staat« im heutigen Sinn kannte man nicht. Jedoch gab es »das Reich«. Quer durch Europa zog es sich, vom Norden hinunter über die Alpenkette bis tief in die Apenninhalbinsel hinein, eine große, festgefügte Einheit — das hoffte jedenfalls derjenige, der in diesem Reich zu herrschen hatte: der Kaiser.
Könige gab es viele, in Polen, Dänemark, Frankreich, England, unten auf Sizilien. Auch der deutsche Herrscher hieß zunächst nur König, bevor ihn der Papst zu Rom gesalbt hatte. Doch nur einen durfte es geben, der sich Kaiser nannte, und dass auch noch ein anderer, der Herrscher von Byzanz, diesen Titel trug, gehörte zu den ständig schwelenden Problemen dieser Zeit. Denn der Kaiser war mehr als nur eine politische Größe. Er war weltliches Oberhaupt der ecciesia, der Christengemeinde, die ihr geistliches Oberhaupt im Papst fand.
Bündnis zwischen Altar und Thron
Hier der Kaiser, dort der Papst, hier weltliche Macht, das imperium, dort die geistliche, das sacerdotium — beides verschmolz zu jenem »Bund zwischen Thron und Altar«, den schon Kirchenvater Augustin beschworen hatte. Es war im Ansatz die Idealform einer Gewaltenteilung zwischen den beiden bestimmenden Kräften dieser Zeit und zugleich Fundament einer klaren Ordnung, in der jeder Zwiespalt aufgehoben war. So schien es jedenfalls. Die Wirklichkeit sah anders aus. Im 12. Jahrhundert war diese Ordnung längst in die Brüche gegangen.
Schon im Jahrhundert zuvor scheiterte der »Bund zwischen Thron und Altar«. In der Zeit der Salierkaiser hatte sich das Papsttum emanzipiert, wollte fort aus der Abhängigkeit vom Kaiser. Und mehr noch: Päpste wie der »heilige Satan« Gregor VII. meldeten ihrerseits politische Führungsansprüche an. Also verlangte die Beziehung zwischen Altar und Thron ihre neue Definition, ohne dass sie in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts schon gefunden war.
Das war das eine große Problem des Kaisertums. Ein anderes zeichnete sich zunächst noch mehr am Rande ab.
Das Reich war Schöpfung eines deutschen Königs gewesen, und deutsche Könige stellten die Kaiser. Zweihundert Jahre lang war das als selbstverständlich hingenommen worden. Dann jedoch begann es sich unter der Oberfläche zu regen. Am Horizont kam bereits die Zeit der Nationalstaaten auf, und ihre Herren waren nicht gewillt, sich länger als »Nebenkönige« abtun zu lassen. Noch stand das Reich, war die Position seines Kaisers unangefochten. Jedoch hörte es auf, alleinige politische Kraft in Europa zu sein.
Diese Entwicklung, langsam, aber unaufhaltbar, machte auch an den engeren Reichsgrenzen nicht halt. Schon lange war in Italien Sizilien selbstständig, wurde unter der Herrschaft der Normannen erster »richtiger« Staat überhaupt, straff organisiert und zentral verwaltet. Doch auch Deutschland selbst zeigte sich für diese eine große Strömung anfällig. Dort fanden sich als Relikte früherer Zeiten die »klassischen« Herzogtümer Bayern, Sachsen, Schwaben, Franken, Lothringen — waren sie aber wirklich nur Relikte? Boten sie sich nicht geradezu an als Keimzellen künftiger Nationalstaaten auf deutschem Boden?
Denn dem »Reichsgedanken«, der gemeinsamen Sprache und dem gemeinsamen König zum Trotz — es war ja keine Einheit, dieses Deutschland jener Zeit. Wer in seinem Süden lebte, fühlte sich wahrscheinlich Italien viel enger verbunden als dem deutschen Norden, wohin nur eine einzige Straße führte, während immerhin schon fünf das südliche Deutschland mit der Apenninhalbinsel verbanden. Der Sachse wiederum sah im Dänen oder Engländer viel eher seinen Nachbarn als im Bayern oder Schwaben. Auf solch unterschiedlichem Terrain waren viele Möglichkeiten, mancherlei Konstellationen denkbar gewesen, auch die eine: Nationalstaaten innerhalb der Herzogtümer, dem Kaiser als Oberherrn so eng oder auch lose verbunden, wie es schon Dänemark oder Polen waren, die ja ebenfalls noch nominell zum Reichsverband gehörten und deren Herrscher ihre Kronen als kaiserliches Lehen in Empfang zu nehmen hatten.
Doch noch war die Zeit der Nationen nicht gekommen. Erst während der nächsten Jahrhunderte sollten sie sich heranbilden. Das war aber nirgends ein so langwieriger, verschlungener Prozess wie gerade in Deutschland, das schwer an der Hypothek aus seiner Anfangsphase trug: an der einen großen Vision; die der gesamteuropäische Frankenkaiser Karl der Große hinterlassen hatte.
Karl der Große — die schwere Hypothek
Das Reich, über das der große Karl im 9. Jahrhundert zwischen Elbe und Pyrenäen im Zeichen einer vereinten abendländischen Christenheit geherrscht hatte, war schon bald nach seinem Tod zerfallen. Geblieben war nur der Anspruch dieses Kaisers: eben der Erste Herr der Christenheit zu sein. Diesen Anspruch griff dann der nach seinem Sieg auf dem Lechfeld als »der Große« bewunderte Sachse Otto auf. Mit seinem deutsch-römischen Reich schuf er im 10. Jahrhundert eine Wiederauflage des karolingischen Imperiums in verkleinerter, auf Deutschland und Italien beschränkter Ausgabe.
Zugleich dürfte Otto der Große der Erste gewesen sein, der klar das eine große Übel erkannt hatte, an dem letztlich das Reich Karls des Großen zugrunde gegangen war: an dem mangelhaften Verwaltungsapparat, der unter Karl nur Ansatz bleiben sollte, um unter seinen Nachfolgern völlig zu versanden.
Otto der Große musste von vorn anfangen.
Auch er hat diesen Verwaltungsapparat nicht schaffen können. Immerhin gelang ihm ein Übergang, als er die kaiserliche Macht auf die einzige überregional funktionierende Institution stützte, die es damals gab: auf die Kirche, auf ihre Äbte und Bischöfe, die jetzt große Herren von überragender politischer Bedeutung wurden, reich, mächtig, lebensfroh, den weltlichen Fürsten gleichgestellt.
Die »Reichskirche« war geboren.
Mit dieser Reichskirche entstand aber die Frage, die dann zum Zentralproblem des deutsch-römischen Kaisertums wurde: Welche Bedeutung hatte nun der oberste aller Bischöfe, der Papst in Rom? Konnte auch über ihn der Kaiser bestimmen wie über die anderen Bischöfe seines Reichs? Oder war nicht vielmehr er es, der über die Kaiser bestimmte, zum Beispiel innerhalb der »Reichskirche« die Bischöfe einsetzte und damit dieses wichtige Instrument kaiserlicher Macht unter Kontrolle hatte?
Wer stand also in Wahrheit an der Spitze der ecclesia?
Zunächst war das keine Frage gewesen. Denn noch galten die Spielregeln jenes »Bundes zwischen Thron und Altar«: Als Repräsentant des sacerdotium stellte sich der Papst freiwillig in den Schutz des imperium, gelobte dem Kaiser Treue und bestätigte ihn durch seinen Segen. Erst das 11. Jahrhundert brachte den Wechsel.
Noch immer zogen deutsche Könige nach Rom, um sich vom Papst zum Kaiser salben zu lassen. Doch vorbei waren die Zeiten, in denen diese Könige zugleich den Papst nach Belieben ein- und absetzen konnten. Noch der Salierkaiser Heinrich III. tauschte mit leichter Hand nicht weniger als dreimal den Papst nach eigenem Gutdünken aus. Doch schon sein Sohn Heinrich IV. durfte seinerseits froh sein, nicht gleichermaßen leichthändig vom Papst ausgetauscht zu werden.
Und in Rom fragte man sich schon ungeniert, ob nicht überhaupt der Kaiser ein Untergebener des Papstes war, da er doch ohne seinen Segen nichts sei, nur irgendein König aus Deutschland.
Das Wormser Konkordat von 1122 war für diese Probleme der vorläufige Schlussstrich. Grundsätzlich klärte es jedoch noch nichts. Der Zwist schwelte weiter, und der Bund zwischen Thron und Altar war zum Zwiespalt zwischen Kaiser und Papsttum geworden.
Das 12. Jahrhundert war gekommen. Eine »Reichskirche« ottonischer Vorstellung gab es nicht mehr. Dafür gab es nun den großen Konflikt zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Ihm mussten sich die Herren dieses neuen Jahrhunderts stellen.
Regieren ohne Kaiserkrone?
Die eine Lösung schien sich anzubieten: Trennung des deutschen Königtums von dieser so problematisch gewordenen Kaiserwürde, also Herrschaft in Deutschland ohne Rücksicht auf Papst und Kirche. Und wenigstens ein König, der erste Stauferherrscher Konrad III., sollte während seiner ersten Regierungsphase eben dies versuchen, um daran zu scheitern: Er schenkte sich die obligate Romfahrt— und konnte sich prompt in Deutschland nicht durchsetzen.
Auch hier rächte sich die große Uneinheitlichkeit im damaligen Deutschland, seine Aufsplitterung in ähnlich große Herzogtümer, deren Herren fast ebenso mächtig, wenn nicht noch mächtiger als ihr König waren. In ihrem Kreis spielte er den ersten unter gleichen, stellte einen politischen Faktor unter vielen dar. Erst das Kaisertum, dieses »gerechte, friedbringende Gottesreich auf Erden«, diese »Vorstufe zum Himmel« hob seinen Repräsentanten in gleichsam göttliche Regionen und gab ihm die Autorität, sich gegenüber den anderen Fürsten als moralisch übergeordnete Macht zu behaupten.
Denn diese anderen Fürsten waren die eigentliche Macht im Reich.
Dieser Macht war noch kein Herrscher beigekommen, nicht Otto mit seiner Reichskirche, nicht seine Nachfolger mit ihren gelegentlichen Versuchen, die Struktur der Fürstenhierarchie zu umgehen und sich die Staatsgewalt über eine direkte, nur dem König untergebene Administration zu sichern. Wer im Deutschland des 12. Jahrhunderts regieren wollte, musste es mit den Fürsten tun. Denn sie besaßen, was als Basis realer politischer Macht mehr als jeder Titel bedeutete: eigenen Grund und Boden.
Lehen — das soziale Zauberwort
Eigener Grund und Boden — das konnte persönliches Eigentum sein, sogenannter Allodialbesitz. Oder es war Besitz, den sein Herr als »Lehen« übernommen, also eigentlich nur »geliehen« hatte. Im 12. Jahrhundert bedeutete »Lehen« aber viel mehr als nur eine Leihgabe. Es war das soziale Zauberwort schlechthin.
»Ich hab ein Lehen«, sollte später Minnesänger Walther von der Vogelweide jubeln, und jeder Zeitgenosse wusste, was den berühmten Dichter daran so entzückte. Er hatte Eingang in die »bessere Gesellschaft« gefunden, durfte mit Wohlstand und Ansehen rechnen. Wer solche Lehen nicht besaß, war ein armer Schlucker. Wer aber erst einmal vor einem Lehensherrn gestanden hatte, barhäuptig und demütig, wer seine gefalteten Hände in die seinen gelegt und gelobt hatte, ihm stets »treu, hold und gewärtig« zu sein, um dann vergnügt mit einem Lehen als Besitz davonzuziehen, war in die soziale Struktur seiner Zeit voll aufgenommen.
Dieses Lehenswesen war keine Erfindung des 12. Jahrhunderts. Schon im 8. und 9. Jahrhundert banden die Mächtigen Vasallen an sich, indem sie ihnen ein Stück ihres eigenen Landes zur persönlichen Nutzung überließen und dafür Gefolgschaftstreue erwarteten. Ein sehr praktisches System: Gab doch damit der bisherige Besitzer sein Eigentum nicht völlig aus der Hand, sondern konnte es spätestens nach dem Tod des Vasallen zurückfordern und von Neuem verleihen. Und ein ungeheurer sozialer Fortschritt war es auch: Löste es doch die bisherigen starren Besitzverhältnisse auf und gab jedem Einzelnen die Chance, Land zu erwerben. Freie Bahn dem Tüchtigen — so schien zunächst die Losung zu sein.
Doch war nur allzu rasch die Zeit über diese ersten produktiven Ansätze hinweggegangen. Spätestens mit der Erblichkeit der Lehen, ohnehin ein Widerspruch in sich, erstarrten die Besitzverhältnisse von Neuem. Und nicht nur die Besitzverhältnisse — mehr als in jedem anderen Teil Europas wurde gerade in Deutschland das Lehenswesen zu einem politischen Prinzip, das auch über die Machtverteilung im Reich entschied. Vor allem die Herrscher des 12. Jahrhunderts sollten das zu spüren bekommen: Um diese Zeit hatte das Lehenswesen seinen Höhepunkt erreicht, und was so bieder-eingängig klang, diese Treue, die da der Lehensmann seinem Lehensherrn gelobte, war zu einem ungemein verwickelten Problem geworden. Denn wo begann diese Treue, wo hörte sie auf? War sie gleichbedeutend mit unbedingtem Gehorsam? Doch wie konnte sie das sein, wenn ein jeder in der Regel Lehen verschiedener Herren besaß?
So hatte sich das Lehenssystem letztlich nicht als der great deal erwiesen, der die Besitzverhältnisse im Fluss hielt und zugleich die einen zuverlässig an die anderen band. Vielmehr hatte es nur einige große Familien nach oben gespült, die mit seiner Hilfe noch größer geworden waren und nun die erste Macht im Reich darstellten.
Die Macht der großen Familien
Diese Familien teilten sich in den Lehensbesitz, gingen nach Belieben mit ihm um, tauschten oder verkauften ihn, vererbten ihn oder gaben auch Teile davon als »Afterlehen« an zuverlässige Dienstmannen weiter. Längst war darüber dem obersten Lehensherrn, dem König, die Kontrolle entwunden worden. Mit lauter kleinen Dynastien hatte er es zu tun, untereinander durch zahllose Ehen verbunden und im Besitz so großer Territorien, dass sie daraus entsprechende Machtansprüche ableiten konnten: die Zähringer, Babenberger, Wittelsbacher, Andechser, Supplinburger. Im Vordergrund standen aber immer mehr die beiden Sippen, in deren Kämpfen schließlich die große Auseinandersetzung zwischen den Lehensgeschlechtern gipfeln sollte: die Welfen und die Staufer.
Diese wenigen Familien stellten die Herzöge, aus ihren Reihen wurden die Grafenämter besetzt. Ihnen entstammten die meisten großen Kirchenfürsten. Und aus ihrer Mitte kam schließlich derjenige, der von seinen Standesgenossen in Frankfurt oder Mainz zum König gewählt wurde. Nach vollzogener Wahl schmückte man ihn dann in Aachen mit den Reichsinsignien, mit Krone, Lanze, Schwert und Mantel, er war gekrönt — und musste nun zusehen, wie er sich den anderen Familien gegenüber behauptete.
So stand es also um den Ersten Herrn der Christenheit, als den sich ein Nachfolger Karls oder Ottos des Großen immer noch empfinden durfte. So stand es um sein Reich, dieses Konglomerat aus immer schwieriger werdenden Besitzverhältnissen und Rechtsansprüchen. Und so stand es um dieses 12. Jahrhundert, das so viele Hypotheken und Traditionen vergangener Zeiten mit sich zu schleppen und zu verarbeiten hatte, das aber zugleich voll neuer Möglichkeiten und ungewohnter Ansätze steckte.
Denn im Grunde war dieses 12. Jahrhundert eine junge, eine neue Zeit: eine Zeit im Umbruch.
Aufbruch zu den Grenzen
Noch bedeckte Wald den größten Teil des deutschen Bodens. Doch immer mehr fiel er den Rodungen dieser Zeit zum Opfer, denn sprunghaft war schon im Jahrhundert zuvor die Bevölkerung angewachsen, und bald reichte der kultivierte Boden nicht mehr für alle, die auf ihm leben und sich von ihm ernähren wollten.
Also brachen die Menschen auf und zogen zu den Grenzen des Reichs, wo als dessen Vorposten die Marken entstanden waren. Wer dort zum Markgrafen ernannt wurde, hatte das große Glück gemacht. Denn nun konnte er weitgehend unabhängig regieren und musste nur zusehen, das anvertraute Land so fest wie möglich in die Hand zu bekommen. So waren es die Markgrafen, die die Ströme der Auswanderer in ihre Gebiete zogen, und ohne all die lästigen Einschränkungen des etablierten Lehenssystems vollzog sich dort die eine kulturelle Großtat dieser Epoche: die Kolonisation an den Grenzen.
Die neuen Mächte: Stadt und Geld
Daheim im Reich verschwand aber immer mehr der »klassische« Stand des freien Bauerntums, wie er ursprünglich die germanische Gesellschaft bestimmt hatte, und vorbei waren die Zeiten, in denen noch der einzelne ein Bauer, Kämpfer und Händler zugleich sein konnte, stolz und unabhängig auf freier Scholle. Der Grundbesitz gehörte den Lehensherren, Handel trieben aber nun die Kaufleute, und in ihren Städten bildete sich bereits der Stand der Zukunft heran, der schon erste Ansprüche auf größere Rechte, vergrößerte Unabhängigkeit anmeldete: das Bürgertum. Mit dem Bürgertum sollte aber jene neue Weltmacht aufkommen, die schließlich Grund und Boden als alleinigen Maßstab für Besitz und Macht ablöste: das Geld. Abgelöst wurde aber auch als bestimmende gesellschaftliche Schicht jener Stand, der im 12. Jahrhundert seine letzte große Blüte erlebte: das Rittertum.
Letzter Glanz für das Rittertum
Ursprünglich waren es nicht allzu feine Herren gewesen, die sich da gegen Entlohnung Mächtigen als Kämpfer zur Verfügung stellten. Doch je dringlicher diese Mächtigen solche Kämpfer für ihre Heere brauchten, desto wichtiger wurden diese Ritter. Ihr Aufstieg war aufs Engste mit dem Aufkommen des Lehenssystems verknüpft, denn für ihre Dienste wollten sie nicht Geld, sondern Grund und Boden. Dort aber bauten sie ihre Burgen, und dort zelebrierten sie ihren Lebensstil, der eine seltsame Mischung aus rüder Praxis und hochfliegenden Idealen war.
Wie ein Ritter sein musste, erfuhr jeder Junge von seinem siebten Lebensjahr an: treu, mutig, ehrenhaft, stets großzügig und maßvoll. Dann war ihm die »saelde« gewiss, die Seligkeit, eine auf Gott bauende, von Angst und Sorgen freie Selbstsicherheit.
In diesen Idealen wurde ein junger Mann erzogen, und diese Ideale versuchte er zu beherzigen.
Konnte er das aber überhaupt in einer Zeit ständiger Kriege, die nicht weniger grausam, nicht weniger blutig waren als die Kriege aller Zeiten? So haftete dem Rittertum gerade in seiner Blütezeit ein Hauch von Künstlichkeit an, von allzu hoch gespannter Lebenshaltung: Die Welt ein riesiger Turnierplatz, wo äußerste Fairness waltete — am Abend trug man dann die Toten weg, verbarg triefendes Blut und scheußliche Wunden hinter gleichmütigem Lächeln, sang von Minne und Edelmut.
Zufall oder Notwendigkeit wollten es aber, dass in dieser letzten großen Blütezeit des Rittertums eine Familie in den Vordergrund trat, deren Männer den typischen Ritter repräsentierten, aus eher trüben Anfängen zu plötzlichem Glanz aufgestiegen und dort nun in der schwierigen Balance zwischen hohem Ideal und rüdem Machtanspruch: die Staufer. Typischer Staufer wiederum, obwohl auch mit allen anderen großen Familien des Reichs verwandt, war der Mann, der sich als erster seiner Sippe zum Kaiser aufschwingen konnte: Friedrich Barbarossa.
Die schöne Welt des Barbarossa
In Barbarossas Welt war das Rittertum nicht nur eine soziale Kaste. Es war eine Daseinsform. Und er selbst wurde ihr berühmtester Repräsentant, der ritterlichste Ritter, der noble Herr, der »Masze« wahrte, wenn er einen gedemütigten Gegner unter Tränen an die Brust zog oder einem anderen den eigenen Leibarzt in die belagerte Stadt schickte, der zugleich aber vor keiner Grausamkeit zurückschreckte, wenn sie ihm geboten schien. Und sie schien ihm oft geboten.
Wie aus lauter schönen Bildern wirkt seine Welt zusammengesetzt: einstimmige Wahl zum König, Krönung zum Kaiser, Triumph als »Vater des Vaterlandes«, Ausritt zum Kreuzzug, um Christi Grab aus den Händen der Heiden zu befreien. Das Land blüht, Gerechtigkeit herrscht. Auf seinen Pfalzen hält der Kaiser prächtige Hoftage ab. Große Ritterfeste werden gefeiert mit siebzigtausend Gästen aus aller Welt, und noch die Dichter späterer Jahrhunderte singen vom Kaiser Rotbart lobesam, bis er schließlich vollends eingeht in die Legende und im rabenumkreisten Kyffhäuser die Ewigkeit hindurch wartet, auf dass eines Tages dieses sein Reich wiedererstehe. Barbarossa wurde vollends zur mythischen Symbolfigur einer Welt, für die er zunächst so typisch wirkt, dass man sie ganz und gar in seinem Bild zu entschlüsseln meint. Ganz und gar scheint sich in ihm das 12. Jahrhundert zu spiegeln.
Jedoch legt sich über dieses Bild ein Schatten. Es ist der Schatten des Löwen, jenes Mannes, der so ganz anders ist als dieser Kaiser — und doch für sein Jahrhundert ebenso typisch wie Barbarossa.
Der Schatten des Löwen
Um Heinrich den Löwen rankt sich kein Kyffhäuser-Mythos. Von ihm haben nicht Dichter gesungen, sondern nur Chronisten berichtet. Er ist kein Ritter wie sein Kaiser. Und fragt man nach seinen Tugenden, darf man nicht im Katalog der Ritterlichkeit nachschlagen.
Heinrich der Löwe war unheimlich fleißig: Sein Itinerar weist einen Mann aus, der sich nie Ruhe gegönnt zu haben scheint, fast ständig unterwegs war und sich auch noch um die geringste Kleinigkeit in seinem Machtbereich persönlich kümmerte.
Heinrich war unheimlich tüchtig: Was immer er anpackte, schien ihm zu gelingen. Und wenig gab es, das er nicht anpackte. Darüber wurde er zum Erfolgsmenschen schlechthin — bis sich sein Erfolg gegen ihn stellte.
Vor allem war er unheimlich egozentrisch: Sein Gesetz war er selbst. Einen anderen Maßstab gab es für ihn nicht. Das war zugleich seine Möglichkeit wie seine Grenze.
Heinrich der Löwe war in jeder Hinsicht unheimlich. Der glatte Reim, den man sich schon auf Barbarossas Welt gemacht hatte, wird durch diesen Mann wieder zerstört. Die Kategorien des ritterlichen 12. Jahrhunderts stimmen dann nicht mehr: Für jede scheint sich eine Alternative anzubieten, und die trägt in der Regel die Spur des Löwen. Das macht aber Heinrich zum großen Stein des Anstoßes in dieser Zeit. Man darf nicht nur Barbarossa, man muss auch ihn verstehen, will man dieses wirre, bunte, widerspruchsvolle 12. Jahrhundert begreifen.
Wo kann dieses Verständnis einsetzen? Beim Bild seiner Persönlichkeit oder beim Bild seiner Zeit? Bei seinen Tugenden oder seinen Schwächen? Vom Ende dieser einmaligen Laufbahn her oder von ihrem Anbeginn aus? Soll man den Heinrich seines Grabmals im Braunschweiger Dom nehmen, den gelassen in sich ruhenden Herrn einer gesicherten Welt? Oder den anderen, wie er sich dort draußen vor dem Dom im Standbild seines Löwen spiegelt und dort einer entfesselten, zutiefst unsicheren Welt die gefletschten Zähne zeigt?
Heinrich der Löwe hat viele Deutungen gefunden. Doch was immer er tat und wie dieses Tun einzuschätzen war — zunächst einmal ist er das, als was er die historische Szene betritt: ein Welfe.
II. Teil:Vor dem Sprung
«Es gab im Römischen Reich im Gebiet von Gallien und Germanien bisher zwei berühmte Familien; die eine war die der Heinriche von Waiblingen, die andere die der Welfen von Altdorf, die eine pflegte Kaiser, die andere große Herzöge hervorzubringen…«
Aus den »Gesta Frederici« Ottos von Freising.
Was es heißt, ein Welfe zu sein
Ein Kind in Deutschland
Die Geburt muss schwer gewesen sein. Jedenfalls wird sich die viel zu junge Mutter nie mehr so recht erholen, und er bleibt auch ihr einziges Kind, dieser Junge, der irgendwann zwischen 1129 und 1135 geboren wird.
Es wirkt seltsam, dass sich für den Sohn eines der mächtigsten Männer seiner Zeit kein genaues Geburtsdatum findet. Doch so ist es in dieser Zeit: Die Geburt eines Kindes nehmen die Chronisten nicht so wichtig, und auch beim ersten und einzigen Sohn Herzog Heinrichs des Stolzen aus dem Haus der Welfen bleibt man auf Mutmaßungen angewiesen.
Bei seinem Tod im Jahr 1195 wird von einem 66-Jährigen die Rede sein. Das lässt auf das Jahr 1129 schließen. Doch noch 1159 weist ihn ein Dokument als »iuvenis« aus, und das heißt im damaligen Sprachgebrauch, dass er zu diesem Zeitpunkt höchstens 28 Jahre alt gewesen sein kann, also nicht vor 1131 geboren worden ist. Eine dritte Möglichkeit: das Jahr seiner Taufe, 1135 — denn 1147 erhebt der Junge erstmals Anspruch auf das bayerische Herzogtum. Dafür muss er »lehensfähig« gewesen sein. Das wurde man aber mit wenigstens zwölf Jahren.
Unbekannt das Geburtsjahr, unbekannt der Ort: Vielleicht ist es das schwäbische Ravensburg in der Nähe des Bodensees gewesen, das nach den »Raven«, den Reben, seiner Weinberge benannt wird. Hier hat die väterliche Familie ihren Stammsitz, hierher soll der Vater seine junge Frau gleich nach der Hochzeit gebracht haben. Und hier könnte auch ihr Sohn herangewachsen sein, frei und ungebärdig wie ein »Welp«, ein kleiner Löwe — ein stämmiger, untersetzter Bursche mit dunklem Haar und auffallend dunklen Augen, bald schon ein guter Reiter und geschickter Bogenschütze, gewandt beim Umgang mit Armbrust und Schwert. Denn das sind die Tugenden, in denen ein Junge seiner Herkunft und Zeit vor allem unterwiesen wird. Alles andere ist weniger wichtig.
Lesen und Schreiben dürfte er gelernt haben, vielleicht ein wenig Himmelskunde, vielleicht Latein und ganz bestimmt die Grundlehren der Religion. Dafür sorgen schon die Geistlichen, in deren Händen die Erziehung liegt. Wer sie sind, wissen wir nicht. Man kennt auch nicht seine ersten Freunde, seine frühen Gefährten und möglichen Vorbilder.
Vom Vater dürfte das Kind wenig gesehen haben. In diesen Jahren ist Heinrich der Stolze vollauf damit beschäftigt, seine und seines kaiserlichen Schwiegervaters Position gegen den Zugriff der großen Rivalen aus dem Haus der Staufer zu verteidigen, sodass er sich fast ständig im Krieg befindet. Im Übrigen ist Erziehung die Sache des Klerus und der Frauen.
Also die Mutter: Uns fehlt ein klares Bild von dieser Frau, der Tochter Kaiser Lothars III. Gerade elf ist die kleine Sächsin, als sie mit dem um einige Jahre älteren Bayernherzog Heinrich verheiratet wird, und auch noch ein halbes Kind bei der Geburt ihres Sohnes. Schon früh wird sie Witwe, früh stirbt sie selbst, eine eher schwache, zarte Frau, diese Gertrud aus dem Haus der Supplinburger.
Anders ihre Mutter, in deren Schatten Gertrud den größten Teil ihres kurzen Lebens verbringt: Richenza aus dem Haus der mächtigen und reichen Grafen von Northeim ist die sicher bemerkenswerteste Persönlichkeit am Hofe ihres Mannes, eine Frau von fast männlicher Tatkraft und scharfem Verstand. Einige ihrer Wesenszüge werden sich bei ihrem Enkel wiederfinden: diese zupackende, ganz aufs Praktische ausgerichtete Energie, dieses bis zum starren Hochmut gesteigerte Selbstbewusstsein, durchglüht von einem unbändigen Ehrgeiz.
Noch zu Lebzeiten ihres Mannes greift sie mehrfach ins politische Geschehen ein, übernimmt dann nach seinem Tod für kurze Zeit die Regierungsgeschäfte und wird schließlich in den großen Kämpfen um das sächsische Herzogtum eine zentrale Rolle spielen. Eine solche Frau dürfte auch dem einzigen Enkel rechtzeitig klargemacht haben, was es heißt, Enkel eines Kaisers, Sohn eines Herzogs und selbst — ein Welfe zu sein. Denn dieses Kind soll einmal die Sache seines Hauses weiterführen.
Doch ist es bis dahin noch weit.
Zunächst findet sich ein erstes präzises Datum für den Lebensweg des Kindes: jene Taufe zu Pfingsten 1135, mit standesgemäßem Aufwand auf der Ravensburg gefeiert. Der Junge erhält aber den Namen des Vaters, heißt nun Heinrich, was so viel wie »Herr eines kleinen Besitzes« bedeutet. Das schmeckt fast nach Ironie. Denn der »kleine Besitz«, dessen Herr der Täufling einmal werden soll, ist der vermutlich größte in ganz Europa.
Güter in Sachsen, Schwaben, Bayern, ein zwar nicht zusammenhängender, doch unübersehbar breiter Gürtel persönlichen Eigentums, der sich von Norden nach Süden zieht — das ist das Hausgut der Welfen. Es endet nicht an der Alpenkette, führt noch weit nach Italien hinein bis an die Ostküste der Apenninhalbinsel, sodass es um diese Zeit »von Meer zu Meer«, von der Nordsee bis an die Adria reicht.
Die Welfen sind nicht nur reich. Sie haben auch Macht. Und sie wissen diese Macht zu gebrauchen.
Schon seit drei Generationen stellen sie die Herzöge von Bayern. Heinrich der Stolze wird zudem noch Markgraf im mittelitalienischen Tuszien. Hinzu kommen Rang und Reichtum seiner Schwiegereltern: Richenzas riesige Besitzungen um Braunschweig und Northeim sowie Kaisertitel und sächsische Herzogwürde Lothars III.
Was fehlt noch? Eigentlich nur noch die Kaiserkrone auf dem Haupt eines Welfen — und auch dieses letzte, höchste Ziel scheint um 1135 greifbar nahegerückt. Dann werden es Welfen sein, die über das Reich bestimmen.
Vom unaufhaltsamen Aufstieg der Welfen
Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Sie zeichnet sich schon um 800 ab, als man die ersten Welfen bei Altorf am Bodensee antrifft, wo später die Ravensburg entstehen soll. Schon um diese Zeit ist die Familie nicht mehr ganz jung, reichen ihre Anfänge bis ins früheste Mittelalter, wenn nicht bis in die Antike zurück, und nicht ohne Stolz rechnen die Welfen Caesars Mörder Cassius zu ihren Vorfahren.
In Schwaben haben sie das Grafenamt inne. Unter Karl dem Großen dienen sie bereits als Heerführer, dürfen sich also schon Herzöge nennen. Daneben treiben sie gezielte Heiratspolitik. Eine Welfin, die schöne und ehrgeizige Judith, heiratet Karls des Großen Sohn Ludwig den Frommen, was wiederum ihre Schwester, die nicht minder schöne und ehrgeizige Hemma, nicht ruhen lässt. Sie wird Frau Ludwigs des Deutschen, eines Enkels des großen Frankenkaisers.
Später werden Chronisten nicht weniger als neun verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Karolingern und Welfen feststellen, worauf die Welfen nicht einmal besonders stolz sind. In ihren Augen haben eher die Karolinger Grund, auf ihre Verbindung mit den Welfen stolz zu sein. Denn Minderwertigkeitsgefühle sind in ihren Kreisen unbekannt.
Doch das alles ist nur Vorspiel. Der eigentliche Aufstieg setzt erst um 900 ein, als sich ein Welfe, »Heinrich mit dem goldenen Wagen«, auf die Regeln des noch jungen Lehenssystem einlässt und fremdes Eigentum übernimmt. Seinen Vater wird dieser Schritt so erbittern, dass er mit einigen Getreuen in die Wildnis geht und von dort bis an sein Lebensende nicht mehr zurückkehrt. Jedoch ist es für die Welfen der Anfang ihrer politischen Karriere.
Im Übrigen bleiben sie auch als Lehensherren, was sie immer waren: eine stolze, selbstbewusste Sippe, der ihr Besitz an Grund und Boden breiten Spielraum für persönliche Machtentfaltung lässt. So sind sie einmal für, dann wieder gegen den jeweiligen Kaiser, sind gute Kämpfer und nicht immer gute Diplomaten. Und sie haben Erfolg — bis ihr Haus in seine erste Krise gerät.
Um 1055 stirbt Herzog Welf III. und hinterlässt keine männlichen Nachkommen. Das könnte das Ende sein. Jedoch tritt nun aus dem Hintergrund Irmentrut hervor, Mutter des Verstorbenen und eine jener ehrgeizigen, tatkräftigen Frauen, mit denen gerade diese Sippe so reich bestückt ist. Irmentrut lässt es nicht zu, dass das welfische Erbe dem Kloster Altdorf in der Nachbarschaft der Ravensburg zufällt, wie es Welf III. vor seinem Tod angeblich verfügt hat. Ihr Hilferuf geht nach Italien. Dort ist ihre älteste Tochter Kunigunde mit dem Grafen Azzo aus dem Haus der Este verheiratet, einem der reichsten und mächtigsten italienischen Fürsten. Kunigunde hat einen Sohn, Welf geheißen wie sein verstorbener Onkel. Diesen Welf lässt die Großmutter fragen, ob er bereit sei, das deutsche Erbe anzutreten.
Welf ist grundsätzlich zu allem bereit, was Erfolg verspricht. Jetzt lässt er sich nicht lange bitten, löst noch rasch die Ehe mit einer Italienerin und kommt als Welf IV. über die Alpen: klug, tüchtig, skrupellos — der rechte Mann für diese Zeit.
Auftritt eines Glückspielers
Es sind dies die Jahre, in denen auf dem Kaiserthron Heinrich IV. sitzt, die wohl problematischste, unseligste aller deutschen Herrschergestalten. Er legt sich nicht nur mit dem Papst, sondern auch mit seinen Fürsten an, er will alles zugleich und erreicht doch nur, dass das Kaisertum in seine schwerste Krise gerät. Gegenkönige werden aufgestellt, Aufstände niedergeknüppelt, es kommt zum schmachvollen Bußgang nach Canossa: lauter unerfreuliche Entwicklungen, die aber auch ein politisches Terrain schaffen, auf dem sich ein Glücksspieler großen Stils zu Hause fühlt. Solch ein Glücksspieler ist Welf IV.
In den Jahren zwischen 1056 und 1106 sieht man ihn wenigstens dreimal Front und Gesinnung wechseln. Er heiratet eine bayerische Prinzessin und verstößt sie wieder, schwört Freunden die Treue und verrät sie bei nächster Gelegenheit. Den eigenen Schwiegervater bringt er um das bayerische Herzogtum, um sich an seine Stelle zu setzen — und geht doch aus allem ungeschoren hervor.
Im Gegenteil: Er hat sogar Erfolg.
Am Ende seines Lebens sieht man ihn dann als Herzog von Bayern, als einen reichen, alten Mann mit besten Verbindungen zum salischen Kaiserhaus, das er so oft verraten hat. Im Übrigen wird er fromm geworden sein, Klöstern reiche Schenkungen machen und schließlich stilvoll auf einer Pilgerfahrt sterben — eine trotz allem imponierende Persönlichkeit und ein ganz neuer Typ im Hause Welf.
Davor hatte man sich diese Sippe als nicht eben bescheidene, doch redliche Verfechter ihrer wohlbegründeten Rechte vorstellen können, mehr trutzige Kämpen als raffinierte Intriganten. Mit Welf IV. mischen sich neue Farben in ihr Bild: Züge des Hasardeurs, des Machtmenschen ohne Skrupel und Moral — und ganz werden sich diese Züge auch nicht mehr verlieren.
Das wird vor allem bei Welfs Sohn Heinrich deutlich, der 1120 das Erbe übernimmt. Man nennt ihn den Schwarzen nach seinem dunkellockigen Bart, doch einmal, gegen Ende seines Lebens, gewinnt sein Beiname tiefere Bedeutung. Er hat die Chance, im ganz großen Stil beim Spiel um die Macht mitzumischen — und er wäre nicht ein Sohn Welfs IV., wenn er sich diese Chance entgehen lassen würde. Es handelt sich um die Königswahl des Jahres 1125.
Der neue Feind aus Schwaben
In Utrecht stirbt an Krebs Kaiser Heinrich V., letzter Vertreter des Salierhauses, das ein rundes Jahrhundert lang mit wechselndem Glück über das deutsch-römische Reich geherrscht hatte. Erben sind zur Stelle: die ebenso ehrgeizige wie begabte Sippe der Staufer. All die Jahre haben sie treu zu den Saliern gestanden, wurden Schwabens Herzöge und sind dem Herrscherhaus durch Verwandtschaft und gemeinsamen Besitz eng verbunden. Lieber noch als Staufer hören sie sich »Waiblinger« nennen nach dem Stammsitz der Salier, als deren legitime Erben sie sich fühlen. Niemand zweifelt denn auch daran, dass ein Staufer nächster deutscher König wird, und guten Mutes stellt sich Herzog Friedrich II. von Schwaben zur Wahl.
Man schreibt den August 1125.
Aus allen Teilen Deutschlands sind rund sechzigtausend Edle zur Königswahl nach Mainz gekommen, dazwischen der Favorit Friedrich und als weiterer Königskandidat der sächsische Herzog Lothar von Supplinburg, ein tüchtiger Provinzfürst, den sich jedoch niemand so recht als Kaiser vorstellen kann, am wenigsten sein Rivale aus dem Haus der Staufer. Überhaupt sieht sich Friedrich schon als gewählter König und sagt das jedem, der es hören will.
Einer hört es gar nicht gern: Bischof Adalbert von Mainz, der Leiter der Wahl. Er gehört zu den rigorosen Vertretern einer mächtigen, unabhängigen Kirche und muss schon deshalb ein Feind der Salier sein, die dem Papsttum so übel mitgespielt hatten. Von den Staufern als Erben der Salier kann er aber keine Wende erhoffen. Dagegen ist der Supplinburger Lothar ein ganz anderer Mann.
Nachdenklich betrachtete Adalbert den stämmigen Sachsen: Gewiss, der ist kein brillanter Kopf, verspricht jedoch, stets fromm und kirchentreu zu sein. Der Mainzer Bischof könnte sich jedenfalls keinen besseren König wünschen. Und im Hintergrund setzt das Getuschel ein, finden geheime Beratungen hinter verschlossenen Türen statt, nicken sich Männer vielsagend zu.
Dennoch scheint Lothars Wahl zunächst aussichtslos. Zu stark ist die Position des Staufers, eigentlich alle scheinen auf seiner Seite zu sein, besonders der Welfenherzog Heinrich der Schwarze, Freund und Schwiegervater Friedrichs. Aber dann kommt es ganz anders. Zur grenzenlosen Überraschung der Versammlung wird nicht der Schwabenherzog, sondern sein sächsischer Kollege zum König gewählt, und den Ausschlag gab kein anderer als eben Heinrich der Schwarze.
Man steht vor einem Rätsel.
Das Rätsel löst sich, als sich im nächsten Jahr der älteste Sohn des Welfenherzogs, Heinrich der Stolze, mit Gertrud verlobt, der Tochter Lothars. Jetzt weiß man, was der schwarze Heinrich mit seiner radikalen Kehrtwendung gewollt hat: Es mag gut sein, einen Schwiegersohn zum Kaiser zu haben, wie es der Staufer gewesen wäre — doch noch besser ist es, dem eigenen Sohn den Weg zum Kaiserthron zu öffnen. Als Ehemann der Kaisertochter Gertrud ist aber Heinrich der Stolze einziger männlicher Erbe des frischgewählten Lothar. Damit hat Heinrich der Schwarze mit kühnem Zugriff das Kaisertum aus der salisch-staufischen Bahn heraus- und es den Sachsen und Welfen zugeführt. Zufrieden kann er sich in ein Kloster zurückziehen, wo er im Jahr darauf stirbt. Sein Haus hat der alte Fuchs besorgt.
Zukunft, die im Norden liegt
Heinrichs Hinwendung nach Sachsen kommt nicht zufällig. Noch unter Welf IV. war die welfische Hauspolitik nach Süden ausgerichtet gewesen mit Bayern als nördlichem Brückenkopf des kleinen Welfen-Imperiums, an dem Welf IV. sein Leben lang zäh und listig gebaut hatte. Jedoch hatte er auch Fehlschläge einstecken müssen: Seine Ansprüche auf das Erbe der Este hatte er gegenüber seinen Stiefbrüdern Folko und Uggo aus der zweiten Ehe des Vaters nicht durchsetzen können; die Ehe seines ältesten Sohnes mit der Markgräfin Mathilde von Tuszien war in die Brüche gegangen, als die ebenso kirchentreue wie herrschwütige Mathilde ihrem über zwanzig Jahre jüngeren Mann ihr Erbe zugunsten des Papstes verweigert hatte. Welfs italienische Träume waren vorerst ausgeträumt.
Doch konnte das diesen Machtmenschen von Geblüt nicht beirren. Sollte es nicht der Süden sein, so würde eben der Norden welfisches Terrain werden: Sachsen zum Beispiel, wo gerade die Ära der Herzöge aus dem Haus der Billunger zu Ende ging. Schon strickte Welf IV. an einem neuen Netz.
Seinen Sohn Heinrich den Schwarzen verheiratete er mit der Tochter des letzten Billungerherzogs. Das brachte immerhin schon stattlichen Grundbesitz, darunter Lüneburg mit seinen Salzsalinen. Den nächsten Schritt tat dann bereits Heinrich der Schwarze selbst mit seiner Entscheidung von 1125: Ein Sachse der König, ein Welfe dessen nächster Gefolgsmann und möglicher Erbe — die Partie scheint aufzugehen.
Und die Staufer?
Sie fühlen sich zu Recht betrogen. Schon bald kommt es zum offenen Streit mit Lothar III., den sie zunächst noch zähneknirschend anerkennen mussten. Schließlich streift Friedrichs jüngerer Bruder Konrad jede Vorsicht ab: Er lässt sich als Gegenkönig aufstellen. Der Kampf beginnt. Und da Heinrich der Stolze natürlich auf der Seite seines Schwiegervaters steht, ist es der erste jener Kämpfe zwischen Staufern und Welfen, die von nun an die deutsche Geschichte mitbestimmen werden.
Doch noch ist die Stunde der Staufer nicht gekommen.
Viele Jahre lang ziehen sich die Kämpfe hin. Für die eine wie die andere Seite bringen sie Sieg und Niederlagen. Schließlich müssen aber doch die Staufer aufgeben, und so findet 1135 eine vorläufige Versöhnung statt: In Bamberg bittet Friedrich von Schwaben Kaiser Lothar kniefällig um Gnade, und ein halbes Jahr später verzichtet sein Bruder Konrad auf das Gegenkönigtum. Ihre Hoffnungen haben sie aber noch lange nicht begraben.
Sieger dieser ersten Staufer/Welfen-Runde ist Heinrich der Stolze. Er kassiert den Preis: die Markgrafenschaft Tuszien sowie das Hausgut seiner inzwischen verstorbenen Tante Mathilde. Es ist die Zeit, in der ihm sein Sohn Heinrich geboren wird, und es mag Augenblicke geben, in denen der Vater diesen kleinen Jungen mit grimmiger Freude betrachtet: Dieser schwarzlockige Knabe wird einmal Kaiser sein, so wie er sich schon selbst als nächsten Kaiser sieht. Die Welfen haben eine kühne Höhe erreicht.
Ein allzu stolzer Heinrich
Heinrich der Stolze ist nicht ganz der Mann, der solch eine Höhe verträgt. Er ist nicht nur stolz, er wird schlichtweg arrogant. Kaum ein Fürst, den er nicht in irgendeiner Weise kränkt — er schert sich nicht darum, bis selbst der welfenfreundliche Papst Überlegungen anstellt, ob sich dieser Mann wirklich als nächster Kaiser eignet. Doch Heinrich fährt fort, andere zu verletzen und Misstrauen gegen sich zu säen, kurzum: Er führt sich auf, als sei er schon König — und ein sehr unangenehmer dazu.
Mit den Staufern scheint sich dagegen ein Wandel zu vollziehen.
Haben sie nicht eben noch gegen den Kaiser aufbegehrt? Hat sich nicht Konrad zum Gegenkönig ausrufen lassen? Das alles scheint vergessen. Als Konrad Lothar III. auf einer Romfahrt begleitet, kann sich der Herrscher keinen loyaleren, liebenswürdigeren Gefolgsmann wünschen. Und auch bei seinen Mitfürsten macht sich Konrad angenehm, ist ein selbstloser Freund und aufopfernder Gefährte. Denn was den Welfen so gänzlich abgeht, nicht nur Heinrich dem Stolzen, sondern auch später seinem Sohn: die Gabe, blitzschnell eine Situation zu erfassen und sich ihr anzupassen — die Staufer besitzen sie in Vollendung.
Im Winter 1137 kehrt Kaiser Lothar von einer Italienfahrt zurück. Sein Ziel ist Sachsen. Doch schafft er die Strecke nicht mehr. Schon in Tirol lässt er haltmachen, und dort stirbt er in einer Hütte am Wegrand, erster und letzter Supplinburger auf dem Kaiserthron. Einige Große umstehen sein Lager. Sie hören, was der Sterbende sagt, und nicken dazu: dass sein Schwiegersohn Sachsen als Lehen erhalten soll, dazu den gesamten Supplinburger Besitz — und dass Heinrich der Stolze nächster König wird.
Der Welfe sieht also der kommenden Wahl mit der gleichen Gelassenheit entgegen wie zwölf Jahre zuvor der Staufer. Im Übrigen hat er jetzt andere Sorgen. Auch sein Vetter Albrecht aus dem Haus der Ballenstädter, »der Bär« genannt, erhebt Anspruch auf die sächsische Herzogwürde. Im Haus der Staufer wittert man aber die große Chance. Einmal hat man sie verpasst — das soll kein zweites Mal geschehen.
Königswahl »im Winkel«
Im Dezember ist Lothar III. gestorben. Zu Pfingsten 1138 soll Königswahl sein. Doch schon im März findet sich eine kleine Gruppe von Fürsten zusammen, darunter Konrad und auch ein gewisser Albero, Erzbischof von Trier. Diesmal spielt Albero die Rolle, die 1125 Adalbert von Mainz innehatte, nur unter anderem Vorzeichen: Jetzt ist ein Staufer Favorit der Kirche.
Zugegen ist ferner Dietwin, Legat des Papstes. Auch er hat seine Rolle in dem Spiel. Denn kaum ist Konrad von dieser kleinen Clique zum König gewählt, als es auch schon in jagendem Ritt weiter nach Aachen geht, wo Dietwin die Krönung vornimmt. Die übrigen deutschen Fürsten werden aber mit der Nachricht überrascht, dass sie einen neuen Herrscher haben: Konrad III.
Eigentlich müssten sie gegen diese »Wahl im Winkel« protestieren. Doch nichts geschieht. Im Gegenteil: Einer nach dem anderen erkennt die Wahl an — und bei dem großen Reichstag zu Bamberg im Mai dieses Jahres fehlt kaum einer, dem neuen König zu huldigen. Der große Geschichtsschreiber Otto von Freising merkt aber einige Jahre später zu diesem Geraufe um die höchste Würde mit philosophischer Gelassenheit einiges an, was die Einstellung des mittelalterlichen Menschen zu solch zynischen Manipulationen kennzeichnet:
»Hier erscheint es mir am Platze, uns Gottes ›furchtbare Ratschlüsse über die Menschenkinder‹ und die Unbeständigkeit der Welt vor Augen zu stellen. Denn siehe, nach Kaiser Heinrichs Tode wurden seine Verwandten, die damals größeres Ansehen im Reiche genossen und, auf dem Gipfel der Macht stehend, sich deshalb sicher fühlten, nicht nur bei der Königswahl übergangen, sondern sogar von dem über sie gesetzten König aufs Tiefste gedemütigt waren, während Herzog Heinrich durch den Einfluss des Kaisers, seines Schwiegervaters, und seine eigenen Machtmittel so hoch gestiegen war, dass er auf alle herabsah und sich nicht dazu herbeiließ, irgendjemand um seine Wahl zum König zu bitten, hat ›der Herr, der auf das Niedrige sieht und das Hohe aus der Ferne erkennt‹, der ›die Mächtigen stürzt und die Niedrigen erhöht‹, jenen so tief Erniedrigten und fast Verzweifelten auf den Gipfel der Königsmacht emporgeführt, diesen dagegen, der ›auf seine Herrlichkeit und Macht pochte‹, hat er von seiner Höhe heruntergestürzt. Was können wir da noch anderes sagen, als dass er zuerst Konrad, als er in seinen Augen groß war, erniedrigte, den Erniedrigten dann aber wegen seiner Frömmigkeit wieder erhöhte? Diese Unbeständigkeit menschlichen Schicksals, entspringend aus Gottes Gnadenfülle, muss uns ein Ansporn sein, Hoffart zu meiden und nach Demut zu streben. Und was sonst erzeugt das unselige Geschick der Sterblichen, das den Menschen bald vom Bettelstab auf den Königsthron, bald vom Königsthron an den Bettelstab bringt und ihn quält, als Geringschätzung des Diesseits, und weist es uns nicht hin auf die Beständigkeit des Ewigen, die sich nicht wandelt noch vergeht?«
Einer fühlt sich nicht auf die Beständigkeit des Ewigen hingewiesen, eher auf die Unverschämtheit dieser Staufer, ihm durch einen schnöden Trick die Krone aus der Hand zu winden: Heinrich der Stolze. Er kommt nicht nach Bamberg, verharrt in ohnmächtig schweigender Wut und scheint nicht fassen zu können, dass nun seinem Haus das gleiche widerfahren ist wie seinerzeit den Staufern.
So war es auch 1125 gewesen. Auch da hatte sich der abgeschlagene Kandidat zunächst in sein Schicksal gefügt. Doch hatte jeder gewusst, dass es nur die Stille vor dem Sturm war. So ist es auch diesmal.
Niemand weiß das besser als Konrad III.
Gegen diesen Mann ist viel einzuwenden, jetzt und in der Zukunft. Doch Mut und Energie können ihm auch seine Feinde nicht absprechen. Und sein Ehrgeiz reicht weit: Nicht nur, dass er den Staufern die Königswürde sichern will; diese Würde soll auch endlich unantastbar werden. Wie könnte sie das aber sein, solange es neben dem Herrscher eine Macht wie die der Welfen gibt, gestützt auf zwei Herzogtümer, ausgestattet mit unermesslichem persönlichen Besitz?
Wenn je in Deutschland der König wirklich König sein will, muss solch eine Nebenmacht endgültig ausgeschaltet werden.
Warten auf den großen Kampf
Der Staufer geht systematisch vor. Zuerst verlangt er die Herausgabe der Reichsinsignien, die Lothar bereits dem Schwiegersohn überlassen hatte. Hierzu zeigt sich der Welfe, nach einigem Zögern, bereit. Allerdings will er sich bei dieser Gelegenheit vom König auch gleich in seiner sächsischen und bayerischen Herzogwürde bestätigen lassen. Genau das möchte Konrad vermeiden. Und so wagt er schließlich den ersten offenen Affront.
Im Juni 1139 kommen Kaiser und Herzog zusammen. Das heißt: Sie kommen keineswegs zusammen. Als Heinrich in Regensburg eintrifft, wo sich auch gerade Konrad aufhält, treten ihm lediglich zwei Abgesandte des Königs entgegen, die ihm die Insignien abnehmen und ihm im Übrigen auszurichten haben, es sei einstweilen noch keine Zeit, die anfallenden Fragen zu erörtern: Doch bitte, Heinrich möge sich gedulden, für den Juli sei eigens ein Reichstag in Augsburg angesetzt. Dort würde alles Weitere geklärt werden.
Heinrich weiß, was das bedeutet. In Augsburg erscheint er denn auch nicht nur mit üblichem Gefolge, sondern lässt sich gleich von einem waffenstarrenden Heer begleiten. Unten am Lechufer schlägt er sein Lager auf und zeigt sich kampfbereit. Doch vorerst wird noch verhandelt, drei Tage lang und ohne Ergebnis.
Am vierten Tag ist Konrad verschwunden.
Abends zuvor hatte er noch im Kreis seiner Getreuen gesessen, hatte sich dann früh zurückgezogen: Müde sei er, wolle schlafen. Doch das ist nur eine Finte. In der Dunkelheit hatten gesattelte Pferde gewartet, und noch in dieser Nacht war der König ins sichere Würzburg galoppiert, fort aus Heinrichs bedrohlicher Nähe. Von Würzburg aus lässt er nun verkünden, dass zwei Herzogtümer in der Hand eines Fürsten unbillig seien. In Klarschrift: Der Welfe soll auf das eine verzichten. Über das andere würde man sich dann, vielleicht, einig werden.
Das nimmt natürlich als realistische Lösung niemand ernst, Heinrich nicht und auch nicht Konrad selbst. Es ist lediglich Auftakt für den zweiten Schritt, und der zielt nun aufs Ganze: Heinrich wird in die Acht getan, Krieg gegen ihn ist nun erlaubt, wenn nicht gar geboten. Zugleich mustert der König den Machtbereich des theoretisch schon gestürzten Rivalen: Wie lässt er sich so aufteilen, dass er künftig keine Gefahr mehr für die Staufer bedeutet?
Heinrich hat Feinde: Albrecht den Bären und Leopold von Babenberg, bislang Markgraf von Österreich und über die gemeinsame Mutter Agnes, die in zweiter Ehe Leopolds Vater geheiratet hatte, Halbbruder Konrads. Unter ihnen wird das Reich der Welfen aufgeteilt: Sachsen für den Bären, Bayern für den Babenberger — beide sind streitlustige und machthungrige Naturen, mit deren Hilfe sich der König gegen den allzu stolzen Heinrich durchzusetzen hofft.
Konrads Rechnung geht nur zur Hälfte auf.
In Bayern akzeptiert man achselzuckend den neuen Herrn. Bei den sächsischen Großen weckt aber diese Entscheidung einen Entrüstungssturm. Vielleicht hat man nicht allzu viel für den Welfen Heinrich übrig. Noch weniger hält man jedoch von einem König, der so leichtfertig die sächsische Herzogwürde weitergibt.
Heinrich kann mit seinen Sachsen zufrieden sein. Noch zufriedener ist seine Schwiegermutter Richenza. Diese erstaunliche Frau, Regentin nach ihres Mannes Tod, war nach Bamberg gezogen und hatte dort dem verhassten Staufer huldigen müssen. Daheim in Sachsen wandert aber ihr Blick von einem sächsischen Großen zum anderen: Wollen diese Herren wirklich Albrecht den Bären als neuen Herzog? Werden sie sich künftig vorschreiben lassen, wer sie regiert?
Der Tod von Quedlinburg
Noch hält sich Heinrich der Stolze in Bayern auf, als bereits deutlich wird, dass Sachsen für die Welfen nicht verloren ist. Da nützt es wenig, dass Albrecht der Bär in einem ersten Sturm Lüneburg, Lübeck und Bardowiek erobert. Ein Fehlschlag wird auch Konrads höchsteigener Besuch in Sachsen, wobei er begreifen muss: Dieses Land wird er nur in offenem Kampf erobern können — oder es den Welfen überlassen müssen.