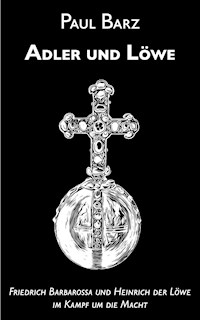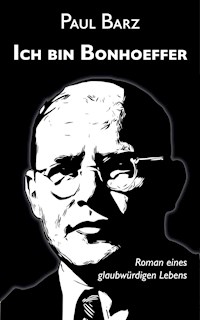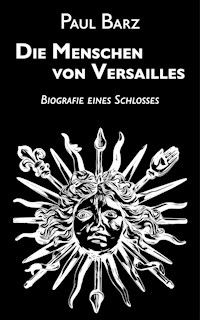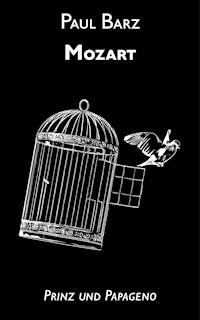
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ich kann nicht poetisch schreiben, ich bin kein Dichter. Ich kann durchs Deuten und Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht ausdrücken. Ich kann es aber durch Töne; ich bin ein Musikus." – W. A. Mozart Paul Barz erzählt in diesem biografischen Roman die Entstehung der wohl meistgespielten Oper Mozarts und lässt in Dialogen und Rückblenden auf der Basis der Zeugnisse aus der Zeit, vor allem der Briefe Mozarts und anderer, das bewegte Leben des Komponisten Revue passieren: seine Kindheit unter dem ehrgeizigen Vater, der das Wunderkind auf ausgedehnten Konzertreisen, oft zusammen mit seiner Schwester Maria Anna (genannt Nannerl), in ganz Europa vorführte; seine ständige Suche nach Aufträgen, die Wechselbäder zwischen Erfolg und Misserfolg; seine Liebesaffären und seine Ehe mit Constanze Weber; seine Konflikte mit der Familie, mit Auftraggebern und Konkurrenten. Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 2005 erschienenen Buches von Paul Barz auf Basis des Originalmanuskriptes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Mozart
Prinz und Papageno
Ein biografischer Roman
Muss es ausgerechnet Mozart sein?
Die Vorstellung im Wiener Theater auf der Wieden war vorbei, der Besuch gut, der Beifall freundlich gewesen und die Kasse leidlich voll.
Dennoch zog Theaterdirektor Emanuel Schikaneder ein schiefes Gesicht, als er den scharrenden Schritten hinterher horchte, kurz mal »Scheiße« sagte und dann in seine Garderobe hinüberging, wo er die Tür mit lautem Knall zuschmetterte und sich so schwungvoll in den nächsten Sessel warf, dass das wacklige Möbelchen fast zusammengebrochen wäre.
»Wir brauchen ein neues Stück.«
Die Frau vor dem Spiegel, halbnackt, die Bluse bis zur Taille hinuntergestreift, fuhr fort, die Schminke aus dem ältlichen Gesicht zu wischen.
»Wieso denn? Das hier läuft doch ganz gut!«
»Ganz gut, nun ja …«
Träge blinzelte er zu ihr hinüber, sah welkes Fleisch, schlaffe Brüste, Speckrollen in der Taille. Lang war es her, dass Kritiker Madame Schikaneder als »klein, aber artig« beschrieben hatten. Nun war sie alt, seine Eleonora, wie sie sich nannte, obgleich sie schlicht »Maria Magdalena« hieß. Wie er selber aus einem biederen Johann Joseph zum pompöseren »Emanuel« geworden war.
»Nein, es läuft nicht schlecht, unser Stück.« Schikaneder war aufgestanden.
Umständlich begann er sich aus seinem zu engen Kostüm zu pellen und einen schwarzbehaarten Körper freizulegen, den nun seine Frau aus den Augenwinkeln musterte: »Welker Arsch, fetter Wanst, und die Haare längst gefärbt«, dachte sie, »den ranken Jüngling, mein Lieber, nein, den wirst du bald nicht mehr spielen können.«
Währenddessen fuhr ihr Mann fort: »Aber unser Publikum verdient anderes. Es ist von mir verwöhnt.« Und gluckste in seliger Erinnerung: »Weißt du noch? Der ›Oberon‹ vor zwei Jahren?«
Das war an diesem Theater einer seiner ersten Erfolge gewesen, mit einem von seinem Ensemble-Mitglied Karl Ludwig Gieseke hastig zusammengeschmierten Text. Aber die Musik vom Hofkapellmeister Wranitzky war recht hübsch, und vor allem hatte das Publikum reichlich zum Gaffen bekommen, bunte Kostümpracht und kochendes Kulissen-Meer, feuerspeiende Berge und ein fast echtes Pferd auf der Bühne. Das waren Theaterkünste, auf die sich Schikaneder verstand.
»So was wie den ›Oberon‹ brauchten wir, mit viel Maschinerie dabei und Zauberstückchen und …«
»… und mit einer Riesenrolle für dich, in der du nicht wie beim Hamlet den ganzen Abend mit eingezogenem Bauch dastehen musst.«
Er biss sich auf die Lippen. Solche Sprüche seiner Angetrauten konnten ihn wütender machen als weiland ihr Ehebruch mit diesem Fant, dem zu den Schauspielern entlaufenen Offizierssohn Johann Friedel, mit dem sie eine Weile Garderobe wie Lagerstatt geteilt hatte. So was ließ sich verzeihen, aber das hier…
Doppelt ärgerlich an ihren Bosheiten war aber, dass Eleonore völlig recht hatte.
Immer ängstlicher horchte ihr Mann bei seinen Auftritten als jugendlicher Held zum Publikum hin, ob dort vielleicht ein kleines Kichern aufkam. Also lieber gleich ins komische Fach gewechselt! Nur eben die richtige, die ganz große Rolle musste her.
»Du kannst doch mal wieder den Anton spielen.«
Der »Dumme Anton« war die Figur, die er im Theater an der Wieden gleich in der Eröffnungspremiere dem »Kasperl« seines Konkurrenten Karl Marinelli drüben im Theater in der Leopoldstadt entgegengesetzt hatte, und auf Anhieb war sie ähnlich populär geworden.
»Nein, nicht schon wieder den Anton. Schon drei Stücke habe ich um ihn herumgebastelt, alle ähnlich dumm …«
»Die Leute lachen darüber.«
»Sie lachen. Aber unter meinem Niveau.«
Schikaneder, nun völlig nackt, schob mit kurzem Griff den Bauchspeck nach oben, wölbte die noch immer prächtig ausladende Brust, zog die Schultern zurück und ließ den Blick funkeln – ja, dachte er laut, während er in den Spiegel blickte, ungefähr so, mit noch breiter geschminktem Mund, angeklebter spitzer Nase und lauter Locken auf dem Kopf, so müsste er sein.
»Wer müsste so sein?«
»Mein Papageno. Dieser Vogelfänger aus meiner ›Zauberflöte‹. Die beste Rolle, die ich je geschrieben habe.«
Eleonore Schikaneder erinnerte sich nur dumpf an dieses Stück, das ihr Gemahl im letzten Herbst verfasst hatte, und wusste eigentlich nur noch, dass ihr das Ganze gar nicht recht gefallen wollte: »Ein Vogelfänger? Ging es denn da nicht um irgendeinen Prinzen?«
»Um den Tamino. Ja. Langweilig. Den kriegt unser Schak, kann dann gleich so schön singen, dass niemand merkt, was für ein miserabler Schauspieler er ist. Aber die eigentlich gute Rolle, der Papageno«, jetzt leuchtete sein Blick, »der bleibt mir. Ein Fressen, sage ich dir. Wie der auftritt, mit all den Vogelkäfigen auf dem Rücken. Und dann das Liedchen, das er dazu singt …«
Er spitzte die Lippen, während er in seine Hosen stieg, brach aber gleich wieder ab: »Na ja, die Musik muss noch einer schreiben. Ich kann schließlich nicht alles sein, Dichter, Spielleiter, Papageno, auch noch Komponist …«
»An wen denkst du?«
»An Mozart vielleicht.«
»Mozart! Ausgerechnet! Muss es gerade Mozart sein?«
»Weißt du einen Besseren?«
»Tausend bessere. Welche, deren Musik ins Ohr geht, bei der alles mitsingen kann …«
»Und zu wem würde Madame raten? Zum Salieri vielleicht?«
Allein der Gedanke trieb ihm das Lachen in die Kehle. Was für eine Vorstellung, Antonio Salieri, der gefeiertste Stern am Opernhimmel, der Herr Hofkapellmeister und führende Kopf der Wiener Musikszene, würde ausgerechnet für ihn und seine Vorstadtbühne hier auf der Wieden arbeiten!
»Du könntest doch den Paul Wranitzky fragen, den vom ›Oberon‹!«
Schikaneder winkte ab: »Auch der ist längst zu fein für uns, seit er unseren Kaiser zu dessen Krönung nach Frankfurt hat begleiten dürfen. Nein, ich frage Mozart. Hab ihn übrigens schon mal gefragt, gleich im letzten Herbst, als mein Büchl fertig war.«
»Und?«
»Druckste herum, zierte sich, hätte noch nie eine Zauberoper geschrieben, das könne er nicht. Als ob der«, Schikaneder lachte, »irgendwas in der Musik nicht kann!«
Dann aber – Schikaneder sah es noch vor sich – hatte Mozart ein wenig im »Büchl« geblättert, bis zur Szene, wo Papageno seine Papagena findet, und sofort zu trällern angefangen: »Pa – pa! Pa – pa …«
Das hatte wohl komisch sein sollen. Doch Schikaneder hatte sich seltsam angerührt gefühlt.
Ja, so ist es wohl, hatte er gedacht, während ihm zur eigenen Überraschung eine Träne in den Augenwinkel geschossen war. Genauso ist es, wenn einer von Liebe überwältigt wird, nicht einmal mehr den Namen der Geliebten aussprechen kann, ins selig hilflose Stottern kommt. Das hatte dieser Mozart in Sekundenkürze in Musik umgesetzt: »Ein Genie« sagte Schikaneder jetzt, »er mag sein, wie er will, hoffärtig, chaotisch. Aber er ist und bleibt ein Genie.«
»… und Genie verkauft sich nicht«, entgegnete Eleonore, zog mit starkem Ruck ihre Bluse hoch und knöpfte sich energisch das Mieder wie zum Zeichen zu, dass sie das Gespräch für abgeschlossen hielt.
Schikaneder merkte sich den Spruch, der vielleicht mal in eine Bühnenpointe umgemünzt werden konnte. Aber vom Plan, Mozart für seine »Zauberflöte« zu gewinnen, hatte ihn Eleonore nicht abbringen können, trotz ihrer leider berechtigten Bedenken.
Denn kassensicher, nein, war dieser Mozart wirklich nicht und äußerst schwierig dazu. Wie soll er doch mal dem Kaiser selbst auf dessen Vorbehalt, es seien zu viel Noten in einer Partitur, flink-frech geantwortet haben: »Gerade so viel wie nötig sind, Euer Majestät!«
Nahezu eine Majestätsbeleidigung. Und doch…
»Ein Genie«, murmelte Schikaneder vor sich hin, »er ist einfach ein Genie. Auch wenn er sich tausend Mal schlecht verkauft.« Und für seine »Zauberflöte« mit der erhofften Riesenrolle für ihn selbst gab es keinen besseren Mann. Schikaneder spürte das einfach.
Gleich am nächsten Morgen, jawohl, ganz früh, wenn Mozart noch gar nicht ganz wach war und sich umso schlechter würde wehren können, wollte er hinüber in die Rauhensteingasse gehen, wo im letzten September die Mozarts ihre wohl neunte oder zehnte Wiener Wohnung bezogen hatten, und wenn alles nicht half, würde er ihn mit einer guten Summe Geld locken. Er wusste schließlich, wie verschuldet Mozart war. Bis über die Ohren, hieß es allgemein.
So schritt denn der Herr Schikaneder am nächsten Morgen hinaus in dieses Wien mit seinem gotisch schlanken Stephansdom, den barocken Adelspalästen und wohl bald hundert Kaffeehäusern, hinein in diese Metropole hier am Schnittpunkt zwischen Ost und West, über der noch wie ein ferner Schimmer das milde Lächeln der von vielen wie eine Mutter verehrten Kaiserin Maria Theresia zu liegen schien.
Aber diese Mutter war nun schon über zehn Jahre tot, und im letzten Jahr war ihr auch der Sohn Joseph II. gefolgt, jener Mann mit dem traurigen Blick und zusammengekniffenen Lippen, der die Mutter so aufrichtig hasste, wie die übrigen sie aufrichtig geliebt hatten. Alles anders als sie hatte er machen wollen, sein Reich neu und hell und menschlich, und hatte sich am Ende doch nur als Grabinschrift gewünscht: »Hier ruht Joseph, dem nichts gelang.«
Aber was gelang denn den anderen Monarchen besser?
Immer stärker durchzog das Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts die bange Ahnung, am Ende seien die gekrönten Potentaten, nun ja, eigentlich recht überflüssig. Schon war in Frankreich, früher mal Hochburg des gottgewollten Absolutismus, der König zur konstitutionellen Marionette degradiert, und drüben in Amerika brauchten sie bereits gar keine Monarchen von Gottes Gnaden mehr.
Dort wählte sich das Volk seinen König selbst, den sogenannten »Präsidenten«, und der erste war George Washington geworden, über den der Spott ging, kein König könne sich königlicher geben als der Tabakpflanzerspross aus Süd-Virginia.
Dennoch: Amerika, du hast es besser!, seufzte mancher wie in Weimar der Geheimrat Goethe, während andere wiederum energisch widersprachen: Noch schlimme Zeiten würden kommen, wenn das so weitergehen sollte mit der Monarchie. Dann würden am Ende noch ganz gewöhnliche Menschen – der Bäcker von gegenüber, der Schuster von nebenan – die Throne besteigen und Herrscher sein wollen.
Europa bebte unter vermeintlich glatter Oberfläche, und nicht nur in der Politik. Überall knackte und knisterte es, in der Dichtung, Musik, Literatur, in den Gedankengebäuden der Philosophen wie in der Naturwissenschaft. Einige spürten das. Die meisten jedoch, wie zu allen Zeiten, scherte das wenig.
Sie hingen, wie immer, ihren Alltagsdingen nach und dachten nicht an Gott und Könige. Ihre Nöte waren der steigende Brotpreis, das Brennholz für die nächste Winterzeit, der Zank mit dem Nachbarn, die Sorge ums kranke Kind.
Oder, wie nun für den Herrn Schikaneder im Wien der ersten noch winterlich kalten Märztage des Jahres 1791, die Frage, wie er wohl den Herrn Mozart zu seiner »Zauberflöte« überreden könne.
4. März 1791
Konstanze Mozart hat den Kopf gehoben und horcht zur Gasse hinunter. Das dort scheinen die Schritte ihres Mannes zu sein. Aber sie klingen anders, nicht hastend, stolpernd wie sonst, müde eher, schleppend, und auf der Stiege zur Mozart-Wohnung im ersten Stock nimmt er nicht zwei Stufen auf einmal, sondern stapft nahezu mühsam hinauf.
»Ist dir nicht wohl, Wolferl?«
Mozart steht in der Tür. Ein schmaler Mann, nicht groß, mit kleinem müden Greisengesicht unter der sorgsam straff gekämmten Perücke. Er antwortet nicht.
»Wie war dein Konzert?«
Er hebt nur die leicht vorgezogenen Schultern.
Wie soll es schon gewesen sein, dort drüben zwei Straßenzüge weiter im Lokal des Herrn Ignaz Jahn? Ganz gut besucht, das schon, aber wohl mehr wegen des Herrn Klarinettenspielers Joseph Bär und der Aloysia Lange, Mozarts Schwägerin und immer noch vom Primadonnenruhm früherer, besserer Zeiten umstrahlt.
Mozart setzt sich, den kleinen Bauch vorgeschoben. Ein müder Mann nach hartem Arbeitstag.
»Die haben dein Klavierkonzert gemocht?«
»Wenn sie es verstanden haben!« Er reibt sich das Gesicht, spürt in der Magengegend einen kleinen pochenden Schmerz, hustet kurz, wie um sich davon zu befreien. Aber der Schmerz bleibt.
»Und Aloysia? War sie gut?«
»Recht gut. Nein. Sehr gut war sie …«
»Denn Gott sei Dank!«
In Konstanzes tiefem Aufatmen hört Mozart sehr wohl die Enttäuschung, dass Aloysia nicht so schlecht gewesen war, wie Konstanze insgeheim gehofft hatte. Neid und Eifersucht sind nun mal das ewige Thema zwischen den beiden ungleichen Schwestern, von denen es die eine zur großen Sängerin, die andere nur bis zur Frau Mozart gebracht hat.
»Ich werde keine Konzerte mehr geben«. Konstanze fährt zusammen.
»Um Himmels Willen, Wolferl! Wovon sollen wir dann leben?«
»Vom Komponieren!«
»Vom Komponieren lebt doch keiner!«
Nein. Nicht ein Mozart. Dazu müsste einer schon ein Salieri sein, und allein bei diesem Namen eines Kollegen, der an Geld und Ehre alles hat, wonach er selbst sich höchstens sehnen kann, spürt Mozart seinen Magen schmerzhaft zucken und muss sich zwingen, nicht an gerade diesen Mann, an sein immerwährend freundliches, Mozart meint: höhnisch herablassendes Grinsen zu denken.
»Die Leute wollen mich doch gar nicht hören. Auch heute Abend nicht. Die sind wegen der Aloysia, wegen Bär und seiner Kunststücke auf der Klarinette gekommen. Ich wurde so hingenommen, na ja. Der Mozart wird schon nicht groß stören, haben sie gedacht.«
Er ist lauter, lebhafter geworden. Die Erbitterung gibt seiner Stimme Kraft und Härte, und Konstanze legt rasch den Finger auf den Mund, weist auf die Tür, hinter der ihr sechsjähriger Sohn Carl Thomas schlummert. Dann starrt sie ihn fast erschrocken an: »Aber …«
»Kein aber«, Mozarts Stimme dämpft sich, nicht seine Heftigkeit, »so war es immer schon. Auch früher. Da ist man zum Wunderkind gekommen, der Mozart selbst war ganz egal.« Und die Phantasie spült ihm Bilder der Erinnerung ins fiebrig flackernde Gedächtnis, er am Klavier, acht Jahre vielleicht, in München, Wien, in London oder Paris, in Amsterdam und Brüssel, der Vater nickt, das Spiel beginnt.
Mozart hat sich wieder gefangen, versucht ein Lachen: »Ja, wenn ich wie damals mit verbundenen Augen oder verdeckten Händen spielen würde! Dann kämen wohl wieder die Leute gerannt. Oder wenn ich mal beim Klavierspiel auf dem Kopf stehen würde …«
Sein Lachen wird ein Seufzen: »Aber so was gehört in die Kasperlbude, nicht in den Konzertsaal. Und außerdem«, wieder die Hände vorm Gesicht, der Oberkörper vorgeneigt, als presse ihn eine überschwere Last zusammen, »ich bin zu alt für solche Kindereien. Und krank«, er flüstert es fast, »krank bin ich auch!«
»Und ich erst, Wolferl!«
Noch nie ist jemand in Konstanzes Nähe krank gewesen, ohne dass sie nicht gleich viel kränker gefühlt hätte. Mozart sieht dennoch erschrocken hoch, sein Blick betastet ängstlich ihren runden, kleinen Bauch: »Das Kind?« Seit drei Monaten wissen sie, dass Konstanze wieder schwanger ist.
Jetzt seufzt sie nur ein gedehntes »Nu ja« voll dunkler Ahnungen darin. Und: »Eine Kur in Baden würde mir mal wieder guttun.« In den letzten zwei Jahren ist die Frau Mozart in diesem exklusiven (und eigentlich viel zu teuren) Kurort vor Wien wiederholter Gast gewesen.
»Wovon sollen wir die Kur bezahlen?«
»Haben wir denn kein Geld?«
In finanziellen Dingen ist Konstanze, wenigstens zu dieser Zeit, fast noch naiver als ihr Mann, dessen Erinnerung wieder in Kinderjahre zurückschweift. Damals hat er nur spielen brauchen, für alles andere sorgte der Papa, auch fürs Geld. Das war einfach da, und die Sorgen darum überließ er nur gar zu gern dem Vater.
Den Vater gab es nun nicht mehr. Dafür den Herrn Puchberg. Freund, Logenbruder, immer großzügig, hilfsbereit. Also immer noch mal ein Bettelbrief an ihn, immer länger, flehender, demütiger. Der letzte steht noch Mozart wie unter einer überscharfen Brille vor Augen: »Wäre mir diese Krankheit nicht gekommen, so wäre ich nicht gezwungen, gegen meinen einzigen Freund so unverschämt zu sein …«
Der einzige Freund hat gezahlt, wohl seufzend. Allmählich übersteigt der Mozartsche Schuldenberg selbst Puchbergs beträchtliche Mittel. Diesmal muss anderes her.
Durch das Halbdunkel der nur von wenigen fast schon niedergebrannten Kerzen erhellten niedrigen Stube spürt Mozart den Blick seiner Frau, flehend, verschreckt, aber auch fordernd. Und fühlt zugleich die tiefe Scham eines Mannes, der für seine Familie nicht sorgen kann.
»Du wirst deine Kur bekommen, Stanzerl. Ich habe da noch einen Auftrag. Hundert Dukaten könnte er bringen.«
Hundert Dukaten! Konstanze schickt der Summe nur ein kleines böses Lachen hinterher. Zu oft hat sie schon solche Versprechungen gehört.
Doch diesmal hat Mozart nicht gelogen.
Es sind die hundert Dukaten, die ihm Schikaneder am Morgen zuvor geboten hatte, als er unverhofft an Mozarts Bettstatt gestanden war. Der hatte sich schlaftrunken aus den Kissen gequält, war im Hemd hinüber zur kleinen Waschschüssel gewankt, noch ganz benommen, da er bis in die Morgenstunden an seinem Klavierkonzert gearbeitet und dabei reichlich Wein getrunken hatte.
Missmutig hatte er sich Schikaneder zugewandt: »Ich würde mich gern anziehen!« Der hatte sich in aller Unbekümmertheit auf den Bettrand gehockt: »Nur zu! Mich stört das nicht!« Der Gedanke, es könne den anderen stören, sich ihm nackt oder halbnackt zu zeigen, kam ihm nicht.
Während sich also Mozart mit verschämtem Seitenblick das Hemd über den Kopf gezogen und um die Lenden geschlungen hatte, fing Schikaneder gleich von der »Zauberflöte« zu sprechen an: »Du erinnerst dich doch noch?«
»Pa – pa! Pa – pa!« kam es von der Waschschüssel her. Nie vergaß Mozart auch nur eine Note, die er je geschrieben hatte. Und Schikaneders Augen blinkten freudig auf. Die Situation schien günstig.
Hastig hatte er davon zu sprechen angefangen, wie schlecht es mal wieder um sein Theater stand, wie ihn von allen Seiten Gläubiger bedrängten, wie er vor praktisch leeren Rängen spielte, während sich Mozart als häufiger Gast im Theater auf der Wieden nicht erinnern konnte, das 1000-Plätze-Haus je anders als gut gefüllt erlebt zu haben.
Doch so eindringlich beschwor Schikaneder seine große Not, Tränen in den Augen, so fesselnd wusste sich der breite Mann als armer Schlucker darzustellen, den jeden Augenblick der Hungertod erwarte, dass Mozart fast versucht gewesen war, ihm zu glauben und tatsächlich anzunehmen, ohne diese »Zauberflöte« seien Schikaneder und sein Theater ewiger Verdammnis preisgegeben.
Ausgepichter alter Komödiant!
Aber gerade das hatte er immer schon an diesem Mann geliebt, damals in Salzburg vor mehr als zehn Jahren, als sie sich bei Schikaneders Gastspiel in Mozarts Heimatstadt kennengelernt hatten, und jetzt wieder.
Der hier machte nicht Theater. Er war Theater. Er atmete, schwitzte, lebte es. Und darum, vor allem darum, nicht seiner Jammerarien wegen und auch nicht nur wegen der gebotenen hundert Dukaten, hatte Mozart endlich zugesagt, sich das Buch zur »Zauberflöte« wenigstens mal anzusehen, obwohl er es so albern fand wie schon im letzten Herbst, als Schikaneder ein erstes Mal davon erzählte, von dieser ganzen abstrusen Geschichte um einen Prinzen, der im Auftrag irgendeiner Königin zu einem Zauberer – Sarastrus, Sarastro oder so – aufgebrochen war, die Tochter dieser Königin aus den Klauen des Bösewichts zu befreien.
Eine einzige große Albernheit.
»Geh zum Teufel mit deinem Schmarren«, hätte er am liebsten auch jetzt zu Schikaneder gesagt, um sich danach noch einmal wohlig für ein Stündchen in die Kissen kuscheln zu können. Aber so rasch war der nicht abzuschütteln und hatte wieder mit der Klage um seinen bald sicheren Ruin eingesetzt, wenn ihm nicht der Mozart (»Du bist doch mein Freund? Mein Logenbruder?«) die »Zauberflöte« schriebe.
Mozart hatte seinen Widerstand schwinden gespürt. Außerdem drückte ihn der Darm, und auf dem Kackstuhl hätte er sich nicht so gern präsentiert. Also sprach er denn endlich sein halbes Ja.
Befriedigt war Freund Schikaneder davongezogen. Draußen war ein letzter kärglicher Frühlingsschnee gefallen. Am Abend ist er auch schon wieder geschmolzen, und Mozart sitzt gedankenverloren am Tisch seiner Wohnstube. Die Lippen spitzen sich und formen ein paar Töne.
»Pa – pa! Pa – pa …«
»Was singst du da, Wolferl?«
Konstanze blickt jetzt wieder zu ihm hin. Rasch fährt er mit der Hand über die Stirn, als wolle er ein lästiges Insekt verscheuchen.
»Ach, nichts!«
»Ist das aus dieser ›Zauberflöte‹?«
»Aber die Musik dazu ist doch noch gar nicht geschrieben!«
»Geh, Wolferl! In deinem Kopf ist sie doch längst schon fertig!«
Er lacht, steht auf. »Geh ins Bett, Stanzerl! Ruh dich aus!«
»Und du? Bist nicht müde nach dem Konzert?«
»Muss noch denken. Arbeiten.«
Mozart allein. Die Kerzen fast niedergebrannt. Nur eine einzige Frische hatte er anzuzünden gewagt. Sie muss reichen. In ihrem Flackerschein sitzt er am Tisch, blättert lustlos im »Büchl«.
Wenn das Da Ponte geschrieben hätte! Dann wäre vielleicht auch diese »Zauberflöte« ein solches Meisterwerk geworden wie zuvor der »Figaro« oder sein »Giovanni«. Aber nie würde sich ein Da Ponte für einen solch albernen Zauberspuk hergeben. Er selber auch nicht. Eigentlich. Wenn eben nicht die vermaledeiten hundert Dukaten wären und die Badekur fürs Stanzerl.
Von der Schlafkammer her hört Mozart leises Schnarchen. Sein Stanzerl! Gleich tief und prompt eingeschlafen. Er nickt. Sie soll ihre Badekur bekommen, soll spüren, dass es etwas Gutes hat, die Frau vom Mozart zu sein und nicht ein schimmernder Opernstern wie Schwester Aloysia.
Wieder blättert er im Buch, blinzelt aus rot entzündeten Augen, zwingt sich zur genauen Lektüre.
Den Vorschlag einer Ouvertüre überspringt er. Damit hat es bis zum Ende Zeit, wenn man weiß, wie die Sache ausgegangen ist. Erst mal der Anfang.
Der Prinz, aha, stürmt auf die Bühne. Eine Schlange ist hinter ihm her. Wieso eigentlich? Müßige Frage. Mozart schließt die Augen.
Ein Mensch auf der Flucht, sein Schrei: »Zu Hilfe! Zu Hilfe!« Mozart sieht sich selber fliehen, Schlangen auf den Fersen. O ja, von denen hat es immer reichlich in seinem Leben gegeben, mit Teufelsfratzen statt Köpfen, und die eine Fratze zeigt die Züge vom Salzburger Erzbischof, die andere Salieris fettes Grinsen, eine dritte aber…
Nein! Mozart fährt hoch. Das können eben nicht die Züge des eigenen Vaters gewesen sein. Der war für ihn keine Schlange, nie. Der war sein Hüter und Beschützer, immer. Aber verfolgt hat er ihn, das schon, verfolgt ihn noch jetzt, da er bereits so lange tot ist.
»Halt dich gerade, Wolfgangerl!«
Seine Stimme. Mozart setzt sich zurecht. Kein Gedanke an den verstorbenen Leopold Mozart mehr. Ganz Konzentration aufs Werk.
Der Prinz also ist ohnmächtig, die Schlange aber getötet worden. Von wem? Von drei Damen, nun ja. Was für Damen? Engeln? Teufelinnen? Egal. Mozart kichert. Wie die drei den Jungen umtänzeln und ihn begehren, seine Schönheit rühmen! Wie ihn jede ganz allein für sich haben will!
Auch ihn haben oft Damen umtänzelt. Ein Prinz war er dennoch nicht. Höchstens in seinen ganz frühen Jahren. Da soll er schön gewesen sein, sagen alle, die sich noch an ihn als Kind erinnern können, mit milchweißem Teint und strahlend blauen Augen, wie Sterne…
Mozart sitzt am Klavier. Aber er spielt nicht. Beugt sich vor, sucht sein Spiegelbild im glattpolierten Holz. Er ahnt mehr, als er sieht. Und weiß: So wie der Prinz dort im Buch der »Zauberflöte« sieht er ganz gewiss nicht aus.
Blatternnarben haben die Milchhaut zerschunden. Über dem Hals formt sich ein kleines Doppelkinn. Spitz und übergroß springt die kräftige Nase vor, der »Mozart-Haken«, wie manche lästern.
Nein, schön ist dieser Mann ganz sicher nicht.
Bis auf die Augen. Die sind geblieben, wie sie immer waren. Übergroß und strahlend blau. Das Schönste an Mozart. Jetzt wie damals schon an jenem Wintertag 1756, als Wolfgang Amadeus Mozart zu Salzburg geboren wurde.
Nach dem lieben Gott gleich der Herr Papa!
Was für herrlich blaue Augen der Junge hat!«
Das soll an jenem grauen 27. Januar des Jahres 1756 Vater Leopold Mozart ausgerufen haben, als er in der Salzburger Getreidegasse Nummer neun aus dem Nebenzimmer den ersten Schrei des Neugeborenen vernommen hatte, sofort hinübergestürzt war und das Kind auf den Arm genommen hatte.
Das hielt zwar die Augen fest geschlossen. Aber blaue Augen, so leuchtend wie die eigenen, hatte es, das stand für den Vater fest. Und im Übrigen, noch wichtiger: »Es ist ein Sohn. Endlich.«
Das kleine Mädchen in der Ecke, »Nannerl« geheißen und fünf Jahre alt, sah kurz hoch und spielte dann mit seiner Puppe weiter, die wie die Köchin »Salome Musch« hieß.
Gleich am nächsten Tag und noch ganz früh, man hatte es eilig – wer wusste damals schon, wie lange ein Neugeborenes leben würde? Dann war es besser, es wenigstens als getauftes Engelchen in den Himmel zu schicken – wurde der Säugling hinüber in die Dompfarre gebracht und dort mit dem Segen der Kirche sowie den Namen Johann Chrysostomos Wolfgang Gottlieb versehen.
Johann Chrysostomos (was so viel wie »Goldmund« hieß) nach einem byzantinischen Patriarchen, der an eben diesem 27. Januar Namenstag hatte. Wolfgang nach dem Vater der Mutter. Gottlieb nur so und aus purer Frömmigkeit, was dann der Mann Mozart erst in »Amadeo«, später in »Amadé« übersetzen sollte, nie aber in Amadeus.
Dies blieb späteren Zeiten vorbehalten. Der gleichen späteren Zeit, die wissen wollte, das mit den blauen Augen habe Vater Leopold gar nicht beim Anblick des Sohnes, sondern erst bei der Geburt des ersten Enkels ausgerufen. Doch Mozart selbst, der Geschichten über sich ganz gernhatte und besonders die aus seiner Kindheit, erzählte es selber so. Und die blauen Augen hatte er nun mal.
Aus diesen Augen also sah das Kind hinein in seine Welt, und die war eigentlich sehr klein, vier Zimmer im dritten Stock hier in der Getreidegasse, wo die Eltern Mozart mit ihren Sprösslingen nebst zwei Bediensteten lebten.
Dem Jungen kam das alles aber riesengroß vor, und draußen ging es weiter, Gasse um Gasse, Platz um Platz. Das war nun Salzburg, die Riesenstadt mit wohl sechzehntausend Einwohnern und dem Salzburger Land rundum, eingeklemmt zwischen Österreich und Bayern, selbstständig seit über tausend Jahren mit einem jeweils neu vom Domkapitel gewählten Fürstbischof als weltlichem wie geistlichen Oberhaupt zugleich.
Es waren Fürsten von Klugheit und Format darunter gewesen, so im Jahrhundert zuvor, als Salzburg von allen Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs verschont geblieben war. Und auch jetzt im Jahr 1756, da gerade ein Krieg begonnen hatte, der sieben Jahre dauern sollte, streifte das pulverdampfende Weltgeschehen nur seine Grenzen. Ein glückliches Land also. Hell und heiter. Wenigstens bei Sonnenschein.
Sie schien nicht immer.
Wolken zogen häufig auf, die Menschen in den Gassen blinzelten misstrauisch zum Himmel hinauf, und schon hatte es zu tröpfeln, dann zu nieseln angefangen, bis schließlich die ganze Welt eine einzige Regenwolke zu sein schien.
Die Leute zogen die Röcke fester und eilten in ihre Häuser, auf deren Dächer der berüchtigte Salzburger Schnürlregen in monotoner Eintracht einhämmerte, oft Wochen hintereinander. Zuweilen stieg dann von der Salzach her feiner Nebel auf, der sich wie ein Schleier über alles legte, weißes Barock in graue Spukhäusern verwandelte und die Spitzen der zahllosen Kirchtürme (»Rom des Nordens« wurde Salzburg auch genannt) im graudicken Dunst verschwimmen ließ.
An solchen Tagen stand ein kleiner Junge am Fenster in der Getreidegasse und starrte aus seinen blauen Riesenaugen in die tropffeuchte Welt dort draußen, während seine Phantasie graue Gespenster in den Nebel malte, langfingrig durch die Gassen schleichende Gestalten auf der Suche nach ihm, den sie gleich greifen, ihn fangen würden, zu welch schlimmem Zweck auch immer.
Die Welt eines Kindes ist voller Schrecken, von denen Erwachsene nichts ahnen. Das war beim kleinen Wolfgang nicht anders. Manche Nacht lag er wach, hörte den Regen aufs Dach trommeln, und es war ihm, als würden dann die Nebelgespenster dort draußen anklopfen, um gleich hineinzukommen und ihn zu holen.
Am Morgen danach zitterte er noch immer und fragte sich, wo wohl die seien, die ihn schützen könnten, da sie ihn lieb hatten, und es kam vor, nicht selten, dass der Kleine auf den nächsten zustürzte, den Vater, die Mutter, die Schwester, vielleicht auch auf eine der beiden Dienstmägde oder irgendeinen gerade eintretenden Bekannten der Familie. Stotternd fragte er dann: »Hast du mich lieb?«, und einmal wurde das einem dieser Bekannten, dem Dichter und Musikus Johannes Andreas Schachtner, einfach zu viel.
»Nein«, donnerte er, »ich habe dich Quälgeist ganz und gar nicht lieb.«
Er hätte es nicht sagen sollen.
Der Kleine starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an, als könne er gar nicht fassen, was eben der ihm sonst so wohlgesonnene Mann gesagt hatte. Und er schluckte am fürchterlich anschwellenden Kloß in seiner Kehle, schon strömten die Tränen, und er weinte so durchdringend, dass es der Vater im Nebenraum hörte und erschrocken hereingestürzt kam: »Was ist denn, Wolfgangerl?«
»Ach, ich habe mit ihm einen kleinen Scherz gemacht, und wie immer fing Wolfgangerl zu greinen an, weil ihn nicht die ganze Welt so richtig liebhat,« lachte Schachtner. Und, mit kleiner Strenge im Unterton: »Sie sollten darauf achten, bester Mozart, dass unser kleiner Wolfgang keine rechte Heulsuse wird. Etwas Härte kann nicht schaden, auch mal ein Klaps hier und dort. Die Rute ist immer noch die beste Lehrerin.«
Aber das sah der Vater ziemlich anders, hielt nichts von Härte und Prügel. Von Strenge ja, die musste sein. Aber sie sollte gleichsam weich daherkommen, den Geist des Kindes formen, nicht brechen. Schließlich kannte Leopold Mozart die großen Pädagogen dieser Zeit, er hatte seinen Francois Feneton gelesen, der selbst Frauen für erziehenswert hielt, und seinen Christian Fürchtegott Gellert, den Professor aus Leipzig, mit dem er sogar eine gelegentliche Korrespondenz unterhielt.
Wie schützend trat er an den weinenden Kleinen heran und legte ihm in beruhigender Güte beide Hände auf den Scheitel: »Keine Sorge, Wolfgangerl, wir alle hier haben dich ganz furchtbar lieb!«, und sein Sohn hörte die tiefe, warme Stimme hoch über sich, er umklammerte mit beiden Armen die Knie des Vaters wie ein Kruzifix: Ja, so musste es wohl sein, wenn Gott selbst zu einem sprach.
Doch, auch die Mutter hatte er lieb, Frau Anna Maria aus der Alt-Salzburger Familie Pertl, die früher einmal sehr hübsch gewesen sein musste, was man trotz der in sieben Schwangerschaften auseinandergeflossenen Figur immer noch ahnen konnte.
Aber lobte oder tadelte sie ihn, bedeutete das nicht viel, wohingegen des Vaters Lob und Tadel gültigen Ewigkeitswert hatten, den man in stiller Demut hinnehmen musste wie Gottes eigenes Gebot. Und wie einem Gott blickte der Sohn diesem Vater hinterher, wenn der, die Geige unter dem Arm, im tadellos gebürsteten Rock mit blütenweißen Manschetten hinüber zum Dienst beim Herrn Fürstbischof ging, in dessen Orchester er Vizekapellmeister sowie Hofkompositeur war.
Ja, dort schritt wohl in majestätischer Erhabenheit Salzburgs eigentlicher Herrscher dahin. Und mochte darüber noch als gleichsam irdische Macht der Herr Fürstbischof in seinem Palais stehen, den man zuweilen vierspännig durch die Gassen rasseln sah, blieb es doch dabei: »Nach dem lieben Gott kommt gleich der Herr Papa!«
So hatte es das Kind einmal beim Nachtmahl verkündet, die Mutter lächelte dazu gütig mit weichem Blick in den schönen Augen, und auch der Vater schmunzelte, während sich in gespielter Strenge seine Stirn skeptisch krauste. Nur Schwester Nannerl streckte dem Bruder die Zunge raus, heimlich nur, aber herzhaft, weil sich dieser Bruder wieder mal so trefflich bei den Eltern eingeschmeichelt hatte.
Überhaupt wusste in diesen Jahren Nannerl, die eigentlich Maria Anna hieß, nie so recht, ob sie über die Geburt des kleinen Bruders wirklich so glücklich sein musste, wie ihr die Eltern befohlen hatten.
Drei Mozart-Kinder vor ihr waren gleich nach der Geburt gestorben, zwei nach ihr, und fünf Jahre lang war das Mädchen praktisch ein Einzelkind gewesen, gleichsam Sohn wie Tochter in einem. Dazu hatte der Vater genickt: »Was brauche ich einen Sohn, wenn ich eine wie dich habe, mein kleines Nannerl?«
Jetzt aber war dieser Bruder da.
Er krabbelte durch die Stuben. Er sprach sein erstes Wort, bekam den ersten Zahn. Es kam der Tag, da er ein erstes Mal auf noch wackligen Beinen von der einen Wand zur anderen gestapft war, und zu allem hatten die Eltern gejauchzt, als hätte sich ein Weltwunder ereignet, während sich Nannerl an keinerlei Jauchzen bei ihrem eigenen ersten Zahn und ersten Schritt erinnern konnte.
Und sie war dann hinausgegangen, ins andere Zimmer, wo das Klavier stand, hatte sich dort in fordernder Bestimmtheit ans Instrument gesetzt und schon mal einen kräftigen Akkord angeschlagen, bis endlich der Vater kam und mit etwas zerstreutem Lächeln sagte: »Richtig, Nannerl! Wir wollten ja üben.«
Es kam aber immer häufiger vor, als Bruder Wolfgang wohl so drei, vier Jahre alt war, dass sich während dieser Übungsstunden die Tür einen Spalt breit öffnete. Der Bruder schob sich dann in den Raum, immer näher ans Instrument, bis er schließlich unmittelbar neben der Schwester stand und sich nicht im Geringsten daran störte, dass sie ihm einen bösen Blick zugeworfen und gefaucht hatte: »Geh weg! Ich übe!«
Der Vater, unfassbare Nachsicht, da er doch mit ihr immer so streng war, hatte jedoch den Bruder hochgehoben und nur gemeint: »Nun sei nicht so garstig zum Wolfgangerl! Lass ihn auch mal ans Klavier, wenn er denn spielen will!«, und der Kleine saß vor dem Instrument, die Patschhändchen konnten nur wenige Tasten fassen. Aber was er spielte, war zweifellos Musik, von Mal zu Mal immer rascher, gewandter, schöner, wahrlich kleine Hexenstückchen, mit flinken Fingern hingewischt.
»Donnerblitzbub!«, dachte der Vater.
Er, der Buchbindersohn und Jesuitenzögling aus Augsburg, hatte nach kurzem Schwanken, ob er nicht vielleicht doch lieber Priester werden solle, zur Musik gefunden, weil er sich davon ein gewisses Maß Freiheit versprochen hatte.
Denn auch in diesem Mann, obgleich streng im Sinn einer Ordnung mit klarem Unten und Oben erzogen, lebte schon die Sehnsucht, diese Ordnung einmal zu durchbrechen, seinen ganz eigenen, von keiner Obrigkeit diktierten Weg zu gehen, und wenn die Menschen zu dieser Zeit noch nicht so weit waren, dafür auf die Barrikaden zu steigen, so richtete mancher schon seine eigenen Barrikaden in sich selber auf.
Für Leopold Mozart war das die Musik geworden.
»Im Reich der Töne kann jeder König sein«, wie er es später seinen Sohn lehrte. Er selbst hatte sich dieses Königreich hart erarbeitet, mit guter Stimme, einiger Fertigkeit auf verschiedenen Instrumenten, viel Wissen über Notenkunst und Musiktheorie, ein unermüdlich Strebsamer, der ebenso gründlich Geschichte, Naturwissenschaften sowie allerlei Sprachen studierte, bald schon vollkommen Italienisch, recht gut Französisch und leidlich Englisch sprach, zudem noch Griechisch und Latein.
Hier aber, in Gestalt seines vierjährigen Sohnes, saß einer am Klavier, der solch eisenharten Fleiß offenbar nicht brauchte. Aus dem schien Musik gleichsam hinauszuströmen, ja, er schien selbst Musik zu werden, sobald er nur am Klavier saß und sich die ersten Töne hinauf zur Decke schwangen.
»Er musiziert, wie er atmet«, musste der Vater oft denken und hätte gern gewusst, woher der Junge das wohl hatte. Denn vor ihm selber war bei den Mozarts nie einer durch große musikalische Begabung aufgefallen, und auch bei ihm – selbstkritisch-nüchtern gestand er es sich ein – ging das Talent über ein robustes Mittelmaß kaum hinaus.
Die Mutter wies zuweilen schüchtern auf Großvater Wolfgang hin, der auch schon recht musikalisch gewesen war. Aber das wischte der Vater weg: »Der Junge ist ein Wunder!« Das war dazu sein letztes Wort.
Dann saß er da, schrieb auf, was wieder der Wundersohn gelernt hatte: »Das vorhergehende 8 Menuet hat d. Wolfgangerl im 4. Jahr gelernet. – Diesen Menuet hat d. Wolfgangerl auch im Vierten Jahr seines Alters gelernt …«
Und so weiter. Nannerls Fortschritte wurden nicht eigens verzeichnet.
In der Regel brauchte der Junge mit seinen vier, fünf Jahren keine halbe Stunde, um selbst schwierigere Stücke zu lernen. Er lernte sie aber weniger, als dass er sie in sich aufsog, und diese halbe Stunde hätte auch ein Tag oder die volle Ewigkeit sein können.
Denn dann bestand für ihn – jenseits aller Örtlichkeiten, jenseits jeder Zeit – keine andere Wirklichkeit als die Musik. Alles Übrige schien wie versunken, es nieselte kein Schnürlregen, kein Nebel kroch durch seine Gassen. Gebannt schien jeder böse Geist, und alle, wirklich alle hatten Wolfgang lieb.
Erst wenn die halbe Stunde vorüber war und alles still, kam das andere wieder. Dann saß der Junge nicht mehr irgendwo im lichten Himmelsblau auf einer Wolke, sondern hier unten in der dumpfen Stube der Getreidegasse, und das Salzburg draußen – ein erstes Mal sollte er das fühlen, später dann steigerte sich das Gefühl bis zur Hysterie – war nicht mehr die Heimat, kuschelig und traut. Das war ein Gefängnis, mit den Bergketten im Hintergrund als unüberwindlich abschüssigem Mauerwerk und der Festung über der Stadt als steinern stummer Drohung.
Mit einem kleinen schluchzenden Seufzer klappte er bei solchen Bildern und Empfindungen den Klavierdeckel zu. Und harrte der nächsten halben Stunde, die ihm wieder das Wunder Musik bringen und von aller Wirklichkeit erlösen würde. Die Zeit dazwischen existierte praktisch für ihn nicht.
Durfte er aber wieder den Deckel hochklappen, war er es manchmal leid, sich immer nur von den Noten anderer seine Musik vorschreiben zu lassen. Schließlich fühlte er davon genug im eigenen Herzen.
Nur ließen sie sich nicht einfach so dahinspielen. Und der Kleine rutschte vom Schemel, auf den man zwei Kissen gestapelt hatte, damit er überhaupt reichen konnte, ging hinüber zu Vaters Schreibtisch, stapelte auch dort zwei Kissen auf den Stuhl, setzte sich, wie er den Vater hatte sitzen sehen, tauchte wie er die Feder in die Tinte, nur zu tief, viel zu tief, bis auf den Grund des Tintenfasses, und das erste, was er auf das Notenblatt malte, war keine Note, sondern ein dicker schwarzer Klecks.
Er wischte darüber hin, dass die Tinte übers halbe Blatt verschmierte, das geschah auch beim zweiten Hinabtauchen der Feder ins Fass und beim dritten Mal wieder, sodass endlich das Blatt mehr Kleckse als Noten überdeckten. Dennoch streckte es der Junge nicht ohne Stolz dem Vater entgegen, als der zusammen mit Freund Schachtner eintrat.
In gespielter Ernsthaftigkeit nahmen die beiden das Werkchen in Augenschein, mit einem Zwinkern in den Augenwinkeln, während sich beider Stirn wie in respektvoll abwartendem Staunen krauste, und Schachtner unterdrückte nur mit Mühe ein kleines Prusten.
Aber Leopold Mozart war plötzlich ernst, sehr ernst geworden. Gleich nahm er sich das Blatt noch einmal vor, führte es dicht an die nicht mehr ganz intakten Augen, sagte sehr leise, fast ängstlich: »Das ist ja ein richtiges Konzert!«, wobei er das Blatt noch einmal dem anderen reichte, und der nahm es, summte ein paar der dort notierten Takte, ließ die Noten sinken: »Tatsächlich! Ein Konzert!«
»Ich habe nahezu Angst um ihn«, meinte später der Vater, als die beiden Herren zu einem kräftigen Kaffee die langen Pfeifen entzündet hatten. Aufs Dach trommelte wieder der Salzburger Regen, die Kinder schliefen in der Kammer, Wolfgang mit einem stolzen, kleinen Lächeln um die Lippen.
»Angst«, wiederholte Leopold Mozart und dachte an die vielen harten Stunden, die er selbst schon als Kompositeur an Klavier und Notenpult verbracht hatte. Er galt als geschickt, mit schönen Einfällen und eigener prägnanter Handschrift, und gerade im Jahr vor der Geburt seines Sohnes waren ihm zwei besonders passable Kompositionen gelungen, »Musikalische Schlittenfahrt« und »Bauernhochzeit«.
Darauf war er denn stolz, nicht zuletzt im Gedanken an alle Mühe und Sorgfalt, die er über lange Wochen hin auf beide Werke verwandt hatte. Hier aber setzte sich ein gerade Fünfjähriger hin, und zwischen lauter verwischten Tintenflecken fand sich ein…
Nein, kein Meisterwerk. Aber doch schon eine Ahnung dessen, was in seinem Sohn noch stecken könne. Leopold Mozart neigte sich wieder über das verschmierte Notenblatt.
»Freuen Sie sich doch, mein Lieber!« Schachtner tat einen tiefen Pfeifenzug. »Die Musik könnte Ihren Sohn davon abhalten, mit seinem Talent einmal ein ganz schlimmer Bösewicht zu sein.«
»Wie meinen Sie das?« Leopold Mozart sah erstaunt hoch. Schachtner hob die Schultern: »Hat einer nur Talent und am Ende noch zu viel davon, ohne recht zu wissen, wohin damit, kann er darüber sehr wohl zum ausgemachten Schurken werden. Denken Sie nur an den Preußenkönig droben in Berlin!«
»Was hat mein Wolfgangerl mit diesem Fridericus zu tun?«
»Er ist ein Genie, vielleicht, und Fridericus ist es auch. Jedenfalls sagen das die Leute, und es wäre schön, würde er dieses Genie in die Musik stecken wie Ihr Sohn oder Bilder malen oder was immer tun. Doch was fängt er mit seinen überreichen Gaben an? Verpasst seinen Untertanen die ›grauen Sterberöcke‹, wie er selbst die Uniformen der Soldaten nennt. Und seine Kriege führt er nur – das hat er selber mal gestanden – um seinen Namen möglichst häufig in den Gazetten zu lesen.«
Schachtner nahm einen letzten Schluck Kaffee: »Hoffen wir, mein lieber Mozart, dass unser Wolfgangerl einmal nur seiner wunderbaren Musik wegen in den Gazetten steht.« Worauf er noch dem anderen kräftig zunickte: »Ihr Sohn, wenn man ihn lässt, wird einmal ein ganz Großer sein. Davon bin ich überzeugt, jawohl!«
Dieses Gespräch hatte Leopold Mozart, der schon seit einigem mit mancherlei Gedanken umging, nochmals sehr nachdenklich gemacht, und so tief war er in diese Gedanken versunken, dass er fast das Nannerl übersehen hätte, als sie bald nach des Bruders erstem Kompositionsversuch mit einem eigenen vollgeschriebenen Notenblatt vor den Vater hintrat und einen scheuen Knicks machte: »Sehen Sie nur, Papa, was ich geschrieben habe!«
»Sehr schön, mein Kind«, nickte er freundlich, war aber nach einem flüchtigen Blick auf die sehr sauber, ohne einen einzigen Tintenklecks hingeschriebenen Noten gleich wieder bei seinen anderen Überlegungen, zumal es ihm ausgeschlossen schien, ein Mädchen könne jemals eine ernstzunehmende Komponistin sein.
Aber der Junge!
Wolfgang musste Musiker werden, das stand für ihn fest. Denn fast eine Sünde wäre es gewesen, dieser Welt ein solches Wunder vorzuenthalten. Aber kein Musiker wie er selbst, der für ein paar Gulden im Dienst irgendeines Bischofs darben musste.
Es fehlte Vater Mozart nicht an Selbstbewusstsein. Weit höhere Positionen als seine jetzige hätte er sich nicht nur gewünscht, sondern jederzeit auch zugetraut wie wenigstens die eines ersten Hofkapellmeisters hier in Salzburg. Und schon, vorerst nur Vize, hatte er darauf gewartet, einmal die Nachfolge des bisherigen Hofkapellmeisters Johann Ernst Eberlin anzutreten. Zugleich ging aber das Gerücht, der andere Vizekapellmeister, ein gewisser Giuseppe Maria Lolli, sollte einmal dieses Amt übernehmen.
Ein Italiener. Umglänzt von Weltläufigkeit und der angeblich nur Italienern angeborenen Musikalität. Kein einfacher Augsburger, dessen Name weniger wie Musik, mehr wie ein Axthieb klang.