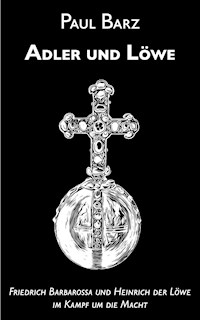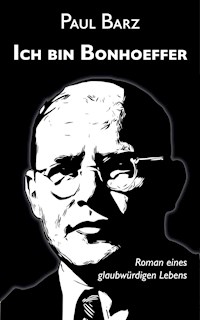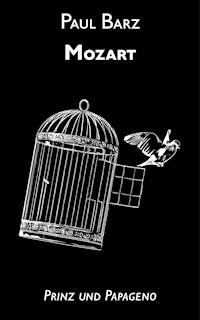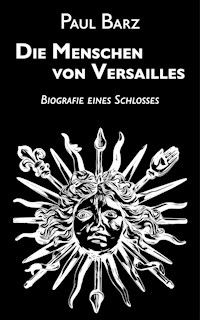Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leibarzt des Königs – Favorit der Königin Das Leben des Doktor Jonathan Friedrich Struensee – vom kleinen Arzt in Altona hin zum "Rebell von Oben", ist Stoff vieler Romane und Filme. Paul Barz legte mit diesem Buch eine mitreißende Biografie dieses aufregenden Lebens vor. Struensee ist wie Cagliostro, Rasputin oder Casanova eine der abenteuerlichsten Gestalten der abendländischen Geschichte. Dieses Buch ist eine ungekürzte, unbearbeitete Neuauflage des 1985 erschienenen Buches von Paul Barz. Lediglich die Rechtschreibung wurde behutsam modernisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Doktor Struensee
Rebell von oben
Für meinen Sohn Helmut
Denn so ist es, Herr:dem Sokrates gaben sie ein Gift,und unseren Herrn Christus schlugen sie an das Kreuz!Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht;aber — einen Gewaltmenschenoder einen bösen stiernackigen Pfarrer zum Heiligen,oder einen tüchtigen Kerl,nur weil er uns um Kopfeslänge überwachsen war,zum Spuk und Nachtgespenst zu machen —das geht noch alle Tage!
Theodor Storm, Der Schimmelreiter
I. Teil: Die Tragödie des Absolutismus
Auf das Osterfeld trieben die Bauern ihr Vieh,und hier wurden auch viele Leute geköpft,darunter der berühmte Doktor Struensee.Er war der Leibarzt des Königs und Liebhaber der Königin.Das kommt davon.
Fremdenführer am Kopenhagener Osterport
Tod auf dem Osterfeld
Sieben Eisenbahnstunden sind es von Altona bis Kopenhagen, und letzte Station vor der Hauptstadt ist Roskilde, ein Bahnhofsschild nur, das kurz in das Abteil hineinblinkt, ein Name mit vagen Erinnerungen an die Zeit, als Roskilde noch das Zentrum dänischer Königsmacht war. Hier hatte um die Jahrtausendwende der Wikinger Harald Blauzahn geherrscht, und hier liegen sie im Dom begraben, die schwarze Margaretha, »Semiramis des Nordens«, die um 1400 ganz Skandinavien unter ihr Szepter zwingen wollte, und all die anderen dänischen Könige. Doch kein Blick auf den Dom, keine Zeit für das Wikingermuseum: Weiter geht es der Hauptstadt zu, eine halbe Stunde lang. Dann ist der Hauptbahnhof erreicht, mit dem Obelisken davor, himmelragende Erinnerung an die große Bauernbefreiung von 1788: »Der König gebot …
Wachablösung vor Amalienborg, darauf die Fahne als Zeichen, dass die jetzige Königin Margarethe zu Hause ist: Dänemarks Monarchie gibt sich familiär, gelassen sind die Denkmäler ihrer Vergangenheit in das Stadtbild eingebettet, Christiansborg, Rosenborg, das Königliche Theater. Und irgendwann passiert man das einstige Osterfeld, nun eine baumumstandene Lagerwiese, bunt und laut im Sommer, jetzt nur leer und still.
Vielleicht ist der Herbst nicht die Jahreszeit, um aufs Osterfeld zu gehen, schon gar nicht am Abend, wenn die Nebel ihre Gesichte in die bittere Herbstluft zeichnen. Kein Laut dringt dann in seine Stille, auch nicht vom benachbarten Fußballstadion her, das fünfzigtausend Menschen fasst, zwanzigtausend mehr, als sich vor zweihundert Jahren hier auf dem Osterfeld versammelt hatten: Auch daran denkt man jetzt, an jenen Frühlingstag des Jahres 1772, als hier das 18. Jahrhundert zu einem seiner großen, blutrünstigen Spektakel angetreten war.
Schon gegen vier Uhr früh waren damals die ersten Neugierigen aufs Osterfeld hinausgekommen, und schließlich war die halbe Stadt auf den Beinen gewesen. Denn so oft kam es selbst in diesem Jahrhundert nicht vor, dass ein leibhaftiger Minister, dazu noch Freund des Königs, geköpft wurde. Viele hatten denn auch ihre Kinder mitgebracht, und vergnügt tollten sie auf dem fünf Meter hohen Blutgerüst herum, bis die Wachen sie verscheuchten, unter gutmütigem Gelächter.
Geduldig durchwartet die Menge den herangrauenden Morgen. Erst um halb acht fängt es endlich an: Soldaten marschieren auf und umstellen das Gerüst, über tausend Infanteristen und noch einmal über viertausend Matrosen. Schließlich reiten noch dreihundert Dragoner heran, und beim Anblick ihres Kommandanten stoßen sich die Menschen in die Seite: Das ist doch der berühmte Oberst Eickstädt, jetzt General und Kopenhagens neuer Stadtkommandant, ausgezeichnet mit dem Danebrog-Orden. Im Januar hatte er sich um den Staat so verdient gemacht. Nun darf er zum Dank die Hinrichtung seines schlimmsten Feindes kommandieren.
Der Henker mit seinen Gehilfen marschiert auf, und ein Murmeln empfängt sie, fast drohend, wie sich überhaupt seit dem Januar die Stimmung im Volk beängstigend gewandelt hat. Damals, im Rausch erster Empörung, hätte es keiner Hinrichtung bedurft. Die Verhafteten, wäre man ihrer nur habhaft geworden, wären in Stücke gerissen worden. Doch verschwanden sie gleich in der Sicherheit wohlabgeschirmter Einzelzellen, die große Stille breitete sich aus, und nur manchmal drangen Nachrichten nach draußen, von geheimen Verhören und einem Prozess hinter strikt verschlossenen Türen. Die Menschen waren ungeduldig geworden. Endlich wollten sie bestätigt sehen, was ihnen erzählt worden war von einer bevorstehenden Verschwörung, von einem Giftanschlag auf den König, von all den wüsten Orgien, die hinter dem Rücken der Majestät gefeiert wurden.
Endlich wird die Anklage veröffentlicht. Sie liest sich recht ernüchternd. Kein Wort von einem Staatsstreich, nichts über Orgien und Giftanschläge — und der ursprüngliche Volkszorn schlägt fast in Mitleid um. Nun fallen schon Worte wie »Justizmord« und »Betrug«, und den Henker erreichen anonyme Drohungen: Ihm würde es übel ergehen, wenn er etwa die Qual der Verurteilten hinauszögere. So sieht denn auch er diesem Tag eher bänglich entgegen.
Es ist dies der 28. April 1772, ein Dienstag und ganz normaler Wochentag. Drüben in Schloss Christiansborg, wo man nach dem gottlosen Lotterleben der letzten anderthalb Jahre wieder sehr fromm geworden ist und selbst eingefleischte Atheisten brav in der Kirchbank knien sehen kann, hält man auch wieder strikt auf die Heiligung des Feiertags: Kein Fest, kein Opernbesuch dürfen an solchen Tagen über die höfische Szene gehen. Doch an einem ganz gewöhnlichen Dienstag braucht man nicht so streng zu sein. So ist denn für den Abend eine Oper angesetzt, eines jener heiteren Stücke, wie sie der König liebt, und zuvor bittet noch die Majestät zu einem Souper im kleinen Kreis. Natürlich wird Professor Guldberg dabei sein, die Graue Eminenz der letzten Wochen, und selbstverständlich Juliane Marie, Königinwitwe und Stiefmutter des Herrschers. Über Jahre hin war die brave Frau von den meisten Festlichkeiten ausgeschlossen worden, aber jetzt prangt sie wieder in der Mitte, nicht mehr jung, doch noch immer stattlich, Herrscherin von Kopf bis Fuß, eine neue Semiramis des Nordens.
Bei der Hinrichtung am Morgen sind diese Herrschaften nicht zugegen, schon gar nicht der König, dem in diesen Tagen nichts die gute Laune verderben soll, schon gar nicht das Ende seines besten Freundes. Auch Guldberg bleibt abseits. Der Herr Professor schätzt mehr die Unauffälligkeit, noch braucht niemand zu wissen, wer er in Wahrheit ist. Nur von Juliane Marie wird erzählt, sie hätte an diesem Morgen, ganz heimlich nur, ein Fernglas vor den kurzsichtigen Augen, hinüber zum Osterfeld gespäht und schließlich gejubelt: »Jetzt ist der Dicke an der Reihe!« Aber vielleicht ist das nur Klatsch. Von dieser Frau wird viel behauptet und erzählt, schließlich sogar, sie hätte ihrer verstoßenen Schwiegertochter Gift ins Exil nachgesandt. Überliefert bleibt nur, dass sie sich am Abend vom Pastor Münter Bericht erstatten ließ und dabei in Tränen ausgebrochen war: »Es tut mir leid für den unglücklichen Menschen. Ich habe mich geprüft, ob ich auch in dem, was ich gegen ihn getan habe, aus persönlicher Feindschaft gehandelt habe. Ich habe mich aber in meinem Gewissen frei gefunden …« Worauf sie dann zum Souper gerauscht war.
Dieser Tag hat nicht nur einen, sondern wenigstens zwei unglückliche Menschen. Gemeinsam sind sie zum Schafott geschritten, und der eine hatte bis zum Schluss nicht ganz begriffen, was ihm eigentlich widerfuhr. Zutiefst ist dieser schmale, dunkle Mann die Frohnatur. Er liebt das Theater, singt nett, spielt gut Flöte, und französische Bühnenklassiker kann er seitenweise auswendig zitieren. Überhaupt ist Frankreich sein großer Traum. Dort hat er zwei vergnügte Jahre lang gelebt, dorthin würde er gern zurückkehren. Soll es aber nicht Frankreich sein, so tut es der Posten eines Amtmanns in seiner engeren Heimat Bramstedt auch. So schreibt er es denn auch in seinem Gnadengesuch an den König. Denn dass er an diesem 28. April tatsächlich hingerichtet werden soll, kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen, dieser Graf Enevold Brandt, eben noch Hofmarschall und Obergarderobenmeister Seiner Majestät.
Auch sein Gefährte hatte noch ein Bittgesuch an den König abgesandt, doch wohl schon ohne Hoffnung. Drei Tage zuvor war ihm sein Todesurteil in die Zelle gebracht worden, und er war sehr ruhig geblieben, hatte nur einige knappe, kühle Fragen gestellt. Vielleicht hatte er dabei auch erfahren, dass im Staatsrat Stimmen für seine Begnadigung laut geworden waren, einer aber heftig widersprochen hatte, ein gewisser Graf Rantzau-Ascheberg. Es hatte aber Zeiten gegeben, da war dieser Graf sein bester Freund gewesen, und der Verurteilte hätte reagieren können wie zwanzig Jahre später Ludwig XVI. auf die Nachricht, auch sein eigener Vetter hätte für seinen Tod gestimmt: »Ich wusste nicht, dass der Mensch so schlecht sein kann …«
Auch er hat nie gewusst, wie schlecht die Menschen sind, mehr noch: Er hat es wohl nie wissen wollen, auch jetzt noch nicht. Denn nun schreibt er noch einen Brief an Rantzau, ohne Vorwurf, voll Freundschaft und Verständnis. Und dann legt er sich hin zu einem letzten kurzen Schlaf. Gegen acht schlägt es dumpf gegen seine Zellentür. Er steht auf. An den Gelenken klirren die Ketten, mit denen er an die Wand gefesselt ist. Sie werden ihm abgenommen. Denn jetzt ist es Zeit für den letzten Gang des Doktor Johann Friedrich Struensee, Graf und Träger des Mathildenordens, vierunddreißig Jahre alt.
Immer schon, noch als schlecht bezahlter Arzt in Altona, hat Struensee Wert auf gute Kleidung gelegt, auf blütenweiße Hemden, gestickte Manschetten, auf spiegelnd blanke Schuhe. Auch jetzt kleidet er sich sorgsam, in einen blauen Samtrock mit funkelnd goldenem Besatz, mit einem Pelz darüber und einem gleichfalls goldbesetzten Hut. So wird er denn seinem Ende entgegenschreiten, immer noch eine blendende Erscheinung, ein schöner Mann von bestem Wuchs, mit klaren, angenehmen Zügen. Todesfurcht steht nicht darin. Der Arzt ist es gewohnt, den Tod als etwas Selbstverständliches zu nehmen, und vielleicht war er sich auch schon lange der Todesnähe bewusst gewesen. Bei seiner Verhaftung hatte man jedenfalls ein goldenes Etui gefunden, mit zwei Giftpillen darin. Gewaltsam hatten sie ihm entwunden werden müssen.
Drei Wagen warten vor der Zitadelle, der erste für den Schicksalsgefährten Brandt, der zweite für ihn selbst. Im dritten nimmt der Ankläger des Königs Platz, Generalfiskal Georg Wilhelm Wiwet, und er ist etwas unzufrieden. Denn sein Antrag hatte ursprünglich gelautet, die Verurteilten vor dem Köpfen noch zu rädern, und launig hatte er dabei in Anspielung auf Struensees Vergangenheit als Anatom gespaßt: »Der Medicus soll öffentlich anatomieret werden … zu seiner Mitcollegen weitern Erfahrungen …« Jetzt wird der Medicus nur geköpft, zuvor soll ihm allerdings noch die rechte Hand abgeschlagen werden. Das mag Wiwet trösten.
Es wird eine lange Fahrt von der Zitadelle bis zum Osterfeld. Denn zweihundert Infanteristen marschieren neben dem Zug, noch einmal zweihundert Dragoner traben hinterher, und so schieben sich die drei Wagen nur im Schritttempo der Stadtgrenze entgegen.
Es bleibt Zeit für vielerlei Gedanken.
Ein Staatsverbrecher soll also Struensee sein. Er soll den König beleidigt, ihn sogar zum Selbstmord gedrängt haben. Auch um Geld war es gegangen, eine beträchtliche Summe, bei deren Überschreibung es in der Tat nicht ganz korrekt zugegangen war, ähnlich wie beim Brillantbukett der Königin, das Struensee verscherbelt hatte. Und dann ist da noch die Sache mit der Königin selbst, mit der kleinen Caroline Mathilde, die jetzt gerade auf den Festungswällen von Kronborg umherirrt und verzweifelt nach dem großen Freund ruft. Er soll ihr Liebhaber gewesen sein, und vor allem deshalb schickt man ihn nun aufs Schafott, den Ehebrecher, der das königliche Bett geschändet hatte als schlimmste seiner Sünden — und was hatte Johann Friedrich Struensee in den sechzehn Monaten seiner Alleinherrschaft sonst noch Verwerfliches getan?
Er hatte, beispielsweise, eine Landreform eingeleitet, die dem Agrarstaat Dänemark endlich zu einer intakten Agrarstruktur verhelfen sollte. Er hatte miefige Moralvorschriften beiseite gefegt, die Übermacht des Adels eingeschränkt, in die wuchernde Höflingshierarchie bei Hofe eingegriffen und Legionen hochnobler Faulpelze zum Teufel gejagt. Er hatte auf Sparsamkeit gedrängt, bis schließlich die Staatsschuld von fünfundzwanzig Millionen Taler auf sechzehn abgesunken war. Und dieser Mann hatte Folter und Zensur abgeschafft, er hatte Krankenhäuser gebaut, Schulen reformiert, ein Findelheim gegründet, er hatte aus Kopenhagens Straßen den Dreck hinauszuspülen versucht, er, hatte …
Eine Stunde dauert die Fahrt zum Osterfeld. Sie reicht nicht, um alle Erlasse Struensees ins Gedächtnis zurückzurufen, und auch nicht alle waren gut und richtig gewesen. Das hatte er selbst gewusst. Aber er kann auch sagen: »Ich nehme das Bewusstsein meines Gewissens mit mir in die Ewigkeit, dass ich den König und das Land nicht habe unglücklich machen wollen …«
Gegen neun ist endlich das Osterfeld erreicht. Neben dem Henker warten zwei Geistliche, die Pastoren Hee und Münter. Sie hatten im Kerker die Seelen der Verurteilten zu retten versucht, und das war auch gelungen, leicht bei Brandt, schwerer schon bei Struensee. Hier hatte Pastor Münter ganze Arbeit leisten müssen, und lange hatte es gedauert, bis sich auch Struensees Hände zum Gebet gefaltet hatten. Darauf ist Münter sehr stolz. Er wird sich darin auch nicht durch die Skepsis eines Herrn von Goethe beirren lassen, der später über Struensees Bekehrung schreibt: »Über den Wert … kann Gott allein urteilen …« Münter urteilt lieber gleich. Er fühlt sich als Freund des Verurteilten, zu dem er sich herzlich strahlend in die Kutsche schwingt, und als echter Freund lässt er den Wagen taktvoll wenden, damit Struensee nicht anzusehen, nur anzuhören braucht, was jetzt geschieht. Denn nun besteigt als erster Enevold Brandt das Schafott.
Auch Graf Brandt ist prächtig gekleidet. Auch er trägt einen Pelz über seinem Rock aus tiefgrünem Samt, und auch an seinem Hut funkeln goldene Tressen. Denn die Regisseure solcher Unternehmen verstehen ihr Geschäft. Dem gaffenden Volk soll schließlich nicht nur etwas fürs Auge geboten werden, es kann dabei gleich auch lernen, aus welcher Höhe einer stürzt, wenn es die Mächtigen so wollen. Da nicken sich die Menschen zu, da sind sie dann mit ihrem eigenen Los als Untertanen zufrieden: nur immer bescheiden sein und an der Stelle ausharren, wohin einen Gott und Fürst gestellt haben. Dann bleibt einem auch solch grausiges Ende erspart.
In Brandts Taschen klimpern Münzen. Sie sind als Trinkgeld für den Henker gedacht, das ihm der Graf gleich nach seiner Begnadigung zuschieben will. Denn natürlich wird er begnadigt werden, was hatte er denn schon verbrochen? Gerade einmal mit dem König gerauft und ihm dabei in die Hand gebissen — das konnte doch niemand ernstlich als Attentat auf das Leben Seiner Majestät werten. Und dass er die Gerüchte vom Ehebruch der Königin nicht weitergab, spricht doch eher für ihn. Denn die Verbreitung eines solchen Klatsches wäre tatsächlich Majestätsbeleidigung gewesen. Also Gnade für Enevold Brandt — nur schade um das hübsche Amt des Garderobenmeisters.
Anderes ängstigt ihn mehr, vor allem die Frage, wie wohl die Menge reagieren wird, wenn sie von seiner Begnadigung erfährt. Denn im Volk ist er fast so verhasst wie Struensee, das weiß er, und so könnten die Leute das Blutgerüst stürmen und ihn in Stücke reißen. Davor hat er Furcht. Nur mit halbem Ohr und zerstreuter Miene hört er der Verlesung seines Todesurteils zu, lüftet kurz den Hut, als die Soldaten ihre Gewehre präsentieren, und nimmt kaum zur Kenntnis, wie jetzt der Henker sein Grafenschild zerbricht: »Dies geschieht nicht umsonst, sondern nach Verdienst!« — nun denn, ein Amtmann in Bramstedt muss nicht unbedingt ein Graf sein.
In gebührender Gelassenheit legt Brandt Rock und Weste ab und sucht noch rasch nach den Münzen für den Henker. Dann entblößt er Arm und Hals, kniet in der vorgeschriebenen Haltung nieder, den Kopf gebeugt, die Rechte ausgestreckt. Nun wird es allerdings Zeit, wenn noch der Bote aus dem Schloss rechtzeitig mit der Begnadigung eintreffen soll …
Der Henker schlägt zu, kurz und genau. Die Hand fällt, der Kopf. Beides wird der Menge gezeigt, dann in den wartenden Karren unterhalb des Blutgerüsts geschleudert. Die Gehilfen schleppen den Körper davon, der Scharfrichter stellt sich wieder in Positur. Das ist erst das Vorspiel gewesen. Der Höhepunkt kommt noch.
In seiner Kutsche hat sich Struensee zum Pastor Münter gewandt, versucht ein Lächeln, höflich, fast entschuldigend: »Ich will Sie nur bitten, auf Ihrer Hut zu sein, dass Sie bei meinem Hingange zum Tode nicht zu sehr beweget werden. Es würde mich sehr beunruhigen, wenn ich Sie leiden sähe …« Dem Pastor kommen Tränen. Er ist eben doch ein guter Mann, der Doktor Struensee, so rücksichtsvoll, und jetzt liefert er ihm auch noch eine so schöne Pointe für das Buch, das Münter über die Bekehrungsgeschichte des Grafen schreiben wird. Es eilt ihm damit. Denn Gerüchten nach arbeitet auch Kollege Hee an einem Buch über die Bekehrung des Grafen Brandt. Solch einer Konkurrenz will zuvorgekommen sein.
Struensee steigt aus dem Wagen. Langsam geht er durch die zurückweichende Menge, sieht zuweilen ein bekanntes Gesicht. Dann nickt er höflich, lüftet den Hut, ganz der Jünger Epikurs, dieses von ihm so verehrten Philosophen mit seiner Lehre vom Leben als einem heiter-ernsten Fest, dessen Gäste den Tod nicht fürchten. Und fürchtet ihn der Doktor Struensee dennoch, soll es wenigstens keiner merken, keiner von denen, die in ihm, dem Bürgerlichen und kleinen Pastorensohn, immer nur den Emporkömmling und größenwahnsinnigen Plebejer gesehen haben. In den Jahren seines Glanzes hat Struensee den Katechismus des Adels gelernt. Er weiß, was sich schickt: Tränen dürfen immer fließen, auch ohne Grund. Aber dem Tod tritt man lächelnd gegenüber, den höflich gezogenen Hut in der Hand.
Die Treppe zum Gerüst ist steil. Nur zögernd nimmt Struensee Stufe um Stufe. Sein Gesicht verzerrt sich. Denn in seiner Brust zucken stechende Schmerzen, der Arm hängt schlaff herab, Folge jenes Reitunfalls im letzten Herbst bei Schloss Hirschholm. Und unten in der Menge nicken sich manche vielsagend zu. Mit wohlgefälligem Grinsen notieren sie, welch miserable Figur der »Pillendreher« auf seinem letzten Gang macht. Er ist eben kein wirklich großer Mann.
Oben auf dem Schafott schwankt Struensee tatsächlich, aber nicht wegen der gebrochenen Rippen in seiner Brust. Jetzt steht er vor dem vom Blut des Freundes noch dampfenden Richtblock, sieht das zerbrochene Grafenschild, und unterhalb des Gerüsts wird gerade Brandts Kadaver ausgeweidet. Auch Struensee hört sein Urteil, sieht sein Grafenschild zerbrechen. Dann soll er sich entkleiden, und seine Finger zittern dabei. Der Henker muss ihm helfen, die Knöpfe aufzunesteln. Endlich ist es so weit. Auch Struensee kniet nieder. Er scheint jetzt wieder ganz ruhig zu sein.
Aber der Henker ist nervös geworden. Erst sein zweiter Schlag trennt die Hand ab, und der Körper des Opfers bäumt sich in wilder Zuckung auf, wird niedergepresst und gewaltsam über den Block gebogen. Der Henker schlägt von Neuem zu, einmal, zweimal. Dann ist alles aus: Der Hass eines Regimes gegen alle, die es zu ändern versuchen, hat seine blutige Atzung bekommen.
Der Kopf wird der Menge gezeigt. Sie schweigt dazu, wie an diesem Abend die Menschen auch nicht ihrem König in seiner Opernloge applaudieren. Dennoch wird es eine schöne Aufführung, schöner noch als die Hinrichtung am Morgen. Die wird rasch vergessen sein, auch wenn die Köpfe der Gehenkten noch einige Wochen lang auf lange Stangen aufgespießt auf dem Schindanger am Rand der Stadt zu sehen sind als Warnung für alle, sich nicht in Geschäfte zu mischen, für die sie nicht geboren sind.
Die dreißigtausend Augenzeugen dieser letzten Stunde Struensees sind davongeschlurft, in das Grau eines absolutistisch regierten Alltags zurück. In der unter Struensee gewonnenen Freiheit darf die dänische Presse noch eine Weile über den gestürzten Unhold toben, und die Obrigkeit lächelt dazu: So ist es recht, dafür ist eine freie Presse gut. Danach wird dann wieder die Zensur eingeführt, schärfer als zuvor. Nun ist es nicht nur verboten, die Regierung zu kritisieren. Jetzt darf über sie überhaupt nichts mehr veröffentlicht werden. Schließlich hat man seine Lehre aus dem Fall Struensee gezogen, der in holder Unvernunft Schreiberlinge jeder Art so lange hatte gewähren lassen, bis er schließlich selbst ihr bevorzugtes Opfer war. So wird auch nur mündlich jene Geschichte vom Landmann aus Jütland weitergegeben, der einen Kirchenfürsten fragt, wann denn endlich die Steuern gesenkt werden. Der Bischof weiß es nicht, und das brave Bäuerlein, umgeben von seiner nackten, hungernden Kinderschar, wiegt gedankenschwer den schlichten Kopf: »Ja, an dergleichen Dinge denken sie in Kopenhagen nicht mehr. Da war ein braver Mann, der uns die Verordnung wegen dem Frondienst gab, und daher mögen sie ihn wohl auch geköpft haben …«
Auf dem Osterfeld wird in der Nacht nach dem 28. April das Blutgerüst schleunigst wieder abgetragen, und schwarze Sklaven sind dafür abkommandiert, wahrscheinlich aus den westindischen Kolonien Dänemarks. Auch um das Schicksal solcher Sklaven hatte sich Struensee gekümmert, hatte für ausreichende medizinische Betreuung und angemessene Rechtsprechung gesorgt. Am liebsten hätte er wohl die Sklaverei gänzlich abgeschafft, das hatte sein Tod gerade noch verhindern können.
In seinem Pfarrhaus aber sitzt Pastor Münter und ist ein wenig ärgerlich. Ausdrücklich hatte ihm Struensee sein Erscheinen als Geist zugesagt. Doch der Geist will nicht erscheinen. So muss sich nun eine andere Pointe finden, und Kopenhagens wortmächtigster Kanzelredner hält auch schon eine parat. Mit Struensee, schreibt er in sein Buch, wüsste er nun einen Freund im Himmel, und das ist eigentlich sehr mutig von dem wackeren Mann. Denn um diese Zeit wagt noch kein anderer, Struensee als seinen Freund zu bezeichnen, schon gar nicht jene, die tatsächlich seine Freunde waren. Sie sprechen lieber von einer Bestie in Menschengestalt, von einem Wolf oder Schakal. So hallt es durch den ganzen Kontinent.
Wer das liest, glaubt das oder schüttelt den Kopf. An den Höfen dieser Zeit geschieht so viel Schlimmes. Da weiß man nicht, wer in diesem Fall der wirklich Schlimme war, Struensee oder sein König Christian, das Opfer oder der Täter. Lieber wird über den Ehebruch der Königin nachgedacht, das ist viel spannender als jeder politische Aspekt der ganzen Angelegenheit. Ähnlich faszinierend lesen sich nur noch die Einzelheiten bei der Hinrichtung. Denn das sind die Dinge, an denen sich dieses so anmutig seinen Charme und seine Grazie über die Zeiten hinweg verstrahlende 18. Jahrhundert labt. Und das ist nicht mehr die barocke Lust, im Leben den Tod zu umarmen. Das Rokoko, längst selbst zum Untergang verdammt, starrt in eigener Todesfurcht voll wollüstig schaudernder Neugier auf den Tod anderer, je scheußlicher, desto besser.
In dieser Hinsicht hält Struensees Hinrichtung mehr die Mitte und wirkt keineswegs so grausam aufregend wie beispielsweise zwanzig Jahre vorher in Frankreich der Tod des geistesgestörten Studenten Robert-François Damiens, der seinen König Ludwig XV. beim Gang zur Messe mit einem kleinen Dolch leicht geritzt hatte. Da war dieses Säkulum zu seiner ganz großen Form aufgelaufen: In vierstündiger Prozedur wurde Damiens zunächst einmal mit glühenden Zangen gezwickt, dann mit kochendem Öl und Blei versengt und schließlich an Armen und Beinen zwischen vier Pferde geschnallt worden. Peitschenhiebe hatten geknallt, die aufgescheuchten Pferde zerrten den Leib auseinander, und das Publikum geriet vor Begeisterung ganz außer sich. Das war nun ein Schauspiel, das sich wirklich lohnte. Das hatte sogar die unverschämt hohen Preise für angebotene Fensterplätze gerechtfertigt. Und an einem dieser Fenster hatte eine Dame Mitleid befallen. Sie brach in Tränen aus und rief: »Seht doch nur, die armen Pferde …«
Aber auch in dieser Zeit gibt es manche, die ernsthaft überlegen, ob solche Methoden wirklich noch in ein aufgeklärtes, fortschrittsfrohes Jahrhundert passen, und in Frankreich entwirft schließlich der Arzt Doktor Guillotin ein Fallbeil, das seine Opfer binnen weniger Sekunden tötet. Ihre Qual, so Guillotin, sei dabei nichts Ärgeres als ein eher angenehmes, erfrischend prickelndes Gefühl in der Halsgegend. Der Doktor sollte denn auch bald Gelegenheit erhalten, dieses Gefühl am eigenen Hals zu erleben.
Doch zunächst einmal ist alles von der Neuerung begeistert. Ein Modell wird gebaut und 1792 dem französischen König vorgeführt. Der ist nun selbst ein geschickter Handwerker. Der sieht gleich die grundlegende Schwäche des neuen Instruments.
Dessen Klinge ist nämlich gebogen, und nicht jeder Nacken passt darunter. »Meiner zum Beispiel«, führt der vierschrötige Monarch aus, »wäre viel zu dick dazu.« Und Ludwig XVI. zeichnet in die Skizze einen Strich: So muss die Klinge aussehen, nicht gekrümmt, sondern abgeschrägt. Die Anwesenden sind beeindruckt. Ein richtiger König kennt sich eben in allem aus. Das muss man diesen Herren lassen, selbst noch im Jahr 1792, da Könige nicht mehr so hoch im Kurs stehen. Denn inzwischen wurde die Pariser Bastille gestürmt, Ludwig XVI. hatte erschrocken gestammelt: »Das ist ja eine Revolte!« und zur kühlen Antwort erhalten: »Nein, Sire, das ist eine Revolution!«
Jetzt nimmt sich diese Revolution der Erfindung des Doktors Guillotin an, sie steht am Anfang einer neuen Zeit, der sich auch der Tod anpasst und immer perfekter, gründlicher und anonymer werden wird bis zu den Erschießungspellotons und Gaskammern in den Hinterhöfen unserer Gegenwart: Gute alte Vergangenheit, da noch die ganze Familie einträchtig hinausziehen konnte zur Hinrichtung auf dem Osterfeld …
Es kommt aber bald nach der königlichen Korrektur ein Tag, der 21. Januar 1793, da liegt dieser König selbst unter dem eigenhändig verbesserten Fallbeil. Die schräge Klinge saust auf seinen Nacken herab, man meint noch einen Schrei zu hören, dann ist alles sekundenschnell vorbei. Die vielen Tausend Zuschauer erstarren zunächst, dann brechen sie in ein gellendes »Vive la république!« aus. Und wäre unter ihnen Johann Wolfgang von Goethe gewesen, hätte er an diesem Tag wiederholen können, was er schon im Jahr zuvor bei der Kanonade von Valmy gesagt hatte: »Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen …«
Bei der Kanonade von Valmy hatten die zerlumpten Truppen der Französischen Revolution über die wohlausgerüsteten Armeen der etablierten Mächte Preußen und Österreich gesiegt. Es mochte Feuertaufe und eigentliche Geburtsstunde der Republik gewesen sein. Jener graue Januartag auf der Pariser Place de la Concorde im Jahr darauf ist aber die Todesstunde der absoluten Monarchie. Das Bürgertum tritt zur Machtübernahme an, ganz ohne Monarchen — und auch ohne all jene, die diese Monarchie noch einmal durch Reformen in eine neue Zeit hinüberzuretten versuchten. Wie beispielsweise in Dänemark der Doktor Johann Friedrich Struensee.
In seiner Geschichte des dänischen Gesamtstaates hat der Historiker Johannes Krumm den Fall Struensee als »die furchtbarste Tragödie des Absolutismus« bezeichnet. Doch setzt Tragik Zwangsläufigkeit voraus. War also das private Schicksal Struensees zwangsläufig? Oder spiegelt sich nicht vielmehr in ihm das zwangsläufige Ende einer Staatsform, die einst als legitime Erbin des mittelalterlichen Welt- und Menschenbildes die erste große Staatsform der Moderne war? Ist der Fall Struensee weniger seine eigene als tatsächlich »die Tragödie des Absolutismus«?
Seine private Geschichte fängt jedenfalls gar nicht so tragisch an, eher als Lustspiel im Geschmack der Zeit, mit der klassischen Besetzung einer galanten Dreieckskomödie, der flatterhaften jungen Frau, dem lächerlichen Hahnrei und einem eleganten Hausfreund im Hintergrund. Das könnte Anlass für viele übermütige Verwechslungsscherze sein, für dralle Situationskomik und neckisch kichernde Erotik, ein Stoff vielleicht für einen Beaumarchais oder Marivaux, ein toller Tag, das Spiel von Liebe und Zufall. Da aber die drei Hauptpersonen zugleich drei Mächtige ihres Jahrhunderts sind und dieses Jahrhundert bereits die Ahnung von Untergang und unaufhaltsamem Verfall durchtränkt, soll unversehens ernst werden, was als Spiel beginnt.
II. Teil: Als Spiel beginnt’s
Den Königen ist zu huldigen. Sie tun, was ihnen gefällt.
Aus einem Schulheft des zehnjährigen Ludwig XIV.
Dämmerstunde für Monarchen
Aus dem historischen Halbdunkel tritt ein junger Mann, gerade achtundzwanzig Jahre alt, mit blaugrauem Strahlblick im mädchenhaft hübschen Gesicht. Seine überschlanke Erscheinung entzückt Frauen wie Männer, einer seufzt bei seinem Anblick: »Ich hätte nicht umhinkönnen, mich in ihn zu verlieben, wenn ich von einem anderen Geschlecht gewesen wäre …« Der junge Mann, für Komplimente sonst nicht unempfänglich, schiebt jetzt jede Schmeichelei beiseite. Er hat anderes zu tun.
Eigentlich wollte er Dichter werden und träumt davon, der Nachwelt ein großes Werk zu hinterlassen. Doch nun beschäftigt ihn ein anderes Werk. Er regiert. Es scheint ihn wie ein Rausch zu packen. Er, der so verspielt schien, nur an Musik und Dichtung interessiert, kennt kein anderes Vergnügen mehr als seine Arbeit, und Freunde hören ihn seufzen, es fehlten an jedem Tag wenigstens vierundzwanzig Stunden. So viel sei zu erledigen.
Wie Furien hetzt ihn seine Vergangenheit, Qualen einer Jugend im Schatten eines überstrengen Vaters, die eigene Ohnmacht über Jahre hin, da niemand recht wusste, wer er war, wohl auch er selber nicht. Nun ist ihm über Nacht alle Macht zugefallen. Er kann endlich zeigen, wer er ist und will dabei keinen Augenblick verlieren.
Ordre um Ordre geht hinaus, binnen weniger Wochen. Die Folter wird abgeschafft, die Pressezensur. Das Reglement in den Kasernen wird erleichtert, die Strafe für Kindsmörderinnen gemildert. Die staatlichen Vorratskammern öffnen sich, der Brotpreis sinkt. Der junge Mann ist schon beim nächsten Thema. Er weiß alles und das meiste besser. Nichts gibt es, worum er sich nicht kümmert, um Eheschließungen zwischen entfernten Verwandten, um die Bauvorschriften in der Stadt, um das Bierbrauen auf dem Lande. Zugleich hat er auch seine Animositäten und lebt sie nun voll aus. Die Geistlichkeit zum Beispiel hasst er, vielleicht weil sein Vater so fromm gewesen ist. Der Sohn verkündet achselzuckend, in seinem Land möge doch jeder nach eigener Façon selig werden. Das haben zwar vor ihm auch schon andere Mächtige gesagt. Aber erst in seinem Mund wird die schlichte Feststellung zum politischen Programm. Europa horcht auf. In benommener Bewunderung starren alle auf den Mann, der dort seinen Namen unter immer neue Erlasse setzt: Friedrich II., König von Preußen.
In dieser Anfangsphase seines Regimes sind die Gerüchte und Vermutungen um ihn noch kühner als alle seine Maßnahmen. 1740, da Friedrich im bestorganisierten und trostlosesten Staatswesen Europas die Macht ergreift, hebt auch das große Raunen an: Ist er nicht immer schon ein Freund der Künste gewesen, ein Bewunderer der Philosophie und fast schon selber Philosoph? Sollte er nun gar die in allen Kaffeehäusern Europas gehegte Utopie einer Republik des Geistes verwirklichen, mit sich selbst als Oberhaupt, mit lauter Philosophen als Beratern?
Schon heißt es, Friedrich würde seinen besten Freund Voltaire, den größten aller Philosophen, zu sich nach Potsdam holen. Voltaire soll Preußens Erster Minister werden, und der Gedanke erscheint nicht einmal abwegig. Waren doch im Frankreich des letzten Jahrhunderts Kardinäle wie Richelieu oder Mazarin Premierminister und eigentliche Macht im Staat gewesen — warum nicht hundert Jahre später in Preußen Voltaire als Kirchenfürst des neuen Glaubens an Fortschritt und Vernunft, als der preußische Richelieu eines neuen Zeitalters?
Die Utopie verfliegt, kaum dass sie entstanden ist. Und als Voltaire tatsächlich von Versailles nach Potsdam überwechselt und ihm sein bisheriger Gastgeber Ludwig XV. den Stoßseufzer nachschickt: »Ein Narr in Preußen mehr, einer an meinem Hof weniger«, darf er zwar an der Tafelrunde von Sanssouci, nicht aber auf einem Ministersessel Platz nehmen. Denn mit den Philosophen hält es Friedrich inzwischen so, wie es ein französischer Diplomat von Anfang an prophezeite: »Es ist anzunehmen, dass Seine Majestät der König sich solcher Köpfe nur zum Zeitvertreib bedienen wird …« Genau das tut Friedrich und klopft seinem Philosophenfreund Dietrich Keyserlingk herablassend die Schulter: »Du bist ein braver Junge, ich höre dich gern singen und lachen, aber deine Ratschläge sind die eines Narren …«
Was für Wandlungen aber Friedrich seinen Bewunderern auch immer zumutet, bis schließlich Freund Voltaire nur noch staunen kann, dass so viele Charaktere in einem einzigen Körper wohnen: Für Jahre bleibt er das europäische Idol. Die Intellektuellen dieser Zeit, ob sie nun an Pariser, Londoner oder Petersburger Kaffeehaustischen Platz nehmen, ersehnen sich in seinem Bild weiterhin die große Aussöhnung zwischen Geist und Macht, und Friedrich wird ihr Ideal, weil sie ein solches Ideal brauchen. Nicht zufällig nennen sie ihn zunächst nicht »den Großen« wie frühere Herrscher auch. Sie sprechen von »Friedrich dem Einzigen« — einzig soll er sein, ein völlig neuer Herrschertyp in einer völlig neuen Zeit.
In dieser Zeit ist der Mensch wieder einmal, wie in der Renaissance, auf die Suche nach sich selbst gegangen, nach einer neuen Position im Koordinatenkreuz des Weltgebäudes. In der Renaissance hatte er sich vom Ruch der eigentlich nichtswürdigen Kreatur erlöst, die allein Gott und Glauben von allen Widrigkeiten duldsam durchlittener Erdenlast befreien können. Jetzt stellt sich der Mensch selbst in die Mitte jeder gültigen Ordnung. Er hat nicht länger den Institutionen, die Institutionen haben ihm zu dienen, auch die Macht, auch ihr König. Denn was gibt dem Herrscher sonst den Anspruch auf die alleinige Gewalt im Staat, wenn nicht das Wohl seiner Untertanen?
Aber auch die Monarchie hat seit der Renaissance ihren Emanzipationsprozess durchlaufen. Der König will nicht länger nur erster unter Gleichen sein, das Instrument seines Adels. »Alle Macht der Krone!« heißt jetzt die Devise, und im Pariser Louvre schreibt ein zehnjähriges Kind hundertmal in sein Schulheft: »Den Königen ist zu huldigen. Sie tun, was ihnen gefällt …« Darunter setzt der Junge seinen Namen: Louis Quatorze, der vierzehnte Ludwig. Als »Sonnenkönig« wird er zum Inbegriff des Absolutismus werden, der in Frankreich seinen Höhepunkt erlebt — und überschreitet.
Es herrschen nicht mehr, wie im Feudalismus, die großen Familien. Es herrscht der König. Die Untertanen sehen zu ihm auf wie zu einem Gott. Und gottgleich entzieht er sich ihren Blicken. Ludwig XIV. bricht aus seiner Hauptstadt auf, verlässt das alte Königsschloss, den Louvre, und schafft sich weit draußen zwischen Sümpfen und Bäumen seine eigene erdenferne Residenz, sein Traumhaus Versailles, fernab schnöder Wirklichkeit. Dort ist er tatsächlich die Sonne, um die alles kreist, der Hohepriester des Absolutismus, der sich bei der Messe als einziger vor der Monstranz verneigt, während sich die anderen vor ihm zu verneigen haben: Es führt kein anderer Weg zu Gott als der über den König. Der Untertan erstarrt in Demut: Er glaubt an seinen König — solange er an einen Gott glaubt …
Ludwig XIV. ist das monarchische Idol seines Zeitalters, wie Friedrich II. Idol der nächsten Epoche sein wird. Dazwischen aber vollzieht sich der große Wandel, nicht in der Monarchie, doch mit den Menschen. Ihr Glaube an Gott bröckelt. Sie glauben jetzt an sich selbst. Noch zu Lebzeiten wird der große Alte von Versailles zum Denkmal seiner selbst, ist sein Schloss bereits ein Monument vergangener Zeiten, an dem die Strömungen dieser Zeit immer rascher vorüberfließen.
Die ›Philosophen‹ geben jetzt den Ton an. So nennen sie sich jedenfalls selbst, diese Jünger einer neuen Religion, die Vernunft zum neuen Abgott macht. Eigentlich ist es eine recht buntscheckige Gesellschaft, die sich dort in den Salons und Kaffeehäusern der Hauptstädte niederlässt, mit Worten diese Welt zu ändern. Doch ist sie zugleich der Humus, aus dem die eigentlichen Geistesgrößen des 18. Jahrhunderts aufsteigen, ein Voltaire als ihr heimlicher König, tiefkonservativ unter den Silberschauern seines Esprit, ein Baron de Montesquieu, der im Staat die Teilung der Gewalten fordert, ein Denis Diderot, der in zwanzigjähriger Arbeit gemeinsam mit dem Mathematiker D’Alembert die achtundzwanzig Bände seiner Enzyklopädie herausgibt.
Das ist nun die Bibel dieser neuen Religion und zugleich die zwischen Buchdeckeln vorweggenommene Große Revolution. Denn nun ist das Wissen dieser Zeit nicht mehr das Privileg weniger. Es wird überschaubar, nachschlagbar. Jeder kann sich informieren, was diese Welt in ihrem Innersten zusammenhält, und wenn es in der Enzyklopädie beispielsweise unter dem Stichwort cerf wie ›Hirsch‹ heißt: »Wenn der Hirsch das verständige Alter erreicht hat …«, wackeln entsetzt alle konservativen Perückenköpfe: Soll nun gar Tieren so etwas wie Verstand zugesprochen werden, wo doch diese Vorstellung schon bei vielen Menschen schwerfällt?
Neben Diderot taucht schließlich ein seltsamer Geselle auf, der die in ihren Fugen aufgestörte Welt vollends aus den Angeln zu heben droht. Er begeistert sich für ein einfaches Leben, fordert eine freie und natürliche Erziehung, definiert Liebe als das umfassende, allbestimmende Gefühl, als Urgewalt und nicht mehr als jene Mischung aus Spaß und Pflicht, wie sie unter dem Stichwort »Ehe« in Diderots Enzyklopädie beschrieben wird: »An seine Ehegattin ist man gebunden, mit seiner Geliebten verbunden …« Und dann wird dieser Mann auch noch politisch.
Allen Ernstes formuliert er einen contrat social, eine neue Gesellschaftsordnung mit dem Volk als einzigem Souverän. Das geht denn doch zu weit. Das ist keine Revolte mehr, das ist eine Revolution. Den Philosophen, immer auf gesittetes Maß bedacht, schaudert es: Dieser Uhrmachersohn aus Genf, dieser Jean-Jacques Rousseau ist nicht mehr ein ›Aufklärer‹, wie sie sich selbst verstehen. In ihm scheint die eben erst vollzogene Aufklärung auch schon wieder überwunden, und nicht mehr der Verstandesmensch à la Voltaire, der ›edle Wilde‹ à la Rousseau droht das neue Ideal zu werden. Kehren wir also rasch wieder zur eigentlichen Aufklärung zurück, wo noch alles so vernünftig zugeht und sich jeder an klare Kategorien halten kann …
Was Aufklärung eigentlich ist, fasst der deutsche Aufklärer und Philosoph Immanuel Kant bündig zusammen: »Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« — Ausgang also aus allen belastenden Vorstellungen von unterschiedlichen Rassen und Nationen. Jeder Mensch ist gleich, ob in China oder Europa, ob Jude oder Christ, und die Gesetze, nie falsch oder richtig, immer nur gut oder schlecht, gelten für alle Menschen gleichermaßen. Ausgang auch aus allen Erpressungsmechanismen einer Religion, die für ein ungewisses Glück im Jenseits diesseitige Unterwerfung fordert, Ausgang aus einer Moral, die dem Menschen seine privaten Lebensäußerungen zu diktieren sucht. Ausgang vor allem aus dem Bannkreis einer angeblich gottgewollten Obrigkeit: Der Mensch ist frei, wenn er nur seinen Verstand gebraucht. Dann wird der Fortschritt unaufhaltsam, ein Fortschritt natürlich nur zum Guten hin, zum immer Besseren, das alle Schlacken dieser Gegenwart zwangsläufig überwindet. Wer ist aber in diesem Zusammenhang noch der König? Was bedeutet seine absolute Macht? Ist sie Hemmschuh oder Förderer dieser großen Entwicklung zum Guten hin?
Um die Jahrhundertmitte, in der Hochblüte der Aufklärung, denkt noch niemand daran, sich dieser Macht, gar gewaltsam, zu entledigen. Drüben in England ist zwar einmal ein Monarch abgesetzt und hingerichtet worden. Aber das gilt eher als Schreckvision, und das Gemälde dieses unhappy king Charles I. hängt im Arbeitszimmer des letzten absoluten Franzosenherrschers. In langen Stunden betrachtet es Ludwig XVI., schüttelt nur den Kopf: Was hatte der königliche Kollege falsch gemacht, dass er diesen Weg hatte nehmen müssen? Dass es schon ein Fehler sein kann, überhaupt ein König zu sein — das weiß der zutiefst gutwillige, reformbereite Louis nicht. Und das wollen auch die wenigstens seiner Zeitgenossen wissen.
Zu tief ist in das abendländische Bewusstsein eingeprägt, dass an der Spitze jeder gesellschaftlichen Hierarchie ein gesalbter Einzelner stehen muss, als dass sich selbst die radikalsten Kritiker des Absolutismus von dieser Vorstellung lösen können. Und noch am Vorabend der Französischen Revolution, als sich Frankreichs Dritter Stand nach Versailles aufmacht, die Vorherrschaft von Adel und Geistlichkeit zu brechen, ist nicht der Sturz der Monarchie das Ziel, sondern lediglich ihre Erneuerung. Vom König als einem »gekrönten Revolutionär« ist im Sommer 1789 die Rede, vom »großen Bund zwischen Volk und Thron« wird geträumt, vom sozialen Umsturz mit dem König an der Spitze, und der so spricht, ist ein kleiner Advokat aus Arras. Er heißt Maximilian de Robespierre und wird nur vier Jahre später den »gekrönten Revolutionär« unter das Fallbeil schicken: »Ludwig muss sterben, damit das Vaterland leben kann …«
Das 18. Jahrhundert will also die Monarchie. Nur will sie sie anders als bisher, nicht als Ausdruck göttlicher Fügung, sondern als Verpflichtung gegenüber den regierten Menschen. Wie ein guter Vater soll der Herrscher das allgemeine Wohl verwalten, soll seine Kinder glücklich machen — eine Vorstellung, die vor allem den Herrschenden selbst gut gefällt: Andere glücklich machen — wer will das schließlich nicht? So nehmen denn die Philosophen an den Fürstentischen zu Wien oder Sanssouci Platz. So bezieht Voltaire Quartier in Versailles, und Jeanne Antoinette Poisson, besser als Madame Pompadour bekannt, lässt sich auf dem vierten Band von Diderots Enzyklopädie abbilden, mit Montesquieus Hauptwerk vom »Geist der Gesetze« in der Hand. Am Wesen des Absolutismus ändert sich im Übrigen nichts.
Weiter folgt die Monarchie ihrer trägen Bahn, schleppt als gültige Wirtschaftsordnung einen schwerfälligen Kronkapitalismus mit sich und taumelt von Krise zu Krise. Weiterhin wird Weltpolitik betrieben, als sei sie die private Familienangelegenheit einiger weniger Mächtiger. Kriege sind in der Regel Erbfolgekriege, Bündnisse die Aussöhnung von Dynastien, nicht von Völkern. Dem immer stärker werdenden Bürgertum steht die herrschende Schicht mit skeptischem Unverständnis gegenüber. Lieber glorifiziert sie den braven Bauern, der in dumpfer Gläubigkeit vor Gott und König seinen Acker bestellt, und man sage nicht, seine Belange lägen den Monarchen nicht am Herzen: Frankreichs Dauphin lernt sogar pflügen und lässt sich dabei malen. Draußen auf dem Land leben aber diese Bauern weiterhin in halber oder totaler Abhängigkeit von ihren Gutsherren. Jeder adelige Grundbesitzer ist sein eigener kleiner König, jeder das Ebenbild Gottes auf Erden. Da seufzen dann die Aufklärer tief und wenden sich mit hilflosem Achselzucken einander zu: Gibt es denn gar keine gekrönten Mächtigen, die ihre Lehren in praktische Politik umsetzen? Sollten am Ende Macht und Geist unvereinbar sein?
In dieser Stunde und unter diesen Vorzeichen geht der Stern Friedrichs des Einzigen auf. Während in Versailles die Erben des Sonnenkönigs Großvaters Spiel vom alleinigen Gottesgnadentum lediglich aufs stets Neue reproduzieren, scheint der Preuße Friedrich die ideale Synthese zu sein zwischen Macht und Geist, zwischen Konservatismus und Fortschrittsglauben, Inbegriff eines aufgeklärten Monarchen, der über das Wohl seiner Untertanen wacht, der ›Bund zwischen Thron und Volk‹ in Person. Und Friedrich, eiskalter Stratege des eigenen Ruhms, gibt mit genialischem Geschick der eigenen Legende ständig neue Nahrung.
Wie vernünftig und ganz im Sinn der Zeit klingt sein Wort vom König als erstem Diener des Staates! Wie sympathisch berührt es, dass ihn sein Freund Voltaire nur mit »Votre Humanité«, nie mit »Votre Majesté« anreden darf! Und wie glänzend ist doch die Geschichte des Müllers von Sanssouci inszeniert, der vor dem Berliner Kammergericht über seinen Herrn und König siegt, als seien beide gleich vor dem Gesetz! Hier scheint ein Monarch die Regeln seiner Zeit wirklich begriffen zu haben, scheint die Vergangenheit bruchlos in die Gegenwart hinüberzuführen: Das bewundert der alternde Johann Sebastian Bach ebenso wie der noch junge Goethe, das beeindruckt Philosophen wie Kant und Herder nicht minder als Herrscher wie Zar Peter oder Kaiser Joseph, bezeichnenderweise die Söhne von Friedrichs schlimmsten Feindinnen. Die Bewunderung für Friedrich ist auch der Protest der Jungen gegen die Vorherrschaft der Älteren.
Johann Friedrich Struensee, Pastorensohn aus dem preußischen Halle und drei Jahre alt, als Friedrich den Thron besteigt, bewundert den Preußenkönig nicht. Aber auch ihn prägt dieses Jahrhundertphänomen, und seine politischen Vorstellungen wird er so getreulich in sein eigenes staatsmännisches Denken einbringen, dass er vielen wie eine Kopie Friedrichs II. erscheint. Struensee wird dann wohl nicht mehr erfahren, dass sich über ihn nach seinem Sturz kein anderer so ätzend giftig, so ganz und gar vernichtend äußert wie gerade dieser König: Fridericus Rex scheint sich zu verbitten, von einem kleinen Bürgerlichen, dazu noch von einem eigenen früheren Untertan, so schamlos genau beim Wort genommen zu werden. Das gehört dann zu den Enttäuschungen, die dieser Herrscher immer wieder seinen Bewunderern bereitet, Österreichs Joseph II. zum Beispiel, als sich Maria Theresias reformwütiger Sohn anhören muss, wen der vergötterte Friedrich als sein eigenes Vorbild ansieht: keinen anderen als Ludwig XIV., einen »wahren Patriarchen der Könige«. Da ahnt dann Joseph, da ahnen manche, dass es sich bei diesem Mann eben doch nicht um eine Alternative zu den herkömmlichen Monarchen handelt. Deren Dämmerstunde ist längst angebrochen, auch Friedrich II. hellt sie nicht mehr auf. Für den Bürger dieser Zeit ist es damit nur noch ein Schritt von der Forderung: »Die Monarchie muss anders werden« zur Erkenntnis: »Ohne Monarchen geht es auch«.
Einstweilen ruht er noch in sich und seiner Welt, der aufgeklärten Bürger des 18. Jahrhunderts. In der Regel ist er ein gescheiter Typ, belesen und gebildet. Er ist nicht eigentlich Atheist, er glaubt durchaus an ein höheres Wesen, nur nicht an das, wovon die Pfarrer predigen, und so belacht er freudig die Sanduhr auf der Kanzel in Potsdams Garnisonskirche, die auf Befehl des Königs dem Pastor das Ende seiner Predigt anzeigt.
Denn unser Mann hat viel Humor, bewundert den geschmeidigen Esprit der Franzosen und den satirisch beißenden Witz der Engländer. Sein Lieblingsautor ist Voltaire, und selbstverständlich steht Diderots Enzyklopädie vollständig in seinem wohlbestückten Bücherschrank. Ins Theater geht er mehr zur Erbauung als zum Vergnügen, die Lebenslust des Adels ist ihm fremd. Dafür ist er informiert, liest Zeitungen und die allerorten aus dem Boden sprießenden Gazetten, schreibt gelegentlich auch selbst, wie er überhaupt ein Mann des Wortes ist: In Gesprächen verbessert sich am besten diese Welt.
In Rousseaus Schriften blättert er zuweilen. Vieles kann ihn daran beeindrucken, insgesamt geht es ihm aber doch zu tollkühn zu: Wie denkt sich das dieser Mann, der seine eigenen fünf Kinder allesamt ins Findelhaus abgeschoben hat: eine Erziehung der Liebe, der totalen Zuwendung des Erziehers zu seinem Zögling? Und wie soll denn dieser contrat social funktionieren, diese Alleinherrschaft des Volkes? Und dann die hemmungslose Anbetung der Liebe: Damit kann unser Mann der Aufklärung nichts anfangen. Emotion gehört nicht ausgelebt, sondern gezügelt, und was hier stürmt und drängt, wird erst die nächste Generation zu ihrem Weltbild machen. Er selbst wahrt noch, bei allem kritischen Bewusstsein, die wohlausgewogene Form.
Gemessen lehnt er sich zurück und ist bemüht, sich auf diese wirre, widersprüchliche Zeit seinen Reim zu machen. Er hat von den Fabriken gehört, deren qualmende Schlote drüben auf den Britischen Inseln das liebliche Panorama merry old Englands zersägen. Er hört von all den Maschinen, die fast Tag um Tag erfunden werden, von James Watts Dampfmaschine oder Richard Arkwrights mechanischen Spinnrädern. Er nickt dazu und fühlt sich nur ganz leise unbehaglich: Gut so, das kann nur Fortschritt heißen, und fortschrittlich will man schließlich sein. Er nickt auch zu den Wirtschaftstheorien von Adam Smith, der Arbeit und Arbeitsteilung als Quelle allen Wohlstands definiert. So versteht er denn auch nicht, wie man immer noch am Prinzip der Leibeigenschaft festhalten kann, an diesem schlimmsten Relikt des Feudalismus.
Natürlich lehnt er die Folter ab, natürlich jede Diskriminierung von Religion und Rasse. Denn er ist tolerant schon aus Prinzip. Intolerant kann nur sein, wer Andersartiges nicht versteht, und unser Mann versteht alles, weiß alles, hält alles für durchschau- und machbar. Es gibt einfach kein Geheimnis, dem nicht Vernunft beikommen könnte, kein Rätsel, das sich nicht wissenschaftlich lösen lässt. Im Übrigen vertraut er auf den Geist der Dinge: Historische Epochen folgen aufeinander in fortschreitender Steigerung, bis hin zur absoluten Vollkommenheit. Sie ist also nur eine Frage der Zeit — hat es nicht so oder ähnlich der große Voltaire gesagt?
Um die Jahrhundertmitte erlebt unser Mann der Aufklärung einen Schock. Im November 1755 hört er, dass in Portugal ein Erdbeben binnen weniger Minuten die Hauptstadt Lissabon fast vollständig zerstört hat. Dreißigtausend Menschen sterben, viele tausend andere irren obdachlos umher, während durch die Ruinen eine Feuersbrunst rast und auch noch den Rest zerstört: Das Erdbeben von Lissabon ist die Katastrophe des Jahrhunderts.
Manche sehen darin das Menetekel Gottes und kehren reumütig zum alten Glauben zurück. Andere fühlen sich erst recht in ihrer Auffassung bestätigt, dass drüben überm Sternenzelt kein guter Vater wohnt. Alle sind sich aber einig, dass an eine gleichsam zwangsläufig vorwärtsschreitende Besserung der Welt nicht mehr geglaubt werden kann. Der Mensch, will er nicht wieder den alten Zwängen verfallen, muss selbst sein Schicksal in die Hand nehmen und durch die Tat entscheiden, wie diese Welt anders und besser werden kann. Kein Gott hilft dabei, keine. Vorsehung und kein Fortschritt der Natur. Der Mensch bleibt auf sich selbst gestellt. Das meint zum Beispiel auch der Doktor J. F. Struensee.