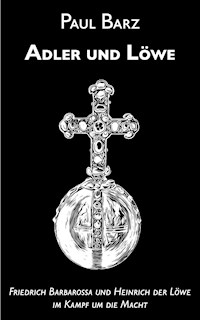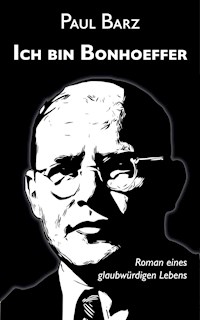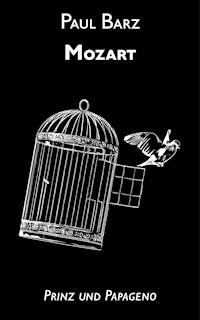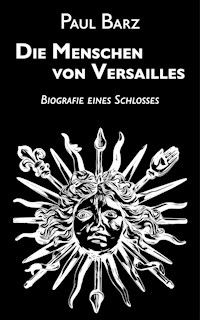
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Vestigo Leonis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
VERSAILLES VOM SEHNSUCHTSORT ZU STEINGEWORDENER GESCHICHTEDer Aufstieg und Niedergang des Prachtschlosses bei Paris vom Bau bis ins 20. Jahrhundert: Wir begegnen Ludwig XIV., seinen Höflingen, Geliebten und Nachfolgern, aber auch den großen Namen französischer Kultur wie Lully oder Molière.Dieses Buch ist eine ungekürzte Neuauflage des 1973 erschienenen ersten Buches von Paul Barz. Es folgt dem Text der Originalausgabe. Lediglich die Rechtschreibung wurde behutsam modernisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Barz
Die Menschen von Versailles
Biografie eines Schlosses
In Versailles wurde auch gelebt
Versailles braucht die Sonne.
Oder auch: Nur an Sonnentagen leuchtet die Fassade in ihrem berühmten mattgelben Schimmer auf, füllen sich die Räume mit Farben, liegt über dem Spiegelsaal wieder der silberne Firnis von einst.
Nur an Sonnentagen scheinen die Gärten keinen Horizont zu haben, verlaufen ihre Linien ins blau-dunstig Grenzenlose.
Nur an Sonnentagen wirkt dies Riesenhaus noch immer wie der steinerne Auftakt zu weltweiter Besitzergreifung.
Regentage aber nehmen dem Haus seinen Glanz. Dann werden die Farben fahl, dann schwindet der Silberfirnis, dann bleibt nur eine monotone Folge muffig-grauer Säle, und der Park draußen vor den Fenstern versinkt in milchigen Nebelschwaden.
Kein Gang hinunter zur Orangerie, keine Promenade zum Drachenbecken — sein Wasser ist trübe, der Kies knirscht feucht unter den Füßen, Statuen werden zu klobigen Fremdkörpern.
Den vielen Hunderttausend Besuchern eines jeden Jahres jedoch scheint es gleichgültig zu sein, ob auf Versailles Sonne oder Regen fällt. Ihr Strom reißt nie ab, für sie ist Versailles die Pflichtlektion, der man das große staunende Bewundern schuldet.
Tag für Tag vollbringt dies Haus ein Wunder: Hunderte stehen vor seiner Fassade, doch nur die wenigsten wagen sich einzugestehen, wie gründlich sie dies vermeintliche Juwel barocker Baukunst enttäuscht, wie langweilig es doch ist, dies Schloss der Schlösser.
Von Paris her kommen die meisten. Sie haben ihren Wagen genommen oder die idyllische Vorortbahn, sie sind allein oder gehören zu jenen zahllosen Trupps, die als Reisegesellschaften in Omnibussen hinaus zum Schloss gekarrt werden. Vorn neben dem Chauffeur der Fremdenführer, über Mikrofon programmiert er seine Kundschaft, bevor überhaupt der Riesenbau in Sicht ist: künstlicher Hügel … Louis Quatorze Quinze Seize … Mansart … Le Notre … grand siècle … größtes Schloss der Welt …
Das Städtchen wird durchquert, in dem heute immerhin schon achtzigtausend Menschen leben. Hier liebt man das Schloss, hier lebt man von ihm. Das war schon immer so — in den Tagen der Könige, als deren Lakaien in den engen Gässchen die Überreste der königlichen Tafel zu guten Preisen verkauften, und auch jetzt, da zu nicht minder gutem Preis die Überreste eines Mythos feilgeboten werden: Cafés dienen ihren Gästen den »Blick aufs Schloss« an, Kioske quellen über von buntlackierten Souvenirs, der Handel blüht, das Geschäft rentiert sich.
Nach dem Einbruch der Großen Revolution war es gefährdet gewesen. Da hatten die Menschen dieser Stadt in den Schlossgärten rasch Obst und Gemüse gepflanzt, um den neuen Herren die Unentbehrlichkeit der Anlage zu beweisen. Die Rechnung war aufgegangen, das Schloss blieb unzerstört. Und auch jetzt noch scheint man unentwegt beweisen zu wollen, dass dieses Monument noch sinnvoll, seine Größe nicht tot, sein Mythos noch lebendig ist.
Einen »kleinen Menschen mit großen Armen und einem dicken Kopf« hatte es schon der große Colbert mit traurigem Spott genannt. Doch so sieht es nur, wer sich den beschwerlichen Weg von dem großen Gitter über das grobklobige Pflaster bis hinauf zu Marmorhof und Mitteltrakt nicht schenkt. Den Teilnehmern arrangierter Versailles-Ausflüge bleibt in der Regel diese Tortur erspart, sie werden seitlich in das Haus geführt wie neugierige Eindringlinge, die hier eigentlich nichts zu suchen haben und denen man nur rasch einen Blick auf all die Herrlichkeiten gönnen will.
Im Schloss dann die von Menschen überquellenden Räume, ein rascher Blick in die Kapelle, rascher Gang durch den Spiegelsaal. In Französisch, Englisch, Deutsch wird erklärt und kommentiert, verschiedene Sprachen, gleiche Worte, Geschichte zurechtgerührt zu belangloser petite histoire: Mangelnde Hygiene … barocke Illusionsmalerei … noch einmal mangelnde Hygiene, das kommt immer an, Kamine als Abort … Molière vielleicht und für Deutsche ganz sicher Liselotte von der Pfalz … ein bisschen Revolutionshorror noch, ein scheuer Blick auf die Schwelle, vor der 1789 die Gardisten der Königin hingemetzelt wurden …
Die Stimmen überlagern, die Sprachen vermischen sich, bis ein internationales Kauderwelsch bleibt, verwirrend und wirr. So lässt man sich vom Regen nicht abhalten, so flieht man schließlich hinaus in den Park, hinaus zur Großen Terrasse. Hier ist es kalt und feucht, doch still, und diese Stille braucht man jetzt, um die Eindrücke der letzten Stunden in sich aufgehen zu lassen — die Räume, die nicht wie Zimmer, sondern wie Dekorationen wirken, die Gänge und Treppen, seltsam leer trotz der darüberflutenden Menschenmenge …
Nicht schön, doch nützlich ist solch ein Versailler Regentag. Er meint es nicht gut, aber ehrlich mit diesem Schloss. Er zwingt zu dem Gedanken, wie es dazu hat kommen können, dass hier einmal der Mittelpunkt der Welt war. Und er zwingt zum kopfschüttelnden Resümee: In Versailles hat man also auch gelebt …
Keinem anderen bedeutenden Bauwerk der Geschichte dürfte so wenig mit kunsthistorischer Terminologie beizukommen sein wie diesem Versailles. Barock, Rokoko — das sagt noch nichts, das lenkt nur ab von seiner wahren Wesensart. Und auch seine Entstehungsgeschichte, auf den äußeren Ablauf reduziert, gibt allenfalls Anhaltspunkte und noch nicht die Erklärung des Phänomens Versailles.
Denn dies hier ist ein Phänomen. Oder auch: ein Mythos. So hat Versailles auf seine Zeit und auf seine Nachwelt gewirkt, auf Außenstehende und auf Dazugehörende — als mythisches Phänomen mit eigenen Gesetzen, die mit logischer Zwangsläufigkeit aus seinen Voraussetzungen hervorgingen, dann jedoch ihre eigene und unberechenbare Wirklichkeit gewannen und schließlich Herr wurden auch über den, der sie geschaffen hatte. Vergeblich haben seine Nachfolger versucht, diesen Mythos zu widerlegen, ihn auf ein normales Maß zurückzuführen — sinnlose Bemühungen. Mit einem Mythos leben hieß die Formel der französischen Politik, solange Versailles ihr Mittelpunkt war.
Schwer macht es der Mythos seinem Betrachter. Fassbar aus Stein gebildet scheint er sich zu präsentieren, entzieht sich jedoch wieder dem Augenschein, sobald man in seinem äußeren Bild nach dem einen erklärenden Ansatzpunkt sucht.
Das Phänomen gibt sich dem Fremden gegenüber offen und verbirgt doch zugleich seine innere Wahrheit, scheint ihn einzuladen und stößt ihn doch ab. Kein Indiz in den Räumen, kein Indiz auch das Denkmal des Erbauers, das ihm eine spätere Zeit im Schlosshof errichtet hat.
Dies also ist er: Ludwig XIV., Sonnenkönig, Herr von Versailles. Hoch zu Ross, den Arm ausgestreckt. Man folgt der Richtung, in die er weist, man begreift nicht, was diese Geste bedeuten soll. Dort ungefähr, wohin die steinerne Hand weist, müsste Paris liegen, ausgerechnet Paris, nach dem der wirkliche Ludwig nie eine Hand ausgestreckt hat. Im Gegenteil: Viele Impulse mögen am Anfang von Versailles gestanden haben, doch keiner war so deutlich, so eindeutig wie der eine: Fort von Paris …
Ein Haus für die Sonne
Fort von Paris
Paris. Ein Morgen wie viele, sehr früh. Hufschläge auf dem hohen Pflaster vor dem Schloss, Reiter, sie traben der Stadtgrenze entgegen.
Noch ist es kühl. Doch wenn erst die Sonne höher steht und mit ihr die große Hitze kommt, wird Schlammgeruch aus den Wallgräben aufsteigen und sich dumpf über die Häuser legen. Dann wird Paris unerträglich sein.
Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ist diese Stadt noch nicht die schimmernde Metropole künftiger Zeiten. Doch wurde sie bereits zur Groß-, zur Weltstadt. Noch klebt der Dreck des Mittelalters an den Mauern der winkligen Häuser und in den Ecken der finsteren Höfe. Doch schon ist dies Heimstatt für Hunderttausende. Schon kommt man aus allen Himmelsrichtungen hierher, doch nicht, um den seidigen Glanz des Wunders Paris zu bestaunen. Wer in dieser Zeit zu den Ufern der Seine aufbricht, will nicht das Amüsement. Der will allein das einträgliche Abenteuer, die große Beute, den raschen Gewinn.
Das Meer ist nicht weit, seine Häfen entlassen täglich Legionen trüber Kreaturen in das Binnenland. Viele finden sich in dieser Stadt wieder, suchen sich irgendwo unter den muffigen Brücken, in den Winkeln der Gassen ihren Unterschlupf. Sie dürfen sicher sein, bald auf ihresgleichen zu stoßen, und sie alle formieren sich zum anonymen Riesenheer der Gesetzlosen, der professionellen Gauner, Bettler, Mörder.
Dies sind die einen, die kleinen Abenteurer, die sich rasch in den Labyrinthen der Unterwelt verlieren. Die anderen aber, die großen Hasardeure mit den klingenden Namen und leuchtenden Wappen, brauchen für ihre Taten und Untaten kein schützendes Dunkel.
Was den einen der umrätselte »Hof der Wunder« ist, jenes gespenstische Asyl aller Recht- und Gesetzlosen seit den Tagen Ludwigs XI., sind den anderen die Gärten der Tuilerien und das Parkett des Louvre, dieser alten Königsburg aus dem dreizehnten Jahrhundert, die Franz I. für die Neuzeit bewohnbar zu machen, suchte und die doch nie recht fertig geworden ist. Nichts Einladendes haben ihre düsteren Gänge und Säle, doch bieten ihre Mauern immerhin vagen Schutz in unsicheren Zeiten.
Immer schon haben Frankreichs Könige versucht, vor Paris zu fliehen. Sie flüchteten sich an die hellen Ufer der Loire oder hinaus nach Fontainebleau, sie zogen ruhelos von Schloss zu Schloss, um doch immer wieder in diesen Louvre zurückzukehren. In diese Stadt, die ihre Hauptstadt ist und sich ihnen doch oft schon verweigert hat. Mächtige vor den verschlossenen Toren ihrer eigenen Kapitale — das gab es schon häufig in der Geschichte dieses Paris mit dem Wahlspruch: Fluctuat nec mergitur — mag es auch schwanken, es sinkt nicht.
Und es sinkt auch nicht, das ewig schwankende Schiff Paris. Doch wer auf ihm Kapitän sein will, braucht einen festen Schritt und eine harte Faust. Manche haben sie besessen: der düstere Ludwig XI., rattenhaft in die Bastille-Burg verkrochen … der helle, heitere Heinrich IV., dem Paris eine Messe wert war … auch sein Sohn, der ihm so unähnliche dreizehnte Ludwig …
Wer sich in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts noch an ihn erinnert, denkt an den ewig kränkelnden Greis, der dieser Mann schon mit vierzig war, bereits von einem frühen Tod gezeichnet, glücklos ein Leben lang: kaum Freunde, nur Neider, die Ehe zerrüttet, zwanzig Jahre kinderlos. Dann ein Wandel, so schien es: Geburt eines Sohnes, den man Louis-Dieudonné nennt, den von Gott gegebenen Ludwig.
Nur vermeintlich war er ein Gottesgeschenk. Längst war es zu spät, als dass die Geburt eines Dauphins Beginn einer neuen und fröhlicheren Zeit am Königshof hätte sein können. Schon erzählte man sich in den Gängen des Louvre: Nach der Geburt hatte der König seiner Frau die zeremonielle Umarmung verweigert. Schon wusste man in den Straßen von Paris: Der König hasste seinen kleinen Sohn, misstraute ihm, drohte der Mutter, das Kind ihrem Einfluss zu entziehen.
Weiter also blieben die Schatten über dem Haus dieses Königs, und es waren Schatten, die Namen trugen, Gesichter hatten.
Da war der König selbst: nicht der Narr, den viele in ihm sehen wollten, vielmehr ein Mann mit vernünftigen Vorstellungen und klugen Gedanken. Doch wollte er sie formulieren, so traten ihm die Worte nur stotternd über die Lippen. Wer war er überhaupt — trotz seiner Königskrone? Niemand wusste es so recht, niemand interessierte sich dafür, am wenigsten die Frau, die es hätte interessieren sollen. Denn sie war seine Frau, die Königin.
Mit fünfzehn hatte man die Schwester des spanischen Königs nach Frankreich geholt, eine Habsburgerin, die nun Königin von Frankreich wurde und sich Anna von Österreich nannte, die in ihrem Inneren jedoch immer nur das eine war: die Spanierin. Hass, Demütigungen, wachsende Isolation — das war ihr Schicksal am französischen Hof. Es änderte sich auch nicht mit der Geburt des so lange ersehnten Dauphin.
Wäre nicht der andere, der große Dritte in diesem unseligen Terzett gewesen, dann hätte vielleicht noch die Ehe zwischen Anna und Ludwig wenn nicht gut, so doch immerhin erträglich werden können. Dann hätte sich die Königin endlich davor sicher fühlen dürfen, eines Tages doch noch das Schicksal ihrer Schwiegermutter zu teilen, die dieser große Dritte mit einem Gleichmut in die Verbannung hatte schicken lassen, als hätte es sich bei Maria von Medici nie um eine Königin von Frankreich gehandelt.
Allgegenwärtig war dieser andere: erster am Hof, erster am Thron, erster bei jeder Entscheidung — Armand du Plessis, Herzog von Richelieu, Kardinal und Prinzipalminister Frankreichs, ein unberechenbarer Kalter, dessen schmale weiße Hände mit der gleichen Leichtigkeit irgendein Lustspiel konzipieren wie ein Todesurteil unterschreiben konnten.
Niemand am Hof, der ihn nicht fürchtete — am wenigsten der König selbst. Und doch hatte Ludwig zugelassen, dass die rote Eminenz zwei Jahrzehnte lang Frankreichs wahrer Herrscher wurde. Er brauchte diese Kraft, diese Unerschrockenheit, diese von keinerlei Skrupeln behelligte Intelligenz, denn was wäre er, was wäre Frankreich ohne das Genie Richelieu gewesen?
Misstrauen, Zweifel und Verzweiflung prägten den Hof Ludwigs XIII., und früh schon erfasste seine ausgedörrte Atmosphäre auch das Kind, das hier heranwuchs. Nichts aus dieser Zeit legt davon Zeugnis ab, dass dieser kleine Junge je mehr sein würde als ein allenfalls durchschnittlicher Mensch. Und doch war er dazu bestimmt, Frankreichs nächster König zu werden. Er war fünf, als er es wurde: Ludwig XIV.
Gestorben der Kardinal, dahin der König — im Laufe eines Jahres hatte der Tod das hasserfüllt ineinander verkrampfte Trio auseinandergetrieben. Zurück blieb die nun zweiundvierzigjährige Anna, längst nicht mehr das schöne Mädchen von einst, sondern eine verbitterte Frau an der Schwelle des Alters. Nur eine Chance blieb ihr noch, das große Defizit ihres Lebens auszugleichen. Sie nutzte sie. Paris, 18. Mai 1643.
Im Justizpalast hatten sich Frankreichs Große versammelt: die Vertreter des Parlaments, die hohen Geistlichen und Militärs, die höchsten Würdenträger. Hatten sie nicht noch vor einem Jahr einen Richelieu gefürchtet? War nicht erst vor wenigen Tagen Ludwig XIII. zu Grabe getragen worden? Jetzt erinnert man sich allenfalls noch an das »Es lebe der König!«, das die Zeremonie beschlossen hatte.
Sollte er nur leben, der neue kleine König. Er würde keinen stören. Höfliche Redner nannten ihn noch rasch das »Sinnbild Gottes auf Erden« und eine »sichtbare Gottheit«, dann wandte man sich der Tagesordnung zu, und an der kleinen Marionette rauschte vorüber, was sich die Mutter und ihre Verbündeten für die nächste Zukunft hatten einfallen lassen: Unter dem Zuspruch der Noblen des Landes wurde Anna Regentin mit absoluter Vollmacht.
Aber es gab doch ein Testament Ludwigs XIII., das der gesamte Hof und auch Anna feierlich hatten beschwören müssen. Und in diesem Testament war eindeutig davon die Rede, dass die Königinmutter zwar Regentin werden sollte, doch nur unter Vorbehalten und erheblichen Einschränkungen ihrer Macht.
Niemand interessierte sich an diesem strahlenden Maimorgen dafür, nichts zählte mehr der Wille eines Toten, das Leben hatte nach den Vorstellungen der Lebendigen weiterzugehen — eine üble Komödie, traurig und gemein. Sie blieb nicht die einzige dieser Jahre.
Bald schon sah man im Louvre ein neues Gesicht. Wieder schillerte eine purpurrote Robe neben dem Königsthron. Doch der nun den Kardinalsmantel wie auch den Rang des neuen Prinzipalministers mit viel Eleganz zu tragen wusste, war kein zweiter Richelieu. Vor allem war er kein Feind der Königin. Mochten es auch nur Gerüchte sein, nach denen sich die beiden heimlich hatten trauen lassen — ohne Zweifel jedenfalls war dieser Neue nun Frankreichs eigentlicher König.
Verächtlich hoben die anderen die Schultern. Wie hieß dieser seltsame Diener Gottes doch gleich? Ursprünglich Mazarini, doch dieser Condottiere der Diplomatie, der schon in mancherlei Ländern mancherlei Posten innehatte, strich mit liebenswürdiger Beiläufigkeit das letzte i aus seinem Namen und war von nun an der getreue Franzose Mazarin.
Groß war der Charme, mit dem sich der kluge Mann über das Parkett des Königshofs zu bewegen wusste, unendlich die Höflichkeit, mit der er einem jeden begegnete. Doch nicht bei allen hatte er damit den gleichen Erfolg wie bei der verliebten Anna. Mochte er auch mit noch so viel Geschick Frankreichs Adel umschmeicheln, so wurde doch rasch deutlich, dass man kein zweites Mal einen geheimen Herrscher über sich dulden wollte. Wozu schließlich die Beihilfe bei dem posthumen Betrug am verstorbenen Ludwig XIII.? Warum überhaupt hatte man sich zum Werkzeug Annas machen lassen? Etwa, um einem Mazarin den Weg zur Macht zu öffnen?
Nicht nur am Hof, auch in der Stadt, im gesamten Land gärte es: Immer höher waren die Steuern geworden, der Parvenü Mazarin jedoch galt als der reichste Mann Frankreichs und stellte diesen aus trüben Quellen stammenden Reichtum auch ungeniert zur Schau. Unkluge Gesetze waren zudem erlassen worden, die sehr nötigen Reformen in der Wirtschaft und Rechtsprechung blieben aus — und all diese Missstände, die zunehmende Armut und Verschuldung waren unschwer auf einen Nenner zu bringen. Der aber hieß Mazarin.
In dieser Situation genügte schon ein Funke. Lächerlich der Anfang jener Revolte, die dann schon bald unter dem Namen »Fronde« das Ausmaß einer Revolution erreichte: Ein populärer Parlamentarier war verhaftet worden, ein Rechtsbruch, von dem bald schon ganz Paris erfuhr. Am Hof glaubte man noch, sich darüber amüsieren zu dürfen, und sprach von einer »Nachttopfrevolution«, doch die Barrikaden, die auf einmal überall die Straßen versperrten, die vom Volk geschwungenen Piken und Gewehre hatten nicht die geringste Ähnlichkeit mit irgendwelchem Nachtgeschirr.
In diesem Augenblick hatte selbst die lustige Witwe im Louvre begriffen, dass der Thron in Gefahr war. Nun war Anna weder sehr intelligent noch sehr weitblickend in den Tagen des Glanzes gewesen, jetzt aber, im Moment der Gefahr, zeigte sie sich auch zu unverzüglichem Handeln fähig. Und sie handelte.
Am 7. Januar 1649 erfuhr das Volk von Paris, dass in der Nacht zuvor Regentin, König und Hof fluchtartig die Hauptstadt verlassen hatten. Das nun hatte niemand gewusst, niemand geahnt. Und doch traf es zu: Nicht im Louvre wollte die mutig gewordene Anna die weitere Entwicklung abwarten, sondern im Schloss von St. Germain.
Zu groß war das allgemeine Erschrecken, als dass irgendjemand die grimmige Ironie dieser Flucht nach St. Germain begriffen oder gar belächelt hätte. Und doch war es grotesk: Ausgerechnet am Lieblingsplatz ihres toten Mannes verbarg sich die Königin, die das gleiche St. Germain nach Ludwigs Ableben fluchtartig verlassen hatte, um nur recht schnell den Toten zu vergessen. Nun aber war sie zurückgekehrt und spürte fröstelnd die Schattenseiten der einst so gierig herbeigesehnten Macht.
Böse Monate für Anna, bitterböse für den kleinen König, der fror und in Lumpen ging, der oft hungern musste und auf Stroh zu schlafen hatte. Und das alles wegen eines Monstrums mit dem Namen Paris, das angeblich seine Hauptstadt war.
Oktober wurde es, bevor sich die Tore der Stadt wieder für die königlichen Karossen öffneten, und hoch war der Preis der Passage: Mehr Gefangene als Herrscher, lebten nun der König und seine Mutter im Louvre, kläglich scheiterten die ungeschickten Versuche der Königin, wieder die Macht von einst herzustellen. Mazarin aber hatte das Land verlassen müssen.
Und dann kam 1651 jene Winternacht, die Ludwig nie mehr vergessen sollte.
In der Stadt machten Gerüchte die Runde: Wieder wollte Anna fliehen, wollte sich und ihren Sohn vor den Parisern in Sicherheit bringen. Vor dem Louvre fand sich eine tobende Menge zusammen. Ein Schrei: Wo ist der König?
Hier war er, in seinem Schloss. Mitten in Paris.
Die Menge glaubte es nicht. Boten wurden ausgeschickt, sie sollten sich mit eigenen Augen überzeugen. Sie überzeugten sich: Der König war im Louvre.
Die Schreie gellten weiter. Der Pöbel von Paris hatte seine große Stunde. Ungehindert drang er in das Schloss, hastete die Treppen hinauf, beugte sich gierig über das Bett des Zwölfjährigen: Ja, es war der König, man konnte zufrieden sein. Aber man war es noch lange nicht.
Diese einmalige Stunde wollte ausgekostet sein, und immer neue Gesichter starrten auf den Schlafenden herab. Erst das Morgengrauen vertrieb die Letzten aus dem Haus des Königs, der nun erfahren hatte, was es auch bedeuten konnte, eine sichtbare Gottheit zu sein.
Welche Farce für den Dreizehnjährigen, wenige Monate nach dieser Nacht in umständlicher und feierlicher Zeremonie nach altem Brauch die Volljährigkeit zugesprochen zu bekommen! Welche Farce sein Auftritt vor dem Parlament, wie absurd die Rede, die er dort zu halten hatte! Und was für ein Hohn der Jubel in den Straßen, der Beifall der Pariser!
Dem jungen Ludwig brauchte niemand mehr seine Mündigkeit zu bestätigen. Er hatte sie in jener Schreckensnacht gewonnen. Und er bestätigte sie im Jahr darauf, als er auszog, nun wirklich König zu werden. Nur wenige Tausend Getreue folgten ihm dabei — weniger, als später seine Leibgarde umfassen sollte.
Wieder war die Revolte ausgebrochen, wütender und gefährlicher als je. Nun ging es nicht mehr darum, den König in Paris zu halten. Man wollte ihn endgültig vertreiben. Und schon schien dieses Ziel erreicht.
Die Hauptstadt in den Händen der Feinde, verschlossen die Tore vieler anderer Städte — wer war Ludwig noch? Eine Größe von vielen im aufbegehrenden Frankreich. Und gewiss nicht die, auf die sich noch zu setzen lohnte.
Und doch kam noch im gleichen Jahr der Tag, an dem Ludwig seiner Hauptstadt wieder entgegenreiten konnte und dabei sicher sein durfte, diesmal von keinen neuen Rebellen empfangen zu werden. Sie waren verjagt, geschlagen, waren wieder brave Diener ihres Herrn. Der Marschall Turenne, vor Kurzem noch gemeinsam mit dem Prinzen Condé ein Führer der Fronde, hatte sich in letzter Stunde doch noch auf die Seite der Krone gestellt. Seinen Truppen verdankte Ludwig Sieg und Thron.
Offen die Tore, Jubel in den Straßen. Bald darauf betrat auch Mazarin wieder französischen Boden — zweimal verjagt, zum zweiten Mal zurückgekehrt, nun wieder Prinzipalminister und unangefochten erster Mann im Staat.
Willig überließ ihm der König den Vortritt. Noch war die Zeit nicht gekommen, in der er selbst und nur noch er den Herrscher Frankreichs spielen konnte. Noch brauchte er seinen Premier, der in den kommenden Jahren den Höhepunkt seiner Macht erreichen sollte. Oft saßen sich in diesen Jahren Kardinal und König gegenüber. Immer war es der Jüngere, der den Älteren aufzusuchen hatte, und Mazarin erwies Ludwig nicht einmal die Ehre, ihn schon an der Treppe zu empfangen. In seinem Zimmer erwartete er ihn, und dann begannen die Lektionen in Sachen Politik. Und Ludwig hörte geduldig der schönen, durch den harten Akzent leicht entstellten Stimme zu, lernte.
Dann wieder ließ er den alternden, schon kranken Kardinal bei seiner Politik zurück, ritt hinaus aus Paris, dort die Erinnerungen zurücklassend, die er doch nie würde vergessen können und die jetzt schon den Weg weisen, den er einmal nehmen wird: der aufbegehrende Adel … das unberechenbare Volk … das Gefängnis, das Louvre heißt … die bewaffnete Macht, die ein Herrscher braucht, wenn er in Frankreich herrschen will…
Es sind vergnügte, lebensfrohe Ausflüge, die der junge Mann in diesen Jahren unternimmt. Klein die Zahl der Gefährten, alle jung wie er, zuweilen ist ein hübsches Mädchen dabei, Louise heißt sie, guter Kamerad unter Kameraden. In die Wälder um Paris führen die Ritte, Hirsche jagt man, hält schließlich ein Picknick ab, und der König fühlt sich wohl dabei, ist es doch immer die Weite, die freie Natur, die ihn anzieht, nicht die Enge einer Stadt. Und manchmal ist das Ziel dieser Ritte das Schloss, das in der Nähe eines kleinen Dorfes liegt und mit ihm den Namen teilt: Versailles.
Ein Schloss?
Um diese Zeit ist es kaum mehr als ein größeres Jagdhaus mit zwei Flügeln und vier kleinen Pavillons. Schmucklos karg die Front — vieles erinnert noch an die kleine Hütte, die hier früher einmal stand. Der dreizehnte Ludwig hatte sie oft aufgesucht, Versailles war schließlich einer der Lieblingsaufenthalte des einsamen Monarchen geworden, und schließlich hatte er die Hütte durch diesen kleinen Bau ersetzt.
Ein seltsamer Ort, dieser kleine Hügel mit dem Schlossbau auf seiner Spitze — wenn man die Linien seiner Konturen fortführt, entsteht das Bild einer Anlage, wie sie hier eines Tages geschaffen werden wird: Ein Haus in der Mitte, unermessliche Gärten, alles klar, übersichtlich, Mauern, die in Alleen übergehen, Alleen, die sich am Horizont verlieren — Platz für Hunderte, vielleicht Tausende, Platz auch für nur einen, um den die Tausende kreisen wie die Planeten um die Sonne. Raum genug ist vorhanden, alles könnte von Grund auf neu entstehen. Und Paris, der Louvre liegen weit hinter dem Horizont, dürfen versinken, vergessen werden.
Träume nur, wahnwitzige Illusionen, hätte sie jemand in den Jahren vor 1660 geäußert. Sand und Sumpf erstrecken sich um das kleine Schloss von Versailles, sie tragen vielleicht ein Jagdhaus, doch nie einen Riesenbau, der größer als der Louvre, größer als alle anderen Schlösser in Europa sein müsste. Viel später wird der Herzog von Saint-Simon Versailles den »traurigsten und reizlosesten aller Orte« nennen, und so sehr persönliche Ressentiments dieses böse Wort diktieren — es dürfte in der Tat schwierig sein, einen Ort zu suchen, der so ungeeignet für das größte Schloss aller Zeiten ist wie die Nachbarschaft des armseligen Dörfchens Versailles.
Doch wer immer dieser junge Mann ist, der sich schon König nennen darf, ohne König zu sein: Er wird noch in mancher Hinsicht seine Zeit das Staunen lehren. Und die Szenerie, vor der er sich dann bestaunen lässt, wird eben dies Versailles sein.
Der lange Weg nach Versailles
Dies also ist Ludwig, vierzehnter seines Namens und dritter Bourbon auf Frankreichs Thron: um diese Zeit noch der eher unauffällige junge Mann von angenehmem Äußeren, an dem auch aufmerksame Beobachter nichts Ungewöhnliches entdecken können.
Es ist in der Tat nur wenig Außerordentliches um den jungen Ludwig. Er verspricht, einer jener redlich-blassen Herrschergestalten zu werden, die ihr Land für einige Jahre mit Anstand regieren, um dann wieder im großen Sog der Geschichte unterzugehen.
Doch dieser Ludwig wird etwas ganz anderes: Frankreichs grand monarque, der König schlechthin. Und so nachhaltig prägt sein Bild das Bewusstsein der Franzosen, dass nichts mehr seine Spur verwischen wird — kein schwacher oder starker Nachfolger, keine Große Revolution, kein erster bis dritter Napoleon, keine dritte bis fünfte Republik. Und das, obwohl er nur in den allerersten Jahren seiner Regierungszeit im eigentlichen Sinn populär war und sich die Grenzen seines Ruhms bereits zu seinen Lebzeiten abzeichneten. Wie das Schloss, das er schuf als steinernes Sinnbild seiner selbst, ist dieser Mann ein Phänomen. Und beschwört man sein Bild, so erfasst den Betrachter das gleiche Staunen wie vor der Fassade von Versailles. Was nur hat bewirkt, dass gerade er, bar der persönlichen Strahlkraft etwa eines Bonaparte, zu einer Zentralgestalt nicht nur der französischen, sondern der europäischen Geschichte schlechthin werden konnte? Sein Äußeres, seltsam gleichbleibend sein überlanges Leben lang, gibt darüber ebenso wenig Auskunft wie das Äußere des heutigen Versailles.
Zweierlei Indizien seien immerhin vorweggenommen:
Ludwig war wenn schon kein großer Mann im Bilderbuchsinn, so doch ein großer Schauspieler mit all dem Instinkt eines jeden großen Schauspielers für den großen Effekt.
Und er hatte das Glück, eine Rolle zu spielen, deren Erfolg bereits vorgeformt war. Für sie nun hatte dieser Mann alle mimischen Mittel zur Verfügung. Nicht er selbst schrieb sich seinen Text — an solcher Aufgabe wäre er gescheitert. Doch er sprach ihn, als sei er nur für ihn verfasst — diese Aufgabe war ihm gemäß.
Um dies nun zu verstehen, muss zum Ursprung dieser Rolle zurückgegangen werden, zurück bis zu dem Zeitpunkt in Frankreichs Historie, an dem ein nun schon neunzig Jahre dauernder Krieg Frankreich verwüstet hatte und ein junges Mädchen aus Lothringen ihr heimatliches Dorf verließ, um ihrem König zu versichern, er und nur er sei des Landes legitimer Herrscher. Sie aber, das Bauernmädchen, würde ihn nun seiner rechtmäßigen Krönung in der Kathedrale zu Reims entgegenführen. Denn Frankreich müsste wieder ein Land unter dem einen wahren Herrscher werden.
Es war das fünfzehnte Jahrhundert, in dem diese für jene Zeit wahrhaft revolutionären Worte fielen.
Denn der 1339 zwischen den Kronen Frankreichs und Englands ausgebrochene Krieg war in seinem Kern so recht ein Relikt des Feudalismus gewesen, bei dessen Kriegen es nicht um Völker oder gar Ideen ging, sondern allein um private Interessen einzelner Mächtiger.
Über Jahrzehnte hatte sich das Völkerschlachten hingeschleppt. Es hatte keine spektakulären Siege gegeben und keine entscheidenden Niederlagen, und all die Last hatten jene zu tragen, die immer die Opfer eines Krieges sind — die Bürger in den immer wieder von Neuem zerstörten Städten, die Bauern auf ihren unentwegt verwüsteten Feldern. Solche Zeiten haben immer schon das Revolutionäre im Bewusstsein der Menschen provoziert und ihre latenten Sehnsüchte an die Oberfläche gespült. Im Frankreich des Hundertjährigen Kriegs war es der Nationalismus. Die Zugehörigkeit zu einem Volk und nicht mehr der Gehorsam gegenüber einem Herrscherhaus bestimmte von nun an das politische Verhalten des einzelnen Franzosen.
Die das aber bewirkte, war eben jenes Mädchen aus dem Dorf Domremy, das von himmlischen Stimmen den Auftrag erhalten haben wollte, Frankreich von seinen Feinden zu befreien.
Um nur wenige Frauengestalten der Weltgeschichte spinnt sich das Netz der Legenden so dicht wie um die der kleinen Jeanne d’Arc. Doch nicht, wer nun diese rührend fromme Amazone wirklich gewesen ist, braucht jetzt zu interessieren, sondern allein die Wirkung auf die französischen Menschen ihrer Zeit.
Es ist noch immer nicht leicht, eine Erscheinung wie Jeanne d’Arc ohne Emotion zu betrachten. Eben hierin lag ihre Stärke. Doch löst man sich von allem Mitgefühl für die kleine Heilige, so erscheint ihr Weg als eine Folge lauter sehr schöner, sehr rührender, zuweilen etwas überspannter und törichter, doch stets großer Gesten:
ihr spektakulärer Ritt zum französischen Dauphin;
ihr Auftritt vor dem verängstigten und seiner Macht fast schon gänzlich beraubten Repräsentanten des Hauses Valois;
ihr großer Sieg vor Orléans;
der Zug durch das allmählich wieder Mut fassende Land; die Krönung in Reims, Jeanne im Hintergrund mit der weißen Fahne in der Hand;
dann ihre Gefangennahme und der schändliche Prozess mit dem von vorneherein festgelegten Ausgang, den Jeanne mit der Gelassenheit einer wahrhaft Glaubenden auf sich nahm;
die letzte und größte Geste schließlich: der tapfer ertragene Flammentod.
Noch heute fügt sich dies alles zu einem Bilderbogen von anrührender Kraft. Doch wie erst wirkte das in jener Zeit auf ein schon müdes, seit Jahrzehnten geschundenes Volk! Mochten die Engländer Jeanne als Hexe verbrennen lassen — für die Franzosen war sie von nun an für alle Zeiten die gute und reine Verkörperung Frankreichs, Vorreiterin einer Zeit, in der es nicht mehr um die Querelen weniger Mächtiger ging, nicht um Erbansprüche, Kronrechte und politische Finten, sondern allein um Frankreich. Jeannes große Gesten hatten sich zum ersten nationalen Mythos summiert.
Ihn nutzte vor allem einer: der zu Reims gekrönte Karl VII., als Persönlichkeit ebenso unerfreulich wie Jeanne erfreulich, ein Opportunist und Intrigant, am Tod der kleinen Heiligen kaum weniger schuld als ihr Henker. Doch zugleich der Mann, der nach ihrem Ende mit großem politischen Instinkt seine Gegner gegeneinander auszuspielen verstand, den Krieg zu Ende führte und Reformen einleitete, die seinem Land eine starke und erfolgreiche Zukunft brachten.
Ein Staatsmann von Format also — und wenn er sich von seiner Retterin abgewandt hatte, als erstmals nicht sie ihm, sondern er ihr behilflich sein musste, so ist darin nicht nur Charaktermangel zu sehen. Eher schon wusste dieser Karl sehr genau, worin Jeannes Kraft lag: nicht in ihr selbst so sehr, sondern vielmehr in der Legende, die sich um sie gebildet hatte. Grausam, doch logisch die Konsequenz im Augenblick der Gefangennahme Jeannes, als für den französischen König noch die Möglichkeit bestand, sie mit Lösegeld zu retten: Eine tote, dazu noch den Märtyrertod gestorbene Jungfrau von Orléans musste ungleich stärker wirken als die lebende, deren militärischer Ruhm ohnehin schon zu verblassen begann. Die Rechnung war grausig, doch ging sie auf: Jeannes Tod wurde zum Fanal, seine Sühne nationales Anliegen. Und die französische Krone trug von nun an eine Gloriole, blieb verbunden mit dem nationalen Mythos Jeanne. Der Monarch und sein Land waren von nun an eine Einheit, und diese Einheit hat niemand so vollkommen repräsentiert wie zwei Jahrhunderte später der Sonnenkönig vor dem Hintergrund von Versailles.
Doch ein Konflikt musste noch ausgetragen sein, bevor ein nationaler Herrscher wie Ludwig XIV. möglich war: die Auseinandersetzung zwischen Krone und Adel, zwischen dem Gestern des Feudalismus und dem Morgen des Absolutismus. Wer war der König von Frankreich — Primus inter Pares, allenfalls, inmitten der großen Adelshäuser? Oder uneingeschränkter Herr?
Der Niedergang des Hauses Valois sowie die religiösen Differenzen im sechzehnten Jahrhundert brachten die Entscheidung. Von Deutschland her war das Gedankengut der Reformation nach Frankreich gekommen und hatte den Adel in zwei Parteien gespalten, denen der konfessionelle Gegensatz willkommener Anlass zum Kampf um die Macht war. Aus ihm ging als Sieger ein Hugenotte hervor, der Katholik geworden war: Heinrich IV., Großvater Ludwigs XIV. und erster Bourbon auf dem Thron.
Zutiefst zerrüttet war das Frankreich, das er von nun an zu regieren hatte, und groß war die Aufgabe, die sich dem neuen Herrscher stellte: dem aus den Fugen geratenen Land wieder den Frieden zu bringen und der französischen Krone den alten Glanz zurückzugeben. Er erreichte das eine wie das andere und eröffnete damit für die Monarchie die letzte Phase ihres Wegs zur absoluten Macht.
So logisch war nach dem Erscheinen dieses einen Mannes die Entwicklung, dass alle folgenden Ereignisse etwas von einer wohleinstudierten grande comédie an sich haben.
Pünktlich treffen die Akteure auf der Szene ein, haben Auftritt und Abgang, zuweilen verspätet sich der eine oder andere Star, oder dieser und jener Chargenspieler versucht, die Protagonisten an die Wand zu drängen — geringfügige Unebenheiten des großen Spiels, die im Parkett kaum auffallen. Und zum Schluss formiert sich alles zum großen Tableau, dessen Kulisse Versailles heißt. Nie wäre sie errichtet worden, hätte nicht jenes große Spiel stattgefunden.
Mit dem ersten Hauptdarsteller hat zugleich auch der sympathischste die politische Bühne betreten: eben der Bourbone Heinrich, der nicht nur ein großer, sondern auch ein guter König wurde — Frankreichs bon roi.
Nie zuvor und nie mehr danach hat das Land einen ähnlich volkstümlichen Monarchen besessen. Liebenswürdige Anekdoten begleiteten seinen Lebensweg von der Stunde seiner Geburt an, so ergiebig war dafür die Persönlichkeit dieses Mannes mit seinem fröhlichen Humor und vergnügten Sarkasmus. Unerschöpflich schien seine Vitalität und bewahrte doch immer die irdische Dimension. Und so stark leuchteten die Farben seiner Aura, dass das Bild vom guten König Heinrich selbst die Revolution von 1789 überdauerte.
Ein so verklärtes Bild kann sich natürlich nicht mit der historischen Wirklichkeit decken. Ein nur edler, nur witziger und liebenswerter Heinrich hätte kaum das politische Geschäft mit so viel Bravour durchgestanden. Doch nimmt man alles nur in allem, so war er ein Mensch, der gern und gut lebte und dabei genügend Verstand besaß, um sich zu sagen, dass in einer wirren Welt voll Blut und Elend kein gutes Leben lange währen könnte. Und wenn man diesen Mann während der Glaubenskriege nicht weniger als dreimal seine Konfession wechseln sieht, so ist auch dies kein Bruch in seinem Charakter, sondern nur Bestätigung einer undogmatischen, allein am Hier und Heute orientierten Denkweise.
Dennoch muss Heinrichs Aufstieg zum bon roi erstaunen, denn nach dem Tod des letzten Valois-Monarchen im Jahr 1589 wies zunächst kaum etwas darauf hin, dass der Hugenotte Heinrich überhaupt je König werden würde. Die Katholische Liga befand sich auf der Höhe ihrer Macht, das Ausland hielt sich bereit, seinerseits im großen Spiel um die Krone Frankreichs mitzumischen, und seit den Tagen des Hundertjährigen Kriegs stand das Land nicht mehr so kurz davor, die nationale Autonomie zu verlieren und zum Schlachtfeld fremder Interessen zu werden.
Und wieder bewährte sich der Mythos um Frankreich als Nation: Gerade die Bedrohung jenseits der Grenzen trieb die Entwicklung für Heinrich voran. Immer häufiger konnte er nun hören, dass man ihn als König akzeptieren würde, hätte er nur den rechten Glauben. Dies aber hatte Heinrich noch nie eigens erklärt werden müssen.
1593 war es soweit. Zum dritten Mal in seinem Leben wechselte der Bourbon die Konfession und entschied damit über den Ausgang des Kriegs. Den Frieden allerdings musste er noch gewinnen. Doch auch das gelang ihm, als er 1598 das Toleranzedikt von Nantes unterzeichnete und damit den vierzigjährigen Glaubenskrieg beschloss. Es war ein Dokument der Toleranz und Menschlichkeit, politisch jedoch von größter Gefahr für die Zukunft. War doch Heinrich mit seinen Zugeständnissen gegenüber seinen alten hugenottischen Mitkämpfern sehr weit gegangen und hatte den Anhängern Calvins fast schon den Status einer eigenen Nation zugebilligt. So war damals schon vorauszusehen, dass hier einmal ein Wandel kommen müsste. Es war der Enkel, Heinrichs, der ihn dann vollzog — mit einer Gründlichkeit, vor der der Großvater erschauert wäre.
Zunächst jedoch schienen Frankreichs Horizonte wieder frei von den Wolken der Vergangenheit, und ein Jahrzehnt konnte beginnen, das späteren Generationen als ein goldenes, als die gute alte Zeit schlechthin erscheinen sollte.
Heinrich hatte große Pläne für sein Land. Dem ausgebluteten Frankreich wollte er frische Kraft zuführen, seine Grenzen neuen Industrien öffnen und damit der Wirtschaft neue Quellen erschließen. An Kolonien und Handelskompanien dachte er und begrüßte lebhaft die Besiedlung Kanadas. Diesen Ambitionen jedoch sollte sich ausgerechnet der Mann entgegenstellen, dem im Übrigen die französische Wirtschaft nach Jahrzehnten der Malaise ihren Aufschwung noch mehr verdankte als dem König: der Herzog von Sully, einer der ältesten Kampfgefährten Heinrichs und oft das Korrektiv für das impulsive Handeln seines Herrn.
In mancher Hinsicht erinnert Sully bereits an den großen Colbert. Fehlte ihm auch das überragende Genie des Finanzministers eines Ludwig XIV., so verstand doch auch er sich auf langwieriges und zähes Rechnen, durch das allmählich das immense Defizit in der Staatskasse ausgeglichen wurde. Zutiefst konservativ, hielt er jedoch hartnäckig — hierin wiederum das krasse Gegenteil Colberts — an seinem Bild von Frankreich als einem Agrarstaat fest, und nicht schön, doch plastisch beschwor er Ackerbau und Viehzucht als die »Nährbrüste der Nation«. Es war der einzige Gegensatz zwischen dem König und seinem treuesten Diener.
Aus Sullys Memoiren erfahren wir auch Heinrichs geheimste Visionen für die künftige Außenpolitik. Von einem völlig neu geordneten und geeinten Europa liest man dort, und doch muss angenommen werden, dass der Herzog hier seinem König Gedankengänge unterstellt, denen in Wahrheit er selbst nachhing. Denn soweit Heinrichs außenpolitisches Konzept überschaubar war, so blieb es ganz in den Grenzen und Möglichkeiten seiner Zeit und war frei von visionärem Aufschwung.
Alles war darauf ausgerichtet, Frankreichs Stellung weiterhin zu festigen und eine mögliche Vorherrschaft auf dem Kontinent durchzusetzen, wenn erst das noch immer mächtige, in Spanien und Österreich stark etablierte Geschlecht der Habsburger geschwächt sein würde.
Er war eben die’ Politik, die dann ein Richelieu, die auch und vor allem Ludwig XIV. fortsetzen sollte.
Heinrich IV. hingegen blieb für entscheidende politische Taten keine Zeit mehr. Ausgerechnet der bon roi fiel einem Attentat zum Opfer, das am 10. Mai 1610 ein Leben beendete, wie es bunter, erfolgreicher und auch grotesker kein anderer französischer Monarch geführt hat. Heinrich wurde Legende, sein persönliches Prestige ein gar nicht zu überschätzendes Erbgut für die französische Krone — für Frankreichs Weg war jedoch eines entscheidend: Dieser König hatte ihm endgültig die Richtung gewiesen und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wieder die Monarchie und nicht ihre Vasallen erste Macht im Staat war.
In Heinrichs Persönlichkeit war für die französische Nation das Mittelalter überwunden worden. Die veränderten Dimensionen der Neuzeit bestimmten von nun an ihr Geschick. Dafür hatte dieser Mann die Pläne gezeichnet und den Boden abgesteckt. Ein anderer musste die Fundamente legen.
Dieser andere hatte in Heinrichs Todesjahr seinen ersten Auftritt schon hinter sich. Vorläufig bewegte er sich jedoch im Hintergrund der Szene. Noch war er lediglich der unbedeutende Bischof von Lucon, doch schon ließ manches auf die künftigen Ziele des begabten Herrn von Richelieu schließen. Wer ihn kannte, wusste auch, mit welcher Inbrunst er darauf wartete, aus der Provinz in das Zentrum der Macht vorzustoßen.
Doch wer kannte ihn schon?
Zahlreich waren die Gesichter, die er seiner Umwelt zeigte:
Da war zunächst der kühle, stets gelassene und korrekte Kirchenfürst, an dem jede Emotion abzuprallen schien.
Andere wiederum berichteten, dass dieser so frostige und beherrschte Mann im Grunde ein Kranker war, depressiv und jähzornig zugleich.
Dritte jedoch wussten von einem liebenswürdigen, geistreichen und aufgeschlossenen Richelieu, der großes Verständnis für Kunst und alles Schöne besaß.
Einig waren sich alle nur in einer Hinsicht: Dieser so rätselvolle, gleichermaßen gewinnend wie abstoßend wirkende Mann wollte um jeden Preis Karriere machen.
Er machte sie.
Lange brauchte er, um alle Etappen des gewählten Wegs hinter sich zu bringen, doch der Vierzigjährige bewegte sich dann in einer Höhe, wie sie vor ihm noch kein anderer erreicht hatte. Nun Kardinal und Herzog, Prinzipalminister und Pair von Frankreich, regierte er uneingeschränkter als je ein König über das Land, und ohne Schranken war auch der Prunk, mit dem er sich in aller Gelassenheit umgab. Nicht einmal der König trieb ähnlichen Aufwand wie sein Prinzipalminister.
Aber mehr, viel mehr hatte Richelieu erreicht als nur die äußerste Macht für die eigene Person. Frankreich trug von nun an seinen Stempel, es war zu seiner Schöpfung geworden und sollte es über seinen Tod hinaus auch bleiben — ein Staat, an dessen Spitze nur noch Raum für einen einzigen war.
Mit einem Heer von Spitzeln hatte der Kardinal das Land überzogen, sie hatten darüber zu wachen, dass alles nur dem einen untergeordnet war: dem Staat. Unter Richelieu war er zum Selbstzweck geworden.
Was war das für ein Mensch, der dies alles in relativ kurzer Zeit erreicht hatte?
Unmöglich scheint es noch immer, für diesen außerordentlichen Charakter schlüssige Kategorien zu finden. Kaum ein Attribut gibt es, das ihn uneingeschränkt bezeichnet. Alles fließt in dieser Natur ineinander, und niemand kann auch sagen, wo bei Richelieu das Interesse für den Staat aufhörte und krasser Egoismus einsetzte, wo seine Brutalität der Krone diente oder der eigenen Karriere, wo dieser Mann ein Diener war und wo der Herr. Er hätte keine Feinde, lautete sein maliziöses Motto, es seien immer nur die Feinde des Staates. Und dieser Staat war er.
Der Weg zu solcher Machtfülle war ihm von seinem König nicht leicht gemacht worden, und Ludwig XIII., Sohn Heinrichs IV. und der Maria Medici, hatte lange gebraucht, um seine tiefe Skepsis gegenüber den mannigfaltigen Talenten des Herrn Richelieu zu überwinden. Dann aber ließ er sich umso gründlicher die Macht aus den ohnehin nicht sehr starken Händen winden, bis schließlich der Kardinal Herr auch des Königs war. Und ohne Ehrgeiz für den persönlichen Ruhm setzte Ludwig XIII. bereitwillig Rang und Namen unter alles, was sein Herr für ihn und die Krone erdachte, plante, schuf.
Was Richelieu vor allem schuf, war die Voraussetzung für Frankreichs künftige Rolle als führende europäische Macht in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts. Begünstigt wurden dabei seine Ziele durch den großen Krieg, der zwischen 1618 und 1648 drei Jahrzehnte lang Deutschland zum Schlachtfeld europäischer Interessen machte.
Richelieu mied dabei das unmittelbare Engagement und griff erst zu, als die Erfolge sicher waren. Zu direkterer Offensive zwang ihn seine Spanienpolitik, und wenn hier auch die endgültigen Entscheidungen erst nach seinem Tod fallen sollten, so wurde doch schon zu seinen Lebzeiten deutlich, dass Frankreichs König und nicht die schwächlichen Nachfahren des Spaniers Philipp II. als Sieger hervorgehen würde.
Vorbedingung für diese weit ausgreifende Außenpolitik war eine weitere Festigung der inneren Lage Frankreichs. Richelieu erreichte sie auf zweierlei Art.
Zum einen bemühte er sich um eine intakte Wirtschaft und eine neue, der unmittelbaren staatlichen Kontrolle unterworfene Verwaltung. Auf beiden Gebieten hatte der Kardinal ganz sicher nicht das Genie Colberts oder auch nur Sullys Talente, doch sein Verständnis vom Staat als der allein dominierenden Macht führte ihn zu Einsichten und Maßnahmen, die das starre soziale Gefüge des alten Frankreich für neue Erkenntnisse durchlässig machten.
Vor allem aber beseitigte Richelieu die überkommenen Machtverhältnisse des Feudalismus, der wohl ausgeschaltet schien, aber noch vorhanden war.
Immer noch hatten die Großen von gestern in der Nähe des Throns verharrt, geblendet von der Strahlkraft Heinrichs IV. und doch bereit, den alten schwelenden Ehrgeiz wieder aufbrechen zu lassen. Sie alle erfuhren nun, wie ein Richelieu mit ihnen umsprang.
Nicht das geringste Erbarmen und keinerlei Schwäche zeigte er, als er nun die Macht der großen Familien zerbrach, sie demütigte und zu Komparsen an der Peripherie degradierte. Hinter den Richtblöcken warteten schon die Henker, der Herzog von Montmorency war der erste, der diesen Weg zu gehen hatte, und eine lange Reihe erlauchter Verurteilter musste ihm folgen. Und auch nicht des Königs unmittelbare Umgebung wurde verschont, nicht sein Günstling Cinq-Mars, der den hübschen Kopf unter das Beil zu legen hatte, nicht sein Bruder Gaston, nicht seine Mutter, die beide in die Verbannung gehen mussten. Und wäre es aus irgendeinem Grund nötig gewesen, zur höheren Ehre des Staates auch den König zu beseitigen, so wäre ein Richelieu auch vor dieser Konsequenz nicht zurückgewichen.
Der Staat um des Staates willen — das war sein Ziel, das auch hat er erreicht. Und so mächtig dadurch auch die Krone wurde, so brachte diese Abstrahierung der Staatsidee noch etwas anderes und nicht Ungefährliches mit sich.
Seit Richelieu war der unmittelbare Kontakt zwischen Herrschern und Beherrschten unterbrochen. Das individuelle Moment der Monarchie, worauf nicht zuletzt ihre Stärke beruhte, war nun getilgt, und es war nicht Zufall oder Mangel an Persönlichkeiten, dass Frankreich nie mehr einen Volkskönig wie Heinrich IV. besaß.
In einem derart perfekt organisierten Staatswesen wie dem Richelieus war die letzte Instanz nicht mehr der einzelne, sondern die Institution, und an dem Einzelnen lag es lediglich, mit welcher persönlichen Geschicklichkeit er die Macht der Institution zu der eigenen machte. Und so souverän und ganz von der Persönlichkeit des Königs her lebend sich auch später das Regiment Ludwigs XIV. ausnahm, so war doch auch er schon kein König mehr im alten Sinn, sondern der königliche Funktionär einer in ihrer letzten Ausprägung abstrakten Macht.
Dies war der eine große Unterschied zwischen der Ära Richelieu und der Zeit eines Heinrich IV.:
Der bon roi hatte den Kampf um die Macht in Frankreich zugunsten einer Dynastie entschieden. Richelieu entschied ihn zugunsten des Staates. Damit war das Fundament für eine zentralistisch und absolut geführte Regierungsform gelegt. Sie brauchte nur noch den Mann, der sie — repräsentierender Monarch und lenkender Funktionär in einem — auf dem geschaffenen Fundament praktizierte. Dieser Mann war Louis Quatorze.
Sein Auftritt verspätete sich. Zwei Jahrzehnte vergingen zwischen dem Tod Richelieus und Ludwigs XIV. Regierungsbeginn. Die Lücke füllte mit geschmeidig funkelndem Charme der Italiener Mazarin, Protegé und Vorzugsschüler des Großen Kardinals. Kardinal war auch er, doch sonst verband ihn zumindest äußerlich nur wenig mit seinem Lehrmeister. Gab sich Richelieu unnahbar, hochfahrend und brutal, war sein Intellekt von kristallener Härte gewesen, so trat nun Mazarin bescheiden bis zur Unterwürfigkeit auf, es sei denn, er meinte, sich die herrische Attitüde leisten zu können. Dann allerdings stand er seinem Vorgänger an skrupelloser Energie nicht nach.
Er war überhaupt ein seltsamer Mann, der Kardinal Mazarin, der gegen ihn gemünzte Spottverse beschlagnahmen ließ, um sie dann heimlich und mit hohem Gewinn weiterzuverkaufen: eine erstaunliche Mischung aus Noblesse und Niedrigkeit, aus Verstand und Verschlagenheit, Großmut und Geiz. Für den französischen Adel war er jedoch nur eines: der Fremde, dessen sich zu entledigen auch wieder der Beginn eigener Macht sein würde. Denn auf dem Thron saß ein Kind, der Knabe Ludwig XIV.
Es kamen die Jahre der Fronde, die jenes Kind so unauslöschlich beeindrucken sollten — der Versuch einer Revolution, in der reaktionäres und fortschrittliches Gedankengut ineinanderflossen und eine ungute Mischung ergaben.
War es noch in ihrer ersten Etappe, der Fronde des Parlaments, um ernsthafte soziale Fragen wie niedrigere Steuern, Immunität von Parlamentsmitgliedern und höhere Gerechtigkeit in der Justiz gegangen, so geriet die zweite Etappe, die Fronde der Prinzen, ganz und gar reaktionär. Es war der allerletzte große Waffengang zwischen Feudalismus und Absolutismus, und die Krone siegte total: entmachtet die Prinzen, an ihrer Spitze der Prinz von Condé, entmachtet auch das Parlament.
Vor seinen Vertretern hatte der junge König seinen ersten Auftritt, der schon den ganzen Ludwig enthielt und alle hätte warnen müssen, die in ihm um diese Zeit noch die Kreatur Mazarins sahen, einen Schattenkönig in der Art seines kraftlosen Vaters:
»Dem Parlament ist es für immer untersagt, Kenntnis von allgemeinen Staatsgeschäften zu nehmen und sich um das Finanzgebaren zu kümmern. Es hat kein Recht, irgendetwas gegen jene, die die Leitung dieser Angelegenheit innehaben, zu unternehmen oder zu befehlen.«
Dies ist nicht nur ein »Wehe den Besiegten!«. Dies ist ein Programm. Und nach ihm wird von nun an der König handeln, auch wenn er noch für einige kurze Jahre seinem verdienten Premier Mazarin den Vortritt und ihn sein politisches Hauptwerk zu Ende führen lässt: den Frieden zwischen Spanien und Frankreich nach jahrzehntelangem Ringen und seine Besiegelung durch die Heirat Ludwigs XIV. mit der spanischen Infantin Maria Theresia, die dem französischen Monarchen eines Tages das Anrecht auf die spanische Krone öffnet. Es war der größte und letzte Triumph Mazarins. Danach aber tritt er ab, und die Szene öffnet sich für den jungen Monarchen.
Fasziniert werden Frankreich und schließlich ganz Europa sehen, mit welcher Selbstsicherheit dieser junge Mann nach der Macht greift und zum bedeutendsten Herrscher seiner Ära wird. Und bald schon wählt man nicht nur aus Devotion, sondern aus innerer Überzeugung die höchsten Prädikate für das Phänomen Ludwig XIV. »Louis le Grand« — so verkünden es noch heute alte Inschriften. »Louis le Grand« — so schält es sich aus den Schnörkelwolken zeitgenössischer Gemälde heraus. Louis le Grand — Ludwig der Große …
Doch nicht allzu lange nach seinem Tod teilen sich wieder die Weihrauchwolken. Der Blick wird wieder frei für eine realistischere Einschätzung der Bedeutung dieses Herrschers. Und man nimmt dem Sonnenkönig das Prädikat der Größe, man ordnet ihn wieder als vierzehnten in die Reihe seiner Vorgänger und Nachfolger ein. Seine Zeit jedoch trägt seinen Namen, bleibt die Epoche Ludwigs XIV.
Dies Urteil ist gerecht. Denn Ludwig war nun einmal kein »Großer« — kein Genie wie vor ihm Richelieu und später Bonaparte. Er besaß nicht einmal das persönliche Format und die souveräne Intelligenz seines Großvaters Heinrich.
Was am Anfang seiner Laufbahn steht, ist das Glück, für die richtige Stunde der rechte Mann zu sein.
Frankreich war reif für einen Herrscher wie ihn. Es brauchte den Methodiker, der mit unbeirrter Gelassenheit das Gegebene sichtet und daraus für sich und sein Land den höchsten Nutzen zieht. Kein ungestüm vorwärtsdrängendes Temperament ist dafür Voraussetzung, sondern eben die spezifischen Eigenheiten Ludwigs: sein fast naiver Egoismus, seine nüchterne Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Macht, die sie ihm nie zum Problem werden lässt. In den letzten Jahren seines Lebens wird auch er die Einsamkeit der Mächtigen erfahren. Doch auch dann noch bleibt der alte Mann von Versailles ein ganz untragischer Charakter. In Ludwigs Politik findet sich kaum ein Moment, das auf besonders originelle Denk- und Verhaltensweisen hindeutet:
Seine Außenpolitik folgt der Spur eines Heinrich, Richelieu, Mazarin und wird in dem Augenblick vom Erfolg verlassen, als sie die Möglichkeiten dieser Vorgänger überschreitet; die Degradierung der einst so mächtigen Vasallen zu marionettenhaft folgsamen Höflingen im Schatten von Versailles war die sich bereits zu Heinrichs Zeiten abzeichnende Konsequenz aus dem Untergang des Feudalismus;
die großen Reformen seiner Ära, die Modernisierung von Heer und Wirtschaft, hatten sich bereits seit der Wende zum siebzehnten Jahrhundert als einzig mögliche Lösung für ein modernes Frankreich abgezeichnet, trugen zudem mehr den Stempel eines Colbert und Louvois als den Ludwigs XIV.;
und nicht einmal der für Ludwig so typische Lebensstil aus hohem, strengem Pathos und in die Breite ausladendem Pomp war original. Er übernahm sie aus den Tagen Richelieus, der in seinem Palais Royal auf ganz ähnliche Weise residiert hatte wie später der Sonnenkönig in seinem Versailles.
Selbst die Idee, Paris und die Burgen der Monarchie hinter sich zu lassen, war so originell nicht. Es hätte vielleicht nicht gerade die Umgebung des schäbigen Dörfchens Versailles zu sein brauchen, doch schon unter Heinrich IV. war der Louvre zu eng für Frankreichs Herrscher geworden.
Ludwig XIV. war ein Nachfolger par excellence.
Doch natürlich wäre es nun grundfalsch, ihn lediglich als Epigonen einzuschätzen. Sein originaler Beitrag bleibt die wahrhaft ungeheure Intensität, mit der er die Muster der Geschichte aufgriff und ihre Linien der letzten Konsequenz entgegenführte — Idol und Diplomat zugleich, Manager des eigenen Mythos.
Dies nun ist die Perspektive der Nachgeborenen. Für des Sonnenkönigs Zeitgenossen bot sich ein anderes Bild.
Um 1660 hatten die ältesten noch alle Qualen der Glaubenskriege durchleiden müssen, die Kämpfe zwischen den großen Familien, Richelieus hartes Regiment. Den jüngeren und jüngsten war zumindest noch die blutige Zeit der Fronde gegenwärtig. Vor diese Menschen nun trat auf einmal ein junger und energischer Monarch, der sich anschickte, die alten Zwistigkeiten für immer zu überwinden, eine neue Ordnung zu schaffen und Frankreich zu einer allerersten Nation zu machen. Er wirkte wie die fleischgewordene Garantie einer neuen und besseren Zeit.
So wird dieser doch ganz bewusst »unpopuläre« König in seinen ersten Jahren von einer Woge ungeheurer Popularität emporgetragen. In gläubiger Demut blickt man ihm nach, wenn er in abweisendem Stolz, erfüllt vom Gottesgnadentum, an seinen Untertanen vorüberreitet — hinaus zu seinem Versailles, einer großen Zukunft entgegen.
Und die Zukunft kommt samt aller Größe. Nur war diese Größe von jener Art, die ihren Preis hatte. Den aber zahlte nicht so sehr Ludwig. Den zahlten die, die jetzt noch ihrem jungen Monarchen mit devotem Staunen nachblickten.
Meine Herren, der König
Alles an dem Haus ist schön: Klar seine Fassade, weit und hell die Räume, schier grenzenlos der Park. Gemälde, Statuen, Teppiche, Mobiliar — alles zeugt von einem erlesenen Geschmack.
Nur zwei Fehler hat dies Haus: Es heißt nicht Versailles. Und es gehört nicht dem König.
Der aber, dem es gehört, könnte ein König sein, so selbstherrlich gibt er sich — getreu seinem Wappenspruch »Wohin steige ich nicht?«. Mit der Gelassenheit des geborenen Götterlieblings hat er dieses Wort zur Maxime seines Lebens erhoben.
Er ist reich. Er hat Macht. Gleich zwei der wichtigsten Ämter vereint er in seiner Person. Oberintendant der Finanzen und Generalprokurator des Pariser Parlaments ist er zugleich. Zu ihm kommt der König, wenn er Geld braucht. Er aber beschafft es mit spielerischer Leichtigkeit und bestimmt dann auch gleich, wie viel davon tatsächlich in den Besitz der Krone kommt und welcher Anteil in seine Privatschatulle fließt.
In den fünfziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts ist Nicolas Fouquet einer der Herren Frankreichs und so mächtig, dass er ungeniert seine Macht öffentlich zeigen darf. Zumindest glaubt er das selbst.
Zu einer Zeit, in der die Monarchie noch auf den Louvre als Repräsentationsstätte angewiesen ist, Versailles nicht mehr als ein kleines Jagdhaus bedeutet und des Königs Feste nur aufwendige Picknickausflüge sind, baut sich der Staatsdiener Fouquet mit Millionenaufwand in der Nähe von Melun das Schloss Vaux-le-Vicomte, engagiert dafür Frankreichs beste Handwerker und Künstler, und nicht einmal das Heer seiner Neider kann leugnen, dass mit Vaux ein architektonisches Wunderwerk entsteht.
Nicolas Fouquet ist nicht der Mann, der Glanz um seiner selbst willen schafft. Wie nur wenige in dieser noch ungeschlachten Zeit hat er die Gabe zum verfeinerten Genuss, und Luxus erschöpft sich bei ihm nicht in greller Prunkentfaltung, sondern wird auch zum geistigen Erlebnis.
Es ist nicht nur der Adel, die Lebewelt, die sich in Vaux versammelt. Mit Verständnis, Takt und Großzügigkeit weiß Fouquet auch die intellektuelle Elite um sich zu scharen: Molière, Corneille, Lafontaine, um nur sie zu nennen. Fouquet ist ihr Mäzen.
Im Sommer 1661 will er alles bisher Gebotene noch übertreffen.
Zur Einweihung des endlich fertiggestellten Baus plant er ein Fest, wie es so pompös nicht einmal Mazarin je feierte. Sechstausend Personen erwartet der Gastgeber, an der Spitze den jungen König selbst. Und dies Fest soll eines Königs würdig sein.
Vielleicht ist im Leben dieses Nicolas Fouquet alles zu rasch, zu glatt, zu selbstverständlich gegangen. Nie hat er sich — wie Richelieu in seiner Jugend — mit Armut und Krankheit auseinanderzusetzen brauchen, ist auch kein Ausländer wie Mazarin, der sich erst als guter Franzose beweisen musste. Niemals bot er sich an, alles wurde ihm angeboten. Schon von seiner Geburt im Jahr 1618 an schien für den Spross einer alten, angesehenen und wohlhabenden Familie die große Karriere festzustehen.
Alle Voraussetzungen waren gegeben. Nicolas Fouquet sah gut aus, besaß natürlichen Charme und eine angeborene Eleganz, die ihn gleichermaßen angenehm wie überlegen machten. Was der intelligente Mann zu sagen hatte, war immer geistreich, originell, durchdacht. Jedes Wort verriet eine umfassend fundierte Bildung.
Mazarin umschmeichelte die Menschen, Richelieu hatte sie eingeschüchtert. Fouquet brauchte weder das eine noch das andere. Anerkennung flog ihm zu, wo er nur auftrat, überall stieß er auf Sympathie. Und da er im Grunde gutmütig war, missbrauchte er nicht die Bewunderung seiner Umwelt, sondern war großzügig und zugänglich für alle, die es wünschten.
Nur einen großen Fehler hatte dieser Mann: Allzu sehr hielt er das Glück für einen selbstverständlichen Bestandteil seines Lebens. Nie rechnete er damit, dass er einmal auch verlieren könne, stets spielte er va banque, um dann den Gewinn als den gebührenden Tribut an seine außergewöhnlichen Gaben einzustreichen. Dies sollte sein Schicksal werden.
Doch bis dahin war noch ein langer Weg, auf dem sich Fouquet zunächst ebenso auf das Glück verlassen durfte wie das Glück auf ihn. Schon sehr früh wurde er Generalprokurator des Parlaments. Doch seinen Höhepunkt erreichte er erst in den Jahren, in denen er zum zweiten Mann im Staat nach Mazarin aufrückte.
Es war die Zeit nach der Fronde, die Jahre, in denen sich Mazarin seines großen Vorgängers Richelieu durchaus würdig zeigte und selbst zum »Großen Kardinal« wurde, vollendete er doch das außenpolitische Lebenswerk des anderen: Frankreich wurde erste Macht des Kontinents, blieb Sieger über die spanischen Habsburger. 1660 wurde der große Frieden geschlossen. Müde, todkrank ließ sich Mazarin vom Verhandlungsort, der Fasaneninsel im spanisch-französischen Grenzfluss Biadossa, heim nach Paris fahren, und die Menschen am Straßenrand knieten vor ihm nieder, als würde die Monstranz vorbeigetragen. Der einst bestgehasste Mann des Landes war zu seinem bewundertsten geworden.
Doch dieser Krieg, der nun Mazarins größter Sieg geworden war, hatte seinen Preis, und er war in den Jahren hoch, immer höher geworden. Denn so bedeutend der Kardinal als Außenpolitiker war, so wenig verstand er von ökonomischen Fragen. Man konnte nicht einmal sagen, dass er versagt hätte. Schlimmer: Er hatte gar nicht erst versucht, die seit Sully und Richelieu immerhin leistungsfähige Wirtschaft zu erhalten oder sie gar den neuen Verhältnissen anzupassen.
Zugleich aber mussten riesige Armeen unterhalten werden, ohne die selbst das Verhandlungsgenie Mazarin sich Spanien niemals hätte gefügig machen können. Und hier nun begann Macht und Wirkung des Nicolas Fouquet.
Das System — oder wie immer man die Machenschaften nennen will, mit denen damals Steuern eingetrieben wurden — war gleichermaßen wirr wie simpel, simpel im Prinzip, wirr in der Durchführung. Der sich stets in finanziellen Nöten befindende Staat hatte nicht die Zeit, die einkommenden Steuern eines jeden Jahres abzuwarten. Auch überstiegen in Kriegszeiten die Ausgaben bei Weitem die Einnahmen. Also wandte man sich gleich an zahlungskräftige Geldgeber und bot ihnen als Pfand seine Steuerrechte an. So konnte ausgegeben werden, was noch gar nicht eingenommen war.
Drei Partner hatte dieses Spiel, zwei davon waren mit ihm zufrieden: der Staat selbst, der rasch zu seinem Geld kam, und seine privaten Gläubiger, die schon dafür sorgten, dass die geborgten Summen um ein Vielfaches vermehrt wieder eingetrieben wurden. Die Zinsen aber zahlte das schwächste Glied in dieser Kette: das Volk, über das die Meute der Steuereinzieher bar jeder Kontrolle hereinbrechen durfte.
Dies nun war das rechte Feld für den Glücksritter Fouquet. Als Prokurator des Parlaments brauchte er die einzige Institution nicht zu fürchten, die noch gelegentlich gegen das unselige System protestierte. Als Oberintendant der Finanzen bestimmte er zugleich, wie viel Geld woher zu nehmen war. Nun besaß der mit dem Ruf eines Midas Ausgestattete bei den Geldgebern größeren Kredit als selbst die Krone, ihm gab man, was man dem König in Krisenzeiten verweigerte, und diese Summen wiederum lieh der geschäftstüchtige Staatsdiener an seinen Staat weiter, deren Oberintendant er zugleich war, also Gläubiger und Schuldner in einem — ideale Basis für eine mühelose Verständigung. Fouquet wurde darüber einer der reichsten Männer des Landes. Ein Bild bietet sich an: hier der seinem Finanzier hilflos ausgelieferte Mazarin, dort Fouquet, der die Schwäche des anderen zynisch zur höheren Ehre seiner eigenen Kasse ausnützt.
Doch dieses Bild, in späteren Jahren eifrig propagiert, ist falsch: Mochte Fouquet an seinen kaum noch oder gar nicht mehr legalen Transaktionen Millionen verdienen, so waren seine Gewinne doch fast bescheiden gegenüber dem, was Mazarin einstrich.
Nichts war dem Kardinal zu schäbig, als dass er daran nicht verdient hätte, ob es sich nun um Freibeuter handelte, mit denen er Halbpart machte, oder um Staatsämter, deren Vergabe dem Premier üppige Provisionen brachten. Und während das von ihm regierte Land kurz vor dem Bankrott stand, wurde Mazarin reichster Mann der Welt.
Dies ändert nichts an seiner Bedeutung als Politiker. Doch relativiert es das Schuldmaß Fouquets. Der Oberintendant durfte sich bei seinen eigenen Räubereien in prominenter Gesellschaft wissen.
Der Unterschied jedoch: Mazarin war auch ein Dieb, Fouquet war es ausschließlich. Er hätte ein großer Politiker werden können — und wurde doch nur der allergrößte Hasardeur.