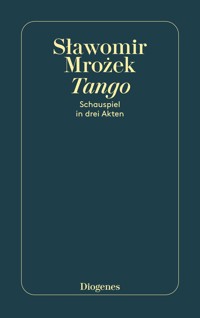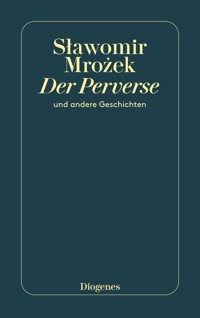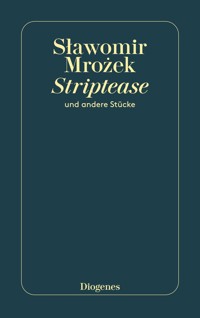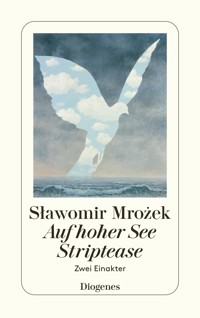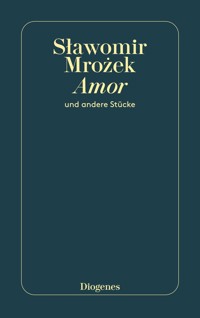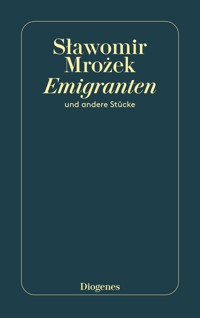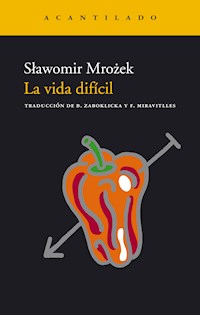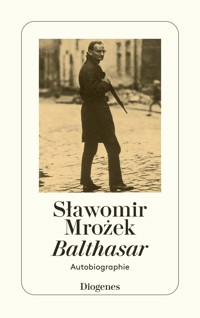
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seine Stücke ›Tango‹ und ›Striptease‹ kennen nicht nur Theaterfans. Seine Stücke werden rund um den Globus gespielt, kein anderer Theaterautor nach Samuel Beckett wurde so berühmt. Nun schrieb der Dramatiker von Weltrang seine Autobiographie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Balthasar
Autobiographie
Aus dem Polnischen von Marta KijowskaMit einem Vorwort von Antoni Libera und einem Bildteil
Diogenes
Vorwort von Antoni Libera
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen Schriftsteller ihre Erinnerungen oder Autobiographien schreiben. Meistens ist es die Überzeugung von der Wichtigkeit oder gar Einmaligkeit der eigenen Existenz, hin und wieder der Wunsch, das eigene Werk zu kommentieren, und manchmal schließlich der Schreibzwang.
Wie Sławomir Mrożek im Vorwort und im Epilog dieses Buches berichtet, begann er mit dem Aufschreiben seiner Erinnerungen aus therapeutischen Gründen. Es ging ihm darum, durch das methodische Erforschen seines Gedächtnisses und das Aufschreiben der darin gespeicherten Erlebnisse, Bilder und Gedanken die Aphasie (den Verlust der Fähigkeit, sich sowohl der gesprochenen als auch der geschriebenen Sprache zu bedienen) zu besiegen, von der er infolge eines Gehirnschlags heimgesucht wurde. In den letzten Sätzen, in denen er seinen Therapeuten und Betreuern für ihre Hilfe während der Rekonvaleszenz dankt, fügt er hinzu, daß er die Frucht seiner Arbeit »allen Personen, die an der Aphasie leiden«, widmen möchte, und äußert die Hoffnung, daß sie ihnen beim Überwinden dieser Behinderung helfen könnte.
Diese Widmung und diese Botschaft klingen ehrlich und echt, dennoch hat man nicht den Eindruck, daß der Autor sich auf der Spur der heutzutage modernen und in der Massenkultur sehr geschätzten ›Opfer‹ bewegt, die – von einem Leiden wie Krebs, Alkoholismus oder Narkomanie betroffen und daraus einigermaßen siegreich hervorgegangen – der Welt ihren Triumph verkünden und anderen gegenüber die Pose der eingeweihten Trostspender einnehmen. (Nebenbei gesagt, besteht ihr Trost oft darin, in einer verhüllten Form mit eigener Heilung, also eigenem Glück, zu prahlen.) Indem er den therapeutischen Charakter seines Buches unterstreicht und es in erster Linie an Personen mit der Behinderung richtet, die ihm selbst zuteil wurde, macht Sławomir Mrozek eine Geste, die, wie es mir scheint, eine tiefere Bedeutung hat als nur eine Solidaritätsbekundung mit seinen Leidensgenossen.
Menschen, die an der Aphasie, aber auch an anderen Krankheiten wie Amnesie oder Alzheimer-Syndrom leiden, scheinen für ihn nicht mehr zu sein als eine Zuspitzung des … normalen Menschenschicksals. Es geht darum, daß der Mensch sich naturgemäß mit der Zeit verändert und dabei, und zwar mehrmals, sich selbst verliert; er hört öfter auf, der sogenannte er selbst zu sein. Der ›sogenannte‹, denn wenn man über den Sinn dieses Pronomens nachdenkt, fängt es an, ›verschwommen‹ zu sein, wird zu einer, wie der Schriftsteller es bei einer anderen Gelegenheit formuliert, ›linguistischen Illusions‹.
Mit anderen Worten, Sławomir Mrożek, der sich übrigens schon immer für die Frage der (nationalen, gesellschaftlichen, kulturellen) Identität interessierte, hat mit einer bewundernswerten Courage und Determination den eigenen Krankheitsfall genutzt, um die grundsätzliche Frage der Selbstidentifizierung des einzelnen zu thematisieren. Was verstehe ich darunter, wenn ich von mir per ›ich‹ spreche? Was bedeutet es, daß ich mich als ›ich selbst‹ fühle? Ist es ein konstanter oder ein wechselnder Zustand, und wenn wechselnd, was unterliegt dann dem Wechsel? Was bildet die Grundlage der Identität, die ich mit meinem Vor- und Nachnamen verbinde?
An einer Stelle spricht der Autor seine Korrespondenz mit dem befreundeten Kritiker Jan Błoński an, die er in den sechziger Jahren führte, und zitiert eine von dessen Bemerkungen, die sich auf sein bis dahin erschienenes literarisches Œuvre beziehen. Błoński behauptet nämlich in einem dieser Briefe, Mrożek würde so schreiben, als wäre er nicht imstande, ein Thema in seinem ›natürlichen Zustand‹ aufzugreifen, sondern immer nur in dem ›übernatürlichen‹; er müsse, um – über was auch immer – etwas Wesentliches sagen zu können, sich auf die Ebene des Sonderbaren, Grotesken, Absurden erheben; nur so könne er über die Welt, den Menschen oder die Geschichte sprechen.
In diesem Buch ist es anders. Der Schriftsteller spricht hier so normal wie nur möglich. Dies geschieht zwar nicht zum ersten Mal – schon früher hat er zahlreiche Beispiele dieser Form geliefert (es sind hauptsächlich Texte, die in den Bänden Varia versammelt sind, sowie Hunderte von Seiten faszinierender Korrespondenz) –, zum ersten Mal aber nimmt es einen solchen Umfang an. An dieser Stelle drängt sich ein Paradoxon auf: Möglicherweise hat dieser Sachverhalt seine Ursache in der ›unnatürlichen‹, ›deformierten‹ oder gar ›monströsen‹ Situation, in der sich der Autor von Emigranten infolge seiner Krankheit befand.
Er selbst interpretiert es mit dem ihm eigenen Sinn für Humor, indem er behauptet, derjenige, der nicht anders als nur ›übernatürlich‹ (surrealistisch, parabolisch, grotesk) habe schreiben können, existiere einfach nicht mehr – er habe sich irgendwo aufgelöst, sei verschwunden, gestorben. Seine Stelle nehme jetzt jemand anders ein: eine Persönlichkeit, die ganz andere Eigenschaften besitze, und zwar in einem solchen Grad, daß sie nach einem anderen Namen verlange. Dieser Name solle der titelgebende Balthasar sein.
Gegen Ende seines Lebensberichts erzählt Sławomir Mrożek von einem Traum, den er in Paris im Dezember 2003 hatte, anderthalb Jahre nach seinem Gehirnschlag. In diesem Traum eben lernte er seinen neuen Namen kennen und ›hörte‹ die Ankündigung einer ›weiten Auslandsreisen Es gibt keinen Grund, an der Ehrlichkeit dieses Geständnisses zu zweifeln; man hat auch nicht den Eindruck, daß der Autor sich diesen Traum aus kompositorischen Gründen ausgedacht, geschweige denn diesen Namen ausgewählt hat. Der Name ist allerdings weder gewöhnlich noch von geringer Bedeutung. Man assoziiert mit ihm unwillkürlich den letzten König von Babylon und somit auch die berühmte Wahrsagung während des mythischen Gastmahls. Es geht natürlich um das biblische ›Mene, mene, tekel, upharsin‹, das von einer geheimnisvollen Hand an die Wand geschrieben wurde. Erinnern wir uns, was diese Worte bedeuten – zumindest dem Propheten Daniel zufolge:
»Gezählt sind deine Tage. Du bist von Gott gewogen und zu leicht befunden. Und geteilt werden wird dein Reich.«
Balthasar vel Sławomir Mrożek zieht in diesem Buch die Bilanz seines Lebens (er ›zählt‹) und beurteilt sich selbst (er ›wiegt‹). Da er aber kein Königreich besitzt und nichts zu teilen hat, teilt er das, was er hat, nämlich seine Weisheit. Und diese Weisheit besagt: Was uns integriert, sind Gedächtnis und Sprache. Das ist das einzige Königreich des Menschen.
Vorwort des Autors
Ich heiße Sławomir Mrożek, doch infolge der Umstände, die in meinem Leben vor vier Jahren aufgetreten sind, wird mein Name erheblich kürzer sein: Balthasar.
Am 15. Mai 2002 erlebte ich einen Gehirnschlag, dessen Folge die Aphasie war. Es ist ein partieller oder vollkommener Verlust der Fähigkeit, sich der Sprache zu bedienen, der durch die Beschädigung einiger Gehirnstrukturen verursacht wird.
Als ich die Sprache wiedererlangte und einen Versuch unternahm, meine Arbeit wiederaufzunehmen, schlug mir Frau Magister Beata Mikołajko vor, die von Beruf Logopädin ist, im Rahmen der Therapie ein neues Buch zu schreiben. Ich beschloß, daß es den Arbeitstitel Tagebuch einer Rückkehr – Fortsetzung tragen würde, in Anknüpfung an das Tagebuch einer Rückkehr, das ich im Jahre 1996 publiziert hatte. Diesmal aber erzähle ich davon, was bis zum Jahr 2005 passiert ist. Und dieses Buch ist jetzt fertig und liegt Ihnen nun vor.
Während des Schreibens kam mein Erinnerungsvermögen langsam wieder. So war ich im September 2005, als ich mit dem Buch fast fertig war, bereits imstande, mich an viel mehr Fakten zu erinnern, und ich konnte sie auch aufschreiben. Ich hoffe, daß dieser Prozeß trotz Fertigstellung des Buches weitergehen wird und daß ich mich sowohl der gesprochenen als auch der geschriebenen Sprache immer besser werde bedienen können. Ich glaube daran, daß ich mit der Zeit meine Schreibfähigkeit in dem Maße wiedererlangen kann, in dem es nach einer Aphasie möglich ist.
Der erste, kürzere Teil dieses Buches bezieht sich auf Mexiko. Ich wollte hier den Leser daran erinnern, was in den Jahren 1990–1996 passiert war und was ich im Tagebuch einer Rückkehr beschrieben hatte. Der zweite Teil des Buches beschreibt mein Leben seit der Kindheit bis zu meiner Ausreise aus Polen.
Suchen Sie bitte in diesem Buch weder nach meiner erotischen Initiation noch nach ihrer Fortsetzung, denn es gibt sie hier nicht. Ich stimme der These zu, daß diese Art Nähe zwischen Mann und Frau die wichtigste auf der Welt ist, aber ich halte mich bei dieser Thematik zurück – wegen des absolut privaten Charakters dieser Angelegenheiten und wegen der in unserer Literatur herrschenden Ungerechtigkeit: Während die Männer viel Lärm um diese Dinge machen, wird von den Frauen meistens geschwiegen, obwohl sie dazu so manches zu sagen hätten. Diese Einseitigkeit der Bekenntnisse macht mich mißtrauisch. Da ich die Männer kenne, kenne ich auch ihre Neigung zur Prahlerei, und das bewirkt, daß ich ihre Tagebücher zumindest mit Unglauben lese.
Ich erwähne in diesem Buch verschiedene bekannte und weniger bekannte Personen sowie verschiedene Situationen, in denen ich mich im Laufe meines Lebens befand. Es kann sein, daß ich gewisse Fakten ungewollt verändert und anders geschildert habe, als sie sich in Wirklichkeit abgespielt hatten. In diesem Fall bitte ich die Leser um Verzeihung.
Balthasar
vel
Sławomir Mrożek
Von Mexiko nach Krakau
Sieben Jahre meines Lebens verbrachte ich in Mexiko, und im April 1996 entschloß ich mich, nach Polen zurückzukehren. Um später bei diesem Entschluß zu bleiben, machte ich ihn sofort in Dziennik Polski (Polnisches Tagesblatt), in einem Feuilleton-Zyklus mit dem Titel Tagebuch einer Rückkehr, bekannt. Dieser Zyklus erschien in Polen bis zum 2. August 1996. Es war eine Handvoll Eindrücke, die sich auf Mexiko und Polen bezogen.
Seit meiner Ausreise aus Polen, also seit dem 7. Juni 1963, war mir das Land immer fremder geworden. Zum ersten Mal besuchte ich Polen fünfzehn Jahre später, bereits mit einem französischen Paß. Ich kam für zwei Wochen, doch es war viel zu kurz, um das Land neu kennenzulernen.
Dennoch gewann ich den Eindruck, daß die polnische Wirklichkeit zwar noch nicht ganz normal, dafür aber wenigstens die Gesellschaft um einiges freundlicher geworden war. Die Gewerkschaftsbewegung ›Solidarność‹ kündigte sich an, das Land wurde immer interessanter. Das nächste Mal besuchte ich Polen im Oktober 1980. Als ich nach Paris zurückfuhr, wußte ich nicht, daß schon am 13. Dezember 1981 über das Land der Kriegszustand hereinbrechen würde.
Die in dieser Zeit geltenden Gesetze zögerten meinen nächsten Besuch in Polen um sieben Jahre hinaus. Als 1987 mein Vater starb, mußte ich erneut einreisen. Da die Ausrufung des Kriegszustands aber bereits sieben Jahre zurücklag und die politische Situation sich wieder entspannt hatte, war dies mit keinem besonderen Risiko verbunden. Schließlich verbrachte ich im Jahre 1990 drei unvergeßliche Wochen auf meinem eigenen Festival in Krakau, in einem schon freien Polen.
Doch diesmal kam ich aus Mexiko, wo ich seit einem halben Jahr lebte. Ich hatte nicht die Absicht, für immer nach Polen zurückzukehren. Ich sah Mexiko als meine Bestimmung an – für immer. Mein Zuhause war eine noch nicht ganz fertige Hazienda, die mitten in den Bergen lag, auf halbem Wege zwischen Mexiko City und Puebla. Ich sah voller Zuversicht in die Zukunft. Doch leider entpuppte sich die Zukunft als nahezu tödlich.
Natürlich nicht sofort. Zusammen mit meiner Frau Susana verbrachte ich ein weiteres halbes Jahr damit, an der Hazienda zu bauen. Wir waren beide zwar noch sehr beeindruckt von dem Krakauer Festival, doch wir machten Pläne, die mit Polen nichts zu tun hatten. Die Vergangenheit war ein abgeschlossenes Kapitel, das Festival ein einziger Triumph, und dem war nichts hinzuzufügen. Jetzt gab es nur noch die Hazienda und ein ruhiges, zurückgezogenes Leben möglichst weit weg von Polen.
Wir kehrten aus Krakau Ende Juni zurück. Als der Dezember kam – in Mexiko unterscheidet sich der Winter nicht viel von anderen Jahreszeiten – und das erste Gebäude fertig wurde, richteten wir ein Einweihungsfest aus. Es gab eine große Feier mit ›Mariachis‹, allen Angestellten und Arbeitern und unseren Gästen. Kurz danach ging es mir auf einmal schlecht. Als ich in der Früh aufstand, fühlte ich mich seltsam, und Susana sagte, nachdem sie mich kurz betrachtet hatte, wir würden sofort nach Mexiko City fahren. Ich erklärte, daß ich nirgendwohin fahren würde. Ohne ein Wort zu mir zu sagen, ließ Susana die Hausangestellte die Autoschlüssel holen und anschließend mich, der ich immer wieder das Bewußtsein verlor, auf den Beifahrersitz setzen. Die Fahrt nach Mexico City dauerte etwa zwei Stunden. Wir hielten vor dem Gebäude von ›The British and the American Hospital‹. Ich war halb bewußtlos. Ich zog mich sofort aus und überschüttete den Arzt mit wüsten Beschimpfungen. Dann wollte ich mich wieder anziehen, um nach Hause zu fahren. Man hielt mich mit Gewalt zurück. Ich verlor das Bewußtsein. Als ich es wiedererlangte, war es schon nach der Operation. Man stellte bei mir ein Aneurysma fest, also eine Schlagadererweiterung. Mein Zustand war ernst, die Chancen standen eins zu neun. Eins für das Überleben der Operation. Ihre Spur, eine Narbe vom Hals bis zur Taille, werde ich bis an mein Lebensende tragen. Diese Narbe verdeckt ein Röhrchen aus Teflon, das heißt eine künstliche Aorta.
Es dauerte lange, bis ich anfing, zu mir zu kommen. Nach einem Monat wurde ich auf die Ranch zurückgebracht, doch bis zu meiner vollen Genesung verging noch ein Jahr. Erst 1992 begann ich, wieder zu Kräften zu kommen, was mit einer weiteren Reise zusammenfiel, diesmal nach Italien und Polen.
Doch zunächst mußte ich noch das Theaterstück Die Witwen schreiben – das erste nach fünf Jahren Pause. Dann nahm ich im Mai 1992 am Internationalen Theaterfestival in Siena teil, wo das Stück uraufgeführt werden sollte. Ich wurde von einer Gruppe polnischer Schauspieler begleitet, denn gemäß der Satzung des Festivals sollte das Stück in der Sprache dargestellt werden, in der es geschrieben war. Mein anschließender Polen-Besuch war nur kurz, und ich bekam dabei die polnische Realität nicht wirklich mit. Mein weiteres Leben sollte sich ausschließlich in Mexiko abspielen.
Die Jahre 1993–1995 waren die schöpferischsten in meiner gesamten Zeit in Mexiko. 1993 schrieb ich das Stück Liebe auf der Krim, das für drei Bühnenwerke gereicht hätte. Ich bekam dafür in Paris einen renommierten Preis und die Zusage, daß das Stück im ›Théâtre national de la Colline‹ aufgeführt würde, was ein Jahr später auch geschah. Das Jahr 1994 brachte die Reisen nach Frankreich, Deutschland und in die Schweiz mit sich.
Zu Weihnachten 1996 gab es einen Börsenkrach – einen von denen, die alle paar Jahre Mexiko, und damit auch andere Länder, erschüttern. Dies zog eine allgemeine Verarmung Mexikos, die Abschaffung kleiner und mittlerer Unternehmen und eine rapid wachsende Arbeitslosigkeit nach sich. Gleichzeitig war nach zehn Jahren relativer Stabilität die Verbrechenrate gestiegen. Vor allem die Zahl der Entführungen mit Lösegeldforderungen. Die Ermordung des mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten und die damit verbundenen Affären trugen ebenfalls zu den sozialen Unruhen bei. Hinzu kam, daß es um unsere Angelegenheiten auf La Epifania (den Namen, der Offenbarung bedeutet, hatten wir unserem Anwesen sechs Jahre zuvor gegeben) immer schlechter stand. Wir konnten der wachsenden Disziplinlosigkeit unter den Hausangestellten nicht mehr Herr werden. Der neue Bodyguard, der uns jetzt auf unseren Fahrten begleiten mußte, begann, immer neue Forderungen zu stellen. Die Bewohner des benachbarten Dorfes hatten die letzten Bäume gefällt. Ich nenne hier nur einige unserer Sorgen. Wir begannen ernsthaft, wenn auch erst noch jeder für sich, darüber nachzudenken, Mexiko zu verlassen.
»Du kannst es dir aussuchen: Paris oder Krakau?« Diesen Satz sagte ich beim Frühstück am 10. April 1996. Und Susana antwortete nach kurzer Überlegung: »Krakau.« In diesem kurzen Augenblick hatte sich, wie ich später in Tagebuch einer Rückkehr schrieb, unser Schicksal entschieden.
Diesmal kehrte ich für immer nach Krakau zurück. Ich hörte zwar nicht auf, mich zu fragen, wie diese Stadt zu uns sein würde, doch die Antwort darauf sollte ich erst nach unserer Ankunft erhalten. Heute weiß ich, daß alles anders gekommen ist, als ich mir damals vorgestellt habe. Wir können nicht handeln, ohne zu planen, wenigstens von einem Tag auf den anderen. Wenn wir aber feststellen, daß das Leben unsere Pläne nicht bestätigt hat, sind wir enttäuscht. Was also tun? Damit einverstanden sein, daß die Wirklichkeit uns mißachtet? Ein zweifelhafter Trost.
Damals allerdings schoben die Reisevorbereitungen dieses Problem weit weg von mir. Wir mußten die ganze Ranch auf einen Container reduzieren und sie darin einschließen, dafür sorgen, daß der Container die Überseefahrt antrat, und uns schließlich selbst, jeder mit zwei Koffern in der Hand, in dieselbe Richtung begeben. Was auch am 8. September 1996 in der Frühe in die Tat umgesetzt wurde.
Als das Flugzeug an Höhe gewann und Richtung Osten ansteuerte, konnte man aus der Ferne wilde Schluchten und Brachfelder sehen – dieses ganze, fast menschenleere Land. Und ich wußte: Wie immer sich mein weiteres Leben gestalten würde, ich entfernte mich von dort für immer.
Zurück in Krakau
Von der Fülle der Eindrücke sind mir nur die Pappeln in Erinnerung geblieben. Jedes Mal, wenn ich an diesen Moment denke, tauchen ihre Silhouetten auf – schlank, selbst beim kleinsten Windhauch zitternd. Und Krakau erst in einem fernen Hintergrund.
Den Weg in die Stadt legten wir im Regen zurück. Wie klein doch dieses Krakau war! Nie zuvor hatte ich es so empfunden, dabei waren wir doch viele Male hier gewesen. Schon waren wir im Viertel Wola Justowska und am Hotel ›Cracovia‹, und dann standen wir auf einmal vor dem ›Teatr Stary‹ (Altes Theater).
Die letzten schweren Koffer wurden nach oben getragen. Alle, die dabei halfen, sprachen Polnisch, ebenso die Passanten auf der Straße. Das verblüffte mich zutiefst. Und dann saßen wir nebeneinander. Allein. Nach zwei Tagen, die wir in Flugzeugen und Flughäfen verbracht hatten.
Wir betrachteten die beiden Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich war so durcheinander, daß sogar der hartnäckige Gedanke ›Was mache ich hier eigentliche?‹, der seit der Landung in meinem Kopf herumgeisterte, verschwunden war.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Die Wolken brachten einen Regen, dann hörte der Regen auf, doch die Wolken blieben. In diesem Jahr war der Herbst ungewöhnlich früh gekommen. Wir gingen die Starowislna-Straße entlang und setzten uns dann im Stadtteil Kazimierz in ein Café, wie es sich für Touristen gehörte. Noch ›für Touristen‹, denn von diesem Moment an sollten wir ja hier ständig leben.
›Was mache ich hier eigentlich?‹ – dieser Gedanke kehrte wieder. Er sollte mich in den nächsten Jahren oft begleiten.
Langsam gewöhnten wir uns an die neuen Verhältnisse. Ich muß sagen, diesen enthusiastischen Empfang, den man mir bereitete, hatte ich nicht erwartet.
Ich war der ›Held der Saisons bis meine Ausreden, Ausflüchte und sonstigen Verstöße gegen derartige Pflichten anfingen, Früchte zu tragen. Solange ich in Polen lebte, hatte ich Erfolg. Als ich ins Ausland ging, hatte dies für mich überhaupt keine Bedeutung mehr. Jetzt war ich wieder da und hatte erneut Erfolg. Schließlich folgte eine relative Stabilisierung. Ein solcher Gang der Dinge verdient einige Bemerkungen.
In meiner frühen Jugend, also im Alter von zwanzig Jahren, war ich über die blitzschnelle Karriere mehr als froh. Es genügt, zu sagen, daß von der Zeit, da ich völlig anonym war, bis zu meiner Ausreise lediglich dreizehn Jahre vergingen. Es stimmt zwar, daß das Jahr 1957 – ein Jahr schneller Karrieren wie die von Marek Hłasko und anderen Personen – mir dabei half. Doch drei Jahre später war das ›Tauwetter‹ vorbei, und nach weiteren drei Jahren fühlte ich mich gezwungen, mein Glück im Ausland zu suchen. Ungeachtet der politischen und sonstigen Umstände ist die Suche nach Ruhm im jungen Alter etwas Natürliches. Besonders in meinem jungen Alter, in dem nichts auf eine solche Entwicklung hindeutete. Doch abgesehen davon, was natürlich ist und was nicht, hatte die Suche nach Popularität in Polen noch andere, besondere Gründe. Wer in einem kleinen und dazu totalitären und von der Welt abgeschnittenen Land als ›Jemand‹ galt, der hob sich von der grauen Masse der sonstigen Bürger ab. Und wer sich abhob, war (nach Stalins Worten) ein ›Ingenieur der menschlichen Seele‹. Eine weitere Kategorie der sich Abhebenden waren die Mitglieder der Partei, insbesondere des Zentralkomitees; sie galten als die oberste Elite und standen dieser Masse als eine kleine Minderheit gegenüber.
Nach meinem Wechsel ins Ausland begann ich, völlig anders zu leben. Hier war die Popularität nicht so wichtig. In einem großen und vernünftig eingerichteten Land reduziert sich die Rolle der Künstler auf ihre konkreten Berufe. Ich stellte mit Erleichterung fest, daß ich die Popularität nicht mehr brauchte. Ich wollte schon immer als jemand leben, der klar definierte Pflichten und eine klar definierte Freiheit hat. In Italien war dies viel einfacher als im damaligen Polen. Doch erst als ich nach Frankreich übersiedelte, erkannte ich, daß ich mein Land gefunden hatte. Nicht ohne Grund verbrachte ich dort einundzwanzig Jahre, und obwohl ich wieder in Polen lebe, habe ich meine Meinung dazu bis heute nicht geändert.
Überhaupt, wenn es um die Rechte geht, ist es mir in meinem Leben nicht besonders gut ergangen. Vor dem Krieg war ich zu klein, um das Recht im allgemeinen zu schätzen. Als Heranwachsender lebte ich in Zeiten, in denen nur Juden und Zigeuner in einer schlimmeren Situation waren, weil sie gar keine Rechte besaßen. Besser ging es mir erst nach dem Krieg, in der Volksrepublik, doch nur als einem ›links denkenden‹ Polen, denn allen anderen Polen waren die Rechte aberkannt. Deshalb eignete ich mir schnell eine doppelte Moral an: eine nachgiebige dem – alles in allem verhaßten – Staat gegenüber und eine private. Meine Rettung war erst die Flucht in den Westen, doch damals war ich bereits dreiunddreißig Jahre alt.
An die Auslandsjahre 1963–1966 erinnere ich mich am liebsten. Die doppelte Moral wuchs sofort wieder zu einer Einheit zusammen, und ich dachte, daß es immer so bleiben würde. Ich hatte meine politischen Präferenzen, aber ohne die Verbissenheit, zu der das Schicksal nur die Eingeborenen eines Landes zwingt. Ich blieb doch immer Ausländer, selbst dann, als ich bereits einen französischen Paß besaß. Ich dachte, was ich fühlte, und ich fühlte, was ich dachte – ohne die geringsten Unterschiede und Hindernisse.
Der zweite Grund meiner Popularität in Polen, neben den politischen Umständen, die mir, wie gesagt, einen schnellen Start ermöglichten, war die Tatsache, daß ich auch im Ausland auf polnisch schrieb. Als ich später endgültig nach Polen zurückkehrte, lernte bereits die dritte Generation das Lesen aus Schulbüchern, in denen unter anderem meine Texte zu finden waren. Außerdem hatte ich das Glück, daß der Name Mrożek selbst denjenigen bekannt war, die noch nie ein Buch von mir in der Hand gehabt hatten. Was für eine Ehre!
Der dritte Grund war der Umstand, daß ich während der langen Jahre im Ausland sehr selten von mir hören ließ. Zunächst, weil ich in der Volksrepublik Polen eine persona non grata war, und dann einfach aus Desinteresse. Das gilt vor allem für die sieben Jahre, die ich in Mexiko verbrachte. Allein die Entfernung machte den Informationsaustausch zwischen Polen und mir nicht gerade einfach. Kein Wunder also, daß die Neugier meiner Landsleute nach meiner Rückkehr groß war, wenigstens für kurze Zeit.
Der vierte Grund war der Ruhm, der mir im Ausland zuteil wurde. Obwohl dieser Ruhm übertrieben war, erfüllte er meine Landsleute mit Stolz. Es gab schließlich nicht sehr viele erfolgreiche Auslandspolen.
Der fünfte Grund war, daß ich seit dreiunddreißig Jahren im Westen lebte und niemand erwartete, daß ich – und dazu noch so plötzlich – zurückkehren würde. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ich meine Rückkehr beschlossen hatte, und dem Moment der Rückkehr waren ja nur vier Monate vergangen. Dazu kehrte ich aus Mexiko, einem sehr weitentfernten Land, zurück.
Und der sechste Grund schließlich war der, daß damals niemand von den bedeutenden Menschen nach Polen zurückkehrte.
Warum keimte also der Gedanke ›Was mache ich hier eigentlich?‹ gleich am ersten Tag nach der Rückkehr in meinem Kopf auf? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Fangen wir mit dem Einfachsten an:
Im Jahre 1978 schrieb ich ein Drehbuch, nach dem später mein Film Die Rückkehr entstand. Weder zu diesem Zeitpunkt noch irgendwann später kam es mir in den Sinn, daß ich nach Polen zurückkehren würde. Dennoch war es ein prophetisches Drehbuch. Es ist die Geschichte eines Mannes im besten Alter, der in einer slowenischen Kleinstadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Damals, während der Regentschaft von Kaiser Franz Joseph, gehörte Slowenien der österreichischen Monarchie an. Der Film beginnt im Jahre 1903, und der Protagonist lebt seit langem in Wien. Er hat den Status eines bekannten Dramatikers erreicht und schreibt auf deutsch. Auf einmal bekommt er ein Telegramm von seiner Schwester, die weiterhin in der Provinz lebt. Aus dem Telegramm erfährt er, daß es der Schwester sehr schlecht geht. Beunruhigt, fährt er, ohne zu zögern, in die Provinz, natürlich mit dem Zug. Er wird von seiner Freundin begleitet. Später ergeben sich daraus verschiedene Komplikationen, doch ich möchte mich jetzt auf die Szene beschränken, in der mein Protagonist namens Leo den Doktor aufsucht:
»DOKTOR
Ich habe gehört, daß Sie uns mit Ihrem Besuch beehren. Darüber wird schon in der Stadt geredet. Eine große Ehre. (…) Nun, und wie haben Sie uns nach so langer Abwesenheit vorgefunden, Maestro? Es sind ja schon zehn Jahre her, scheint mir …
LEO
Fünfzehn.
DOKTOR
Wie die Zeit rast …! Und nun, wie? Haben Sie es geschafft, sich umzusehen? Was ist Ihr Eindruck?
LEO
Ich bin erst seit ein paar Stunden hier.
DOKTOR
Ein gräßliches Loch, was?
LEO
Es ist meine Heimatstadt.«
Dann wird Leo krank. Er liegt auf dem Sofa im Hotel. Der Doktor untersucht seine Lunge. Er richtet sich auf und legt das Stethoskop in sein Arztköfferchen.
»DOKTOR
Symptome wie im Anfangsstadium von Asthma. Ansonsten kann ich, ganz allgemein gesprochen, bei Ihnen nichts Anormales entdecken. Hatten Sie je eine Neigung zur Epilepsie?
LEO
Nein.
DOKTOR
Hm … Aber es gibt doch eine Erklärung. Solange das psychosomatische Gleichgewicht nicht angetastet wurde, brauchte sich so eine verborgene Veranlagung nicht zu zeigen. Sie haben eine sensible Konstitution. Bei Ihrer Geburt und die ersten zwanzig Jahre lang waren das hiesige Klima und die Bedingungen hier für Sie normal. Dann fand ein gewaltsamer Wechsel statt. Eine erste Erschütterung, deren Sie sich vielleicht gar nicht bewußt waren, weil Sie noch ein junger Mann waren. Jetzt haben wir wieder eine Krise, diesmal eine der Wiederanpassung. Aber diesmal, wenn wir Ihr Alter berücksichtigen …
LEO
Um so mehr sollte ich von hier weg.
DOKTOR
Natürlich, aber das hätten Sie gleich nach der Ankunft machen müssen. Ich habe Ihnen das ja geraten, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt ist es zu spät.
LEO
Wieso zu spät?
DOKTOR
Sie gewöhnen sich hier und da schwer ein. Ihr Organismus erträgt den Wechsel vom Gewohnten zum Fremden besser als vom Fremden, an das Sie sich inzwischen irgendwie wieder gewöhnt haben, zum früher Gewohnten, das Ihnen inzwischen wieder fremd geworden ist. Jetzt würden Sie den Wechsel von der unvollkommenen Wiederanpassung zur weiteren Neuanpassung irgendwo sonst noch schlechter ertragen. Ein neuer Wechsel könnte jetzt Ihren Organismus völlig durcheinanderbringen.
LEO
Das heißt, daß ich für immer hierbleiben muß?
DOKTOR
Das habe ich nicht gesagt. Aber ganz sicher muß man warten, bis das erste akute Stadium der Beschwerden vorbei ist. Deshalb würde ich Ihnen nicht raten, sich mit der Abreise zu beeilen. Besonders da …
LEO
Besonders da?
DOKTOR
Besonders da wir es mit noch einem Element zu tun haben, das mir Sorgen macht.
LEO
Und zwar?
DOKTOR
Eine endgültige Diagnose erfordert eine etwas längere Beobachtung.«
Genau achtzehn Jahre später, als ich ›für immer‹ nach Krakau zurückkehrte, begriff ich, wie prophetisch diese Worte waren. Es wurde mir auch folgendes klar: Je länger man in der Fremde bleibt, desto schwieriger ist es, sich wieder an die Heimat zu gewöhnen. Doch es war nicht allein das, was mir die Zeit in Krakau schwer-, manchmal gar unerträglich machte.
Erst jetzt, im Alter von sechzig Jahren, begriff ich, daß das Leben nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt geradlinig verläuft. Mit der Zeit macht die Linie einen leichten Bogen, um schließlich einen Kreis zu bilden. Ich hatte ein Alter erreicht, in dem dieser Wechsel bereits vollzogen war. Es wurde Zeit, auf alles, was einst neu und unbekannt war, auf alles, was der Mühe wert war, zu verzichten. Die Fortsetzung sollte nur eine Art Parodie meines psychischen Zustands in alten Dekorationen sein.
Eine andere Kategorie dieses Zustands bildete die Obsession der ›wiederkehrenden Geistern Vom 3. bis zum 29. Lebensjahr hatte ich in Krakau gelebt. Der Rest der Zeit, den ich in Borzęcin und Poronin verbracht hatte, wo mein Vater Postbeamter gewesen war, zählte kaum. Ich hatte also sechsundzwanzig Jahre lang Krakau nicht verlassen. Im Laufe dieser Jahre hatten sich viele scheinbar unwichtige Ereignisse angesammelt, dann war ich weggegangen, sehr weit weg, und hatte dreiunddreißig Jahre auf verschiedenen Kontinenten gelebt. Nun war ich wieder in der Stadt an der Weichsel. Einer Stadt, die man an einem einzigen Tag und ohne Eile zu Fuß umgehen kann. Sobald ich also aus dem Haus ging, plagten mich diese ›wiederkehrenden Geistern Das äußerte sich so, daß mir die Zeit doppelt erschien: als Gegenwart und als die Zeit der Erinnerung. Ich sehe zum Beispiel, während ich die Marienkirche passiere, daß mir ein junger Mann entgegenkommt. Wir nähern uns einander, und plötzlich wird mir klar, daß dieser junge Mann ich selbst bin. Nur daß uns der Altersunterschied von vierzig Jahren trennt. Der junge Mann verschwindet, bevor ich es schaffe, ihn anzusprechen.
Anfangs erschienen mir diese ›wiederkehrenden Geister‹ mehrmals am Tag. Dann nur noch ab und zu. Schließlich verschwanden sie ganz.
Die Veränderungen, die ich beobachtete, betrafen hauptsächlich den Alltag der Krakauer. Ihre Kleidung war anders, genauso ihr Essen und sogar – in den neuen Stadtteilen – ihre Art zu wohnen. Doch was am wichtigsten war, das Land hieß nicht mehr Volksrepublik Polen, sondern einfach nur Polen. Es bestand kein Zweifel, daß es positive Veränderungen waren. Auf der anderen Seite gab es aber auch Dinge, die genau die gleichen geblieben waren. Etwa der Krakauer Akzent, den ich kannte, seitdem ich das Sprechen gelernt hatte. Die gleiche Überheblichkeit im Umgang mit Ankömmlingen aus anderen Teilen Polens, die Neigung also, sich für etwas Besseres zu halten. Der gleiche Partikularismus. Die gleiche Johannisnacht-Feier im Sommer und die gleichen Bälle im Winter. Früher, als ich noch ein Teil von Krakau war, nahm ich all das gern in Kauf. Jetzt aber, nachdem ich in der Welt herumgereist war, kam mir das lächerlich vor.
Doch das Problem war nicht die Rückkehr nach Krakau. Solange ich im Ausland lebte, konnte ich über Polen sagen, was immer ich wollte. Ich war dort allein, den Rest der Bevölkerung bildeten Menschen, die eine andere Sprache sprachen. Als ich zurückkehrte, hatte ich die Wahl: entweder schweigen oder zu meinen Landsleuten sprechen, dabei aber auf meine Worte achten, denn wir sind sechsunddreißig Millionen, und jeder Pole könnte einer anderen Meinung sein. Die typischen Emigranten, das sind die, die Polen übertrieben lieben und sich bemühen, auch ihre Kinder in diesem Geist großzuziehen. Aber nur nach außen. Nach innen denkt jeder das Seine, ohne es vor jemandem offenbaren zu wollen oder zu können. Nicht einmal vor sich selbst. Dies zeugt von Naivität, denn fremde Menschen haben andere Dinge im Kopf, und sie würden sich ohnehin wundern, wenn sie erführen, daß die Polen ihr Land so sehr lieben. Es ist eine polnische Manie, zu glauben, daß andere, und zwar überall auf der Welt, sich für uns interessieren würden.
Während all der Auslandsjahre schwieg ich zum Thema Polen. Ich beantwortete nur höflich die Fragen, die mir von Fremden gestellt wurden. Übrigens fielen diese Fragen eher selten und auch nur aus Höflichkeit. Daraus schließe ich, daß die Kenntnis Polens im Ausland gering ist und daß es keinen Sinn hat, sie den Ausländern gegen ihren Willen zu vermitteln.
Kurz nach meiner Rückkehr mußte ich einem Landsmann, den ich zufällig traf, etwas über die fernen Länder erzählen. Ich erzähle nicht gern, ich höre lieber zu. Ich gehe davon aus, daß ich beim Erzählen nichts erfahren kann, was ich nicht schon weiß, während ich beim Zuhören sehr viel Neues erfahren könnte. Doch der Landsmann war neugierig, was auch sein gutes Recht war. Andernfalls hätte er nichts Neues erfahren können. Ich versuchte allerdings, nicht zu detailliert zu erzählen, denn ich kannte die Überempfindlichkeit des Landsmanns in bezug auf alles Fremde. Man wußte nie, welche Geschichten ihn kränken könnten.
Sonst aber ahnte ich eine weit gefährlichere Sache. Man erwartete, daß ich mich nach meiner Rückkehr zu ›prinzipiellen Fragen‹ äußern würde. Die ›prinzipiellen Fragen‹, das war das, worüber die meisten Polen schrieben und sprachen, ohne im Grunde die geringste Ahnung von der Materie zu haben. Sie quasselten dennoch ununterbrochen, denn keine Meinung zu haben gilt bei uns als Mangel an Kultur und guter Erziehung und überhaupt als etwas Undemokratisches.
Kurz nach meiner Rückkehr unterschrieb ich mit Gazeta Wyborcza (Wählerzeitung) einen Vertrag über allwöchentliche Feuilletons. Später erschienen diese Feuilletons alle zwei Wochen. Unsere Zusammenarbeit wurde vor drei Jahren wegen meiner Krankheit plötzlich unterbrochen. Doch bis dahin hatte ich über fünf Jahre diese Feuilletons geschrieben, und erst heute sehe ich, mit welch deprimierendem Ergebnis. Man sieht daran die ganze Befangenheit und Ungeschicktheit der Situation eines Rückkehrers. Es wirkt, als würde ich gute Miene zum schlechten Spiel machen. Es dauerte fast fünf Jahre, bis ich mich an Polen wieder gewöhnt hatte.
Meine Feuilletons aus den Jahren 1997–1999 sind in Buchform erschienen. Sie sind nicht sonderlich gelungen, und ich würde mich nur zu einigen von ihnen bekennen, wenn ich sie im Ausland geschrieben hätte. Die Ratlosigkeit angesichts des polnischen Themas und die fremde Perspektive stechen nach sieben Jahren selbst mir, dem Autor, stark ins Auge.
Die prinzipiellen Fragen … Ich kann mich nur noch schwach daran erinnern, was damals von mir erwartet wurde. Polen ändert sich ständig und immer schneller. Tatsache ist, daß ich zu diesem Zeitpunkt sehr in Mode war und daß man verschiedene Dinge von mir erwartete. Man wollte zum Beispiel – was ich heute bekanntgeben kann und was unglaublich klingt –, daß ich die Direktion eines der beiden größten Theater Polens übernähme. Oder ich sollte von der Stadt Krakau, als Zeichen der Dankbarkeit der Nation, ein Appartement annehmen und dort einziehen. Das ist nicht lustig, ich sehe darin durchaus eine ernsthafte Sache. Es ist ein Beweis für die rührende Naivität der Polen. Sie sind bereit, in ihrer ersten Herzensregung und ihrer Gastfreundschaft einem Ankömmling viel zu schenken, um es dann gleich bitter zu bereuen. Es spielt auch keine Rolle, ob ich all diesen Ehrungen gerecht geworden wäre oder nicht. Außerdem können offenbar mit einem solchen Empfang auch ganz gewöhnliche Hochstapler rechnen.
Eines steht fest: In diesen sieben Jahren meines neuen Lebens in Polen erfuhr ich keinerlei Anzeichen von Haß oder auch nur Neid. Dabei war ich auf diese Eventualität durchaus vorbereitet. Und dafür bin ich den Polen wirklich dankbar.
Und schließlich der letzte und wichtigste Grund meiner Rückkehr. Das letzte Stück, Lauter Sünder (Wielebni), schrieb ich im Jahre 1996 in Mexiko. Es war also an der Zeit, ein neues Stück zu verfassen. Im Herbst 1998 fuhr ich dazu nach Nieborów. Und hier stellte sich heraus, daß das Problem größer war, als man hätte meinen können. Wenn es stimmt, was der Kritiker Jan Błoński während meines Auslandsaufenthalts geschrieben hatte, dann stellten sich die Dinge folgendermaßen dar:
Als ich in den Westen kam, gingen sieben dramatische Werke auf mein Konto, darunter aber nur ein einziges, das halbwegs abendfüllend war. Der Rest waren Kleinigkeiten, aus der Perspektive des Spielplans nur als einzelne Akte verschiedener Stücke einzustufen. Die eigentliche Karriere machte ich erst im Ausland, indem ich fast zu lange Sachen schrieb, bestehend aus drei soliden Akten und für die Aufführung an diversen Theatern geeignet. Und dazu hat Jan Błoński eine interessante Bemerkung gemacht: Ich würde so schreiben, als könnte ich den Inhalt niemals in einem ›natürlichen Zustand‹ ertragen, immer nur in einem ›übernatürlichen‹. Daß ich mich also immer auf das Niveau des Absurden, des Grotesken, des Sonderbaren und Schrägen erheben müßte. Erst wenn ich eine ungewöhnliche und rätselhafte Sache entdeckt hätte, könnte ich das Thema frei entfalten.
Da war etwas dran. Ich hatte zwar im Laufe der Zeit bewiesen, daß ich die Wirklichkeit durchaus auch in ihrem natürlichen Zustand beschreiben kann – ich tat es zum Beispiel in Form des besagten Drehbuchs –, doch die Erinnerung an Jan Błońskis Worte wurde trotz der vergangenen dreißig Jahre wieder lebendig, und das beunruhigte mich. Sollte ich etwa nach meiner Rückkehr nach Polen auf dasselbe Problem stoßen, das mich schon vor der Ausreise geplagt hatte?
Das neue Stück schloß ich im Mai 1999 ab. Es trug den Titel Abrahams Gäste (Goscie Abrahama) und wurde bis dato von keinem Theater aufgeführt, weder in Polen noch sonstwo auf der Welt. Es stimmt zwar, daß es vom polnischen Fernsehen inszeniert wurde, doch jeder Dramatiker weiß, daß das nicht dasselbe ist. Diese Mißachtung empfand ich anfangs als Niederlage, was kaum verwunderlich war: Zum ersten Mal seit meiner Jugendzeit wurde mein Stück von den Theatern ignoriert, und zwar in jeder Sprache. Nicht jeder Autor endet auf diese Weise. Es gibt solche, die in dem Bewußtsein sterben, daß in diesem Moment eines ihrer Stücke auf einer Bühne gespielt wird. Allerdings bin ich, zum Glück, noch nicht gestorben.
Es bleiben zwei Erklärungen. Doch ich möchte von vornherein klarstellen, daß ich mich für keine von ihnen entscheide.
Die erste Erklärung: Meine Zeit ist abgelaufen. Es wäre nichts Ungewöhnliches daran, schließlich schreibe ich seit fünfzig Jahren Theaterstücke. Die ersten Anzeichen der nachlassenden Popularität registrierte ich bereits vor etlichen Jahren, noch in Mexiko. Obwohl ich damals zurückgezogen, ohne Kontakt zu irgendwelchen Kreisen lebte, merkte ich es natürlich, doch mit der gleichen Einstellung, also ohne die Kreise zu beachten, schrieb ich weiter. Erst während meiner Besuche in Europa, bei Premieren und in den sich daraus ergebenden Situationen, konnte ich mich endgültig davon überzeugen. Dennoch kehrte ich nach Mexiko zurück, um weiter im Zustand der Seligkeit zu verharren, bis mein plötzlicher Umzug nach Polen es mir dauerhaft bewußt machte.
Es ist allerdings schwierig, von jemandem zu behaupten, seine Zeit sei ›abgelaufen‹. Noch schwieriger ist es, wenn es sich um einen Dramatiker handelt, vor allem um einen wie mich. Da sind zu viele verschiedene Umstände miteinander verflochten. Man kann nur allgemein sagen, daß die Zeit zweifellos vorbei ist – und als Begründung hinzufügen: weil alles irgendwann vorbei ist.
Die zweite Erklärung ist subtiler. Solange ich in Polen lebte, unterlag ich dem von Jan Błoński vermuteten Prinzip. Nach meiner Ausreise wurde die Welt für mich um einiges größer, und infolge dessen begann ich, deren Vielfalt wahrzunehmen. Ich konnte sowohl über Absurdes als auch über die Wirklichkeit in ihrem ›natürlichen Zustand‹ schreiben. Doch als ich nach Polen zurückkehrte, tappte ich wieder in die alte Falle.
Diese Theorie läßt das Reifen eines Individuums außer acht. In diesem Fall wäre das Individuum ich selbst, und die Frage, ob ich mich zu diesem Zeitpunkt in Polen oder in einem anderen Land befand, wäre nebensächlich.
Auf der anderen Seite setzt diese Theorie einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem damaligen Polen und den westlichen Ländern voraus. Polen war eine ›Volksrepublik‹, und davon, was das bedeutete, zeugen die Erinnerungen der Betroffenen, mich selbst eingeschlossen. Polen trug damals alle Züge, die für das russische Imperium typisch waren – völlig anders als heute, da es Mitglied der Europäischen Union ist. Deshalb kann ich sagen: Polen war damals eingeschränkt. Ich kann aber auch die Behauptung riskieren: Polen ist immer eingeschränkt, ungeachtet des politischen Systems.
Hier möchte ich anmerken, daß Polen für mich eine Art Atemlosigkeit bedeutet, es ist, als würde das, was so vertraut ist, mir gleichzeitig den Schreibimpuls rauben.
Kehren wir aber zur Gegenwart zurück, von der ja dieses Buch handeln soll. Doch bevor ich meinen Bericht fortsetze, sei es mir erlaubt, mich in die Vergangenheit zu vertiefen.
Mein frühes Krakau
Anfangs war Krakau überhaupt nicht klein. Als ich noch nicht laufen konnte, stellte es für mich die ganze Welt dar. Um ehrlich zu sein, hatte ich das Laufen noch in Borzęcin und Poronin gelernt, wo mein Vater, wie gesagt, die Stelle eines Postbeamten bekommen hatte. Nach Krakau kamen wir, als ich drei Jahre alt war. Wir ließen uns im Stadtteil Prokocim nieder. Man muß bedenken, daß all das über siebzig Jahre zurückliegt. Um es sich vor Augen zu führen, genügt es, sich einen Film anzusehen, dessen Handlung um 1930 spielt. Amüsante Kleider, eigenartige Möbel, eine leicht antiquierte Architektur, all das wirkt etwas sonderbar. Wie wenige Einwohner Krakau damals doch hatte! Im Vergleich zu heute war es geradezu leer. Daher auch der Eindruck der allgegenwärtigen Provinzialität, obwohl es damals nicht mehr Provinzialität gab als heute.
Krakau war die erste Stadt in meinem Leben. Der Unterschied zwischen Stadt und Land war in jenen Zeiten viel größer als heute. Allein die Tatsache, daß ich auf Kopfsteinpflaster oder auf dem Asphalt und nicht auf einer Landstraße lief, war für mich ein unvergeßliches Erlebnis. Es kam hinzu, daß es in meiner Kindheit auf dem Lande noch kein elektrisches Licht gab.