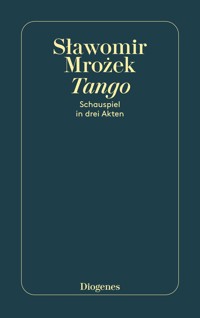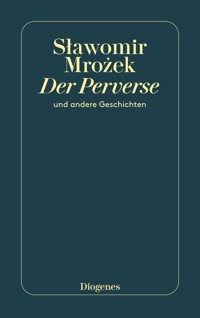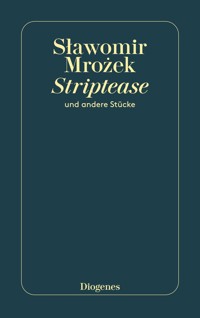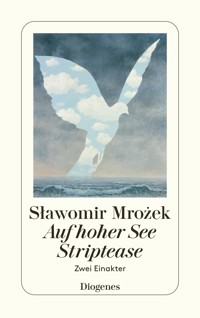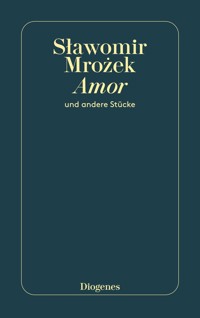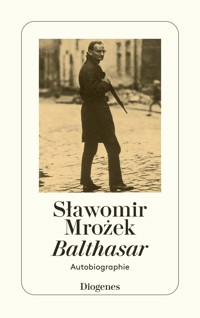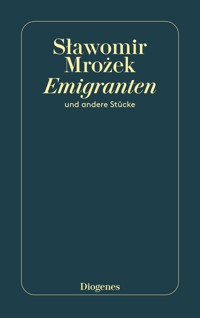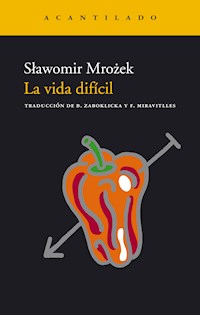1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Minute Books
- Sprache: Deutsch
»Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst«, so Goethe – wirklich hilfreich ist das jedoch nicht. Mrozek lässt uns dagegen nicht im Stich. In diesem Buch werden alle lebenswichtigen Themen abgehandelt, von A wie Abwechslung, Anarchie und Angst über Fortschritt, Frauen, Freiheit, Rente und Revolution bis Tod, Tourismus, Ungerechtigkeit und Wahrheit. Mrozek weiß immer Rat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Das Leben für Anfänger
Ein zeitloses ABC
Diogenes
Abwechslung
Die Revolution
In meinem Zimmer stand das Bett hier, der Schrank dort und der Tisch dazwischen. Bis mir das langweilig wurde. Ich rückte das Bett dorthin und den Schrank hierher.
Eine Weile spürte ich die belebende Strömung des Neuen. Doch nach geraumer Zeit – wieder Langeweile.
Ich gelangte zu dem Schluss, die Quelle der Langeweile sei der Tisch oder vielmehr seine unveränderte mittlere Stellung. Darum schob ich den Tisch dorthin und das Bett in die Mitte. Nonkonformistisch.
Das erneute Neue belebte mich von neuem, und solange das andauerte, war ich zufrieden mit der nonkonformistischen Unbequemlichkeit, die es zur Folge hatte. Ich konnte jetzt nämlich nicht mehr mit dem Gesicht zur Wand schlafen, was stets meine bevorzugte Lage gewesen war.
Doch nach einer Weile hörte das Neue auf, neu zu sein, nur die Unbequemlichkeit blieb übrig. Deshalb verschob ich das Bett hierhin und den Schrank in die Mitte.
Endlich eine radikale Änderung. Denn der Schrank mitten im Zimmer, das war mehr als nonkonformistisch. Geradezu avantgardistisch.
Aber nach einiger Zeit … Ach, gäb’s nur nicht dieses ›nach einiger Zeit‹! Kurz und gut, auch der Schrank mitten im Zimmer hörte für mich auf, etwas Neues und Ungewöhnliches zu sein.
Man musste einen Durchbruch erzielen, einen Grundsatzentschluss fassen. Wenn im gegebenen Rahmen keine echte Veränderung möglich ist, muss man ganz aus dem Rahmen treten. Wenn das Nonkonformistische nicht genügt, wenn das Avantgardistische erfolglos ist, muss man zur Revolution schreiten.
Ich beschloss, im Schrank zu schlafen. Jeder, der einmal versucht hat, stehend im Schrank zu schlafen, weiß, dass man in dieser unbequemen Lage überhaupt nicht einschlafen kann, gar nicht zu reden vom Kribbeln in den Füßen und von den Schmerzen im Rücken.
Ja, das war der richtige Entschluss. Der Erfolg, der volle Sieg. Denn diesmal trat der bekannte Effekt auch ›nach einiger Zeit‹ nicht ein. Ich gewöhnte mich nach einiger Zeit nicht nur nicht an die Veränderung, die Veränderung blieb Veränderung, ich empfand die Veränderung im Gegenteil immer stärker, weil die Schmerzen mit dem Ablauf der Zeit stärker wurden.
Alles wäre somit vorzüglich gewesen, hätte sich meine psychische Durchhaltekraft nicht als begrenzt erwiesen. Eines Nachts hielt ich es nicht mehr aus. Ich verließ den Schrank und legte mich ins Bett.
Ich schlief dreimal rund um die Uhr. Darauf schob ich den Schrank an die Wand und den Tisch in die Mitte, denn der Schrank mitten im Zimmer störte mich.
Jetzt steht das Bett wieder hier, der Schrank wieder dort und der Tisch dazwischen. Wenn mir Langeweile zusetzt, erinnere ich mich der Zeiten, als ich ein Revolutionär war.
Anarchie
Tee oder Kaffee
»Tee oder Kaffee?«, fragte die Dame des Hauses.
Ich mag das eine wie das andere, und hier befahlen sie mir auszuwählen. Das hieß, sie geizten entweder mit Kaffee oder mit Tee.
Ich bin gut erzogen, also ließ ich mir nicht anmerken, dass ich einen derartigen Geiz verabscheue. Ich war gerade mitten im Gespräch mit dem Professor, meinem Tischnachbarn, den ich von der Überlegenheit des Idealismus dem Materialismus gegenüber überzeugte, und tat so, als hätte ich die Frage nicht gehört.
»Tee«, sagte der Professor, ohne zu zögern. Natürlich, dieses Mistvieh war ein Materialist und drängelte sich gleich an den Fresstrog.
»Und Sie?«, wandte sie sich an mich.
»Entschuldigung, ich muss mal raus.«
Ich legte die Serviette hin und ging zur Toilette. Ich musste überhaupt nicht, aber ich wollte überlegen und Zeit gewinnen.
Wenn ich mich für Kaffee entscheide, dann verliere ich den Tee und umgekehrt. Wenn die Menschen frei und gleich geboren werden, dann sind es Kaffee und Tee auch. Wenn ich Tee nehme, dann fühlt sich der Kaffee zurückgesetzt und umgekehrt. Eine solche Verletzung des Naturgesetzes des Kaffees, oder auch des Tees, widersprach meinem Gerechtigkeitsgefühl als der übergeordneten Kategorie.
Ich konnte aber nicht endlos in der Toilette sitzen, sei es auch nur deshalb, weil das nicht die reine Idee einer Toilette war, sondern eine allgemeine Toilette beziehungsweise eine gewöhnliche Toilette mit Kacheln. Als ich ins Esszimmer zurückkam, tranken bereits alle entweder Tee oder Kaffee. Mich hatte man ganz offensichtlich vergessen.
Das traf mich tief. Keinerlei Aufmerksamkeit, keinerlei Toleranz für das Individuum. Nichts kann ich so wenig leiden wie eine seelenlose Gesellschaft; ich lief also in die Küche, um die Menschenrechte einzufordern. Als ich auf dem Tisch einen Samowar mit Tee sowie eine Kaffeemaschine sah, erinnerte ich mich, dass ich das ursprüngliche Dilemma noch nicht gelöst hatte: Tee oder Kaffee, oder auch Kaffee oder Tee. Natürlich sollte man das eine oder das andere fordern, statt dem Kompromiss einer Wahl zuzustimmen. Ich bin aber nicht nur gut erzogen, sondern auch sehr zartfühlender Natur. Also sagte ich höflich zur Dame des Hauses, die in der Küche herumwirtschaftete: »Bitte halb und halb.«
Dann schrie ich: »Und ein Bier!«
Angst
Auf dem Turm
Der Herr hatte sich auf seiner Burg verschanzt. Aus dem höchsten Gemach auf dem höchsten Turm betrachtet er durch die Schießscharte seine Ländereien.
Ganz in der Ferne die Wälder. Bläulich am Horizont, werden sie erst schwarz, wenn der Blick sich näher schiebt. Dann stehen sie im Gesichtskreis als schwarze Wand.
Durch die Wälder zu gelangen ist schwierig. Es gibt dort keine Wege, und ein Angreifer könnte nicht hindurchkommen, ohne seine Belagerungsmaschinerie und seinen Tross zu verlieren. Zunächst also schützen die Wälder den Burgherren.
Vor dem Wälderkreis die grünen Auen. Doch ihr Grün ist zu grün, ein gesteigertes Grün, zu aufdringlich grün, um bei jemandem, der ihr wahres Wesen nicht kennt, Vertrauen zu wecken. Denn das sind keine Auen, sondern grundlose Moore, obenauf von echtem Grün bedeckt.
Wer die Pfade nicht kennt, versinkt in ihnen. Darum – selbst wenn die Wälder enttäuschen sollten, die Moore schützen den Burgherren.
Die Burg aber steht auf dem Berg, und der Berg ist unten mit Palisadenreihen umgeben, deren Pfähle scharf zugespitzt sind. Vor der Palisade ein tiefer, mit Wasser gefüllter Graben, ein zweiter auf der Innenseite. Zufrieden blickt der Burgherr auf diesen dreifachen ersten Verteidigungsring.
Von der Zugbrücke führt ein schmaler Weg, in den Felsen gehauen, in Windungen steil hinauf. Ganz oben sind die Burgmauern noch höher und überragen die unzugängliche Senkrechte der Felsen. Mächtige Mauern, mit Zinnen und Schießscharten, Basteien und Türmchen gekrönt, auf die der Burgherr von noch weiter oben herabblickt. Und er freut sich, dass dieser zweite Verteidigungsring ihn noch besser schützt als der erste, weil er nun schon völlig unzugänglich und unbezwingbar ist.
Er denkt sich: Sollte der Feind durch ein unbegreifliches Wunder diese Mauern überwinden, droht mir immer noch nichts, kann ich immer noch ruhig sein. Denn dann steht der Feind zu Füßen der Zitadelle, vor der inneren Burg, der Burg in der Burg, das heißt vor dem höchsten Turm, der von den übrigen Befestigungen unabhängig ist, die dicksten Mauern hat und, mit eigenen Vorräten ausgerüstet, sogar der längsten Belagerung standhält. Eindringen kann man in ihn nur einzeln, auch wenn man die schmale, aus drei Schichten Eichenholz gefertigte und eisenbeschlagene Tür einrennt; wie groß immer die Zahl der Eindringlinge sein mag, stets wird nur ein einzelner eindringen können, um sogleich von der Hand der zahlreichen Verteidiger zu sterben. Von dem geräumigen Flur aber führt wieder nur eine schmale Treppe zu den höher und noch höher gelegenen Gemächern. Es ist eine Wendeltreppe, eingefügt ins Innere der dicken Mauern, darum kann man nur frontal und einzeln aufwärts vordringen, was durch die Tatsache erschwert wird, dass die Verteidiger ihre Schläge leichter, nämlich von oben, austeilen können und die Angreifer, die dem ersten von ihnen folgen, die Verteidiger nicht einmal sehen, geschweige denn ihre Spieße und Armbrüste gebrauchen können. Listig gebaut ist das, denkt der Burgherr und fühlt sich noch mehr, beinahe schon vollkommen sicher. Er weiß, kein Feind wird ihn durch diesen dritten, stärksten, völlig senkrechten Verteidigungsring vom Himmel bis zur Erde erreichen.
Er wendet sich von der Schießscharte ab, hinter der die ferne, zum Glück so ferne Linie des Horizonts dunkelt, und blickt hinunter vor seine Füße auf die erste, zweite, dritte Stufe der abwärts führenden Treppe. Denn er steht im obersten Gemach, und vor seinen Füßen enden die Stufen, unter ihm ist im Fußboden der tiefe Schacht der Treppe. Und er denkt: Mögen selbst meine braven Soldaten sterben, hier bin ich ganz allein jedem Angreifer überlegen. Niemand wird mich hier erreichen, denn niemand wird höher gelangen als bis auf die Höhe meiner Füße.