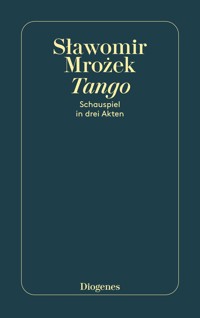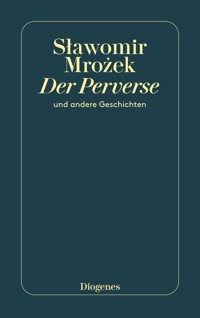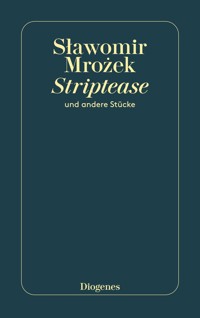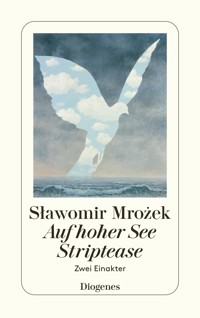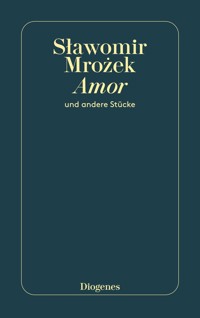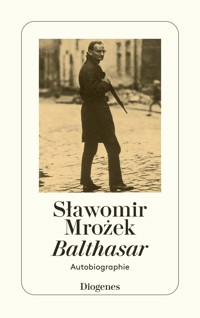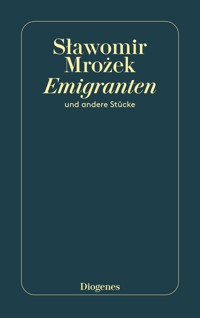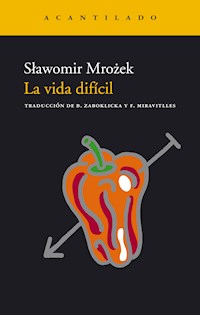7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Lolo‹ drückt immer die richtigen Tasten, die, die den Herrn mit dem Bart zufriedenstellen – und dann gibt's Speck. Aber nur für Lolo. Doch eines Tages hat Lolos Freund, die andere Laborratte, die immer hungriger wird, weil sie nicht die richtigen Tasten zu drücken versteht, eine Methode gefunden, um auch was abzukriegen… In ›Monisa Clavier‹ lauert ein polnischer Tourist einem westlichen Filmstar auf. Nun kommt es darauf an, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Da dem komplexbehafteten polnischen Jüngling dies nicht gelingen will, gibt er sich auf einer Party gläserschmetternd als Russe aus, denn Russen scheinen im Westen den Exotik-Bonus zu genießen. Zwar erreicht der junge Pole so sein primäres Ziel, doch fangen die Probleme nun erst an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Lolo
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Christa Vogel, Ludwig Zimmerer und Witold Kośny
Diogenes
Lolo
Ach, dieser Lolo.
Wie der es versteht, auf die Tasten zu drücken. Das heißt, auf die richtigen Tasten, denn drücken, das kann sogar ich. Aber wir werden ja nicht deswegen hier gehalten, Lolo und ich, daß wir auf irgendwas oder irgendwie drücken. Wenn es nur darum ginge, brauchte man kein Wort darüber zu verlieren, das heißt, wenn es hier nur richtige oder nur falsche Tasten gäbe. Aber die Idee dieses Herrn mit dem Bart beruht eben gerade darauf, und anscheinend geht es ihm nur darum, mich zu erniedrigen und Lolo zu erhöhen, daß es zweierlei Arten von Tasten gibt. Eine, auf die man drücken, und eine, auf die man nicht drücken soll, was um so schlimmer ist, als sie sich überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, sie unterscheiden sich nicht bis zu dem Moment, in dem man auf eine drückt. Danach zeigt sich der Unterschied, ach, allzu sichtbar. Wenn man nämlich auf die richtige Taste drückt (das heißt, wenn Lolo drückt, denn mir wird das nie gelingen), öffnet sich eine Klappe, und ein Stück Speck springt heraus, das der verzehrt, der auf die Taste gedrückt hat – das heißt Lolo. Wenn man aber auf die falsche Taste drückt (auf die, auf die ich immer drücke, obwohl ich immer auf eine andere drücken möchte), öffnet sich nichts.
Warum ist das so? Warum gelingt es mir nie, auf die entsprechende richtige Taste zu drücken? (Während es ihm immer gelingt.) Der Herr mit dem Bart, der das alles so angeordnet hat, hat uns ja die Freiheit gelassen, auf jede beliebige Taste zu drücken, ich habe also die Wahl. Mehr noch – der Herr scheint von mir zu erwarten, ja selbst zu fordern, daß ich auf die richtige Taste drücke. Womit soll man erklären, daß ich nicht so drücke, wie es sich gehört, während Lolo es tut? Doch nur damit, daß es Lolo versteht und ich nicht. Das heißt: daß ich dümmer bin als Lolo.
Um nicht Hungers zu sterben, muß ich mich anders behelfen. Und zwar so:
Eben haben Lolo und ich auf die Tasten gedrückt, aber mit verschiedenem Resultat, wie ich es oben beschrieben habe. Lolo hält in seinen Vorderpfoten ein Stück lecker duftenden Specks (für mich duftet er viel leckerer als für ihn, denn ich bin hungrig und er nicht), ich dagegen habe leere Pfoten, und es rumpelt in meinem Bauch. Er macht sich nicht gleich ans Essen (er ist satt und vollgefressen, die Bestie); ich würde mich gern ans Essen machen, aber ich habe nichts, woran ich mich machen könnte. Der Speck befindet sich in Lolos Händen. Also sage ich:
»Weißt du, Lolo, ich bewundere dich. Du bist klug und so intelligent, daß das winzige kleine bißchen Stückchen Verstand, das ich besitze, kaum ausreicht, um das zu erfassen und zu schätzen. Wenn ich überhaupt etwas Verstand besitze, dann wohl nur so viel, und nur aus dem Grunde, um dich bewundern zu können.«
»Hm hm …«, murmelt Lolo. »Wie bin ich?«
Der beißt an, denke ich bei mir und wiederhole:
»Du bist klug, intelligent, bedeutend, wirklich außergewöhnlich.«
»Außergewöhnlich, sagst du?« nimmt Lolo selbstgefällig meine Worte auf und macht dabei ein Gesicht, als wenn er den allerköstlichsten Speck auf der Welt äße. »Außergewöhnlich?«
»Selbstverständlich. Nehmen wir zum Beispiel mich. Ich kann nichts, weil ich dumm, beschränkt und blöd bin. Du dagegen bist genial.«
»Hm, na, da nimm«, sagt Lolo und gibt mir seinen Speck. (Er kann sich das ja leisten, denn er weiß, daß das nächste Stück Speck herausspringt, wenn er erneut auf eine Taste drückt.) Und er fügt verächtlich hinzu:
»Aber verschluck dich nicht.«
Diese Bemerkung ist wohl am Platze. Ich bin so ausgehungert, daß ich mich wirklich allzu gierig auf den Speck stürze. Aber ich kann mich nicht beherrschen, trotz Lolos Verachtung. Außerdem amüsiert ihn meine Gefräßigkeit.
»O ja, d … st groß … mäschtig … miam miam, mlam, mlam, unerhört … miam miam … wunderbar.«
Es ist schwierig, gleichzeitig zu essen und zu sprechen, aber ich weiß, daß ich reden muß, wenn ich Lolo befriedigen will. Man muß leben. Obwohl ich, wenn mich jemand fragte: »Warum muß man leben?«, auf diese Frage keine Antwort wüßte.
Lolo diskutiert gern über allgemeingültige Themen. Er hat den Kopf frei dafür, da er immer satt ist. Ich denke vor allem ans Essen, aber ich kann es ihm nicht abschlagen, wenn er plötzlich über Abstraktionen reden möchte. Das ist sein gutes Recht.
Meistens unterhalten wir uns abends, wenn das Laboratorium bereits geschlossen ist und uns niemand mehr beobachtet. Dannn fängt Lolo an:
»Meine Mission ist es, zu beweisen, daß wir fähig sind, die Macht über die ganze Welt zu übernehmen. Ratte – das klingt stolz. Ich bin unerhört intelligent, aber das ist noch gar nichts. In dem Maße, in dem ich meine Intelligenz übe, entwickle und vertiefe, nähere ich mich Resultaten, von denen die Menschheit nicht einmal geträumt hat.«
»Aber Lolo«, versuche ich schüchtern zu widersprechen. »Fürs erste sind wir im Käfig eingeschlossen.«
Er ignoriert meinen Einwurf.
»Meine Größe beweist, daß wir eine außergewöhnliche Rasse sind. Meine Berufung ist die evolutionäre Entwicklung, die mich an die Spitze der Gattung stellt und unsere Gattung an die Spitze aller anderen Gattungen. Wir müssen diese Aufgabe bewältigen.«
»Du bewältigst sie sicher. Aber ich nicht.«
»Mach dir keine Sorgen. Letztlich bist du ja auch eine Ratte, wenn auch eine dumme. Du gehörst zu derselben Rasse wie ich.«
Lolo breitet die Flügel seiner Phantasie aus. Er redet von Erfindungen, die er vollbringen wird, obwohl er sie selbstverständlich nicht präzisiert, da er noch nicht weiß, was es für Erfindungen sein werden. Aber er hat Visionen, Intuition und Enthusiasmus. So vertraut er mir zum Beispiel an:
»Mir dämmert schon etwas. Wir erfinden etwas … so etwas …« Er findet das rechte Wort nicht, er macht eine runde Geste mit den Pfoten.
»Du denkst an ein Rad?«
»Ja, ja, ein Rad!« freut er sich. »Die Erfindung des Rades öffnet uns den Weg zu anderen Erfindungen.«
»Selbstverständlich«, stimme ich scheinheilig zu. »Wir beherrschen den Kosmos. Speck.«
»Was?«
»Nichts, nichts, es ist mir nur so rausgerutscht.«
Und so plaudern wir.
Seit einiger Zeit ergreift mich eine gewisse Angst. Das ist nicht die Angst um den Speck, die ich allzu gut kenne. Das ist etwas anderes. Ich sage zu Lolo:
»Ich kann es nicht beschreiben, ich bin nur eine einfache, dumme Ratte. Aber ich höre eine Stimme, die mir sagt: Zerbeiß den Käfig, befreie dich, raus aus den Mauern, spring ins Wasser!«
»Wie dumm«, lacht Lolo. »Die Untersuchungen unterbrechen? Den Käfig zernagen? Wozu willst du ins Wasser springen?«
»Ich weiß nicht, es ist eine geheimnisvolle Stimme, die sich mir nicht vorgestellt hat. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich weiß nur, daß sie sehr befehlend klingt.«
»Um so weniger solltest du auf sie hören. Man redet nicht mit fremden Stimmen. Drück lieber auf eine Taste.«
Und Lolo drückt und erhält seinen Speck, er ißt. Ich habe keine Lust, auf irgendeine Taste zu drücken. Noch nicht einmal deswegen, weil ich sowieso nichts davon habe. Die Stimme verstummt nicht, sie kommt immer wieder, sie gibt mir keine Ruhe. Diese Stimme sagt mir, daß dieser Käfig und diese Behausung, in dem sich der Käfig befindet, und das, worin sich diese Behausung befindet, in Gefahr sind. Daß wir das alles schnellstens verlassen müssen, versuchen sollten, hinauszugelangen und zu fliehen. Ich weiß nicht, wohin, aber fliehen, fliehen, fliehen … Ich träume vom Ozean, ich sehe mich und Lolo auf dem Ozean, wir schwimmen mit zappelnden Pfoten und entfernen uns von der Gefahr. Aber er will nichts davon hören.
»Was für ein Ozean, wozu ein Ozean, bist du verrückt geworden? Auf dem Ozean ist es erst recht gefährlich.«
»Ja, ja, aber da haben wir noch eine Chance. Hier dagegen …«
»Was hier dagegen?«
»Hier kommen wir um.«
»Du vielleicht, aber ich nicht.« Er war beleidigt. »Ich mit meiner Intelligenz …«
Er hat recht. Er kann sich mit seiner Intelligenz hier gut behelfen. Und was würde er auf dem Ozean tun? Dort gibt es keine Tasten, kein Drücken, es wäre das Ende seines Prestiges. Hier kommt er nicht um, und ich komme neben ihm ebenfalls nicht um.
Weshalb also ängstige ich mich?
Narr
Herr de Calvo gab mir einen Empfehlungsbrief an den Gouverneur von San Juan. Ich machte mich auf die Suche nach einem geeigneten Schiff. Aber das einzige Schiff in Palos, das zu den Karibischen Inseln fahren sollte, flößte nicht gerade Vertrauen ein. Es war ein antiker Nachen, kaum ein Einmaster, von Würmern zerfressen. Außerdem wußte der Kapitän nicht, wann er in See stechen würde. Er verbrachte seine Zeit in Trunkenheit. Er hatte weder eine Mannschaft noch eine Ladung, noch Passagiere.
Am Himmelfahrtstag saß ich nachmittags auf der Mole und sah angestrengt gen Westen, in die Richtung, in die ich aufbrechen wollte, aber nicht konnte. Da kam von Süden her ein großes sechsmastiges Schiff mit aufgeblähten Segeln und legte im Hafen an. Das ganze Städtchen lief zusammen. So eine Herrlichkeit hatte man hier noch nicht gesehen. Es war ein ganz neues Schiff, reich geschmückt, mit drei Reihen von Kanonen und dem Kopf des Königs Salomon am Bug. Unter den entfalteten Linnen, die das Deck vor der Sonne schützten, spielte ein Orchester. Wie sich herausstellte, kam das Schiff von Cádiz und brachte Leute und Waren für den Gouverneur von San Juan. Es hatte unseren Hafen nur kurz angelaufen, um seinen Süßwasservorrat zu ergänzen, worauf es unverzüglich seine Reise fortsetzte.
Mit verständlicher Freude schloß ich mich diesem Unternehmen an. Am nächsten Morgen lichteten wir in aller Frühe die Anker. Das andere Schiff lag tot im Hafen, verlassen wie ein Wrack, das niemals mehr in See stechen wird. Ich sah ohne jedes Bedauern auf seine geschwärzten Taue, den angebrochenen Mast, die aufgequollenen Tonnen und das mit rostigen Ringen zusammengeflickte Deck, auf dem sich keine lebende Seele befand. Wie armselig erschien es doch, verglichen mit unserer Salomon.
Bald ließ die Salomon diese traurige Erscheinung im Hafen hinter sich. Dann verschwand auch der Hafen. Und danach verschmolz das Städtchen mit dem Land, bis sich auch das Land glättete und mit dem Horizont zusammenfloß. Die ganze bis dahin unermeßliche Welt schrumpfte auf die Ausmaße der Salomon zusammen.
Es stellte sich heraus, daß ein Schiff von weitem gesehen immer bedeutend größer erscheint als dasselbe Schiff, wenn es sich uns nähert. Und es ist noch kleiner, wenn wir auf sein Deck gehen, und im weiteren Verlauf verkleinert es sich in dem Maße, in dem man Zeit auf ihm verbringt.
Es verging gar nicht viel Zeit, bis ich mich in dieser begrenzten Welt zurechtfand, bis ich zu ihren Grenzen vorgedrungen war und meine weiteren Entdeckungen sich nur den Menschen zuwenden konnten, die sie bewohnten. Nur wir, die Bewohner der Salomon, nährten unsere Neugier und hielten sie gegenseitig aufrecht. Außer dem Ozean, auf dem sich unser Blick verlor, waren nur unser Leben, unsere Beschäftigungen, nur unsere Sorgen und Hoffnungen unendlich. Der Rest, dieses materielle, kleine, begrenzte Gefäß, in dem wir eingeschlossen waren, war bald bekannt.
Aber der Ozean war trotz seiner Unendlichkeit leer. Er antwortete weder unseren Worten noch unseren Gedanken. So blieben wir uns allein überlassen, wir, die Passagiere der Salomon.
Wir schlossen bald Bekanntschaften. Das war nicht schwierig, weil wir ja Tisch und Bett miteinander teilten. Wir waren gezwungen, die Schiffsnahrung aus einem gemeinsamen Kessel zu essen, den uns die Matrosen einmal am Tag aus der Kombüse in unsere Kajüte brachten. Wir schliefen Kopf an Kopf in fünfstöckigen Kojen, wie Bienen in einem Bienenstock oder eher wie Drohnen, denn da wir nicht zur Mannschaft gehörten, hatten wir nichts zu tun.
Diejenigen unter uns, die an Land solide Berufe ausgeübt hatten, waren während ihrer Seereise besonders zur Tatenlosigkeit verurteilt. Der Kaufmann konnte hier nicht handeln und der Handwerker nichts produzieren. Am allerwenigsten zu Hause fühlte sich ein Pflanzer, eben deswegen, weil weder unter uns noch irgendwo sonst mit dem Auge ein einziger Fuß Erde zu entdecken war.
Um also nicht völlig die Fassung zu verlieren, erzählten sie davon, was sie an Land getan hatten und was sie tun würden, wenn sie wieder an Land wären. Nur einige, die an Land weniger erdnahen Beschäftigungen nachgegangen waren, fühlten sich nicht so verloren auf See. Zu ihnen gehörten ein Geistlicher, ein Kunstmaler und ein Falschspieler.
Die einen erzählten von ihrer Tätigkeit, die andern bemühten sich, auch hier weiter zu wirken, aber die einen wie die andern taten, was sie konnten, um nicht die Identität zu verlieren, mit der sie auf das Schiff gekommen waren. Doch es gab einen, der sich dieser Regel nicht anpaßte.
Es war ein nicht mehr ganz junger Mann, mit einer Glatze auf der Schädeldecke, die von einem Kranz steifer grauer Haare umrahmt wurde. Er hatte ein merkwürdiges Gesicht. Auf anderen Gesichtern überwiegt der eine oder andere Ausdruck. Auf einem ist es ein Zug von Vergeistigung, auf einem andern Traurigkeit und Nachdenklichkeit, auf einem dritten Freude, auf einem vierten Schlauheit, auf einem fünften Dummheit. Und selbst wenn der eine oder andere Zug auf dem jeweiligen Gesicht nicht immer vorherrscht, so doch so oft, daß man jedem Gesicht so ungefähr einen einheitlichen Charakter verleihen kann. Statt dessen war das Gesicht dieses Mannes wie ein Gasthaus, durch das verschiedene Gestalten kommen, ohne dort je länger zu wohnen. Dieses Gesicht war auch lebendig wie ein Gasthaus, ohne jede feste Ordnung, vielleicht mit der Ausnahme, daß es manchmal leer stand. Dann machte es einen unnatürlichen und peinlichen Eindruck, eben so wie ein verlassenes Gasthaus.
Sein Beruf band ihn nicht ans Land. Er war Berufskomiker, Possenreißer und Narr. Aber wenn er uns das nicht gesagt hätte, wären wir nie darauf gekommen. Er hielt sich stets abseits und versuchte nicht einmal, uns aufzuheitern. Er hatte keine Spur von jener Natürlichkeit und Fröhlichkeit, die für einen Spaßmacher kennzeichnend sein sollten; da er nicht mehr ganz jung war, konnte man auch nicht mehr an ein hoffnungsvolles Talent glauben. Und es war nicht verwunderlich, daß er bis jetzt noch nicht Karriere gemacht hatte. Wenn er sein Glück jenseits des Ozeans suchte, dann sicher nicht deswegen, weil er in seinem Vaterland zu viel Erfolg gehabt hätte. Allgemein war bekannt, daß sich der neue Großfürst der Kolonie einen Hof nach dem Muster des königlichen Hofes bilden wollte. Da brauchte er also auch einen Narren.
Im übrigen waren wir alle entweder bereits Diener des Gouverneurs, oder wir hofften, solche zu werden; entweder direkt in seine Dienste zu treten oder auch nur auf der Insel zu landen, die er regierte. Auf die Landung wartete wohl jeder. Jeder wartete ungeduldig auf den Moment, in dem er endlich wieder einen Fuß auf die Erde setzen konnte.
Und das, obwohl die Beschwerden der Reise uns nicht übermäßig zu schaffen machten. Das Wetter war schön, und die Winde wehten günstig. So hielten wir uns meistens auf dem Deck, in Luft und Sonne auf. Ins Schiffsinnere gingen wir nur zum Schlafen und zum Essen. Hier oben verkehrte jeder auf seine Art mit den Naturgewalten Luft und Wasser sowie mit den Reisebegleitern.
Der Geistliche verband Menschen und Elemente mit Hilfe einer höheren Synthese. So unterstellte er sowohl die Menschen wie auch die Elemente einer höheren Kraft, dem Willen Gottes. Die Elemente schienen sich in dieses System ohne jeden Widerstand, aber auch ohne besondere Zustimmung einzufügen. Die Menschen dagegen machten ihm einige Sorgen. Insbesondere der Falschspieler, der sich, völlig unempfindlich für Elemente und völlig desinteressiert an jeder höheren Synthese, ganz und gar dem menschlichen Element hingab. Er betrog uns beim Kartenspiel und strebte einzig und allein danach, soviel Geld wie möglich zu verdienen. Die Reise war eine gute Gelegenheit für ihn, da die Passagiere, die sich langweilten und zur Tatenlosigkeit verurteilt waren, sich gerne zu diesem Spiel verleiten ließen.
Der Maler wiederum widmete sich übertrieben der Natur. Er wollte fliegende Fische malen und jagte ihnen mit dem Skizzenblock in der Hand nach. Darin war er sogar besessener als die Fischer, die nicht so sehr die Fische an sich, sondern deren Leiber begehrten. Er aber war besessen vom Hunger nach einem ganzen Fisch, nach einem Fisch als solchem, nach einem Fisch an sich und nach dem fischlichen Geheimnis.
Am dreißigsten Tag unserer Reise kam eine Windstille auf, und das Meer wurde so flach wie ein Tisch. Der Himmel, vorher dauernd blau und etwas bewölkt, bezog sich milchig. Monotone Unbeweglichkeit verband den Himmel mit dem Meer in Leblosigkeit, Stille und Langeweile. Die Segel fielen herab, und der Kapitän befahl, sie einzuziehen. Er gab auch noch einige andere Befehle aus, und auf dem Schiff herrschte im Gegensatz zu der Leblosigkeit um uns herum eine ziemliche Verwirrung. Alles, was sich nicht unter Deck bringen ließ, wurde mit Seilen und Klammern festgemacht. Und als wir sahen, daß selbst das Steuerrad festgezurrt wurde, so als sollte es für die Ewigkeit vorbereitet werden, verstanden wir, daß etwas sehr Ungewöhnliches passieren würde. Auf die Frage, was wir tun sollten, antwortete der Kapitän kurz: »Beten.«
Wir saßen schon unter Deck, wo uns nur das Licht einer Laterne, die an einer Kette an einem Balken hing, erlaubte, unsere Gesichter zu unterscheiden. Die schleichende Dämmerung nahm Bedeutung an, sie schien ein Bote der Dunkelheiten, die auf dem Ozean regierten – ein Spion und Verräter in den Mauern unserer Festung. Wir empfanden ihre Gegenwart auf dieser Seite der Wand, die uns von den schwarzen Abgründen trennte, als sehr unangenehm. Jetzt spielte niemand mehr Karten, da wir Ereignisse erwarteten, angesichts deren ein Kartenspiel unangebracht gewesen wäre, sozusagen eine sündige Beschäftigung. Aber bis jetzt betete auch noch niemand, als befürchtete man, ein allzu frühes Gebet könne den Sturm beschleunigen.
Als er kam, neigten wir uns alle zusammen mit dem Schiff, verbeugten uns vor jener Lampe, die der einzige beständige Punkt auf dem ganzen Ozean geblieben war. Unverändert zum Mittelpunkt der Erde strebend, wies sie beständig auf deren Zentrum. Das war ein kleiner Trost. Alle anderen Gegenstände wurden lebendig und machten sich auf die Wanderschaft. Selbst die hölzernen Alkoven begannen, obwohl sie an Wänden und Fußböden befestigt waren, zu zittern und schickten sich an, auf die Reise zu gehen. Es herrschte ein allgemeiner Wille zum Zerfall. Alles wollte jede Gemeinschaft mit allem zerstören, sämtliche Bindungen lösen und alle Bänder zerreißen. Nicht nur das Schiff in seiner Gesamtheit, sondern auch seine Bestandteile wurden vom Aufruhr gegen ihre eigene Wesenheit ergriffen. Von der Gier nach Zerfall, vom zentrifugalen Druck, vom Wahnsinn unbekannter Antithesen. Mit Ausnahme der Lampe, die direkt mit dem Mittelpunkt des Planeten korrespondierte und mehr zu ihm als zum Schiff gehörte; sie bewegte sich nicht von ihrem Platz.
Jetzt war es also Zeit zu beten. Der Geistliche, der zwischen den verschiedenen Gegenständen kniete und sich an einem massiven Tisch festhielt, der sich wiederum, wohl gegen seinen eigenen Willem, am Fußboden festhielt, intonierte die Litanei. Die übrigen antworteten ihm, jeder kniete nieder, wo er gerade konnte, und hielt sich an dem fest, was gerade da war. Aber bald konnte man nirgends mehr knien und sich auch an nichts mehr festhalten. Die Stöße wurden so heftig, daß wir uns mit den Gegenständen und mit uns selber vermischten, als wenn jemand beabsichtigte, mit uns Würfel zu spielen und uns zuerst in dem Würfelbecher durcheinanderzuschütteln.
Wir klammerten uns an alles, was uns in die Hände gelangte. Aber da alles in der gleichen Bewegung war wie wir, sicherte uns das keinen Halt. Es passierte nicht selten, daß ich auf der Suche nach einem Balken oder einem Holzstück irgend jemandes Bein oder Nase erwischte. Bald griff ich wahllos nach jedem beliebigen Gegenstand. Aber es glitt einem sowieso alles aus den Händen.
Das Wasser gelangte langsam ins Innere. Es kam von oben und rann an den Wänden durch plötzlich entstandene Ritzen herunter. Und obwohl jeder einzelne in seiner trunkenen Planetenbahn kreiste, verstanden alle ein und dasselbe. Das Schiff ging unter, und man mußte sich retten.
Nach dem allgemeinen Zerfall entstand plötzlich eine große Enge. Wir drängten alle am Ausgang zusammen. Ströme von Wasser stürzten über uns herab. Diejenigen, die weiter unterhalb waren, zogen diejenigen, die höher waren, herunter. Trotz dieses Stoßens und Ziehens und entgegen der Schwerkraft drängten wir uns auf den Treppen in die Höhe. Wir sammelten uns auf dem Deck wie Bienen in ihrem Schwarm, der sich, selbst wenn er verletzt und durcheinandergerüttelt ist, durchnäßt, blind und unfähig zu fliegen, trotzdem eng zusammenschließt und, von zahllosen Extremitäten zusammengehalten, lebendig ist.
Hier wehte uns weder der Wind auseinander, noch spülten uns die Wellen vom Deck. Das Knäuel wurde erst an die eine Bordwand, danach entsprechend mit einer anderen Welle an die andere geschleudert, danach purzelte es noch einige Male in verschiedene Richtungen, gepeitscht vom Wind und in Wellen gebadet, bis es zum Schluß über die Reling sprang und ins Wasser fiel.
Das Ganze wäre sicher auf den Grund gesunken, wenn da nicht ein Floß gewesen wäre. Man hatte schon vorher Flöße und Schaluppen heruntergelassen, aber die Schaluppen waren untergegangen, und es blieben nur die Flöße übrig. Diejenigen, die schwimmen konnten, hielten sich an dem Floß fest, die anderen klammerten sich wieder an die an, und so hing der ganze Schwarm am Floß. Er kroch hinauf, backte an ihm fest und war durch keine Macht der Welt herunterzubringen.
Jetzt erst konnte ich mich ein bißchen umsehen. In der Ferne drehte sich das Schiff wie eine Spirale in das Wasser hinein. Über dem Schiff rostiger, roter, finsterer Himmel.
Von dem Schiff war nur noch der Rumpf übrig. Alle Masten waren spurlos verschwunden. Um so deutlicher war auf dem Hintergrund des Himmels der Kopf des Königs Salomon zu sehen und dann eine andere, unerwartete Gestalt.
Auf der höchsten Erhebung des Schiffes sah ich den Narren. Ein Domino in schwarzweißen Rhomben ließ ihn deutlich sichtbar werden. Der Wind zerrte an diesem Narrengewand, zog an den drei Hörnern der Narrenkappe, die mit Glöckchen besetzt war. Das kalkweiße Gesicht spiegelte ein kaltes Abbild wider. Er hielt sich mit beiden Händen am Steuerrad fest und schien einige possierliche Sprünge zu machen. Uns erreichten weder ein Ton dieser Glöckchen noch die Schreie, die er, nach seinem offenen Mund zu schließen, auszustoßen schien. Nur die Narrengrimassen und Gesten waren deutlich. Ob er improvisierte oder eine gelernte Nummer wiederholte? Das konnte man schwer beurteilen. Im übrigen rechnete er sicher nicht mit Publikum. Er konnte ja nicht einmal erwarten, daß ihm irgend jemand Aufmerksamkeit schenkte, wieviel weniger erst, daß er irgend jemanden erheiterte. Ob er wahnsinnig geworden war und er sich der Realität bereits nicht mehr bewußt war? Oder umgekehrt, ob er, als er erkannte, daß alles vorbei war, beschlossen hatte, noch ein letztes Mal aufzutreten? Aber in diesem Fall: vor wem und für wen? Er, der uns niemals seine Narretei gezeigt hatte, zeigte sie jetzt dem Sturm. War er also hundertfach ein Narr, oder war er, wenn er mehr Narr war, als sich das ziemte, überhaupt kein Narr?
Mal auf einem Wasserhügel schwimmend, mal in ein Wassertal fallend, entfernten wir uns vom Schiff. Ich sah die Salomon noch einige Male von dem Gipfel irgendeiner Erhöhung, auf einem anderen immer weiter entfernten Gipfel, über die Rücken der uns trennenden Anhöhungen hinweg. Das Schiff versank langsam, wie ein schwarzer Klotz in saftigem Grün, und nur ein greller Fleck, das Zeichen, daß der Narr immer noch aushielt, leuchtete in immer größerer Entfernung. Ein bunter Schmetterling, der sich auf dem Klotz niedergelassen hatte. Er leuchtete ein letztes Mal auf, und von dem Augenblick an war nichts mehr außer den beweglichen Meeresbergen zu sehen.
Wir wären jedoch alle umgekommen, auch wir auf unserem armseligen Floß, wenn uns nicht nach drei Tagen, die wir ohne Essen und ohne Trinken verbrachten, ein Schiff aufgelesen hätte, das ähnlich wie die Salomon, aber mit größerem Glück, die Absicht hatte, nach San Juan zu fahren. Es war dies das alte, zerlöcherte Schiff, das ich in Palos verschmäht hatte. Es vergingen keine drei weiteren Tage, als zwischen dem blauen Meer und dem azurnen Himmel sich ein Streifen grüner, fedriger Palmen zeigte, rote Häuserdächer und die aschfarbenen Bastionen der Zitadelle, das fröhliche Puerto Rico.
Fallen
Zu Anfang war ich nur verwirrt und wußte nicht einmal, daß ich fiel. Meine verstörten Sinne purzelten durcheinander und übereinander wie junge Katzen in einem Sack. Solange ich nicht wußte, daß ich fiel, hatte ich keine Angst. Ich fühlte nur eine leichte Übelkeit in der Magengegend, die auf das Chaos um mich herum zurückzuführen war.
Dann gewöhnte ich mich daran. Die Gewöhnung brachte folgerichtig Langeweile mit sich. Die Langeweile ließ mich nach der Ursache meiner Langeweile forschen, und ich stellte fest, daß mich die Gewöhnung langweilte. Aber woran hatte ich mich gewöhnt?
Ans Chaos natürlich. Aber woher kam das Chaos? Ich entdeckte, daß ich mich um mein eigenes Gravitationszentrum drehte, das heißt, Purzelbaum schlug. Warum? Das würde ich nicht erfahren, wenn ich nicht aufhörte, Purzelbaum zu schlagen. Mit Armen und Beinen fuchtelnd gelang es mir schließlich, in eine vertikale Position zu gelangen. Das heißt in eine Lage, in der die Flechten, die Moosballen und kleinen Büsche auf den Felsplatten an mir so vorbeiglitten, daß sie unter meinen Füßen hervor auf mich zusausten und über meinem Kopf verschwanden. Da erst begriff ich, daß ich fiel, und begann, mich zu fürchten.
Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß ich mich nicht so sehr vor dem Fallen an sich wie vor den Folgen des Fallens fürchtete. Das Fallen an und für sich war ja nicht schädlich und konnte nicht ewig währen. Aber ich hatte schon eine geraume Zeit Angst gehabt, und es war noch kein Ende abzusehen. Also gewöhnte ich mich auch an die Angst, zumindest soweit, daß ich imstande war, meine Lage näher zu untersuchen.
Ich fiel neben einer Felswand, um mich herum ein unendlicher Raum ohne erkennbare Entfernungen. An manchen Stellen ragte die Felswand ein wenig hervor, bildete Überhänge und Vorsprünge. Ich kam auf die Idee, daß ich diese Unebenheiten der Wand benutzen, einen Felsvorsprung, einen Baum oder wenigstens ein Grasbüschel packen und meinen Fall dadurch aufhalten könnte. Ich sah unter mich und wartete auf eine günstige Gelegenheit. Als erstes bot sich eine Latschenkiefer an. Ich streckte beide Arme weit aus und packte sie, als ich auf gleicher Höhe war. Ein Ruck, ein Ziehen, Zerren, und schon flog ich mit der Kiefer in beiden Händen weiter, als wenn ich mit einem absurden Blumenstrauß in der Hand einen Besuch abstatten wollte.
Also ließ ich die Kiefer fahren. Sollte sie allein fliegen, wenn sie mir doch nichts nützte. Vielleicht ergab sich eine bessere Gelegenheit? Ich entdeckte einen größeren Baum, der dem Augenschein nach entschieden solider war als mein Latschenkieferchen. Ich breitete abermals meine Arme aus und packte, als er nahe genug herangekommen war, wieder fest zu. Ein Krachen, ein Ruck, und ich flog weiter, aber diesmal bemerkte ich mit Verwunderung, daß ich vier Arme und vier Hände hatte, die sich krampfhaft an den abgebrochenen Zweig anklammerten … Nein, nur zwei gehörten zu mir, die beiden anderen zu einer Person, einem Kerl, der – während ich nach unten gesehen hatte – unbemerkt über mir geflogen war und sich dasselbe Bäumchen ausgesucht und ergriffen hatte. Da er dicker, also auch schwerer war als ich, flog er schneller. Im Vakuum fliegen alle Körper mit derselben Geschwindigkeit, aber wir fielen ja nicht im Vakuum, oder … Er hatte mich eingeholt, und jetzt flogen wir zusammen, Stirn an Stirn, Auge in Auge, und betrachteten uns gegenseitig aus nächster Nähe. Zwischen uns den Ast, den wir gemeinsam festhielten. Schließlich ließ er eine Hand los und lüftete höflich seinen Hut: »So und so«, stellte er sich vor.
Ich nickte mit dem Kopf, konnte mich aber zu keiner freundschaftlichen Haltung ihm gegenüber durchringen. Nur seinetwegen fiel ich hier immer noch, denn das Bäumchen hatte unser gemeinsames Gewicht nicht ausgehalten. Wenn er nicht gewesen wäre … dann. Wenn ich allein wäre … jetzt. Ich fiel sogar noch schneller als vorher, weil ich zusätzlich mit der Differenz zwischen seinem und meinem Gewicht belastet war. Trotzdem ließ ich den Zweig nicht los, obwohl es die einfachste Art und Weise gewesen wäre, sich von ihm zu befreien.
»Fallen Sie auch?« eröffnete er dümmlich das Gespräch. Offensichtlich war er ein extrovertierter Pykniker.
»Ach …«
»Na, dann werden wir zusammen fallen«, freute er sich, als wenn es einen Grund zur Freude gegeben hätte.
Woher nahm er bloß diese Sicherheit? Fiel ihm nicht ein, daß ich den Ast jeden Augenblick loslassen konnte? Aber ich schob es noch hinaus. Ob er recht hatte? War es lustiger, in Gesellschaft zu fallen? Zu zweit, vielleicht sogar zu dritt, denn auf dem Ast kroch ein kleiner, grüner Käfer entlang.
»Er ist abgebrochen«, sagte ich vorwurfsvoll. Wenigstens sollte er nicht glauben, ich sei begeistert, seinetwegen weiter zu fallen. Wenigstens schuldig sollte er sich fühlen.
»Sie meinen das Bäumchen?« Er lachte. »Nicht das erste und nicht das letzte. Ich habe mich schon an so vielen Dingen festzuhalten versucht, und es war immer dasselbe. Kein Grund zur Aufregung.«
Kein Grund zur Aufregung! Als ob wir irgendwo in einem gemütlichen Café säßen! War das Dummheit oder Unverschämtheit?
»Bitte sehen Sie nur.«
Ich sah hinter mich in die Richtung, die er mir mit den Augen und einer Kopfbewegung wies. Ungefähr dreihundert Meter von uns entfernt fiel eine ältere, hochgestellte Persönlichkeit mit einem Monokel in die Tiefe, anscheinend ein ehrenwerter Universitätsprofessor. Er umarmte ein wildes Berggeißlein, das sich losreißen wollte, mit den Hufen ausschlug und mit seinen Hörnern wild in die Luft boxte. Offensichtlich hatte er es im Fluge ergriffen, so wie wir unseren Ast. Er fiel mit ihm zusammen und ließ es, von einer sinnlosen Hoffnung erfüllt, trotz seines Widerstandes nicht aus den Armen.
»Das heißt, daß wir nicht allein sind?«
Statt einer Antwort ließ er wieder den Zweig mit einer Hand los und beschrieb einen weiten Halbkreis … ich folgte seiner Geste mit meinem Blick.
Jetzt erst bemerkte ich, daß der unendliche Raum voll von fallenden Gestalten war. Vorher war ich viel zu sehr mit meinem eigenen Schicksal und der Beobachtung der Wand beschäftigt gewesen, um seitwärts oder gar nach hinten zu blicken, wo sich die endlose Leere erstreckte.
Einige schlugen Purzelbäume, wie ich zu Anfang, andere fielen mit dem Kopf nach unten, wieder andere mit dem Kopf nach oben, wie ich im Augenblick. Es gab auch einige wenige, die in horizontaler Stellung flogen, als wenn sie auf unsichtbaren Sofas lägen. Im allgemeinen konnte man zwei Fallarten unterscheiden: Die einen hielten sich an irgend etwas fest, die anderen verzichteten auf jeden Halt und fielen frei. Die letzteren befanden sich in der Minderheit.
Unter dieser Minderheit waren ein paar wenige, die wie echte Dandys fielen. Man konnte sehen, wieviel Wert sie auf Stil legten. Die Beine fest geschlossen, die Hände nonchalant auf die Hüften gestützt, den Kopf in die Höhe gereckt und ein schneidiger, forscher Blick. Andere dagegen fielen einfach irgendwie, sie gestikulierten wild umher oder waren vielleicht nicht imstande, ihre Bewegungen zu beherrschen; sie fielen, als bestünden sie aus einem Haufen loser Teile.
Ein junger Mann kam an uns vorbei. Er hatte ein Edelweiß in den Händen. Er hielt sich an ihm fest, obwohl er kaum hoffen konnte, daß es ihn retten würde.
»Ein Ästhet!« zwinkerte mir mein Reisegefährte vertraulich zu, aber dem Jüngling rief er laut zu: »Wie schön! Wie schön!«
Er wollte sogar in die Hände klatschen, überlegte es sich aber anders. Auch er wollte den Ast nicht loslassen. Er hing an ihm wie der Professor an dem Geißlein.
Wir wurden von einer älteren Frau überholt, die einen Büschel Grünzeug mit herausgerissenen Wurzeln in den Armen hielt. Offenbar hielt sie sich bereits seit langer Zeit daran fest, denn die Kräuter waren trocken und verwelkt, aber die alte Frau drückte sie an sich, als seien es die frischesten Blumen. Außerdem war sie mit den verschiedensten Ästchen, Stengeln und Heu behängt, und ihre Tasche war voller Kieselsteine.
»Andenken«, erklärte mir mein Begleiter leise. Und er verbeugte sich vor ihr charmant.
»Kennen Sie sie?«
»Nein, aber sie tut mir leid.«
Ich hörte auf, mich nach ihr umzusehen, weil mich etwas auf meiner Hand kitzelte. Der Käfer war von dem Zweig auf meine Hand gewandert und begann auf meinem Handrücken weiterzukrabbeln. Ich pustete ihn an, er hörte auf zu kriechen, erstarrte in Bewegungslosigkeit und hielt sich noch fester mit seinen unsichtbaren haarigen Beinchen an mir fest. Er stellte sich tot. Ich wollte ein zweites Mal pusten, aber mein Reisegefährte hinderte mich daran.
»Lassen Sie ihn doch, was stört er Sie?«
»Er kitzelt mich.«
»Ach was! Er wird auch so …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende aus, aber ich ahnte, was er sagen wollte. Ich ließ den Käfer in Ruhe. Der Käfer rührte sich nicht und wartete noch eine Weile ab, bevor er sich auf seine weitere Reise begab.
Die unausgesprochene Anspielung meines Gefährten ließ mich ihn in neuem Licht sehen. Er schien sich trotz allem der Tragik unserer Situation bewußt zu sein (falls man Fallen eine Situation nennen kann), er war nicht der gedankenlose Optimist, für den ich ihn zuerst gehalten hatte. Ich konnte mich ernsthaft mit ihm unterhalten.
»Dauert es noch lange?« begann ich im Plauderton, nun meinerseits etwas zweideutig.
»Woher soll ich das wissen? Ich müßte erst ganz nach unten gefallen sein und dann wieder zurück nach oben, um irgendeine Ahnung zu haben.«
»Zurück … Haben Sie jemanden gesehen, der zurückgefallen wäre?«
»Nein.«
In diesem Augenblick fühlte ich einen starken Schmerz im Kreuz. Ich drehte mich sofort um und konnte gerade noch ein aufgedunsenes, verzerrtes Gesicht sehen, einen weit offenen Mund, der irgendwelche Schimpfworte schrie. Und das Bein, das mich gestoßen hatte und sich rasch entfernte.
»Wofür denn!« schrie ich, obwohl der Angreifer mich längst nicht mehr hören konnte.
»Das fragen Sie noch? Fürs Fallen natürlich.«
»Aber es ist doch nicht meine Schuld, daß er fällt.«
»Natürlich ist es nicht Ihre Schuld, meine auch nicht, niemand hat schuld. Aber er rächt sich an allen … so einer wird jeden stoßen und beißen, der ihm in die Quere kommt. Und wenn er nicht nah genug rankommt, spuckt er ihn wenigstens an. Tut es weh?«
»Sehr.«
»Aber dafür juckt es nicht mehr.« (Tatsächlich, angesichts dieses Schmerzes war das Kitzeln des Käfers gar nichts.) »Ich habe ein paar Hustenpillen bei mir, wollen Sie die haben?«
»Aber ich huste doch nicht.«
»Das ist egal, Hauptsache, Sie nehmen irgendeine Medizin. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich besser.«
Ich nahm eine Pille, und es ging mir tatsächlich besser. Mein Reisegefährte war ein Mann mit Erfahrungen.
Gott sei Dank benahmen sich nicht alle so wie dieser Gewaltmensch. Allgemein reagierten die Leute auf eine für ihre Umgebung weniger bedrohliche Art und Weise auf das Fallen. Zum Beispiel ein junger Mann, der wie alle anderen fiel, aber dauernd auf seine Uhr sah und eher sich selbst als uns zurief: »Ach, ich habe es so eilig, ich habe es so eilig …«
»Wohin hat er es nur so eilig?« fragte ich verwundert.
»Nach oben!«
»Wieso denn nach oben, er …«
»Pst!« verschloß mir mein Gefährte den Mund. »Lassen Sie ihn!«
»Ich fliege nach oben, ich fliege nach oben, halleluja!« rief der junge Mann und fiel nach unten.
Nur einmal geschah es, daß wir jemanden trafen, dessen Fallweise Neid und Bewunderung erregte. Ich glaube, wenn ich selbst nicht gefallen wäre und sie fallen gesehen hätte, wäre ich sofort völlig verhext ihnen hinterhergesprungen. Ich sage »ihnen«, denn es waren zwei. Sehr junge Leute, sie fielen eng umschlungen und sahen sich in die Augen. Wahrscheinlich sahen sie etwas in ihren Augen, was niemand außer ihnen sehen konnte. Sie achteten nicht im geringsten auf ihre Umgebung, vielleicht wußten sie nicht einmal, daß sie fielen, aber selbst wenn sie es wußten, war es ihnen völlig gleichgültig.
Mein Gefährte bemerkte sie ebenfalls, aber er schwieg, ähnlich wie ich, weil wir so etwas wie Scham und Ressentiment empfanden. Wir bemühten uns, unseren Blicken auszuweichen. Ich nahm ihm übel, daß er der war, der er war, und er nahm mir übel, daß ich der war, der ich war. Aber im Vergleich zu dem Abenteuer, das uns später wiederfuhr, war das alles nichts. Gerade zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht herumgeschaut, da ich mit dem Käfer beschäftigt war, der hin und her gekrochen war und sich schließlich auf der Fingernagelkante meines linken kleinen Fingers niedergelassen hatte. Dort trödelte er eine Weile herum, und plötzlich breitete er seine kleinen Flügelchen aus.
»Sehen Sie!« rief ich. »Soll ich sie ihm ausreißen?«
Mein Gefährte wurde blaß, aber nicht auf Grund meines Vorschlages. Er sah ganz woanders hin, nach unten.
»Da, da«, stammelte er. Er war nicht imstande, ein anderes Wort herauszubringen.
Ich sah in dieselbe Richtung und vergaß sofort den Käfer. Da ich daran gewöhnt war, daß man einzeln fiel, begriff ich nicht sofort, daß sich diese dunkle, graubraune Masse aus Menschen zusammensetzte. Sie fielen auch, aber wie sie fielen! Sie bildeten eine geschlossene Kugel von etwa einem Kilometer Durchmesser und waren so ineinander verschlungen, daß alle ins Innere sahen. Von außen konnte man kein einziges Gesicht erkennen, nur gekrümmte Rücken und Kreuze. In sich verhakt, verklettet und ineinander verkeilt, bildeten sie zusammen ein homogenes Gebilde von regelmäßiger Gestalt, eben eine Kugel. Eine Art von kleinem Planeten. Die Kugel sonderte einen starken Geruch ab.
»Herrlich!« rief ich, fasziniert von diesem gigantischen Schauspiel.
»Sind Sie verrückt geworden? Wir fliegen doch direkt auf sie zu. Wir müssen was unternehmen, oder wir sind verloren!«
»Warum? Von weitem sieht das so schön aus.«
»Von weitem, aber nicht von nahem … Und es kommt immer näher!«
Tatsächlich, die Kugel näherte sich, die Rundung ihrer Oberfläche verflachte vor unseren Augen und begann bereits einen Horizont zu bilden, der aber immer noch bogenförmig war. Aus dem, was vorher eine Kugel war und was sich in einen ungeheuren, riesigen Buckel verwandelt hatte, erreichte uns ein dumpfes Geräusch.
»Knöpfen Sie sich auf, schnell!«
»Was soll ich denn aufknöpfen?«
»Die Knöpfe!«
Ohne über den merkwürdigen Befehl nachzudenken, folgte ich seinem Beispiel. Er selbst knöpfte sich den Mantel und ich mir meine Jacke auf. Der Mantel bauschte sich auf und bildete eine Art von Fallschirm, meine Jacke ebenfalls, aber sie war weniger wirksam als der Mantel. Wir wurden etwas langsamer, aber gleich darauf erreichte unser Fallen wieder die vorherige Geschwindigkeit.
»Es nützt nichts. Diese Schweinerei zieht uns an!«
Tatsächlich. Die Kugel besaß gemäß den uns bekannten physikalischen Gesetzen tatsächlich als Masse Anziehungskraft. Mir schien es, als ob uns nichts retten könne und wir unvermeidlich auf der schäumenden und gurgelnden Masse landen müßten.
Da fühlte ich ein Kitzeln in der Nase und nieste mit voller Lautstärke. Die Wirkung war ähnlich, als wenn Triebwerke in einem Raumschiff gezündet worden wären: Das Niesen veränderte unsere Richtung. Statt vertikal zu fallen, schossen wir jetzt seitwärts an der Oberfläche des Planeten entlang. Als der Rückprall seine Wirkung verloren hatte, befanden wir uns bereits außerhalb des Perimeters des Planeten, wir waren noch in Sichtweite, aber bereits weit genug entfernt, um sicher an ihm vorbeizukommen, als das vertikale Fallen wieder begann (das stärker als die Anziehungskraft der Masse war). Ich konnte ziemlich deutlich seine unebene, pulsierende Oberfläche erkennen, die aus armlosen Rücken und beinlosen Hintern bestand, da die Extremitäten, wie Wurzeln ins Erdreich gesteckt, unsichtbar blieben. Ebensowenig sah man auch nur ein einziges Gesicht. Das Getöse und Dröhnen machte uns ganz taub, die Hitze erschlug uns fast, der Geruch raubte uns alle Sinne, aber nach kurzer Zeit war alles ausgestanden. Die Kugel schwebte an unserer Seite, sie entfernte sich und wurde einer Kugel wieder ähnlicher.
»Sie waren großartig!« schrie mein Gefährte, als wir zu uns gekommen waren. »Sie sind vielleicht ein Gauner. Wenn Sie nicht … Schrecklich, daran zu denken. Aber wie haben Sie das gemacht?«
Seine Anerkennung und Bewunderung schmeichelten mir, aber ich war nach der überstandenen Gefahr auch wie gerädert; die Gefahr hatte mich geadelt, und ich wollte keine Verdienste usurpieren.
»Das war nicht ich, das war der Käfer«, gestand ich der Wahrheit entsprechend. Es war tatsächlich der Käfer gewesen, der in dem kritischen Moment seine Flügel ausgebreitet hatte, losgeflogen und direkt auf meiner Nase gelandet war. Dies wiederum stand in ursächlichem Zusammenhang mit meinem erlösenden Niesen. Kein Zweifel, er hatte uns gerettet. Und ich hatte daran keinerlei Verdienst.
»Wo ist er?«