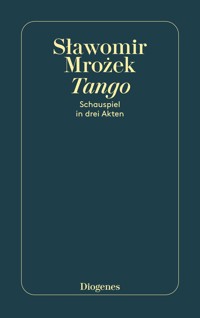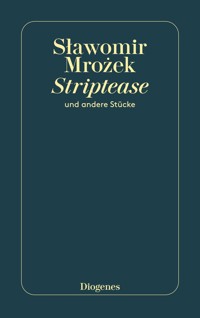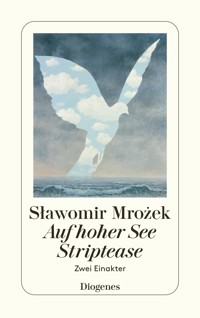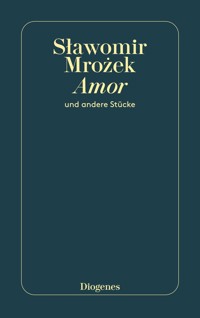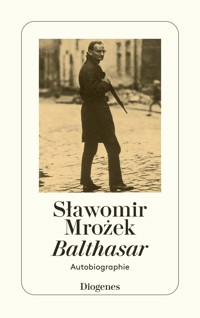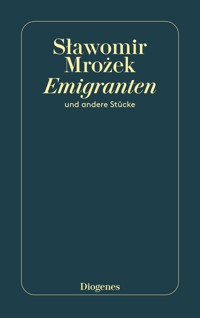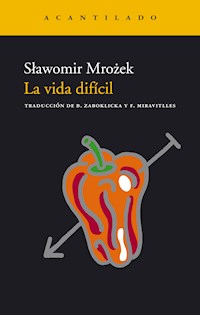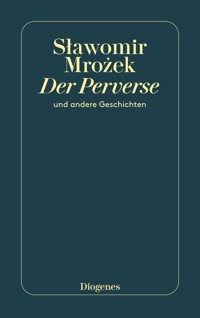
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Mrozek die neue Geschäftstüchtigkeit seiner Landsleute nach der Wende auf die Schippe nimmt oder mit der Idee des Vampirkommandos frischen Wind in festgefahrene Abrüstungsverhandlungen bringt, ob er in den allseits beliebten Präsidentengeschichten der Herrschaftsdummheit eins auf die Mütze gibt oder den Allmachtswahn der modernen Medizinmänner aufs Korn nimmt: Vor seinem bissigem Witz gibt es kein Ausweichen. Hat er mit den ›Geheimnissen des Jenseits‹ bereits das Diesseits entlarvt, so ist auch in ›Der Perverse‹ nichts so normal, als dass es nicht ins Irreale kippen könnte. 100 Satiren vom »Spezialisten des linden Wahns« (›FAZ‹). Aber Vorsicht: Als Bettlektüre ungeeignet – zum Einschlafen viel zu kurzweilig!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Der Perverse
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Christa Vogel
Diogenes
Das Kommando
»Wir müssen die Reserve in Bewegung setzen«, sagte der Marschall zum Stabschef.
»Wir haben keine Reserven mehr«, antwortete der Stabschef.
»Und wozu gibt es Soldatenfriedhöfe?«
»Die Gefallenen sind nicht aktiv. Sie wurden in den Zustand ewiger Ruhe überführt.«
»Bürokratie! Sie wollen doch nicht annehmen, daß sich unter Hunderttausenden von Gefallenen nicht wenigstens einige Hundert finden lassen, die weiterhin dienen wollen. Ein echter Soldat hört selbst nach dem Tod nicht auf, dem Vaterland zu dienen.«
»Zu Befehl, Herr Marschall! Aber selbst für diese paar Hundert können wir nicht viel tun. Sie sind nicht mehr fähig zu weiterem Kriegsdienst.«
»Ich gestehe, daß mir die Bereitschaft zu weiteren Diensten allein nicht genügt. Aber ich denke an all diejenigen, die außer der Bereitschaft noch entsprechende Qualifikationen haben, um weiter nützlich zu sein. Unter den paar Hundert posthumen Freiwilligen findet man sicher ein paar zig, die sowohl die Bereitschaft als auch die Qualifikationen haben.«
»Was für Qualifikationen, Herr Marschall? Ich habe von solchen Qualifikationen bis jetzt nichts gehört.«
»Weil der Krisenstab sie bis jetzt nicht in Betracht gezogen hat. Auf allen Friedhöfen gibt es Vampire; also muß es auch welche auf den Soldatenfriedhöfen geben. Sie aber sind nicht von uns erfaßt worden, es gibt keinerlei Kontrollen von unserer Seite, eine sträfliche Vernachlässigung seitens der Armee. Die Kriegsvampire werden zivil vergeudet.«
»Wie lautet der Befehl, Herr Marschall?«
»Wir schaffen eine spezielle Abteilung, ein Vampirkommando. Dank der übernatürlichen operativen Fähigkeiten der Vampire wird diese Abteilung Aufgaben übernehmen, die für die gewöhnlichen Abteilungen unmöglich sind. Sie dringt in den Generalstab des Feindes ein und vampirisiert deren höchste Führer. Es ist bekannt, daß ein vampirisierter Marschall oder General selbst wiederum zum Vampir wird und seine allernächste Umgebung beziehungsweise seine direkten Untergebenen vampirisiert. Die Brigadeführer wiederum vampirisieren die Majore und die Kapitäne, die Epidemie reicht bis zu den Leutnants und dem Unteroffizierskader und schließlich bis zu der Masse der Gefreiten. Auf diese Weise wird die gesamte Armee des Feindes völlig ausbluten, ohne einen einzigen Schuß von unserer Seite.«
Aus Rücksicht auf die Erhabenheit des Unternehmens beschäftigte sich der Stabschef persönlich mit der Organisation des Vampirkommandos. Er besuchte Soldatenfriedhöfe, um die entsprechenden Kontakte zu knüpfen und mit der Rekrutierung zu beginnen. Aber die Versuche, Kontakt aufzunehmen, mißlangen, bis man plötzlich ahnte, was der Grund des Mißerfolgs war.
Je höher nämlich der Rang des Offiziers, desto älter war er auch und damit bereits ausgetrockneter. Doch die Vampire, selbst die Kriegsvampire sind eher geneigt, mit rotwangigen Personen in Kontakt zu treten, als mit Ranghöheren, aber verwelkten. Man schickte also Offiziere mit immer niedrigeren Rängen, bis man schließlich die Mission einem jungen Fähnrich mit außerordentlich roten Backen anvertraute, der schließlich Erfolg hatte.
Der Stabschef meldete sich beim Marschall.
»Auftrag erfüllt«, meldete er. »Das Vampirkommando ist bereit zum Kampf.«
»Ausgezeichnet, setzen Sie sich doch.«
Der Stabschef setzte sich auf den Sessel vor dem Schreibtisch des Marschalls.
»Welche Stärke? Was für eine Moral der Abteilung?«
»So lala«, antwortete der Stabschef und schob sich samt Sessel näher an den Schreibtisch.
»Weshalb nur so lala, es sollte bestens stehen. Sind das nicht unsere Soldaten-Vampire-Patrioten?«
»Doch …« bestätigte der Stabschef und schob sich noch näher heran.
»Warum ist ihre Moral dann nicht die allerbeste? Was haben Sie, Sie scheinen etwas schläfrig zu sein.«
»Weil …« begann der Stabschef, aber er unterbrach sich.
»Weil was? Und wieso starren Sie mich so an?«
Statt einer Antwort zog der Stabschef die obere Lippe hoch, unter der zwei riesige weiße Eckzähne zu Tage traten. Der Marschall sprang auf.
»Was soll das heißen?«
»Herr Marschall, ich weiß da keinen Rat, unsere ganze Armee ist schon ausgesaugt. Es hat von unten her begonnen, bei diesem Fähnrich, und ging nach oben, bis zu mir. Da fragen Sie nach der Moral? Wie soll die Moral sein, wenn das Personal aufwärts saugen muß, immer weniger appetitlich. Sie als der Oberste Heerführer sind bereits der letzte, der übriggeblieben ist. Jetzt muß ich Sie beißen, obwohl ich melde, daß ich das überaus ungern tue. Als Ältester sind Sie einfach hoffnungslos, die reinste Anämie, aber ich habe keine andere Wahl.«
Er sagte es, stand auf, öffnete den Mund und bereitete seine Eckzähne zur Aktion vor.
»Verrat!« schrie der Marschall. »Ihr solltet den Feind attackieren und nicht die eigenen Vorgesetzten!«
Der Stabschef verschmälerte die Breite seiner geöffneten Kiefer, aber nur um eine Erklärung abzugeben.
»Sie haben eins vergessen: Es herrscht Frieden, wir sind mit niemandem im Kriegszustand. Was also sollen wir machen?«
Und er versenkte die Zähne in die Kehle des Obersten Heerführers.
Der verspätete Gast
Der Empfang war schon vorbei. Da ich zu müde war, konnte ich die Uhrzeiger nicht mehr koordinieren, aber der blaugrauen Dämmerung in den Fenstern nach und dem Vogelgezwitscher im Garten mußte es schon früh am Morgen sein. Ich begab mich gerade auf allen Vieren in Richtung Garderobe, als in den Bankettsaal jemand kam, der nicht nur noch auf beiden Beinen stand, sondern auch ein frisches Aussehen, rosige Wangen und einen vernünftigen Blick hatte.
»Sie sind noch hier?« wunderte ich mich, indem ich das Parkett überquerte.
»Noch? Erst! Früher haben sie mich nicht reingelassen, weil ich keine Einladung hatte.«
»Passen Sie auf, Sie treten auf den Grafen N.«
»Was? Der Graf N. ist auch hier? Können Sie mich ihm vorstellen?«
»Gern, Herr Graf N., das ist Herr … Aber ich glaube, wir kennen uns gar nicht!«
Der Ankömmling nannte einen mir nichts sagenden Namen und drückte das Bein des Grafen, weil dessen Hand mit Mayonnaise beschmiert war.
»Was für eine Ehre! Kreuzzüge, dreizehntes Jahrhundert. Dann ist vielleicht der Fürst P. auch hier?«
»Ich habe ihn noch vor Mitternacht gesehen, als er zur Toilette ging. Es scheint so, als wäre er noch nicht zurückgekommen.«
»Macht nichts, ich warte. Und Professor R.?«
»Der mit dem Kosmos?«
»Ja! Das ist ein Genie! Den kann man nur mit Kopernikus vergleichen.«
»Klar, der ist da. Unter dem Tisch. Wollen Sie ihn dort besuchen?«
»Unter dem Tisch wage ich es nicht, ihn zu stören, ich setze mich lieber an den Tisch.«
Er setzte sich. Der Tisch sah aus wie immer um diese Zeit und unter diesen Umständen, er schien das aber nicht zu bemerken.
»Wie elegant es hier ist … Ich bin zum ersten Mal in so einer erlesenen Gesellschaft. Und die Dame, die auf dem Tisch liegt, wer ist die?«
»Zaza Rospor, der Filmstar.«
»Kenne ich, kenne ich, klar, daß ich sie kenne. Nur daß ich sie nicht gleich erkannt habe, weil ihr Gesicht in der Schokoladentorte versteckt ist … Ist ihr nicht kalt?«
»Sicher doch.«
»Und weshalb hat sie sich dann ausgezogen?«
»Weil ihr vorher zu heiß war. Möchten Sie was trinken?«
»Wenn das möglich ist …«
Er goß die Reste aus einigen Gläsern in eins und trank es aus.
»Was ist das?«
»Champagner.«
»Wunderbar! Gehen Sie schon?« wunderte er sich, als er sah, daß ich mich wieder auf vier Extremitäten fortbewegte.
»Ja, ich muß gehen, ich arbeite gerade an einem neuen Roman.«
»Ich verstehe, Sie sind ein Schriftsteller von Weltrang.«
»Na na, übertreiben wir mal nicht. Obwohl ich natürlich das eine oder andere geschrieben habe.«
»Wie gern wäre ich wenigstens ein Maler … Erlauben Sie, daß ich noch ein bißchen sitzen bleibe?«
»Aber bitte sehr, nur keine Umstände.«
Ich mag Parvenüs, sie haben diese Frische des Blicks, die uns, der Elite, manchmal fehlt.
Dann kroch ich ohne weitere Zwischenfälle hinaus.
Aus dem Notizbuch eines Kapitalisten
Endlich schlägt die Stunde, wo ich wieder straflos den Menschen das Blut aussaugen kann. Ich denke da an das Volk der östlichen Ränder Europas, denn bei den westlichen habe ich immer nach Belieben saugen können. Und jetzt gibt es keine Hindernisse mehr, sie laden sogar selbst zum Saugen ein. Ich setze den Zylinder auf und fahre.
Ich bin bereits an Ort und Stelle. Den ganzen Abend lang habe ich den Sauger im Hotel gereinigt. Ich habe ihn beim Personal in der Rezeption ausprobiert, er funktioniert wie neu. Also ab morgen – auf zur Tat!
Sie wollten, daß ich ein Atomkraftwerk kaufe, das bis jetzt wegen mangelndem Atom nicht funktioniert. Ich habe abgesagt, aus denselben Gründen.
Ich habe einen Vorschlag bekommen, in die Landwirtschaft zu investieren im Sinne eines gemeinsamen Unternehmens. Als ich sie um Details bat, zeigten sie mir eine Grube und schlugen vor, daß ich dort das Kapital reinlege, und sie würden es festklopfen.
Ein Vorschlag, ich solle in die Telekommunikation investieren. Ich fragte, wieviel ich davon hätte. Sie versprachen, daß sie telefonisch antworteten, wenn ich ihnen ein Telefon besorge.
Ich fühle mich nicht sehr toll, ich bin zum Arzt gegangen, der einen Saugschnupfen feststellte. Er riet mir zu Klimawechsel.
Ich sollte eine Hühnerfarm besichtigen, die Forellen züchtet. Aber mit dem Sauger wird es immer schlimmer, ich verkürze den Aufenthalt und fahre nach Hause zurück.
Ich bin schon zu Hause, aber keinerlei Besserung. Wieder zum Arzt. Eine starke Saugentzündung aufgrund einer Infektion. Er empfahl eine Analyse.
Die Analyse bringt nichts, das ist irgendeine im Westen unbekannte, geheimnisvolle Krankheit; man rät mir von einem erneuten Besuch im Osten ab. Ich halte mich an den Rat des Arztes.
Tätowierung
Ende des Winters kam ein Tätowierungsspezialist zu uns und empfing drei Tage lang die Kundschaft. Sie ließen sich die verschiedensten Dinge von ihm eintätowieren, denn die Jugend liebt Illustrationen. Aber ich bin ein seriöser Mensch und habe was anderes im Kopf.
»Können Sie auch Portraits malen?«
»Ja«, sagte er. »Aber männliche Portraits nur im Profil.«
»Im Profil nicht«, antwortete ich. »Nur vom Foto.« Und ich zog ein Foto des Präsidenten heraus.
Er handelte mit mir, das sei ein schwieriges Modell wegen des nachdenklichen Ausdrucks in den Augen. Was soll’s, ich zahlte. Dafür hat er mir einen schönen Präsidenten auf die Brust gemalt. Es tat weh, aber was tut der Mensch nicht für seine Karriere.
Zuerst zeigte ich es probeweise meiner Frau. Sie lobte es, aber es stellte sich heraus, daß wir uns trennen mußten, so sehr erheiterte sie der Präsident. Sicher war der Tätowierer kein Matejko, aber der Präsident ist ja auch nicht die Schlacht bei Tannenberg. Eine Ähnlichkeit war jedoch da, und das war das wichtigste.
Ich mußte allerdings bis zum Sommer warten, damit ich eine Gelegenheit hatte, den Beweis meiner Anhänglichkeit vor dem Präsidenten öffentlich zu zeigen. Am besten am Strand.
Der Frühling war ungewöhnlich kalt. Es vergingen der Mai und der Juni, und es war gar nicht daran zu denken, auch nur das Unterhemd auszuziehen. Ich saß also im Mantel da, denn im Büro war es kalt, und tröstete mich nur damit, daß ich alles bereit hatte. Es brauchte nur noch die Sonne zu scheinen.
Aber es vergingen Juli und August, wir hatten schon September, und die Temperatur war immer noch niedrig. Im Oktober verlor ich die Geduld. Ich zog den Mantel aus und ging zum Präsidenten.
»Mir ist irgendwie heiß«, sagte ich. »Erlauben Sie, Herr Präsident, daß ich das Jackett ausziehe?«
Er wunderte sich, hatte aber nichts dagegen. Ich hing das Jackett über den Stuhl und band den Schlips ab.
»Was haben Sie?« fragte der Präsident. »Sind Sie vielleicht krank?«
»Nichts dergleichen, es ist nur schwül.« Und ich zog die Weste und den Pullover aus.
»Haben Sie Fieber?« fragte der Präsident, und ich sah, wie er sich irgendwie merkwürdig von mir entfernte.
»Ich? Haha! Wissen Sie denn nicht, Herr Präsident, wie ich gebaut bin, ein echter Herkules! Wollen Sie mal mein Muskelspiel sehen?«
»Vielleicht ein anderes Mal …«
»Wozu warten, ich zeige es Ihnen sofort!«
»Nein!« schrie er, aber es war schon zu spät.
Ich habe mich damals erkältet, und ich habe bis heute Lungenstechen, unterhalb des Präsidenten. Das ist eben unsere geophysische Lage.
Der Verbrecher
Jedes Kind weiß aus dem Fernsehen, daß die Verbrecher im Ausland elegant sind. Und was ist bei uns? Wir haben einen rückfälligen Verbrecher, aber der ist weit entfernt von James Bond. Er stiehlt höchstens mal ein Huhn, läuft schlampig angezogen herum und kann keine Fremdsprachen. Jeden Augenblick kann ein ausländischer Tourist anreisen, man darf nicht zulassen, daß er von einem Dieb auf so niedrigem Niveau bestohlen wird.
Wir riefen also unseren Verbrecher zu uns und wandten uns folgendermaßen an ihn: »Schlag dir deine Hühner aus dem Kopf. Nur noch Brillanten und Wertpapiere. Ab heute ein weißes Hemd mit Krawatte, ein Alfa Romeo und lernen mußt du auch.«
Darauf er: »Brillanten habt ihr keine, was die Wertpapiere angeht, klar, ich kann Klopapier klauen, und der Alfa Romeo ist wohl ein Scherz.«
Ein bißchen hatte er ja recht. Wir ließen die Brillanten weg, waren mit dem Papier einverstanden und kauften ihm ein Moped. Was sein Aussehen betraf, verschafften wir ihm auf Gemeindekosten ein Abonnement beim Friseur.
Er besserte sich, aber er war immer noch nichts Richtiges. An dem einen oder anderen Punkt mußte man noch mit ihm arbeiten.
»Whisky mit Soda wäre nicht schlecht. Whisky können wir uns nicht leisten, aber Sodawasser gibt es in der Genossenschaft genug. Du bekommst ein Kilo Sodasalz wöchentlich auf unsere Rechnung und trinkst den Wodka mit diesem Zusatz. Wenigstens fünfundzwanzig Deka Soda auf einen Liter Wodka.«
Er besserte sich. Wir blickten schon mit etwas weniger Sorge in die Zukunft. Aber da blieben noch die Fremdsprachen.
»Kannst du nicht irgendeine? Wenigstens ein bißchen slowakisch, bis zur Grenze ist es nicht weit, die Frauen kommen mit Schmuggelwaren her, wir könnten dir eine besorgen, für Nachhilfestunden.«
Er machte Fortschritte. Er fing jetzt sogar selbst an, Dinge zu fordern: »Ich würde ja mal in die Philharmonie gehen …«
»Halt an dich, woher sollen wir denn eine Philharmonie nehmen?«
Aber im stillen waren wir stolz auf ihn. Wir hatten Bedürfnisse in ihm geweckt.
Bis er eines Tages verschwunden war. Er hinterließ nur einen Zettel: »Ich fahre weg. Ich kann es mit so unkultivierten Leuten wie euch nicht aushalten. Wodka trinkt ihr ohne Soda, zum Friseur geht ihr nur zu Ostern, eine Philharmonie gibt es nicht, mit niemandem kann ich mich in einer Fremdsprache verständigen. Arrivederci Roma.«
Da saßen wir also ganz ohne Verbrecher da. Sie haben schon recht, wenn sie in den Zeitungen schreiben, daß wir uns nicht an westlichen Vorbildern orientieren sollen.
Der Europäer
Als das Krokodil in mein Schlafzimmer kroch, dachte ich, man muß ja nicht übertreiben. Ich meinte damit nicht das Krokodil, sondern mich. Denn mein erster Reflex war, nach dem Telefon zu greifen und alle drei Alarmnummern zu wählen: die Polizei, die Feuerwehr und den Notarzt. Aber eben gerade eine solche Reaktion schien mir übertrieben. Da ich ein im kartesianischen Geist erzogener Europäer bin, hege ich einen Abscheu gegen Extreme, ich denke rational und unterliege keinen Impulsen, ohne sie vorher analysiert zu haben.
Ich steckte also den Kopf unter die Decke und machte mich an die geistige Arbeit.
Erstens, legte ich fest, das Erscheinen eines Krokodils in meinem Schlafzimmer ist absurd, dem logischen Denken gemäß dient das Absurde nur dazu, es von dem weiteren Verständigungsweg auszuschließen. Das heißt, es gibt kein Krokodil. Von dieser Schlußfolgerung beruhigt, guckte ich unter der Decke hervor, dank dessen ich gerade noch erblickte, wie das Krokodil die Schnur des Telefons anknabberte, das es vorher schon verschluckt hatte. Selbst wenn ich durch den Schlund in den Bauch des Krokodils gefaßt hätte und eine der Notnummern gewählt hätte, wäre die Kommunikation schon abgebrochen gewesen.
Ich beschloß, mich zu der nächsten öffentlichen Telefonzelle zu begeben, um die entsprechende Abteilung des Kommunikationswesens von dem Defekt meines privaten Telefons zu benachrichtigen, was mir dann mithilfe einer Mannschaft von Spezialisten erlauben würde, mich mit der Institution zu verständigen, die dazu da ist, Krokodile zu entfernen.
Als zivilisierter Mensch konnte ich jedoch nicht im Schlafanzug auf die Straße gehen, das Krokodil aber beendete gerade das Verschlingen meiner Hose. Natürlich war das nicht das einzige Paar Hosen, über das ich verfügte. Trotz des meiner Meinung nach ungenügenden Lebensstandards hatte ich noch ein Paar Hosen im Schrank. Leider befanden sich die, die ich beabsichtigte anzuziehen, weil sie am besten mit dem Umhang »Yves Saint Laurent« harmonisierten, nicht im Schrank, sondern in der chemischen Reinigung. Und wo war die Quittung, die meine Identität als Besitzer jener Hose bestätigte, ein Dokument, ohne das sich das Abholen meiner Hose aus der Reinigung als unmöglich erweisen würde? Ich begann die Quittung zu suchen, etwas hinkend, weil das Krokodil mir inzwischen ein Bein abgebissen hatte. Ich schenkte dem Bein keine Beachtung, weil meine Sorge um die Hose wuchs. Das Krokodil wollte mir gerade das zweite abbeißen, als ich die schreckliche Wahrheit ahnte: Es hat die Reinigungsquittung mitsamt der Hose aufgefressen und ich würde die Hose nie wiederbekommen.
Ich habe das Krokodil mit bloßen Händen erwürgt. Ich gestehe, daß ich brutal vorgegangen bin, und was noch schlimmer ist, unter dem Einfluß unkontrollierter Emotionen. Ich gestehe, daß ich, statt den konstitutionellen Institutionen zu vertrauen, auf eigene Faust gehandelt habe. Aber die Quittung von der Reinigung zu fressen?! Es gibt Situationen, in denen die Verteidigung der Zivilisation eine Überschreitung der zivilisierten Normen erfordert.
Gesundheitswesen
Es erwies sich als notwendig, mir den Blinddarm zu entfernen. Ich füllte die entsprechenden Formulare aus, und man schrieb mich in die Warteliste ein.
Zwei Jahre vergingen wie im Fluge, dann kam ich an die Reihe und fand mich im Krankenhaus wieder.
Die Operation gelang vorzüglich. Der Chefarzt selber gratulierte mir zu den Ergebnissen. »Das war ein schöner Eingriff, meine Dame«, sagte er.
Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß ich männlichen Geschlechts bin. Er überprüfte was in seinen Papieren.
»Sie waren es, vor der Operation. Durch einen Irrtum sind Sie auf die Experimentierstation gekommen, gegenwärtig sind Sie eine Frau. Die Geschlechtsumwandlung ist ein Pionierzweig der Chirurgie, aber wir haben ausgezeichnete Resultate, wofür Sie, liebe Dame … lieber Herr …? ein Beweis sind.«
»Und was ist mit dem Blinddarm?«
»Wollten Sie den nicht behalten, gute Frau?«
»Nein. Ich möchte auch keine Frau bleiben, ich bitte Sie, dieses Mißverständnis sofort zu korrigieren.«
»Sie sind, mein lieber Herr, meine liebe Dame …? ein schwieriger Patient. Na gut. Was wollen Sie, liebe Dame, zuerst, erst die Männlichkeit oder den Blinddarm?«
»Das, was schneller geht.«
»Bitte füllen Sie die Formulare zweifach aus.«
Die Zeit verging schnell und die nächste Operation gelang ebensogut wie die vorherige. Die neue Niere funktionierte hervorragend, nur daß ich jetzt drei hatte, zwei eigene und eine verpflanzte. Aufgrund eines Irrtums in der Computerprogrammierung hatte man mich in den falschen Operationssaal gebracht. Ich war kaum zu mir gekommen, als ich schon Formulare in Sachen Nieren ausfüllte, die man zu den anderen legte.
Ich war schon kein junges Mädchen mehr, als ich die Nachricht erhielt, daß im Krankenhaus ein Platz frei sei und ich an der Reihe mit einer Nierenoperation sei. Es ging um die Entfernung von nur einer Niere, aber ich fand mich auf der Wöchnerinnenstation als Neugeborenes wieder. Es war ein Irrtum in der Zentralen Verwaltung des Gesundheitswesens unterlaufen, aber die Eltern protestierten nicht. Ich war schon ein ausgewachsenes Kind und sie sparten die Kosten für die Ausbildung, daher zogen sie es vor, mich als ihr eigenes anzuerkennen. Was mich betrifft, so hatte ich genug vom Ausfüllen von Formularen und ergab mich in mein Schicksal.
Die Beziehungen zwischen mir und meinen Eltern sind sehr gut. Die einzige Sorge, die ich ihnen bereite, ist mein Blinddarm, der mir immer noch zu schaffen macht. Sie wollen mich in ein Krankenhaus überweisen, um den Blinddarm herausoperieren zu lassen. Das trifft sich gut, denn ich habe den Verdacht, daß sie trotz allem lieber einen Jungen als ein Mädchen haben wollen.
Der Misanthrop
Das Abteil war leer. Ich setzte mich ans Fenster und schlug ein Buch auf.
Ich hörte das Schurren sich öffnender Türen. Es kam ein Typ mit einem großen Koffer herein. Ich kehrte zu meiner Lektüre zurück, weil ich keine Lust hatte, Bekanntschaften zu schließen. Der Verlust meiner Einsamkeit war genügend unangenehm.
»Sie sitzen auf meinem Platz.«
»Auf Ihrem Platz?«
»Bitte, sehen Sie nach.«
Ich hatte vergessen, in welche Tasche ich meine Karte gesteckt hatte, endlich fand ich sie.
»Bitte, Platz Nummer vierunddreißig, und das ist die Nummer neununddreißig.«
Ich setzte mich gegenüber hin. Ich hatte nicht die Absicht, den Fensterplatz zu verlassen, weil ich die Landschaft betrachten wollte.
»Ihr Gepäck.«
»Mein Gepäck?«
Er zeigte auf die Ablage.
»Ach, es geht Ihnen um meinen Mantel …«
»Nach den Vorschriften ist das Gepäck, weil es sich an dem Ort befindet, der für Gepäck vorgesehen ist.«
Ich nahm den Mantel von der Ablage. Mit Mühe brachte er dort seinen Koffer unter, wobei er mich belehrte, daß dieser Abschnitt des Gepäcknetzes ausschließlich dem Passagier gehört, dem rechtmäßig der Platz neununddreißig zustand. Der Zug ruckte an, etwas gewaltsam. Ich begann, die Landschaft zu betrachten.
»Sie sitzen auf dem Platz Nummer achtunddreißig.«
Ich sah mich um, tatsächlich, an der Lehne war ein Emailleschildchen mit dieser Nummer.
»Der Platz Nummer vierunddreißig ist da.«
Er zeigte auf die Ecke bei der Tür.
»Ist das nicht egal? Das Abteil ist doch fast leer.«
»Es geht ums Prinzip.«
Ich hatte die Wahl: entweder mich in den offenen Konflikt mit diesem Besessenen zu stürzen oder ihm nachzugeben. In jedem Fall hätte ich ihm eine Genugtuung bereitet, wenn auch in jedem Fall eine andere. Ich beschloß also, das Abteil zu verlassen.
Ich stand auf und verlor fast das Gleichgewicht, der Zug beschleunigte und schüttelte die Waggons hin und her. Der Koffer über seinem Kopf schob sich an den Rand der Gepäckablage. Ich wurde mir bewußt, daß man weitere Beschleunigungen abwarten müßte.
Wortlos setzte ich mich auf den Platz Nummer vierunddreißig, um, weniger bequem, die Landschaft zu betrachten, dafür war hier eine bessere, weil diagonale Sicht auf den Koffer über dem Kopf meines Mitreisenden.
Der Zug bremste, und der Koffer zog sich in die hintere Ecke der Gepäckablage zurück. Ich begann zu zweifeln, ob meine Berechnung richtig war. Vielleicht wäre es doch besser, das Abteil zu verlassen?
»So ist es, mein Herr. Man muß immer die Vorschriften beachten.«
Er belehrte mich triumphierend.
Das entschied die Angelegenheit, und ich beschloß auszuharren. Schließlich war der Zug noch gar nicht in voller Fahrt gewesen und man konnte noch Hoffnung haben.
Ich schloß die Augen. Neben der Lektüre und dem Betrachten der Landschaft ist das Dösen die dritte Annehmlichkeit der Reise. Aber ich döste nicht wirklich. So konnte ich unter den geschlossenen Lidern die Gepäckablage beobachten, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen, was ich weder während des Lesens noch während dem Betrachten der Landschaft tun konnte.
Meine Berechnung erwies sich als richtig. Langsam, aber sicher rutschte der Koffer zum Rand. Zwischen mir und seinem Schwergewicht knüpfte sich eine intensive Verständigung an. Der kritische Moment kam näher.
Aber ich beschloß, ihm eine Chance zu geben. Nicht aus humanitären Gründen, noch weniger aus Nächstenliebe – aus Neugier.
»Sie sind, scheint es, ein Anhänger von Vorschriften. Darf man wissen weshalb?«
Er wurde lebhaft, offensichtlich war das sein Lieblingsthema.
»Vorschriften, mein Herr, sind notwendig, damit Ordnung herrscht. Ohne Vorschriften herrscht Unordnung.«
»Dann schlage ich Ihnen etwas vor: tauschen wir unsere Karten. Dann setze ich mich auf Ihren Platz, und Sie sich auf meinen. Auf diese Art und Weise verletzen wir nicht die Vorschriften, weil die Fahrkarten ja nicht namentlich ausgegeben werden, sondern auf den Besitzer. Was sagen Sie dazu?«
Er schwieg einen Augenblick lang überrascht.
»Und warum eigentlich?«
»Weil ich gern am Fenster sitze. Und Sie?«
Ich wartete auf die Antwort. Wenn er es eingestehen würde, wäre er gerettet.
»Aber die Nummer neununddreißig ist meine Nummer!«
»Ich verstehe, es wäre Manipulation. Naturgemäß können Vorschriften nicht absolut genau sein, aber das heißt noch lange nicht, daß man sie manipulieren darf. Ist es nicht so?«
»Na sicher …«
»Das heißt, daß Sie die Vorschriften mit der Vorsehung identifizieren.«
»Mit was?«
»Mit der Vorsehung, mit dem Schicksal. Vorschriften eliminieren die Beliebigkeit, das heißt den Zufall, das heißt das Chaos, also sind sie eine Erscheinung der Vorsehung, die Stimme des Schicksals.«
»Sie benennen das irgendwie …«
»Ich sage dasselbe wie Sie, nur mit anderen Worten. Sie sagen: Ordnung. Ich sage: Vorsehung. Sie sagen: Unordnung, ich sage: Chaos. Aber das läuft auf dasselbe hinaus. Also haben Vorschriften etwas Göttliches an sich. Jetzt verstehe ich, weshalb sie Ihnen heilig sind.«
»Vorschriften, mein Herr, sind Vorschriften, und basta.«
»Ausgezeichnet«, sagte ich und schloß die Augen zum Zeichen, daß es nichts mehr zu reden gab. Und so war es tatsächlich.
Als der Koffer runterfiel, sank er auf den Boden, an der Stirn von der Metallkante getroffen. Ich dachte, er sei ohnmächtig geworden, und schwöre, daß ich das nicht gewollt hatte, schon allein deshalb, weil ich jetzt nicht wußte, was ich tun sollte. Wie weckt man Ohnmächtige auf? Und überhaupt so ein Ärger … Als ich mich ratlos umsah, bemerkte ich die Notbremse mit einem Täfelchen: »Im Notfall ziehen«. Es war ein Notfall, und wenn ihm niemand erste Hilfe erteilte, würde sich sein Zustand verschlechtern. Ich zog die Notbremse.
Aufgrund dessen hatte der Zug eine zweistündige Verspätung, was ein Chaos im Fahrplan des gesamten Bezirks verursachte. Diese Verletzung der Ordnung brachte aber überhaupt nichts, weil er, wie sich dann herausstellte, sofort tot gewesen war. Ich aber hatte mich die ganze Zeit den Vorschriften entsprechend verhalten und hatte mir nichts vorzuwerfen.
Wirtschaftswunder
Ich begab mich in eines der Osteuropäischen Länder, um – die neue politische Situation ausnutzend – wirtschaftliche Beziehungen anzuknüpfen.
Ich mietete einen Laden und hämmerte ein Schild daran mit der Aufschrift EXPORT – IMPORT und wartete auf Angebote. Aber es erschien niemand.