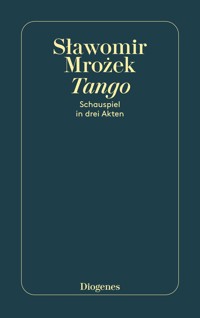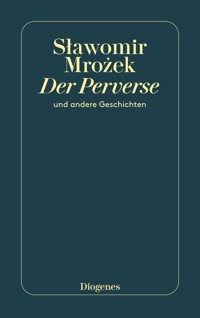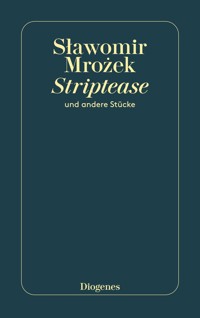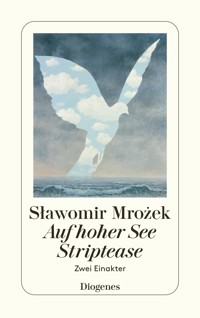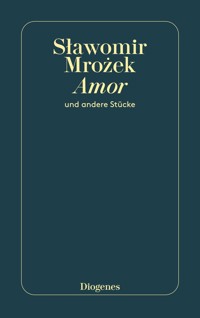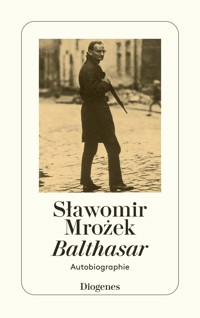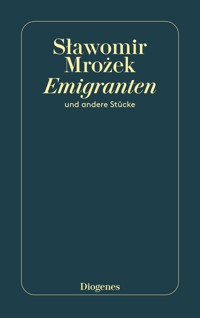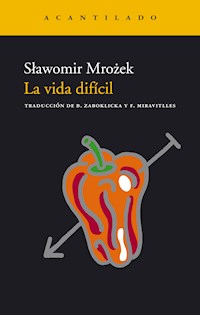7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Der Doppelgänger‹ des Tyrannen hatte diesen lange Jahre bei Paraden und anderen langweiligen Anlässen vertreten, und wenn er dienstfrei hatte, bestellte er sein Land wie alle anderen Bauern auch. Doch nun war der Tyrann gestorben. Jetzt gebe es keine Ausbeutung und Ungerechtigkeit mehr, sagten die Leibwächter des toten Tyrannen, als sie den Doppelgänger aufsuchten, und auch keine mysteriösen Unfälle mehr. Nur eins sei noch zu regeln: Das Volk dürfe auf keinen Fall durch ein Gesicht an vergangene Zeiten erinnert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Der Doppelgänger
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Christa Vogel und Ludwig Zimmerer
Diogenes
Mitleid
Auf Grund von Mißerfolgen in meinem Leben verfiel ich in Depressionen. Da zog eine Anzeige meine Aufmerksamkeit auf sich, die ich zufällig in einer Zeitung las: »Bist du traurig? Hast du keinen Erfolg? Hältst du dich für vom Schicksal benachteiligt? Straße der Rentnerfreuden 13, Hinterhof rechts.«
Unter der angegebenen Adresse herrschte ein großer Andrang. Man mußte ein Billett an der Kasse kaufen und dann warten. Es wurden nur zehn Personen auf einmal hereingelassen.
Als die Reihe an meine Zehnerschaft kam, führte uns ein Diener ins Innere. Es war eine gräßliche Einzimmerbehausung. Auf einer erbärmlichen Pritsche wanden sich einige Kinder in Krämpfen. Emailschildchen an den Wänden informierten: »Bitte rauchen und spucken – es schadet sowieso nicht mehr.« Und: »Bitte nicht die Türen schließen – wozu?«
An einem Tisch saß ein Mann mit einem Bein und eingefallenen Wangen. Als wir uns mehr oder weniger in diesem Loch verteilt hatten, sah der Mann auf die elektrische Uhr, räusperte sich und begann zu sprechen. Es war seine Lebensbeichte.
»Bitte, verzeihen Sie, daß meine Frau nicht da ist«, sagte er zu Beginn, »sie weilt im Krankenhaus. Und jetzt werde ich Sie in kurzen Worten mit meiner Situation vertraut machen.«
Je länger er sprach, desto fröhlicher wurde ich. Denn im Vergleich mit seinem Leben mußten meine Mißerfolge wie Lappalien erscheinen. Es war dies eine einzige Kette von Niederlagen und Krankheiten. Schon bei der Beschreibung der Umstände, unter denen er zum Waisenkind wurde, erhellten sich die Gesichter der Kunden ein wenig, und als er zu der Geschichte seiner ersten Schwindsucht kam, wurden sie erheblich fröhlicher. Von Zeit zu Zeit gab er Schmerzensschreie von sich, zum Schluß verfiel er in leises Weinen. Als er geendet hatte, betrachtete er unsere strahlenden Gesichter und gestand uns, daß er obendrein noch Alkoholiker sei und bereit, sich für eine kleine Nachzahlung auf der Stelle unter Alkohol zu setzen, was ihm zusätzlich schaden würde. Einige Leute nutzten dieses Angebot aus. Ich verließ diesen Ort beträchtlich im Geiste gestärkt.
Einige Zeit später, als ich abends nach Hause zurückkehrte, traf ich diesen Mann auf der Brücke. Er stand da und starrte in die träge Strömung des Flusses. Er sah aus, als hätte er Kummer.
Ich näherte mich ihm.
»Irgendwelche neuen Sorgen?« fragte ich. »Eine Vergiftung? Ein Ekzem? Oder vielleicht, Gott verhüte, Syphilis?«
»Ach was«, er seufzte schwer. »Lassen wir das Geschäft. Ich bin einfach traurig.«
Er sah so düster in die Tiefe, daß ich das nicht länger ertragen konnte.
»Wissen Sie was?« sagte ich. »Ich weiß nicht, was es sein kann, aber seit längerer Zeit habe ich hier solches Seitenstechen.«
»Eh, wirklich?« fragte er schon lebhafter.
»Ja, und außerdem hat mich in diesem Sommer auf dem Land ein Blitz getroffen.«
Er wurde so sichtlich heiter, daß es mich etwas unangenehm berührte. Also fügte ich hinzu:
»Aber er hat mich nicht erschlagen.«
Seine Miene verdüsterte sich wieder.
»Aber es hat weh getan? Was?« fragte er hoffnungsvoll.
Es war etwas so Flehentliches in seiner Stimme, daß ich ihm, weil ich ein so gutes Herz habe, antwortete:
»Sehr.«
»Na, dann werde ich mal wieder«, sagte er fast fröhlich. »Irgendwie wird’s schon werden, nicht wahr?«
Und er ging pfeifend fort. Seit der Zeit habe ich bei ihm Rabatt.
Ad astra
In der Absicht, ein Glas Milch zu trinken und sich bei dieser Gelegenheit ein wenig unters Volk zu mischen, begab sich der Romancier eines Tages in die Milchbar. Dort erregte seine Aufmerksamkeit ein Jüngling, der unmittelbar vor ihm in der Schlange stand. Der junge Mann unterschied sich auf den ersten Blick von den übrigen Kunden nur durch seine außerordentliche Blässe und die Anzeichen von Entkräftung, die sein Gesicht wie seine ganze Haltung aufwiesen. Sein Blick war umflort, sein Anzug sauber, aber zerknittert. Er machte den Eindruck, gerade eine lange und überaus anstrengende Reise hinter sich gebracht zu haben. Als die Reihe an ihm war, sagte er zu der Werktätigen hinter dem Schalter leise aber deutlich, mit einer sorgfältigen, jedoch nicht affektierten Diktion:
»Bitte sechzig Brötchen und eine Milch.«
In einer Epoche der Kollektivausflüge, in der selbst Hinterwäldler das Land gruppenweise zu durchstreifen gewohnt sind, erregte eine derartige Bestellung kein Aufsehen. Dennoch interessierte sich der Romancier jetzt um so lebhafter für den Jüngling. Er nahm, nachdem er den entsprechenden Preis an der kunstvoll dekorierten Kasse entrichtet hatte, sein Rote-Rüben-Filet in Empfang und setzte sich an einen Tisch, von dem aus er den jungen Mann weiter beobachten konnte.
Diesem zitterten die Hände, als er den ersten Schluck des erfrischenden Getränks zu sich nahm. Unmittelbar darauf überzog sein bisher wächsernes Gesicht eine zaghafte Röte, und plötzlich zückte er seine Füllfeder und begann, wie von einer höheren Gewalt getrieben, auf die Papierservietten zu schreiben. Er schrieb pausenlos, biß nur gelegentlich in seine Semmel oder hob gedankenverloren den Milchbecher zum Mund. Anscheinend verlieh ihm jeder Bissen neue Kräfte, denn immer schneller eilte die Feder über das Papier. Als der Becher leer war und die Semmel aufgegessen, blickte er um sich, als wäre er soeben aufgewacht, steckte den Füller in die Tasche und eilte hinaus, wobei er nicht vergaß, die restlichen neunundfünfzig Brötchen mitzunehmen.
Kaum hatte die Tür sich hinter ihm geschlossen, als der Romancier die auf dem Tisch gebliebenen Servietten ergriff und sie mit geübtem Blick überflog.
Er hatte eine vollständige Romanskizze vor sich, und es stand für ihn bald außer Zweifel, daß es sich trotz mancher Mängel und Flüchtigkeiten um das Werk eines Genies handelte.
Er rannte dem Jüngling nach, wiewohl er sich sagen mußte, daß die Aussicht gering war, ihn im Straßengewühl einzuholen. Von weitem sah er noch, wie der andere enteilte. Aber plötzlich blieb der junge Mann stehen, zögerte, schien mit sich selbst zu kämpfen, wandte sich dann aber einer Bank in den nahen Anlagen zu. Dort nahm er Platz und fing an, fieberhaft das zerknitterte Einwickelpapier zu beschreiben, in welches man ihm die Brötchen gepackt hatte. Der Romancier stellte sich hinter ihn und schaute ihm über die Schulter.
Was er zu lesen bekam, erfüllte ihn mit Bewunderung. Der Jüngling war dabei, die zuvor in der Milchbar hingeworfene Skizze auszuführen. Einige der ursprünglichen Fehler waren bereits eliminiert. Der Fortschritt gegenüber der Skizze war unverkennbar.
Da stellte sich der Romancier vor. Der Jüngling hob seine umwölkten Augen, in denen das Feuer des Genies brannte, zu ihm empor. Nach vielen Jahren einer erschöpfenden, aber vom Schein seines Talents aufgehellten Arbeit fing der Romancier an, sich alt zu fühlen. Daher liebte er es, Debütanten zu betreuen und sie als seine Nachfolger dem Ruhme entgegenzuführen.
»Hier können Sie doch nicht bleiben«, rief er. »Kommen Sie mit mir und lassen Sie dieses Backwerk liegen.«
Der Jüngling schien von dieser Einladung nichts wissen zu wollen. Er scharrte mit den Füßen, machte Verbeugungen und suchte sich zu entfernen. Dies war um so seltsamer, als er keineswegs den Eindruck der Schüchternheit machte.
Fast mit Gewalt führte ihn der Schriftsteller in seine Wohnung. Unterwegs eröffnete er dem jungen Mann eine glänzende Zukunft und versprach ihm seine Hilfe. Der Jüngling jedoch schwieg und warf ihm einen ebenso strengen wie rätselhaften Blick zu. Vermutlich leistete er nur deshalb keinen aktiven Widerstand, weil die neunundfünfzig Semmeln ihn in seiner Bewegungsfreiheit erheblich einschränkten. Dem Romancier entging das nicht. Er ist arm, genial und unzivilisiert, dachte er gerührt. Man muß sich seiner annehmen und sehr auf ihn achtgeben. Zu Hause schloß er ihn in seinem Arbeitszimmer ein. Die Semmeln erwähnte er nicht mehr, und er erlaubte es dem Jüngling, sie bei sich zu behalten. Er wollte nicht allzu streng gegen die seltsamen Gewohnheiten seines Gastes vorgehen, da er annahm, sie seien das Ergebnis bisheriger äußerst harter Lebensbedingungen. Seiner Haushälterin jedoch gab er den Auftrag, ein reichhaltiges und schmackhaftes Mittagessen zu kochen. Als der Jüngling in seiner Abgeschlossenheit das Mahl zu sich nahm, rief der Romancier seine Bekannten an und erzählte ihnen von seinem erstaunlichen Fund. Dann ließ er die Haushälterin zu sich kommen:
»Was macht er denn jetzt?« fragte er.
»Gegessen hat er, und nun schreibt er wieder. Sie können einem ja ein Loch in den Bauch fragen«, fügte sie im Weggehen noch hinzu. Sie war eine Frau aus dem Volke.
»Ausgezeichnet!« rief der Romancier und rieb sich die Hände.
Der Jüngling schrieb den ganzen Nachmittag. Abends machte er Licht im Arbeitszimmer. Nach diesem ungewöhnlichen Tag fühlte sich der Romancier frühzeitig müde. Er verbarg den Schlüssel zum Arbeitszimmer unter seinem Kopfkissen, legte sich nieder und schlief ein.
Mit dem Gefühl, etwas Unangebrachtes sei geschehen, schreckte er hoch. Schnell schlüpfte er in seinen roten Schlafrock aus chinesischer Rohseide und lief in das Arbeitszimmer. Die Hände zitterten ihm, als er den Schlüssel im Schloß umdrehte. Die Morgensonne erfüllte den Raum. Im stillen Frühlicht, das den Beginn eines neuen, erfreulicheren Lebens zu verheißen schien, lagen achtlos auf dem Schreibtisch verstreut die Blätter seines kostbaren Schreibpapiers. Sie alle waren vollgeschrieben, aber im Zimmer befand sich niemand.
Der Romancier eilte zum Schreibtisch. Er brauchte nicht lange, um herauszubekommen, was der Jüngling geschrieben hatte. Was in der Milchbar in flüchtiger, unsicherer, wenn auch schon genialer Form erschienen war und später in den Anlagen bereits klarere Konturen angenommen hatte, lag jetzt vollendet vor ihm. Es war ein Meisterwerk, dessen Feuer ihn blendete. Offensichtlich hatte der erschöpfte Organismus des Jünglings in dem Maße, als er Speisen zu sich nahm, neue Geisteskräfte entwickelt, und lediglich der Mangel an den nötigen Kalorien und Vitaminen war seinem bisherigen Schaffen Fessel und Hemmschuh gewesen. Das reichliche, im Arbeitszimmer verabreichte Mittagessen hatte den Durchbruch herbeigeführt.
Die offenstehende Balkontür verriet den Weg der Flucht. Im frischen Morgenwind blähten sich die Vorhänge. Augenscheinlich war das unbekannte junge Genie erst vor einem Augenblick am wilden Wein hinuntergeklettert, hatte den Gartenzaun überstiegen und befand sich jetzt auf der Straße. Bei der Flucht hatte er die Brötchen mit sich genommen.
Der Romancier zog rasch seine bulgarische Pelzjacke an und eilte die Treppen hinunter. Seine erste Information erhielt er von dem Invaliden im Zeitungskiosk, wo auch Schreibwaren zu haben sind. Dieser hatte den jungen Mann gesehen und sogar mit ihm gesprochen, als der bei ihm Kanzleipapier einkaufte. Dem gleich darauf angesprochenen Straßenkehrer war aufgefallen, wie der Jüngling an der nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle wartete. »Er war taufrisch und schön wie eine Rose. Dauernd hat er Papier aus der Tasche gezogen und darauf geschrieben«, erklärte er. Trotz aller Eile und Aufregung konnte sich der Romancier des Staunens nicht enthalten. »Sogar auf der Flucht schreibt er noch. Fürwahr, ich habe ein Genie entdeckt, wie es nur alle hundert Jahre einmal vorkommt. Und ich sollte es schon wieder verloren haben?« sagte er zu sich. Er beschloß, unermüdlich nach dem Jüngling zu suchen.
Die Bahn, auf die der ungewöhnliche junge Mann nach Aussage des Straßenkehrers gewartet hatte, konnte nur in Richtung Bahnhof gefahren sein und nur eine Haltestelle weit, da dort die Endstation war. Voll Unruhe erreichte der Romancier den Bahnhof. Viele Züge fuhren von dort in verschiedene Richtungen. Der Flüchtling konnte schon weit sein, und nichts berechtigte zu der Hoffnung, daß er ihn jemals wiederfinden würde. Der Romancier begab sich zur Sperre. Sofort fiel ihm der Eisenbahner auf, dessen Aufgabe darin besteht, zu kontrollieren, ob die Reisenden mit den erforderlichen Fahrkarten ausgestattet sind. Statt dessen jedoch las der Beamte, und sein Gesicht drückte die stärksten und verschiedenartigsten Gefühle aus. Bald lachte er, bald zeigte er höchstes Erstaunen, ja manchmal wischte er sich gar die Tränen aus den Augen. Die Reisenden aber kamen und gingen, wie es ihnen gefiel. Der Romancier trat näher und erblickte in den Händen des Eisenbahners Kanzleipapier, dessen Seiten mit einer ungleichen Schrift bedeckt waren, so als habe die Hand des Schreibenden infolge der Stöße und Erschütterungen einer Straßenbahn gezittert.
»Woher haben Sie das?« fragte er den Eisenbahner mit einer infolge seines bösen Vorgefühls gepreßt klingenden Stimme.
Dem Angesprochenen fiel es schwer, sich von seiner Lektüre loszureißen, und es verging einige Zeit, bis er die Frage schließlich verstanden hatte. Zuerst rief er nur immer: »Ist doch unerhört! Nein, so etwas! Stell sich einer vor!«, und erst dann kehrte er in die Wirklichkeit zurück. Beinahe barsch erklärte er, das Manuskript habe ihm ein junger Mann gegeben, der durch die Sperre gegangen sei. Nach dieser Erklärung las er sofort eifrig weiter. Der Romancier aber eilte auf den Bahnsteig.
Hier standen ein paar Vorortzüge herum, schnauften schläfrig einige Lokomotiven. Der Schriftsteller durchsuchte Zug für Zug jedes Abteil. »Wenn er sich nicht unter einer Bank versteckt hat, kann ich mir nicht vorstellen, wohin er geraten ist«, sagte er sich. Er schaute auf den Fahrplan. Seitdem der Jüngling die Sperre durchschritten hatte, war kein Zug abgefahren.
Ratlos und niedergeschlagen suchte er weiter. Schon befürchtete er, sich im Bekanntenkreis durch seine Anrufe lächerlich gemacht zu haben. Was nützte es, daß sich ein Manuskript in seiner Hand befand? Die ganze Angelegenheit mußte jedem verdächtig erscheinen. Bestimmt würden alle glauben, er selbst habe das Meisterwerk verfaßt und wolle durch das Märchen von einem unbekannten jungen Verfasser nur Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Jetzt irrte er an der Peripherie des Bahnhofs umher. Hier langweilten sich einzelne Waggons und ganze Güterzüge, mit denen es niemand eilig hatte. Gerade ging er an einem abgestellten Güterwagen vorbei, als er ein Summen wie aus einem Bienenstock vernahm. Aber da der Romancier beim Studium des Lebens auch einige Zeit auf dem Lande verbracht und sich mit den Problemen der Natur vertraut gemacht hatte, wurde ihm bald klar, daß dieses Geräusch nicht von Bienen oder anderen tierischen Wesen herrühren konnte.
Die seltsamen Töne kamen aus einem jener gedeckten Wagen, wie sie beim Transport von Pferden oder anderer empfindlicher Ware Verwendung finden. Er legte sein Ohr an die nach Teer, Kohlenstaub und weiten Reisen riechenden Bretter. Das Geräusch verstärkte sich, mußte also im Innern des Waggons seinen Ursprung haben. Die Schiebetür befand sich auf der anderen Seite.
Er sprang über die Schienen. Die Tür stand offen. Im Waggon saßen ungefähr sechzig junge Leute und schrieben voll Hingebung. Ihre über das Papier rasenden Federn ergaben jenen Laut, jenes regelmäßige Kratzen, das an das Summen von Hummeln erinnerte oder an ein im Anmarsch befindliches Termitenheer.
Ganz außen saß der Entflohene. Auch er schrieb. Die jungen Männer unterschieden sich kaum voneinander. Alle waren sie sauber und bescheiden gekleidet, alle hatten sie Anzüge, die von einer langen Reise zerknittert schienen. Trotz verschiedener individueller Merkmale lag in all diesen Gesichtern etwas Edles, trugen sie alle das Siegel des Genius.
Der Romancier zog seinen jungen Freund am Ärmel. Er wollte etwas sagen, etwas fragen; aber noch ehe er dazu kam, warf jener einen Blick auf ihn, der aus einer ganz anderen Welt zu kommen schien. In diesen Augen lag eine so furchtbare Gleichgültigkeit gegenüber der Umgebung, eine solche Abwesenheit und gleichzeitig eine so unglaubliche Konzentration, daß der Romancier erblaßte, den Ärmel fahren ließ und, über die Schienen stolpernd, weglief. Das unablässige Rascheln verfolgte ihn noch lange. Vor einem alten Mann in Eisenbahneruniform blieb er endlich stehen. Der Blick der alten, verwaschenen Augen, die nichts mehr in Erstaunen versetzen konnte, ließ ihn wieder zu sich kommen.
»Dieser Güterwagen«, fragte er schwer atmend und hinter sich weisend, »was hat das zu bedeuten?«
»Sie sind alle in einem plombierten Waggon gekommen«, murmelte der Alte. »Niemand weiß woher … Und ob sie schreiben! Die ganze Zeit. Als wir den Waggon aufmachten, kamen sie gar nicht auf die Idee, Gott zu loben oder uns einen guten Tag zu wünschen. Sie griffen bloß zur Feder. Bestimmt haben sie schon unterwegs geschrieben, aber nicht so viel, weil sie da Hunger hatten. Ihre Marschverpflegung war schon lange alle. Aber dann ist einer losgezogen und hat Semmeln geholt; jeder hat eine bekommen und einen Schluck Wasser getrunken, und heißa, wie sie jetzt schreiben! Weiß der Teufel, was da dahintersteckt.« So schloß der alte Weichensteller nachdenklich.
»Ich danke Ihnen«, flüsterte der Romancier.
»Nicht der Rede wert! Wir Weichensteller haben schon manches erlebt.«
In der Seele des Schriftstellers war alle Entdeckerfreude erloschen. Mit hängendem Kopf, von unklaren Gedanken hin und her gerissen, verließ er langsam den Bahnsteig. Es war noch ziemlich früh am Vormittag; der Gedanke, sich jetzt an die gewohnte Arbeit zu begeben, bereitete ihm Unbehagen. Als hätte er bleierne Sohlen, so schwerfällig schleppte er sich zur Stadt. Er betrat ein Restaurant. Der Kellner schlug ihm eine reiche Auswahl von Vorspeisen und Hauptgerichten vor; aber der Romancier bestellte nach kurzem Nachdenken nur ein Brötchen.
»Und ein Gläschen Wodka«, fügte er nach einer Pause hinzu. Er hoffte, der Alkohol verhelfe ihm zur Kristallisierung seiner Eindrücke und Bedenken, deren Formlosigkeit ihn jetzt so quälte. Mit der Semmel verband er eine besondere Absicht.
»Noch eine Semmel«, sagte er nach einiger Zeit. »Und noch einen Wodka.«
Auch zum Mittagessen bestellte er lediglich drei Semmeln mit Wodka. Aber die ihn grämende Unklarheit wollte nicht weichen. Am Nachmittag sah man ihn da und dort; sein Zustand wurde besorgniserregend. Er ging nicht nach Hause, sondern betrat bald eine Bäckerei, bald eine Bar. Am Abend hatte er insgesamt fünfzehn Semmeln verspeist; mehr bekam er einfach nicht hinunter. So beschränkte er sich auf den Wodka und verbrachte die Nacht in einem entsprechenden Etablissement.
»Nur fünfzehn!« sagte er zu dem Barmann, und dann fuhr er fort: »Angesichts des Kollektivs ist das Individuum ein Nichts … Josef, seien Sie so gut und hauen Sie dem Kerl da drüben eine herunter …«
Schließlich brachten ihn irgendwelche Bekannte nach Hause. Am Morgen ließ man ihn nicht ausschlafen, obwohl er dessen so dringend bedurft hätte. Das Telephon weckte ihn. Ein Anruf folgte dem andern. Sämtliche Romanciers meldeten sich. Ihre Stimmen klangen erregt. Aus den Mitteilungen, die er empfing, ehe er von neuem in einen schweren, vom Wodka aufgedunsenen Schlaf fiel, ehe sich in seinem aus der Fassung geratenen Unterbewußtsein wieder Klumpen von Empfindungen zusammenballten und dann aufplatzten, ehe er sich wieder an die hinkende Verfolgung unfaßbarer Assoziationen machte und dennoch nur dem einzig greifbaren Nichts näherrückte, ergab sich gegen Mittag folgendes Bild:
Am Palais des Verlags, der sich auf die Herausgabe von Romanen spezialisiert hatte, war ein Taxi vorgefahren. Ihm entstiegen vier bescheiden, aber sauber gekleidete junge Männer und schleppten etwa sechzig Kilogramm Meisterwerke. Einer von ihnen rührte die Trommel; so schritten sie in das Gebäude. Sie benahmen sich zurückhaltend und korrekt. Ihre Namen kannte niemand. Der Direktor war so entzückt, daß er ihnen sofort den höchsten Honorarsatz anbot. Sie jedoch wollten lediglich, daß ihnen die Kosten fürs Papier ersetzt und Spesen für eine spartanische Lebensweise ausgesetzt würden. Sie unterzeichneten einen Vertrag und fuhren dann mit ihrem Taxi wieder ab. Die Angestellten, die sie von den Fenstern aus beobachteten, versicherten, daß sie bereits im Auto wieder anfingen zu schreiben. Die Lektoren jedoch, die sich sofort an die Durchsicht des überbrachten Materials machten, behaupteten, niemals in ihrem Leben etwas ähnlich Vollkommenes gelesen zu haben.
Der Romancier hatte einen schweren Tag. Nach dem gestrigen Alkoholmißbrauch kam er erst allmählich wieder zu sich. Aber die zahllosen Anrufe zeigten ihm, daß in der Stadt etwas ganz Außergewöhnliches vor sich ging. Die entferntesten Bekannten riefen ihn jetzt an, als seien angesichts einer besonderen Gefahr die gegenseitige Verständigung und der Halt aneinander unerläßlich geworden. Selbstverständlich riefen auch jene Kollegen an, denen der Romancier vorgestern, als noch niemand eine solche Wendung vermuten konnte, seine Entdeckung berichtet hatte. Aufgeregt begehrten sie, Einzelheiten zu erfahren. Sie erkundigten sich nach dem Befinden des jungen Genies, und als sie erfuhren, daß es entflohen sei, schrien sie auf und beendeten das Gespräch ganz plötzlich, als hätten sie es überaus eilig, in ihr Café zu kommen. Die Haushälterin jedoch ließ nichts von sich hören und erschien auch nicht, obwohl er mehrmals nach ihr gerufen hatte. Dabei quälte ihn ein schrecklicher Durst.
Schließlich rief ein Kritiker an, den alle seines unbestechlich kühlen Verstandes wegen schätzten. Dieser Anruf brachte endlich eine gewisse Ordnung in das bisherige Durcheinander. Der Kritiker wünschte, der Romancier solle ihm das Manuskript des Jünglings überlassen, damit er eine entsprechende Analyse anstellen könne.
Immer noch schwankend begab sich der Romancier in sein Arbeitszimmer. Aber das Manuskript war verschwunden. Er durchsuchte den Schreibtisch und dann das ganze Zimmer. Er wühlte im Schlafzimmer und im Salon, da er annahm, er habe es geistesabwesend dort irgendwo verlegt. Endlich kam er auch in die Küche. Die Haushälterin saß auf ihrem Bett; sie bemerkte ihn nicht, so vertieft war sie in die Lektüre des Manuskripts. Er wollte seinen Augen nicht trauen. Das schlichte Weib hatte bisher allen Aufrufen zur Volksbildung sein Herz verschlossen. Auch hatte sie es niemals zuvor gewagt, auf dem Schreibtisch ihres Herrn etwas anzurühren.
Der Romancier versuchte, ihr das Manuskript abzunehmen, aber sie leistete Widerstand. Krampfhaft hielt sie die Bogen mit beiden Händen fest, wandte keinen Blick davon ab und las mühsam halblaut Zeile für Zeile. Eine solche Gewalt hat das Meisterwerk über eine unverbildete Seele! Im Verlauf des sich ergebenden Gezerres stieß er sie etwas zu heftig, so daß sie vom Bett fiel und mit dem Kopf an das eiserne Gestell schlug. Sie lag regungslos und hielt in der Hand ein von einem Bogen abgerissenes Fetzchen, als ob sie trotz allem weiterlesen wolle. Eine stille Glückseligkeit verklärte ihre Züge. Der Romancier zog rasch seine vietnamesische Weste an und enteilte mit dem Werk.
Das Ergebnis der Analyse deckte sich mit den ersten Eindrücken. Es handelte sich um ein vollendetes Meisterwerk, das alle jemals gegenüber der Literatur erhobenen Forderungen in den Schatten stellte. Etwas Überirdisches, unbegreiflich Vollkommenes pulsierte in jedem Satz. Mit diesem Roman waren alle Begrenzungen durchbrochen, mit ihm wurde der Vorstoß in Sphären, die bis dato nicht einmal erfühlt waren, zur Tatsache. Seine Aussagen über den Sinn des Lebens waren völlig ausreichend, und doch ließ er genügend offen, um gleichzeitig mitreißen und lokken zu können, er stillte die von ihm entfesselte Sehnsucht und stachelte sie dennoch weiter an. Eines stand fest: nach einem Autor dieser Klasse hatte niemand mehr etwas zu sagen.
Die Erfahrungen der folgenden Tage bestätigten die Ergebnisse der Analyse. Die von der vierköpfigen Delegation der Genies beim Verlag abgegebenen Werke erschienen in unglaublich kurzer Zeit auf dem Markt, da alle übrigen im Druck befindlichen Romane zurückgestellt wurden. Im Sektor Verlagswesen herrschte Freude und Begeisterung. Nach einer Periode, da man nur mit größter Mühe einigermaßen ordentliche Werke hatte ausfindig machen können und stolzen Schriftstellern ihre zweitrangigen Arbeiten auch noch abringen mußte, hatte man auf einmal Meisterwerke en masse, bei denen sogar der Gedanke an Korrekturversuche unter den Tisch fiel. Die erste Auflage war in ein paar Tagen vergriffen; diese Bücher kaufte der Mann von der Straße und der anspruchsvolle Kenner. Jetzt fühlten sich nicht nur die Romanciers, sondern auch die Kritiker in ihrer Existenz bedroht. Angesichts solcher Werke konnte nicht mehr die Rede davon sein, Nuancen aufzuzeigen, irgendwo einzuhaken, erübrigte es sich eben, Rezensionen zu schreiben. Es war sogar sinnlos, ihr Loblied zu singen.
Die Landleute ließen ihren Pflug stehen und zogen es vor zu lesen. Die Ernte war in Gefahr. Das Vieh brüllte hungrig in den Ställen. Und dabei war bereits ein neuer Schub von Meisterwerken zu erwarten, da eine weitere Delegation der Genies, diesmal mit einem Lieferwagentaxi, beim Verlag vorgefahren war und ein paar hundert Kilo Manuskripte abgegeben hatte. Alle früher erschienenen Romane wurden beiseite gelegt und vergessen. Sie waren überflüssig. Im ganzen Land las man nur noch die neuen Bücher.
Es war eine knappe Woche seit den eingangs beschriebenen Ereignissen vergangen, als sich unser Romancier zu einem Verlag begeben wollte, der sich ausschließlich mit der Veröffentlichung von Lyrik befaßte. Bisher nämlich war lediglich der Romansektor von der neuen, befremdlichen Fruchtbarkeit befallen. In seiner Aktentasche hatte unser Freund einige selbstverfertigte Gedichte, deren Ausarbeitung ihn viel Schweiß gekostet hatte, da er in dieser Sparte sich nicht zu Hause fühlte. Dennoch trug er sich mit der Hoffnung, einen Vorschuß zu bekommen. Unterwegs begegnete ihm ein bekannter, sehr angesehener Dichter.
»Du brauchst gar nicht erst hinzugehen«, sagte er finster. »Sie waren bereits da. Jetzt sind wir an der Reihe. Gestern ist ihre Lyrik-Abteilung in Aktion getreten.«
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander. Der Himmel war bewölkt; Regen stand bevor.
»Vielleicht gehen wir zum Theater«, sagte der Romancier. »Lange schon erfüllt mich ein Gedanke, aus dem sich etwas machen ließe.«
Im Theater stellte sich heraus, daß gleichzeitig mit ihrer lyrischen auch ihre dramatische Sektion gestartet war und außerdem noch die Sektionen für Filmdrehbücher, Kleinkunst und Jugendbücher. Selbst die Kabaretts waren bereits den Neuen in die Hände gefallen. Am selben Tage noch mußte man eine Reihe von Zuschauern hinaustragen, weil sie sich krank gelacht hatten. Dies war das Signal zum letzten Gefecht.
Die Vögel setzten sich im Geäst bereits zum Schlafe nieder, als der Romancier auf einer kleinen Provinzstation aus dem Zuge stieg. Bald schon schritt er auf einem holprigen Waldpfad. Von überall her drang das Knacken trockener Äste, die unter unsichtbaren Füßen zerbrachen, der Widerhall von Schritten, das Rascheln dürren Laubwerks. Schon in der nächsten Schneise traf er auf eine Gruppe von Schriftstellern. Hier prüfte ein Stückeschreiber die Tragfähigkeit eines halbzerfallenen Stegs, dort besserten hervorragende Kritiker einen Damm aus, und plötzlich brach der Märchenonkel aus einem Haselgebüsch. Von der Schonung her drang das Kreischen eines Eichelhähers. So riefen die Avantgardisten die Ihren mit dem verabredeten Signal zusammen. Die Authentisten aber gingen, als ständen sie still. Ein Anhänger des Realismus beobachtete, während er rüstig ausschritt, das Leben der Ameisen, die Verfasserin bekannter Kinderbücher aber scheuchte das Füchslein, das sich den Hals nicht gewaschen hatte, aus seinem Versteck, um bald darauf forschend das Ohr an eine Baumhöhle zu legen. Die verheißungsvollen Debütanten aber rissen da und dort ein Bäumchen aus und bemühten sich, überall ihre Losung zu hinterlassen. Ein Unbekannter jodelte.
Laut, überschäumend und mutig eilte das wackere Volk neuen Taten entgegen. Von überall her waren die Abteilungen zusammengeströmt; manche dieser Recken hatte der Herold beim Melken getroffen, beim Umgang oder Feiern, und all dies hatten sie stehenden Fußes verlassen, um dem Ruf zu folgen, der an sie ergangen war.
Sie kamen zusammen im malerisch auf einer Waldwiese gelegenen Jagdschlößchen, wo Thingstätte und Betten vorsorglich gerichtet waren.
Als der letzte Spätling mit Blattwerk im Haar atemlos aus dem Wald gekeucht kam, wurden die Türen geschlossen und die hellhörigsten Kritiker als Wachen aufgestellt. Alle waren sich des Ernstes der Lage bewußt und bequemten sich daher zu einer vorbildlichen Disziplin. Nicht einmal bei der Leibesvisitation kam es zu Zwischenfällen. Einigen allerdings war es bereits gelungen, Alkohol aus Eicheln zu saugen; diese wurden in den Alkoven der Eckkemenate geschickt.
Knapp waren die Eröffnungsworte des Vorsitzenden. Er wies lediglich darauf hin, daß der Kongreß in diesem abgelegenen Winkel offiziell als Gedächtnistreffen für einen längstverstorbenen Volksdichter angekündigt war, der mit seinen schlichten Worten die Schönheit der Gegend besungen hatte. Es könne jedoch als bekannt vorausgesetzt werden, daß nicht aus diesem Grunde sich so viele auf den Weg gemacht hätten:
»So schlage ich denn vor, eine Schweigeminute zu Ehren dieses Dichters einzulegen und dann zur Sache zu kommen.«
So geschah es mit dem Einverständnis aller. Dann erhob sich ein Mitglied der Kommission und hub also an:
»Mir ist die Aufgabe zugefallen, ein allgemeines Licht auf unsere Lage zu werfen. Ich habe jedoch den Eindruck, daß dieselbe allen hinreichend bekannt ist. Das einzig Tröstliche sind die Einmütigkeit und die Brüderlichkeit, die unter uns …«
»Zuerst muß Wladek ausgeschlossen werden, weil er ein Schweinehund ist«, ertönte eine Stimme aus dem Saal.
»In unerschütterlicher Einmütigkeit, sage ich noch einmal. Da sehe ich vor mir Debütanten und Invaliden der Feder, Realisten und die Vertreter der am weitesten vorangetriebenen Spitze. Aber kommen wir zur Sache. Auf dem Büchermarkt erscheinen neuerdings die Werke teuflisch begabter Autoren. Woher kommen diese Autoren? Meine Damen und Herren, das dürfte Sie interessieren. Seit geraumer Zeit schon werden Ankömmlinge aus dem Kosmos erwartet. Man schreibt ihnen die phantastischsten Gestalten zu und macht sich bei ihnen auf das Außergewöhnlichste gefaßt. Freilich hat niemand angenommen, daß es sich dabei ausgerechnet und ausschließlich um Literaten handeln würde, denen das Wort des Absoluten zur Verfügung steht. Keine geheimnisvollen Strahlungen, keine neuartige Energie, keine unerhörten Maschinen, sondern eben die Genialität im Bereich der Literatur! Ihr Eintreffen war für uns Spezialisten des Wortes ebenso niederschmetternd, wie es zum Beispiel für unsere Ingenieure gewesen wäre, wenn es sich zufällig um geniale Techniker und Konstrukteure gehandelt hätte. Zu unserem Unglück traf dieser Schlag uns und nicht die Ingenieure.«
»Schweinerei! Schiebung!« rief jemand aus dem Saal.
»Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Verlagsanstalten jetzt unsere Arbeiten verschmähen und sich nur noch mit den Zugereisten befassen. Seien wir ganz ehrlich. Angesichts des Absoluten und des rätselhaften Alls ist keiner von uns besser oder talentierter als die andern.«
»Da können Sie nur in Ihrem eigenen Namen sprechen, merken Sie sich das! Das ist Ihre Angelegenheit, wenn Sie nur Durchschnitt sind!« kam es aus dem Saal.
»Und nun einige Worte zu der Frage, warum wir unsere Versammlung nicht in aller Offenheit einberufen konnten, sondern zu dieser Dichterehrung unsere Zuflucht nehmen mußten. Das ganze Land ist in die neuen Autoren vernarrt. Sogar Familien, die bisher in bester Eintracht lebten, reißen sich ihre Werke aus der Hand. Die Druckereien kommen überhaupt nicht mehr nach. Stellt euch also vor, Kollegen, welchen Eindruck eine solche Versammlung machen müßte. Unser ganzes Leben lang haben wir uns damit abgerackert, der Vollkommenheit, dem Geheimnis näherzukommen. Ich möchte sogar behaupten, daß wir gerade aus diesem Grund von so viel Achtung umgeben waren. Und plötzlich treten diese Wesen auf, die Erfüllung unserer Träume sind, Vollkommenheit und Geheimnis personifizieren. Wir aber, statt uns zu demütigen, Hosianna zu rufen, das Ereignis, die Offenbarung und das Werk zu rühmen, ziehen uns in den Schmollwinkel zurück, sind verstimmt, ja, berufen gar eine Versammlung gegen die Sendboten des Absoluten ein. Wie würden wir dastehen, was sollte die öffentliche Meinung von uns halten? Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, insgeheim oder öffentlich, die Versammlung findet jedenfalls statt, und wie stehen wir nun vor uns selber da? Gestattet, daß ich darauf nicht eingehe, sondern das Problem jedem einzelnen überlasse, auf daß er selbst seine Antwort darauf finde …«
Stimmen: »In den Verlagsanstalten ist alles Protektion … Geben Sie mir meinen Notizblock zurück! … Was ist hier eigentlich los?«
»Ich wiederhole es noch einmal: Dem Absoluten gegenüber stehen wir alle nur auf einer Stufe.«
Stimmen: »Und wie wird das jetzt mit den Stipendien?«
»Nach diesen kurzen Ausführungen schlage ich vor, wir sollten keine weitere Zeit mehr mit der Erörterung der Angelegenheiten verlieren, deren Bedeutung für uns außer Frage steht. Beschränken wir uns nun auf das Problem, wie wir uns verteidigen können, obwohl, wie ich gestehen muß, unsere Aussichten ungemein gering sind.«
Im Saal herrschte große Unruhe. Niemand schlief. Einige riefen: »Los, denen werden wir’s zeigen! Wo ist Kazik?« Andere dagegen mahnten zur Mäßigung. Es war schon ganz dunkel geworden, und vor dem Fenster stand der Wald als schwarze Wand. Jemand brachte elektrische Glühbirnen. Die Kritiker auf Posten riefen sich ihr »Allzeit bereit!« zu. Die Hungrigsten packten ihre Butterbrote aus.
Als nächster gab der Leiter der Spionageabteilung des Hauptvorstands seinen Bericht. Im Gegensatz zu seinem Vorredner vermied er allgemeine Schlußfolgerungen, aber von ihm erwartete man es nicht anders. Mit leiser, jedoch vernehmlicher Stimme erteilte er seine Informationen, wobei er sich auf Tatsachen und Statistiken stützte. Die Versammelten erfuhren, daß die Junggenies kaserniert und in vier Grundeinheiten, sogenannte Schreibanien, eingeteilt waren. Diese wiederum bestanden aus Skriberiegen zu je fünf Mann. Je zwei Schreibanien bildeten ein Kulturion. In die Stadt gingen sie nur gruppenweise und nur dann, wenn ein Transport fertiger Meisterwerke fällig war. Nach Unterzeichnung der Verträge und Entgegennahme der Vorschüsse begab sich die betreffende Delegation in vorbildlicher Ordnung in die Zitadelle zurück.
Stimme: »Wieviel bekommen sie pro Bogen?«
Den Auskünften der Nachrichtenmänner zufolge arbeiteten die Genies sehr gleichmäßig und bedienten sich dabei einer Methode, die dem Infanteriereglement für Sturmangriffe entsprach. Dieses bestimmt bekanntlich, daß, während die eine Schützenkette vorrückt, die andere liegenbleibt und ersterer Feuerschutz gewährt – und dann umgekehrt. So arbeiteten auch die Genies. Die eine Hälfte schrieb, und die andere las, was die einen zustandegebracht hatten. So schulten sie sich gegenseitig und wurden noch vollkommener. Dementsprechend erwies sich die Hoffnung, die Qualität müsse bei einer so intensiven Produktion gelegentlich zu wünschen übriglassen, als trügerisch. Außerdem garantierte ihnen dieses System völlige Autarkie.
Stimme: »Vielleicht sollte man mit ihnen mal Wodka trinken.«
Der Redner erklärte mit gleichmäßiger, leidenschaftsloser Stimme, daß sich die Genies bescheiden, aber gesund ernährten. Sie vermieden rauchige Lokale, machten vor dem Schlafengehen einen Spaziergang, trieben Gymnastik und gingen grundsätzlich vor Mitternacht ins Bett. Sie tranken ausschließlich abgekochtes Wasser und auch das nur in kleinen Mengen.
Erst jetzt begriffen die Versammelten, in welch schwieriger Lage sie sich befanden. Im Saale herrschte betretene Stille. Hinter den Fenstern ging der Mond auf. Jemand verlangte mit gepreßter Stimme, man solle die Lampen hochschrauben.
Der Redner berichtete dann über die Versuche, die unternommen wurden, um die Popularität der Genies zu vermindern. Entschlossene, zu allem bereite Schriftstellerfreiwillige begaben sich, als Leser verkleidet, in die öffentlichen Bibliotheken und versuchten dort den Leuten die Meisterwerke madig zu machen. Sie wurden jedoch so scharf zurückgewiesen, daß man diese Versuche als aussichtslos einstellte. Der Redner wandte sich mit der Bitte um Vorschläge an die Versammelten. Jemand meinte, man solle die Leser verprügeln. Da erhob sich der Romancier und überzeugte anhand des Zwischenfalls mit seiner Haushälterin die Hörer von der Zwecklosigkeit dieser Methode. Schließlich begann man über die Möglichkeit einer Verbesserung der eigenen Werke zu beraten. »Wir brauchen mehr Inspiration.« – »Man sollte grundsätzlich nur bei Kerzenlicht schreiben.« – »Wladek muß aus dem Schriftstellerverband hinausgeworfen werden.« – »Machen wir eine Kampagne, um Neuzugänge zu gewinnen.« Mehr kam bei der stürmischen Diskussion nicht heraus.
Da erhob sich ein Schriftsteller, der in einer hinteren Reihe an der Seite gesessen hatte und den die Versammelten voll Respekt anblickten, obwohl er bisher kein Wort gesagt hatte. Dieser stattlich gewachsene, beim Schreiben ergraute Mann hatte ein von der Ideengewinnung für Stücke und Novellen durchfurchtes Gesicht. Im Saal entstand erwartungsvolles Gemurmel. Er aber warf den Versammelten seinen hellen und klaren Blick zu und begann dann mit überzeugender Bruststimme:
»Kollegen, Brüder, unser Landtag geht seinem Ende entgegen, und da müssen wir feststellen, daß wir zwar viele treffliche Bemerkungen gehört haben, daß es aber unmöglich ist, aus diesen einen einheitlichen Gedanken, eine Leitidee abzuleiten. So lasset uns doch die Sache der allgemeinen Rettung jetzt in die Hand nehmen.«
Wieder herrschte Schweigen im Saale, und alle hefteten den Blick auf den neuen Headman. Der goß sich dann und wann einen Schluck Wasser ein und fuhr fort:
»Unsere Kundschafter haben uns mitgeteilt, daß die Genies gemeinsam und gleichmäßig schreiben. Wir aber haben uns zerstreut und vereinzelt, und statt einer Schlacht liefern wir nur Scharmützel. Ich sehe nur einen Ausweg: Lasset uns unsere Kräfte zusammenschließen und allen Eigennutz aufgeben. Jeder halte sich bereit und begebe sich unverzüglich an den ihm zugewiesenen Platz. Wir müssen ein befestigtes Lager anlegen. Dort werden wir die Gedanken und Talente konzentrieren und im Austausch der Ansichten wie der Themen mit Hilfe von Diskussionen und Tagungen tüchtige Werke schaffen, die den Rivalen zumindest einen hinhaltenden Widerstand zu leisten vermögen. Auf, ins Lager!«