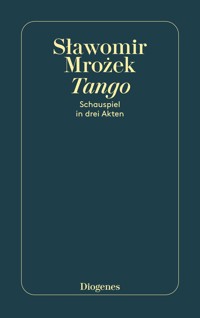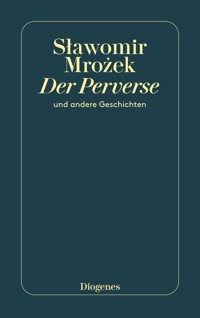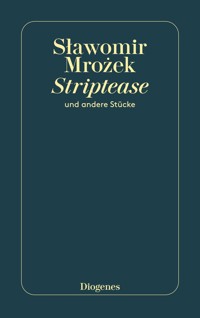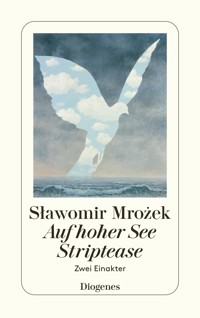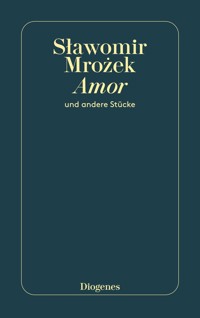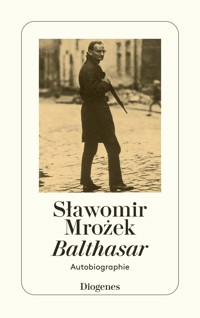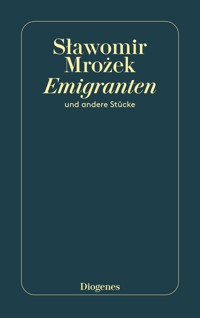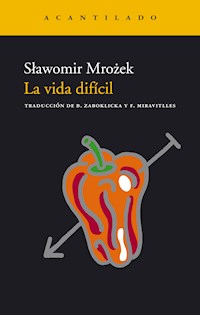7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zeitloses Geschenkbuch für alle Lebenslagen: Noch nie war leben so einfach! Von A wie Arbeit über Beziehung, Bildung, Glaube, Haustiere, Karriere, Konkurrenz und Nervosität, Sadismus, Sicherheit, Verantwortung bis Z wie Zivilisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Das Leben für Fortgeschrittene
Ein überflüssiges ABC mit Zeichnungen von Chaval
Herausgegeben von Daniel Keel und Daniel Kampa
Diogenes
Die Kandidatur
An den Allerhöchsten Staatsrat: Hiermit kandidiere ich für den Grabposten des Unbekannten Soldaten.
Als Unbekannter habe ich hervorragende Qualifikationen, weil mich niemand kennt. Alle wissen, wer Elvis Presley war, oder die Beatles oder Mick Jagger, aber über mich ist nichts bekannt. Wenn der Allerhöchste Rat das nicht glaubt, dann können Sie fragen, wen Sie wollen, jeder wird dem Allerhöchsten Rat bestätigen, daß niemand je von mir gehört hat.
Ich habe sogar versucht, berühmt zu werden, und habe einmal auf einer Hochzeit einen halben Liter Wodka in fünf Minuten ausgetrunken. Aber mir ist schlecht geworden, und ein Krankenwagen hat mich abgeholt, und sie haben mir den Magen ausgepumpt. Danach habe ich mir eine Zeitung gekauft, weil ich dachte, da wäre vielleicht eine Notiz in der Rubrik ›Kleine Unfälle‹, aber es war nichts drin.
Ich habe dann lange nachgedacht, warum es so ist, und jetzt weiß ich es. Ich habe ein sehr großes Talent dazu, unbekannt zu sein, und deshalb kann ich kein anderes Talent haben.
Als Soldat habe ich die Kategorie C, aber nur in der Reserve. Aber darum geht es ja auch nicht, der Unbekannte Soldat muß ja nicht die Kategorie A haben, Hauptsache, er ist sehr unbekannt, und das kann ich wirklich garantieren, da darf der Allerhöchste Rat ganz beruhigt sein. Es wird nie einen Skandal geben, wenn eine ausländische Delegation anreist, um einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niederzulegen, denn im Ausland bin ich noch weit unbekannter als bei uns im Lande. Diskretion wird zugesichert, und ich werde auch zufrieden sein, wenn ich im Lande und im Ausland berühmt werde, wenn auch als völlig Unbekannter. Und warum sollte man ein solches Talent vergeuden?
Meinen Namen und meine Adresse füge ich aus verständlichen Gründen nicht bei. Ich warte gern auf Ihre positive Antwort.
Das Dreieck
Wir sollten uns trennen«, sagte ich. »Schluß mit dieser Geschichte. Wir sind schon lange beieinander, haben viele Abenteuer zusammen erlebt, doch nun ist es genug, wir haben uns gegenseitig satt. Wozu das verheimlichen? Ich kann euch nicht mehr riechen.«
»Tut mir leid«, sagte der Fuchs, »aber ich bin’s, der dich nicht mehr riechen kann. Und ihn auch nicht«, setzte er hinzu und wies auf den Hahn.
»Und ich weder ihn noch dich«, sprach der Hahn.
»Ich habe gesagt: gegenseitig. Das erste schließt das zweite nicht aus, das zweite nicht das dritte und das dritte nicht das erste. Punktum, wir alle haben unsere Gesellschaft satt. Es bleibt uns nur auseinanderzugehen.«
»Gut«, stimmte der Fuchs zu, »aber wer verläßt wen?«
»Genau«, bestätigte der Hahn. »Einverstanden, aber wer geht als erster weg?«
»Niemand geht als erster weg. Wir gehen gleichzeitig auseinander.«
»Unmöglich«, sagte der Fuchs.
»Warum?«
»Wenn wir alle gleichzeitig auseinandergehen, wer bleibt dann hier, um festzustellen, daß wir nicht mehr da sind?«
»Das ist’s. Jemand muß hierbleiben, um das festzustellen.« Damit unterstützte der Hahn den Fuchs.
»Dann bleibe ich hier.«
»O nein«, widersetzte sich der Hahn. »Du bleibst hier, als wäre nichts geschehen, und ich soll weggehen? Kommt nicht in Frage.«
»Das wäre auch in bezug auf mich ungerecht«, warnte der Fuchs.
»Dann gehe eben ich weg, und ihr bleibt hier.«
Der Hahn warf einen Blick auf den Fuchs, der Fuchs auf den Hahn.
»Und ich soll weiter diese Fuchsschnauze anschauen?«
»Und ich soll weiter diesen dummen Schnabel anschauen?«
»Nun, dann laßt uns alle gemeinsam hierbleiben.«
»Ja, das ist der einzige Ausweg«, sagte der Hahn nach kurzem Schweigen.
»Ja, das ist die einzige Möglichkeit«, gab der Fuchs nach kurzem Überlegen zu.
»Wer aber geht nun woandershin?« fragte ich.
»Mach dir keine Sorgen«, sprach der Fuchs. »Wir werden zwar gemeinsam hierbleiben, werden dafür aber nicht woanders sein.«
So macht man das nicht
In der Zeitung habe ich gelesen, daß über uns Satelliten fliegen. Mit bloßem Auge kann man sie nicht sehen, selbst durch ein Fernrohr nicht, weil sie im Kosmos fliegen. Aber sie sehen uns. Was schlimmer ist, sie fotografieren alles auf der Erde – und das mit einer solchen Genauigkeit, daß alles, was nicht weniger als einen halben Meter lang oder breit ist, auf dem Foto so genau herauskommt, als ob dieses Foto ein Cousin bei der Namenstagsfeier oder bei der Hochzeit gemacht hätte. ›Man braucht sich keine Sorgen zu machen‹, dachte ich, ›meine Fresse ist weniger als einen halben Meter lang.‹
Nichtsdestotrotz begann ich die Sache zu verfolgen. Meine Fresse kann sich entzünden und anschwellen, oder – was Gott verhüten möge! – jemand haut mir auf die Schnauze, und dann bin ich so auf dem Foto.
Irgendwie aber hat mein Gebiß gehalten, und bis jetzt hat mich niemand verprügelt. Aber was hilft’s! Eines Tages erfuhr ich beim Zeitunglesen, daß sie die Satelliten verbessert haben und daß sie jetzt sogar das fotografieren können, was weniger als einen halben Meter und mehr als dreißig Zentimeter lang ist.
›Was soll’s‹, dachte ich. ›Man muß sich wenigstens einmal in der Woche rasieren. Das Risiko bleibt, daß es auf dem Foto gräßlich aussieht.‹
Ich rasiere mich nicht gern, aber ich habe auch meinen Stolz, also habe ich mich einmal, sogar zweimal in der Woche rasiert, besonders bevor ich in die Stadt ging.
Aber dann berichtete die Presse, daß die Technik Fortschritte gemacht habe und daß nun überhaupt alles, ohne Rücksicht auf die Größe, fotografiert werden könne. Um mit der Technik mitzuhalten, mußte ich mich täglich rasieren und einen neuen Schlips kaufen, was eine unvorhergesehene Ausgabe war. Meine Schuhe putzte ich ebenfalls, und überhaupt mußte ich aufpassen, um jetzt jeden Tag so auszusehen wie vorher nur am Sonntag. Allein die Rasierklingen und die Schuhcreme kosteten mich siebenmal mehr als vor der Technik.
Als ich mein Gesuch für die Rente einreichte, sollte ich ein Foto beilegen. Ich dachte mir: ›Wieso soll ich zum Fotografen gehen und wieder bezahlen, wenn sie jede Menge Fotos von mir haben?‹ Also schrieb ich an die Vereinten Nationen, sie sollten mir eins schicken. Ich denke, eins steht mir doch zu. Oder? – Aber ich bekam keine Antwort. Ich wartete und wartete, und nichts geschah. Aber das Gesuch mußte termingerecht abgegeben werden, sonst würde ich keine Rente bekommen.
Ich ging zum Fotografen, ließ mir ein Foto machen, zahlte aus eigener Tasche und reichte mein Gesuch ein. Dann stieg ich in die Straßenbahn und fuhr bis zur letzten Station. Von dort aus ging ich lange zu Fuß, bis ich mich auf freiem Feld befand. Ich sah mich um, kein Mensch weit und breit, nur ein paar Kühe, aber weit weg. Ich ließ die Hosen herunter und streckte meinen Hintern in Richtung Himmel.
Sollen die ruhig wissen, was ich von ihnen halte.
Museum
Unser Hund war entlaufen, und das Kind war untröstlich, weil es den Hund sehr liebte. Also nahm ich das Kind mit zum Hausmuseum eines berühmten Schriftstellers. Es könnte sich ablenken und sich gleichzeitig bei der Gelegenheit bilden.
Ich kaufte Eintrittskarten, dann warteten wir, bis sich eine Besuchergruppe zusammenfand und der Museumsführer uns in die Zimmer des Schriftstellers führte. Denn der Schriftsteller war vor hundert Jahren gestorben, und das Museum war seine Wohnung, die man in ein Museum umgewandelt hatte.
Neben der Kasse war ein Kiosk mit Büchern, die der Schriftsteller geschrieben hatte. Bücher, wie Bücher eben sind, nichts Interessantes.
Die Gruppe sammelte sich, und der Führer brachte uns ins Vorzimmer.
»Rechts das Bad«, informierte der Führer.
Wir sahen in das Bad, denn die Tür war offen, nur daß man nicht rein durfte, weil der Eingang mit einer roten Brokatkordel versperrt war. Auf dem Waschbecken eine Seifenschachtel und darin Seife. Auf der Seife eine Tafel: ›Die Lieblingsseife des Schriftstellers‹.
»Darf man daran riechen?« fragte eine Dame.
»Verboten«, verkündete der Führer. »Aber die Forscher haben festgestellt, daß er sich täglich gewaschen hat.«
»Die Ohren auch?« fragte das Kind entsetzt.
»Sei still«, rügte ich den Kleinen. »Stör die Erwachsenen nicht bei der Besichtigung. Na sicher auch die Ohren. Wenn du dir die Ohren wäschst, dann wirst du auch ein berühmter Schriftsteller.«
Danach kam der Salon und das Schlafzimmer. Möbel aus Nußbaum, ganz gut, aber nichts Besonderes. Die Dame wollte die Matratze ausprobieren, aber das war auch verboten, sogar bei Nachzahlung.
»Das Studierzimmer des Schriftstellers«, gab der Museumsführer bekannt und ließ uns vorgehen.
Am Schreibtisch saß der Schriftsteller in Lebensgröße. Er sah aus wie echt; war wohl aus Wachs; im Schlafrock. Er hielt eine Feder in der Hand, und auf dem Schreibtisch lag beschriebenes Papier: »Eine Handschrift, denn er schrieb mit der Hand«, erklärte der Museumsführer. »Das haben die Forscher festgestellt. Hier wird vorgestellt, wie er seine berühmtesten Verse schreibt. Erinnern Sie sich? Mein Volk, als ich in deinen Armen, wie ein Kind gewiegt, trank deinen Geist …«
»Sieh mal, Papa!« schrie das Kind. »Genau wie bei uns!«
Ich sah hin. Tatsächlich, unter dem Schreibtisch stand eine leere Wodkaflasche.
»Die haben die Maler nach der Renovierung stehengelassen«, erklärte der Museumsführer. »Das gehört nicht zu den Ausstellungsstücken.«
In diesem Augenblick entdeckte ich eine Inschrift auf der Glatze des Schriftstellers: »Ich war hier. Kazik.«
›Sicher hat er sich sogar Notizen gemacht, wenn er kein Papier zur Hand hatte‹, dachte ich. ›Ein echter Schriftsteller. Aber was ist hier unten?‹
Unten auf der Glatze war eine zweite Notiz: »Na und was weiter, du Scheißer?« Und eine Unterschrift: »Ein Literaturliebhaber.«
›Das hat er ja wohl kaum selber geschrieben‹, dachte ich. ›Eine ganz andere Schrift.‹
Ich sah mich um. Das Kind war damit beschäftigt, Schubladen aufzumachen, und der Museumsführer damit, das nicht zuzulassen. Währenddessen fotografierte die Dame, und andere stritten sich darüber, ob es eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung war. Der Museumsführer konnte nichts aufklären, weil er das Kind verfolgte, das auf dem Fußboden langschlidderte, der wunderbar gebohnert war wie immer im Museum. Ich nahm einen Kugelschreiber und schrieb unter den ›Literaturliebhaber‹: »Hund entlaufen. Gegen Belohnung abzugeben bei …« Und die Adresse.
Eine Menge Leute gehen in dieses Museum, und jeder wird es lesen. Vielleicht findet sich der Hund.
Sparsamkeit
Der Präsident empfahl uns zu sparen, und um mit gutem Beispiel voranzugehen, schob er den zweiten Sessel aus seinem Arbeitszimmer. »Nichts zu machen«, sagte er. »Ich muß mit der Sekretärin auf einem Sessel Platz finden. Es wird eng für uns werden, aber wir sparen ein Möbelstück, das Holz ist jetzt so teuer. Was seht ihr für Reserven?«
Wir berieten und berieten uns … Reserven sahen wir keine. Jeder will leben.
Schließlich analysierten wir den Boten. Man könnte den, der da ist, auswechseln und an seiner Stelle einen einbeinigen Invaliden einstellen. Allein an den Beinen ergäbe sich eine Einsparung für das Unternehmen von fünfzig Prozent.
Leider gab es in unserer Ortschaft keinen Einbeinigen. Ohne Zähne, ohne Blinddarm, bitte sehr, aber einen Einbeinigen nicht mal auf ärztliches Attest. Unsere Gesellschaft ist zweibeinig, und manche laufen sogar auf vier Beinen. Total genommen ist die Anzahl der Beine eine gerade Zahl.
Wir fragten im Krankenhaus nach, aber es war keine Amputation vorgesehen, trotz der fortschreitenden Motorisierung.
Wir gaben eine Anzeige in der Zeitung auf: »Bote gesucht, für sofort. Verlangt wird ein Bein und die mündliche Kenntnis der polnischen Sprache.« Es meldete sich ein Einheimischer, der hatte zwar ein Bein, aber war stumm.
Also gaben wir eine Anzeige in der Kreiszeitung auf. Da meldeten sich zwei, jeder mit einem Bein. Wir nahmen den, der das kürzere Bein hatte. Wenn schon sparsam, dann ganz sparsam.
Der sitzt jetzt in der Portierloge und trinkt Tee. Und wenn wir was in der Stadt zu erledigen haben, geht jeder selber los und erledigt das allein. Wie sollte es anders gehen? Einen Krüppel quälen?!
Vor allem, da man unterwegs mal auf ein Bier einkehren kann.
Praxis
Ich begegnete meinem Nächsten, der mir ganz ohne Grund eins in die Schnauze schlug. Ich wollte es ihm zurückgeben, doch das Gute gewann die Oberhand, ich beherrschte mich, wandte ihm meine rechte Backe zu und sagte: »Jetzt bitte auf diese Seite.«
»Was denn, sind Sie Masochist?«
»Nein, Christ.«
»Macht nichts. Ich persönlich habe nichts gegen Christen.«
»Sie haben mich falsch verstanden. Das christliche Gebot lautet: Wer dich schlägt auf eine Backe, dem biete die andere auch dar.«
»Damit es weniger schmerzt?«
»Nein, nur damit er weiter schlägt. Das heißt als Zeichen der Demut. Sie verstehen.«
»Nein. Aber letzten Endes ist das nicht meine Sache.«
»Also schlagen Sie zu. Auf die rechte, denn auf die linke haben Sie schon geschlagen.«
»Ich habe keine Lust mehr.«
»Tun Sie es trotzdem für mich … Verstehen Sie, da ich mich schon auf dem Pfade der Tugend befinde, möchte ich etwas davon haben. Sonst ist alles für die Katz, es wird dann bloß heißen, ich hätte eins in die Schnauze bekommen, und fertig. Ganz normal, ohne jedes Verdienst.«
»Ich bin müde.«
»Nur noch einmal, der Vollständigkeit halber. Versetzen Sie sich in meine Lage, halbe Ergebnisse sind keine Ergebnisse, und ich habe bereits fünfzig Prozent investiert. Entweder auf beide Backen, oder es kommt auf null heraus.«
»Na schließlich … kann ich ja. Aber auf die rechte, das ist ungeschickt. Ich bin doch kein Linkshänder.«
»Dann vielleicht mit dem Fuß?«
»Mit dem Fuß auf die Backe? Sie überschätzen mich. Da reiche ich nicht hin.«
»Ich könnte mich vorbeugen.«
»Aber dann kann ich nicht Schwung holen. Und außerdem, wenn es Ihnen um die Symmetrie geht, ist das mit dem Fuß nicht dasselbe wie mit der Hand. Ein anderer Schlag.«
»Vielleicht fangen wir dann noch einmal von vorne an? Diesmal ausschließlich mit dem Fuß.«
»Wie denn?«
»Ich drehe mich um, Sie treten mich, dann drehe ich mich wieder um, und Sie treten mich noch einmal.«
»Sie sind sehr naiv. Jedes Kind weiß, daß der Mensch hinten nicht dasselbe hat wie vorn. Es wäre keine Symmetrie.«