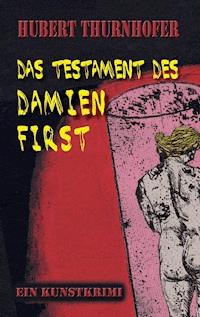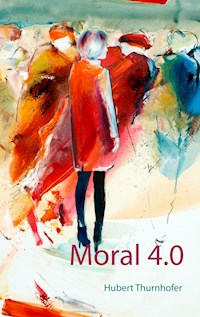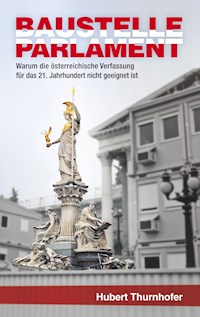
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch enthält zahlreiche Kommentare des Autors, kann aber auch als Einführung in das Österreichische Bundesverfassungs-Gesetz (B-VG) gelesen werden, wenn man nur die ausgewählten, kursiv geschriebenen Verfassungsartikel liest und alle Kommentare und Kritiken ausblendet. Der Leser erhält hier einen Überblick über alle Themen der Verfassung, die gesellschaftspolitisch von Relevanz sind und kann sich damit eine eigene Meinung über Form und Inhalt des B-VG bilden; und auch darüber, was nicht Inhalt der Verfassung ist. Das B-VG wird im Jahr 2020 einhundert Jahre alt. Warum die Fundamente und zahlreiche spätere Zubauten der österreichischen Verfassung in schlechter Verfassung sind, das erklärt der Philosoph Hubert Thurnhofer in allgemein verständlicher Sprache. Mit kritischen Fragen öffnet er die Tür von der bestehenden, antiquierten zu einer neuen, modernen Verfassung, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Vergleiche mit dem Grundgesetz Deutschlands und der Bundesverfassung der Schweiz zeigen, dass Verfassungen nicht nur Spielregeln festsetzen, sondern auch inhaltliche Vorgaben machen können. Vorarbeiten und Analysen zu weiteren Themen der Verfassung publiziert der Autor auf www.ethos.at
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Die Verfassung in schlechter Verfassung
Artikel 1 bis 9a
Beamtenstaat im Geiste Kakaniens
1862, 1867, 1988 und Artikel 10 bis 13 sowie 24 bis 49
Unsere Verfassung kennt keine Bildung
Artikel 14, 14a und eine Auswahl von 14b bis 23k
Das freie Mandat
Der Souverän (Artikel 56) und die Regierung (Artikel 19)
Staatsvertrag und Neutralität
Österreichs Demokratie ist völkerrechtlich verankert
Die Todesstrafe als Bruchlinie
Artikel 85, Menschenrechtskonvention und Charta der Grundrechte
Finanzkapitalismus unterwandert die Demokratie
Artikel 50, 50a bis 50d
Kann die Verfassung das Bargeld retten?
„Die Verwendung von Bargeld unterliegt keinen Einschränkungen“
Die Bevorzugung des ORF ist verfassungswidrig
Rundfunkgesetz und Artikel 11 Charta der Grundrechte
Der Rest ist Bürokratismus
Drittes bis Neuntes Hauptstück des B-VG
Ein kleiner Ausflug in die Schweiz
Und: der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau
Epilog
Literatur
Prolog
Im Mai 2019 feierte Deutschland 70 Jahre Grundgesetz. Und Deutschland hatte jeden Grund dazu. Denn das nach Ende des nationalsozialistischen Regimes völlig neu konzipierte Werk ist verständlich und schlüssig formuliert, beginnt mit der Auflistung der Grundrechte, die sich an der UNO-Menschenrechtsdeklaration orientieren und ist in den Verwaltungsbestimmungen präzise wie zukunftsorientiert.
Im Jahr 2020 feiert Österreich 100 Jahre Verfassung und man muss sich ernsthaft fragen, ob das ein Grund zum Feiern ist. Das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) war nach Abschaffung der k.u.k.-Monarchie darauf angelegt, die noch junge Demokratie durch einen starken Beamtenapparat zu stützen. Grundrechte und Grundwerte kommen im sogenannten „Nebenverfassungsrecht“ vor. Das beginnt mit dem Staatsgrundgesetz von 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (von Österreich-Ungarn) und führt über ein paar willkürlich eingestreute Werte-Appelle im Hauptteil des B-VG bis zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2009). 1945 waren die Politiker Österreichs offenbar der Meinung, man könne fünf Jahre Austrofaschismus und sieben Jahre Nazi-Diktatur aus der Geschichte des Landes streichen und dort weitermachen, wo der Rechtsgelehrte Hans Kelsen 1920 aufgehört hat.
Im Mai 2019 zog durch Deutschland eine Euphorie. Der Hamburger Journalist und Verleger Oliver Wurm hat nach einer Startauflage von 100.000 Stück noch drei Neuauflagen des Grundgesetzes in Form eines Hochglanzmagazins auf den Markt gebracht. Tausende parteiübergreifende Festreden im ganzen Land trugen zur Popularisierung des Grundgesetzes bei.
Zur gleichen Zeit bekundet der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen (VdB) seine Euphorie für Österreichs Verfassung: „Gerade in Zeiten wie diesen, zeigt sich die Eleganz, ja die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung. Jeder Schritt, der jetzt getan wird, ist vorgesehen und in der Verfassung verankert. Ich achte dabei penibel auf die Einhaltung jedes einzelnen Details. Es ist mein zentrales Bestreben, dass nun ausschließlich im Interesse und zum Wohle der Republik gehandelt wird. Alles, was in den vergangenen Stunden getan wurde und im weiteren Verlaufe des Überganges getan wird, hat der Aufrechterhaltung der Stabilität und Funktionsfähigkeit unseres Staates zu dienen“ (VdB am 21. Mai 2019 anlässlich der Amtsenthebung der FPÖ-Minister).
Grund für diese Verfassungs-Euphorie des Bundespräsidenten war aber nicht eine Reform des behäbigen, durch hunderte parteipolitische Interventionen zusammengeschusterten Flickwerks, sondern die elegante Absetzung eines ihm unliebsamen Ministers. Nach dem Rücktritt des FP-Vizekanzlers H.C. Strache (Ibiza-Affäre) musste auch noch der Kopf des FP-Innenministers Herbert Kickl rollen. Dass er damit eine Lawine auslöste, hat der Bundespräsident höchst wahrscheinlich nicht beabsichtigt.
Nach Kickls Absetzung reichten alle FP-Minister aus Protest ihren Rücktritt ein. Bereits einen Tag nach dem kollektiven Rücktritt konnte der Präsident neue Minister angeloben. Die Notwendigkeit dieser Horuck-Aktion kann bezweifelt werden, denn die Verfassung kennt beim Ausscheiden von Ministern eine Stellvertreter-Regelung (Artikel 71). Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar (aber auch nicht auszuschließen), dass ein paar Tage später die gesamte Regierung durch einen Misstrauensantrag (Artikel 74) gestürzt werden könnte. Doch genau so war es dann.
Erstmals in der Geschichte der 2. Republik musste die gesamte Regierung inklusive der Drei-Tages-Minister vom Bundespräsidenten ausgetauscht werden. Nach wenigen Tagen konnte der Präsident – natürlich verfassungskonform – eine Expertenregierung vereidigen. Der Begriff „Expertenregierung“ lässt die Frage aufkommen, ob die Jahre und Jahrzehnte davor keine Experten zum Wohle des Volkes in Regierungsfunktionen waren. Aber das ist eine andere Frage.
Im Zentrum dieses Buches steht die grundsätzliche Frage: Was ist der Sinn und Zweck unserer Verfassung?
Kann es Sinn einer Verfassung sein, dass sie nur hundert oder bestenfalls tausend Verfassungsexperten des Landes verstehen und richtig auslegen können? Wie kann der Zweck einer Verfassung, Fundament der Bundesgesetze zu sein, erfüllt werden, wenn sogar die Mehrheit der Nationalratsabgeordneten diese Verfassung nicht gelesen hat? Wie kann eine Verfassung Grundlage unserer Demokratie und einer aufgeklärten Bevölkerung sein, wenn die Österreicher zur Unmündigkeit erzogen werden, indem ihnen suggeriert wird, sie seien gar nicht imstande dieses Werk zu verstehen, folglich auch nicht berechtigt es zu beurteilen? Diese und viele weitere Fragen stellen sich anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der österreichischen Verfassung, die am 1. Oktober 1920 von der konstituierenden Nationalversammlung in dritter Lesung angenommen wurde.
Das vorliegende Buch enthält zahlreiche Kommentare des Autors, kann aber auch als Einführung in das B-VG gelesen werden, wenn man nur die ausgewählten, kursiv geschriebenen Verfassungsartikel liest und alle Kommentare und Kritiken ausblendet. Der Leser erhält hier einen Überblick über alle Themen der Verfassung, die gesellschaftspolitisch von Relevanz sind und kann sich damit eine eigene Meinung über Form und Inhalt des B-VG bilden; und auch darüber, was nicht Inhalt der Verfassung ist.
Nicht zuletzt sollte das vorliegende Buch eine Diskussionsgrundlage sein für all jene, die sich mit Rechtsphilosophie beschäftigen wollen, also für alle Bundes- und Landesbürger, einfach gesagt: für alle Menschen dieses Landes ab 15 Jahren! Denn ab 16 sind die Österreicher und Österreicherinnen wahlberechtigt.
Wer bislang der Meinung war, Philosophie habe nichts mit dem Leben und den täglichen Problemen unserer Zeit zu tun, noch weniger als die Rechtswissenschaft, dem möchte ich vorab mein Verständnis von Philosophie vermitteln: Philosophie ist zum einen eine Lebensform und zum anderen eine besondere Form Fragen zu stellen. Meiner Überzeugung nach kommt jeder Mensch als Philosoph zur Welt, was allein die Tatsache beweist, dass jedes Kind, kaum dass es sprechen kann, ständig die Frage „warum?“ stellt. Doch die meisten Eltern halten diese Fragen, die manchmal ihre eigene Weltanschauung fundamental und ihre Lebensweise existenziell in Frage stellen, nicht sehr lange aus. Früher oder später folgt der infantophobe Imperativ: Hör endlich auf zu fragen! (Man könnte dies auch als schlimmste ungsunde Watschn bezeichnen, die man einem Kind verpassen kann, aber das klingt nicht so gelehrt.) Nur wenige ignorieren diesen Imperativ und bleiben Kinder, also Philosophen.
Hinweis für Jäger des unbemerkten Tippfehlers: Zitate aus Büchern vor der Rechtschreibreform wurden in alter Schreibweise übernommen.
Gender-Hinweis: die Gleichbehandlung der Abgeordneten mit dem Abgeordneten setze ich voraus.
Die Verfassung in schlechter Verfassung
Artikel 1-9a B-VG
Vielgerühmtes, vielgeprüftes, vielgeliebtes Österreich! Als Bürger dieses Landes bin ich der Überzeugung, dass ich nicht nur unsere Bundeshymne, sondern auch unsere Verfassung kennen sollte. Nun legt das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) mit Nebenverfassungsrecht bei einem Umfang von 550 Seiten (621 Seiten inklusive Sachregister, Ausgabe MANZ'sche Verlagsbuchhandlung, 2014) die Vermutung nahe, dessen Lektüre sei nur für Experten geeignet. Vermutlich unterschreibt die absolute Mehrheit der Österreicher diese Vermutung. Doch als Bürger dieses Landes möchte ich mich nicht mit Vermutungen abspeisen lassen, sondern habe mich der Lektüre hingegeben. Naja, sagen wir ausgeliefert. Meine Diagnose (ich weiß, mangels rechtswissenschaftlicher Ausbildung ist sie naiv): Unsere Verfassung ist in einer schlechten, ja sogar bedauerlichen Verfassung!
Das VOLK kommt im B-VG nur zwei Mal vor: in Artikel 1 und 91, das BUNDESVOLK erhält seinen Platz in den Artikeln 44 und 60.
Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.
Artikel 91. (1) Das Volk hat an der Rechtsprechung mitzuwirken.
Artikel 44. (3) Jede Gesamtänderung der Bundesverfassung … ist nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42, jedoch vor der Beurkundung durch den Bundespräsidenten, einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes zu unterziehen.
Artikel 60. (1) Der Bundespräsident wird vom Bundesvolk auf Grund des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes der zum Nationalrat wahlberechtigten Männer und Frauen gewählt; stellt sich nur ein Wahlwerber der Wahl, so ist die Wahl in Form einer Abstimmung durchzuführen. Art. 26 Abs. 5 bis 8 ist sinngemäß anzuwenden.
Wenn das Recht vom Volk aus geht, so stellt sich die Frage: wo kehrt es danach ein? Die Antwort lautet: im Staatsapparat. Anders gesagt: das Recht geht vom Volk aus und ist dann ausschließlich im Staatsapparat zuhause! Schon ab Artikel 2 (die meisten Artikel sind in viele Absätze gegliedert) erfährt das Volk, dass es im B-VG um den Staatsapparat, seine Institutionen und Bediensteten geht.
Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bundesstaat. (2) Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbständigen Ländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien. (3) Änderungen im Bestand der Länder oder eine Einschränkung der in diesem Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mitwirkung der Länder bedürfen auch verfassungsgesetzlicher Regelungen der Länder.
Artikel 3. (1) Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. (2) Staatsverträge, mit denen die Bundesgrenzen geändert werden, dürfen nur mit Zustimmung der betroffenen Länder abgeschlossen werden. (3) Grenzänderungen innerhalb des Bundesgebietes bedürfen übereinstimmender Gesetze des Bundes und der betroffenen Länder. Für Grenzbereinigungen innerhalb des Bundesgebietes genügen übereinstimmende Gesetze der betroffenen Länder. (4) Sofern es sich nicht um Grenzbereinigungen handelt, bedürfen Beschlüsse des Nationalrates über Grenzänderungen gemäß Abs. 2 und 3 der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
Schon in den Artikeln 2 und 3 spiegelt sich der Zeitgeist nach dem Ende einer Epoche, die Robert Musil Kakanien nannte. Hier geht es darum, Maßnahmen zu setzen, damit sich die Jahrhunderte alten Usancen der europäischen Adelsdynastien nicht mehr wiederholen. Denn in der rund 1000-jährigen Geschichte Österreichs bis 1918 war es üblich, dass Herzog- und Fürstentümer Gebietsansprüche am Schlachtfeld anmeldeten und über anschließende Friedensverträge regelten. Auch Schenkungen oder Gebietsverschiebungen durch Erbschaften waren an der Tagesordnung. So übergab Kaiser Otto II im Frühjahr 976 „den spärlich besiedelten Landstrich, den man in den offiziellen Urkunden immer noch 'Awarenland', 'Orientalische Mark' oder einfach 'Östliche Gegend' (nicht aber, wie erst ab dem 19. Jahrhundert, 'Ostmark') genannt hatte einem an seinem Hof anscheinend bereits als fähigen und treuen Anhänger geführten Grafen Luitpold. Damit begann die eigentliche Geschichte Österreichs. … Markgraf Luitpold, der erste Babenberger...“ (Vajda, 41)
Nachdem es in Österreich seit 99 Jahren keine Grenzverschiebungen innerhalb der Bundesländer gibt, könnte man Artikel 3 komplett streichen und Artikel 2 auf Absatz 1 und 2 kürzen. Man könnte aber auch darüber nachdenken, ob das kleine Land Österreich innerhalb der großen EU heute noch neun Bundesländer benötigt, die nicht nur als Verwaltungseinheiten dienen, sondern auch zusätzlich mit eigenen Legislativen ausgerüstet sind. Immerhin hat die Steiermark begonnen Gemeinden und Bezirke zu fusionieren. Das ging, abgesehen von ein paar verbalen Aufständen von Bürgermeistern, die ihren Einflussbereich verloren haben, ziemlich reibungslos über die Bühne. Bei den Bürgern dagegen war ein Ansteigen von Selbstmorden aufgrund von Identitätsverlust nicht zu verzeichnen.
Artikel 4. (1) Das Bundesgebiet bildet ein einheitliches Währungs-, Wirtschafts- und Zollgebiet. (2) Innerhalb des Bundes dürfen Zwischenzolllinien oder sonstige Verkehrsbeschränkungen nicht errichtet werden.
Auch dieser Artikel lebt von der historischen Erinnerung an hunderte Zollschranken innerhalb Europas. Was soll man im Jahr 2020 dazu sagen? Danke, dass uns die Verfassung vor der Schnapsidee schützt am Semmering oder in Simmering Zoll- und Grenzschranken aufzustellen. Nach 25 Jahren in der EU sind bei den Bürgern zumindest zwei Änderungen im täglichen Leben angekommen: freier Warenverkehr und freier Personenverkehr. Jeder, der in einem EU-Land Urlaub macht erlebt die Annehmlichkeiten dieser Grundsätze ganz persönlich.
Artikel 5. (1) Bundeshauptstadt und Sitz der obersten Organe des Bundes ist Wien. (2) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung den Sitz oberster Organe des Bundes in einen anderen Ort des Bundesgebietes verlegen.
Mag sein, dass dieser Artikel vor einer dauerhaften Verlegung der Bundeshauptstadt nach Brüssel schützt. Jedenfalls konnte er nicht verhindern den Regierungssitz der „Ostmark“ nach Berlin zu verlegen, obwohl für die „Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse“ sicher nicht sieben Jahre Diktatur vorgesehen waren. Somit war das letzte historische Ereignis, von dem dieser Artikel inspiriert sein konnte, die Türkenbelagerung Wiens 1683. Kaiser Leopold I. flüchtete damals über Linz nach Passau, wo er „mit bemerkenswerter Energie, aber auch mit viel diplomatischem Taktgefühl die umfassenden Hilfsmaßnahmen für Wien zu organisieren begann“. (Vajda, 306) Es ist bekannt, dass der polnische König Jan Sobieski mit seinem Heer Wien befreite. Weniger bekannt ist, dass er dafür einen Sold von 500.000 Gulden kassierte. Leopold I. hat zur Finanzierung dieses Krieges so etwas wie eine erste europäische Union zur Leistung von Transferzahlungen organisiert: „Papst Innozenz XI stellte über eineinhalb Millionen Gulden zur Verfügung, und Spanien, Portugal, die Toskana sowie Genua machten eine weitere Million flüssig“. (Vajda, 310)
Artikel 6. (1) Für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. (2) Jene Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz haben, sind dessen Landesbürger; die Landesgesetze können jedoch vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in einem Land einen Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, dessen Landesbürger sind. (3) Der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begründet, wo sie sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, hier den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu schaffen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen einer Person auf mehrere Wohnsitze zu, so hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem sie das überwiegende Naheverhältnis hat. (4) In den Angelegenheiten der Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament, der Wahl des Bürgermeisters durch die zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten, in den Angelegenheiten der Durchführung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung oder einer Landesverfassung sowie in den Angelegenheiten der unmittelbaren Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde gelten für die Dauer einer Festnahme oder Anhaltung im Sinne des Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988, die letzten, außerhalb des Ortes einer Festnahme oder Anhaltung gelegenen Wohnsitze und der letzte, außerhalb des Ortes einer Festnahme oder Anhaltung gelegene Hauptwohnsitz vor der Festnahme oder Anhaltung als Wohnsitze beziehungsweise Hauptwohnsitz der festgenommenen oder angehaltenen Person.
In einem Satz zusammengefasst: Der Artikel 6 regelt Staatsbürgerschaft und Wohnsitz. Darüber hinaus ist der Artikel ein gutes Beispiel dafür, dass Gesetze Probleme oft erst schaffen, die sie eigentlich vermeiden sollten. Es ist plausibel, dass die Frage des Wohnsitzes für die Sicherheit des Landes (Kontrollmöglichkeit) notwendig ist. Dagegen kann Erfassung aller Steuerzahler nicht im Fokus dieses Artikels stehen, denn dafür gibt es laut Artikel 13 ein eigenes Finanz-Verfassungsgesetz. Wozu sind diese Detailregelungen des Wohnsitzes in der Verfassung erforderlich? Damit der Staat bei Wahlen exakt weiß, welcher Gemeinde die Stimme von Häfenbrüdern zuzuordnen sind. Das ist der Inhalt von Absatz 4. Bei einer freien Wahl geht es eben um jede Stimme, sogar um die von inhaftierten Bürgern.
Trotz enger Verflechtung der Staatsbürgerschaft mit der Frage des Wohnsitzes ist Artikel 6 nicht geeignet, der Entwicklung unserer Zeit Rechnung zu tragen. Laut UN-Bericht von 2017 leben weltweit 258 Millionen Menschen außerhalb ihrer Heimat. Rund zehn Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung sind lediglich „Wohnbürger“, wie Soziologen diese Gruppe nennen. Wohnbürger haben nicht die gleichen Rechte wie die übrigen Staatsbürger, doch die Klärung der Gleichbehandlung ist unmöglich, denn das Thema Migration bleibt im B-VG ausgeklammert.
Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. (2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig. (3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Geschlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeichnungen. (4) Den öffentlich Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundesheeres, ist die ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet.
Der Artikel 7 erfasst den ersten substanziellen Grundwert unserer Verfassung: Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Aber nicht alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, wenn es darum geht österreichische Staatsbürger zu werden. So ist es ein Privileg der Landeshauptleute (verfassungsmäßig gedeckt durch Artikel 11, Absatz 1, siehe nächstes Kapitel) Staatsbürgerschaften an prominente Ausländer zu verleihen. Eine Geste, in der sich manche Landesfürsten offenbar wohl fühlen, weil sie an alte Zeiten erinnert, als manche Stände noch über dem Gesetz standen.
So hat der Salzburger „Landesfürst“ Wilfried Haslauer den Künstler Georg Baselitz 2015 "im besonderen Interesse der Republik Österreich" eingebürgert. Was genau könnte das besondere Interesse der Republik an einem Künstler sein, der in