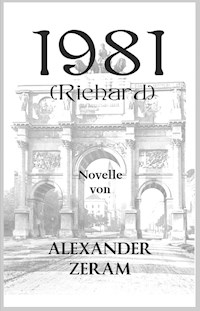Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
*BLIND BLUES* Der letzte große Auftritt des blinden Bluessängers Joe Morgan. *BEGEGNUNG* Perspektivisches Verwirrspiel über Motivationslosigkeit und Lebensüberdruss. *DER FLUCH (D-Day)* Vor 666 Jahren prophezeit, droht einer ganzen Sippe der Untergang. Vampirgrusel mal ganz anders. *HENRY* Eine erfolgreiche Geschäftsreise … mündet in den Kampf um Vergehen, Überleben und Erleben. *HOCHZEITSREISE* Unvergessliche Flitterwochen fern der Heimat – ganz exklusiv? Aber ja! Nur … wie finanziert ein mittelloser Bräutigam solch eine Traumreise? *STAUB* Ein junger Forscher macht eine außergewöhnliche Entdeckung … und kommt nicht mehr davon los. *AUSSPRACHE* Zwei alte Freunde, eine kostbare Flasche Whisky und … eine Frau im Hintergrund! Gefühls-Theater für Zwei!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Zeram
BEGEGNUNGEN
7 Kurzgeschichten und Erzählungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
BLIND BLUES
Begegnung
Der Fluch (D.-Day)
HENRY
HOCHZEITSREISE
S T A U B
AUSSPRACHE
Der Autor
Impressum neobooks
BLIND BLUES
Kurzgeschichte (Studie)
»When you lose your eye-sight,
yo’ best friend’s gone.
sometimes yo’ own dear people
don’t fool with you long.«
(›Sleepy‹ John Adam Estes)
Blind Joe Morgan rückte sich den wackeligen Stuhl zurecht, stimmte die tiefe E-Saite seiner Gitarre neu ein und schlug dann einen Akkord an, der die Aufmerksamkeit des Publikums ein klein wenig auf den Sänger lenkte. Es gab also wieder Musik, man würde wieder tanzen können – und sofort erhoben sich einige Paare und auch einzelne Gäste von den Schemeln, lösten sich von der Bar aus den dicht gedrängten Reihen und sammelten sich langsam auf der Tanzfläche.
Der Musiker setzte nach ein paar einleitenden Läufen mit dem markanten Rhythmus des Sleepy John Estes Liedes ›I’d be well warned‹ein und sang neben eigenen Versen auch den, der seine Blindheit als einen Zustand der Entrücktheit, der Hilflosigkeit und des Ausgeliefert-Seins darstellte.
Aus dem Publikum kamen sehr bald vereinzelte Rufe, die nach ›was Peppigerem‹ verlangten.
»Spiel’ uns ?nen Shimmy, Joe. Das traurige Gedudel kannste zu Hause Deinen Leuten vorjaulen!«, hörte er Big Artie lallen – einen Bullen von Mann, der sich gerne mit jenen prügelte, die ihm Widerworte gaben. Der hielt sich mehr schlecht als recht zwischen zwei ebenfalls ziemlich angetrunkenen Mädchen und fuchtelte dabei mit einer halb leeren Whisky-Flasche herum. Die zu seiner Linken, Roxy wurde sie genannt, musste sich in diesem Augenblick übergeben. Ein Schwall übel riechender Flüssigkeit spritzte fast bis vor den Sitzplatz des Sängers.
Es gab einen Aufruhr, weil der Wirt ›heute schon zum dritten Mal‹ seinen Barmann mit dem Putzeimer losschicken musste.
»Roxy, wenn de nix mehr bei Dir behältst, dann kriegste nix mehr!«, schrie er hinter seiner Theke hervor.
Der Gitarrist stimmte, kaum, dass man ihm einen kurzen Hinweis gegeben hatte, dass die Tanzfläche wieder zu betreten war, einen flotten Rhythmus an und sang einen seiner immer wieder von allen bejubelten Songs über eine alte, fette aber sehr wohlhabende Frau, die sich junge Liebhaber kaufte. ›Big Sally?s Wedding‹ war jetzt genau das Richtige für diese Situation, da sich Big Artie mit dem Barmann anzulegen drohte. Das Publikum konnte lachen, den Refrain mitsingen und über die derben Witze des obszönen Textes lachen.
Blind Joe Morgans raue Stimme hörte man gerne in dieser Kneipe, wo sich Huren und Zuhälter Stammkunden nannten und zusammen mit dem betrügerischen Wirt und dessen alter ›Mammy‹ die Gäste ausnahmen. Wer auch immer seinen Fuß über die Schwelle setzte, gehörte nicht mehr der so genannten heilen Welt an – hier unterstand ein jeder anderen Gesetzen.
An diesem ehrwürdigen Ort herrschten Geld und Sucht – hier regierte das Verderben eines jeden Einzelnen. Wer sich dem Alkohol verschrieben hatte, war angesehen und der Spieler genoss –wenn er gut war und oft gewann– Dank seines Geldes die Achtung aller leichten Mädchen. Freundlichkeit hieß hier Heuchelei und wer Witze riss, meinte damit nicht die Welt zu verspotten. Meist fand Humor hier nur Anerkennung, wenn er beim Spiel zu Betrug und bei einer Unterhaltung zu obszönen Einwürfen verwendet wurde. Die angesehenste Person war schließlich der Wirt – nach dem sich jeder zu richten hatte und der in seiner Kneipe wie in einem kleinen Königreich herrschte. Alleine an ihm lag es, ob man reinen Wein eingeschenkt bekam – was heißen sollte: billigsten Fusel oder Markenalkohol, den der Wirt nicht versetzt hatte. All dies berührte den alten Bluessänger auf dem wackeligen Stuhl jedoch wenig. Er war in diesem Milieu zwar aufgewachsen, aber seit einigen Jahren sah er der mächtigen Konkurrenz junger Musiker zu, die sich in allen Spelunken breitmachte, mit verstärkten Gitarren, Schlagzeug und allmöglichem Backing arbeiteten sie und legten Wert darauf, von den Tänzern nicht nur gehört zu werden, sondern diese und alle anderen Gäste zu übertönen. So schien ihnen darauf anzukommen, lauter als alles zu sein und dadurch im Mittelpunkt zu stehen.
Blind Joe Morgan wusste, dass die Zeiten vorbeigegangen waren, da man alleine oder zusammen mit einem Partner ein gutes Engagement länger halten konnte. Nicht alleine diese Einsicht schlug sich auf seine Musik nieder – es war auch die Erfahrung langer Jahre voller Entbehrungen darin.
Mit heiserer Stimme sang er seinen Blues und manchmal vermochte er die jungen Leute hier dennoch anzusprechen. Dann schüttelten sie sich zu seinen traditionellen Rhythmen und verlangten noch nicht einmal, dass er lauter spielte. Ohnehin hatte ihm der fette Wirt ein Mikrofon aufgebaut und die Lautsprecher verstärkten seinen anklagenden, traurigen Song.
Es wunderte ihn oft, dass man ihn überhaupt noch singen ließ, da die Musik seiner Generation doch längst nicht mehr gefragt schien. Zudem fühlte er sich zuweilen derart niedergeschlagen und zermürbt, dass er nicht die Kraft fand, einen lustigen Party-Song zu produzieren – und was wollte er denn mit seinen selbstanalytischen Texten in diesem Milieu. Früher hatten Seinesgleichen draußen auf den Straßen gesungen und Geschäfte mit dem Mitleid der Passanten gemacht. Er aber war in den Kneipen hängen geblieben – vielleicht ließ man ihn auch hier nur aus Mitleid spielen. Er zweifelte daran, dass der Wirt eines solchen Gefühls fähig war – aber anders konnte er sich diesen Umstand kaum noch erklären.
Er durfte also spielen … und singen. Singen von Unzufriedenheit, Liebeskummer, Ungerechtigkeit und dem kleinen Rest Hoffnung, den er noch in sich trug – aus welchem Grund immer.
Und manchmal hatte er die Kraft, sich selbst zu überwinden und dann riss er Witze, spielte die herrlichsten Boogies, sodass die Jungen nur vor Genugtuung und Begeisterung jauchzten. Dann hieß es allgemein ›Der alte Joe soll was auf meine Rechnung trinken!‹ Und wenn der Wirt ihm dann tatsächlich einen Gin eingoss, von dem man nicht unbedingt krank zu werden brauchte, dann wohl auch nur deshalb, weil er vermeiden wollte, den umgekippten Sänger am Ende noch von einem Krankenwagen abgeholt und im Hospital untersucht zu haben … auf eigene Rechnung, denn Blind Joe Morgan war bei keiner Krankenversicherung bekannt und der Wirt wollte bei keinem der Prüfer im Gesundheitsamt bekannt werden.
Zu Hause schliefen seine Leute um diese Zeit, denn die Arbeit des Tages war anstrengend genug und wenigstens am Samstag gönnten sie sich den Schlaf nach Mitternacht. Andere Familien feierten die Nacht vom Samstag auf den Sonntag in Kneipen wie dieser und verprassten das Geld, welches sie in einer Woche durch harte Arbeit verdient hatten. Diese waren gewissenlos und kannten kein Verantwortungsbewusstsein. Blind Joe Morgans Leute jedoch hatten den Ruf, fleißige Arbeiter zu sein, und wenn sie nicht immer bequem waren, hatte man zumindest in den Kneipen noch nie Arger mit ihnen gehabt.
Vonihm– dem vor ungezählten Jahren erblindeten Musiker – hatte diese Eigenschaft sicherlich keiner, weder der Sohn noch die beiden Enkel.
Ja, früher war auch er ohne dieses Verantwortungs-bewusstsein durchs Leben gewandert und hatte zusammen mit anderen Musikern seinen kargen Lohn bei den Huren durchgebracht – bis er wohl an die richtige Frau geraten war, die ihm das Geld abgeknöpft hatte, bevor es vertrunken war – zum Wohl der Nachkommenschaft.
Blind Joe Morgan stand jetzt völlig abseits.
Einen Papagei hatte er, mit dem er sich unterhalten konnte und seinen jüngsten Enkel, der ihn jeden Sonntagmorgen vom Arbeitsplatz abholte und heimführte. Vielleicht war er schon zu alt, noch etwas anderes zu tun als zu singen und seine Gitarre zu spielen, mit seinem Papageien zu reden und dem Enkel von der großen Zeit zu erzählen, als er mit den Berühmtheiten jener vergangenen Jahre zusammen aufgetreten war.
Oh – damals … da hatte er noch sein Augenlicht gehabt … da war noch alles in Ordnung gewesen. Es schien ihm lange her – zu lange! Wann wollte ihn eigentlich der HERR zu sich holen? – Was hatte er denn verbrochen, dass sein Leben noch immer währte, während alle anderen seiner einst gleichaltrigen Freunde längst zu der einen oder anderen Version des ›St. James’ Infirmary Blues‹beerdigt worden waren?
Er tastete sich mit seinem dünnen Stock den Gang entlang bis hinter die Theke, wo ihm der Wirt seine paar Dollar Lohn in die Rechte drückte und ihm den nächsten Termin gab. In zwei Wochen sollte man ihn wieder in dieser Kneipe hören – wieder von zwei Uhr morgens an bis Sonnenaufgang, wenn sich die hart gesottenen Saufbrüder langsam zerstreuten und der Laden geschlossen werden konnte. Blind Joe Morgan murmelte ein raues »Danke!«, und der Wirt war so freundlich, ihn nochmals darauf hinzuweisen, dass er lieber gleich absagen solle, wenn er in zwei Wochen nicht kommen könne.
»Kann unzuverlässige Leut’ nich’ brauchen, Joe … heh, kapiert?« Aber Blind Joe Morgan musste Geld verdienen, denn im Haus seines ältesten Sohnes ging man nicht zimperlich mit ihm um. Wenn er sich einige letzte Rechte sichern wollte, dann musste er Geld in den Taschen haben und der Schwiegertochter zumindest zum Essen dazugeben können. Andernfalls hätte er wohl ins Armenhaus verschwinden müssen – und das wollte er auf keinen Fall.
Von irgendwoher vernahm er eine schlecht gespielte Mundharmonika, die sich über die ewig gleich bleibenden Zugimitationen versuchte und nichts zustande brachte.
Ach … zuseinerZeit, als man in Memphis, Beale Street, zusammengekommen war – da war der Teufel los gewesen. Zugimitationen … das gehörte zum Rüstzeug eines jeden Harmonikaspielers – ohne ging da gar nichts. Und wer einmal Noah Lewis oder Hammie Nixon gehört hatte, der brauchte sich nicht mehr einzubilden, irgendetwas erreicht zu haben, wenn er ein bisschen herumschnaufte und ein Hornsignal imitierte.
Heutzutage … alle schönen Songs starben mit den letzten Repräsentanten dieser Zeit und nichts blieb übrig als melodienloser Radau, Lärm …
Lärm, nichts als Lärm!
Seine Leute hatten schon recht, wenn sie auf die Zeiten schimpften, in denen man lebte. Zwar hatte sich im Gegensatz zu früher eigentlich gar nicht so viel verändert, aber das Wenige machte es gerade aus, dass zumindestersich nicht mehr wohlfühlte in seiner alten Haut.
Draußen auf der regennassen Straße erwartete ihn sein Enkel Billy, der ihn wie üblich erst eine Zeit lang stehen ließ, bis er wütend zu schreien begann.
»Ja–ja, … bin schon da, Alter!«, und dann hüpfte er herbei, nahm den Großvater am Arm und führte ihn die Straße hinauf – vorbei am Bäcker, wo jedes Mal ein kleiner Köter hervor schoss und ihn in die Beine zwickte, dass es ein Gräuel war.
»Pass’ mir auf diesen räudigen Köter auf, Billy!«, brummte Blind Joe Morgan vor sich hin und stützte sich auf seinen dünnen Stock, warf die Gitarre, die er an einem Riemen über den Rücken hängen hatte und die vorgerutscht war, zurück und fluchte noch ein paar Mal vor sich hin. Dann war der Hund auch schon da und dessen Gekeife zusammen mit seinem eigenen Gebrüll und dem fröhlichen, schadenfrohen Gelächter Billys weckte den Bäcker, der ihnen vom ersten Stockwerk her Flüche nachschickte und sie allesamt zum Teufel wünschte.
Morgenidylle!
Blind Joe Morgan lachte in sich hinein und musste an seinen längst verstorbenen Partner Henry Pickles denken, der immerzu ›Morgenidylle‹ gerufen hatte, wenn er nach der Arbeit durch die in aller Frühe noch stille Stadt getorkelt war. Früher … da mochte es so etwas wie eine ›Morgenidylle‹ wohl noch gegeben haben. Heute dagegen? – Noch nicht einmal der feiste Sergeant Chick war mehr am Leben. Die jungen Polizisten nahmen einen doch jedes Mal mit auf die Wache, wo man endlosen Befragungen ausgesetzt wurde.
»He, Billy!«, murmelte er plötzlich und kramte seinen Lohn aus der Tasche. »Zähl’ nach, ob er mich auch nicht beschissen hat, der verdammte Hurensohn!«
Und Billy stahl sich –wie gewöhnlich– einen Nickel, indem er zwei Münzen geschickt auswechselte, ohne dass es der alte Dummkopf gemerkt hätte.
»Alles in Ordnung!«, sagte der Junge und ließ das Geld zurück in die hohle Hand des Großvaters klimpern. Dieser zählte die Münzen –wie gewöhnlich– argwöhnisch nach und steckte dann alles fort.
»Altes Schwein … hätte mir längst mal ’nen Gin umsonst geben können. Aber er weiß ja, dass ich sonst kaum noch wo unterkomme und bei ihm mein Altersbrot verdienen muss. Fetter Hurensohn! – Ich möchte noch mal den alten James Sticks und Henry Pickles bei mir haben. Damals … 1927, Billy, das war noch ’n Leben. Was wir an einem einzigen Abend alleine an Trinkgeldern zugeschoben bekommen haben, verdient Dein Vater heut’ nicht durch harte Arbeit in ’ner ganzen Woche. Und … manchmal hatten wir in einer Woche so viel Kohle beisammen, dass wir in die feinsten Spielhäuser reingingen und …«
»Kein Wort wahr, Alter! – Aus allen Spielhäusern seid ihr rausgeflogen … Henry Pickles und Du. – Weiß doch die Welt, dass ihr nicht zu ertragen wart und nie ’nen Dollar in der Tasche hattet.«
»Schweinskerl, kleiner! – Wirst wohl deinem eigenen Großvater nicht vorwerfen, dass er vielleicht noch lügt, eh? – Verdammter Hurensohn! Das ist alles Dein Vater, dieser elende Flegel! Der glaubt, dass er mich schlecht machen muss vor aller Welt. Nur weil ich ihm nicht mehr in die Augen sehen kann. Dabei ist er nur neidisch, weil er sich abrackert, um das in ’ner Woche zu verdienen, was ich früher mit Henry Pickles an einem einzigen Tag gescheffelt hab’! – Ja, so ist’s, Du kleiner Schurke … glaub’ mir nur!«
Billy hörte gar nicht mehr zu.
Vielmehr hatte er am Ende der Straße zwei Gestalten entdeckt, deren Anblick ihm den Gedanken eingab, heute vielleicht einmal einen anderen Weg nach Hause zu nehmen. Die beiden Männer dort in einiger Entfernung torkelten sehr verdächtig und Billy wusste aus Erfahrung, dass man in diesem Viertel Betrunkenen zumindest nach Mitternacht bis Mittag aus dem Weg gehen sollte. Aber bevor sich der Junge entschieden hätte, war es bereits zu spät.
»Hey, ey, ey … kommt da nicht der alte Joe und hat er nicht vielleicht die ganze Nacht durchgeschuftet?«, lallte einer schon von Weitem und gerade vertrauenswürdig sahen weder er noch sein bulliger Begleiter aus.
»Hurensöhne … macht Euch davon, sonst will ich Euch gleich mal zeigen …«
Aber höhnisches, raues Gelächter schnitt dem Sänger das Wort ab. Billy versuchte seinen Großvater zur Seite zu ziehen. Da gab es eine enge Gasse, über die man sich vielleicht aus dem Staub machen würde können, bevor es Arger gäbe.
»Aber sag’, Joey … hast Du nicht ’nen Dollar für ’n paar alte Freunde übrig? – Wir haben nämlich noch was vor, weißte … und wir zahlen Dir deinen Scheißdollar schon zurück, keine Angst!«
»ZumeinerZeit hätt’ man Euch eingesperrt … jawohl!«, ereiferte sich Blind Joe Morgan und begann mit seinem Stock herumzuwirbeln. »Ja, nach Parchman Farm hätte man Euch geschickt – so wahr ich Joe Morgan heiße!« Drohend schlug er gleich noch ein wenig härter mit dem Stock um sich.
»Hoho … hör 'n Dir an, den alten Spinner!«, höhnte der eine.
»Mann, tu’ die Krücke weg, gleich steck’ ich se Dir in Dein blödes Maul rein, klar?«, drohte der andere, dem Joe unbewusst vor dem Gesicht herumfuchtelte. Doch gerade in diesem Augenblick stieß er ein wenig weiter vor und traf den Kerl ziemlich böse an der Wange, wo der alte, rissige Stock die Haut aufschürfte. Sicherlich mehr vor Überraschung als vor Schmerz schrie der Betrunkene auf.
»Ha … hab’ ich Dich erwischt, Du versoffenes Schwein, he?«, jubelte der Musiker und ließ seinen Stock gleich nochmals in die Richtung loswirbeln, in der er eben erfolgreich gewesen war.
»Los, mach die Mücke, sonst schlag’ ich Dich so weich, dasse Dich von der Straße zusammenkehren können.«
Billy ahnte, wie das ausgehen würde – doch bevor er seinen Großvater mit sich ziehen hätte können, bekam er eine brutale Ohrfeige verpasst, die ihn zu Boden schleuderte. Da gab es nicht mehr viel zu tun … Billy rappelte sich auf und rannte ein Stück weit davon.
In sicherer Entfernung blieb er kurz stehen, wandte sich um und sah, wie die beiden Betrunkenen über Blind Joe Morgan herfielen.
Zuerst verteidigte sich der Blinde mit seinem langen Stock ziemlich effektvoll, doch als er bei einem kräftigen Rundschlag die Waffe verlor, gab es keine Möglichkeit mehr für ihn, sich zu wehren.
Etwas später kehrte Billy zurück.
Blind Joe Morgan lag röchelnd an eine Hauswand gelehnt und hielt den Rest seiner alten Gitarre in den Armen. Er wimmert so etwas wie ›mein armer, alter Freund‹ vor sich hin … sang es fast wie einen Blues. Aus seinen Mundwinkeln rann Blut übers Kinn, das eine Auge hatten sie ihm völlig kaputt geschlagen – aber auch am Körper war er schrecklich zugerichtet. Ein Wunder, dass er noch atmete – wie Billy sich dachte.
»He, Alter … geht’s?«, fragte der Junge mit weinerlicher Stimme.
»Geht’s?«, wiederholte er, da der Großvater nichts weiter sagte als ›mein armer Freund‹ und dabei die Reste der Gitarre an sich drückte und in den Armen wiegte.
Billy griff rasch in die Tasche des Großvaters – aber das Geld war natürlich fort.
»Schweine, die haben deinen Lohn gestohlen.«
»Wer’n in der Hölle schmoren, diese Kerle!«, brummte der Alte und es klang erstaunlicherweise ziemlich klar – klar und böse. »Geh’ und hol’ gefälligst jemand, Dummkopf! – Oder soll ich hier verrecken, he?«
Billy rannte davon.
»Ah … so isses … erst wird man zerdroschen und dann muss man im Straßengraben verrecken. Ja … Sergeant Chick wär’ damals schon längst hier gewesen. Die jetzigen Hohlköpfe … keinen Verstand … und immer dort, wo man se gar nich’ brauchen kann. – Bah!«
Er spuckte ein bisschen Blut aus und erinnerte sich an den Tag, an dem man ihn und Henry Pickles fast totgeschlagen hatte. Sie waren im Straßengraben liegen geblieben und hatten sich aus zerschundenen Gesichtern hervor angesehen … und es war gut gewesen!
Aber jetzt … was hatte er noch? Noch nicht einmal der Enkel taugte zu etwas!
»Ach Gott … was soll ich hier denn noch? – Bin wohl noch immer nich’ so weit, he? – Warum fällt denn nichts herab, verdammter Hurensohn? – Lass was herabfallen, wenn’s dich wirklich gibt, heh! – Ein paar Ziegelsteine wirste doch da oben bei Dir im Himmel für mich übrig haben, was?«
* * *
Billy und sein Vater fanden den Alten mit einem seligen Lächeln vor – und ein paar Krümeln Blumenerde auf der blutigen Stirne. Neben ihm lag ein zerbrochener Tontopf auf dem Pflaster … eine verkümmerte Pflanze in den Scherben. Der Vater sah nach oben und entdeckte einen Fenstersims mit Blumentöpfen, in deren Reihe einer fehlte. Sicherlich hatte sich da jemand durch den Lärm auf der Straße gestört gefühlt und seinen Unmut zum Sonntag-Morgen mit einem gezielten Wurf hinab aufs Haupt des vermeintlich Betrunkenen Ausdruck verliehen.
Nun denn … so oder so wäre der Alte mit den Verletzungen, wie sie Billy kurz beschrieben hatte, nicht mehr lange herumgerannt – und besser einen Toten auf dem Friedhof als einen Krüppel zu Hause! – Das Begräbnis musste man nur einmal bezahlen und dann konnte man Gras über die Sache wachsen lassen.
»Schon tot?«, murmelte der Mann und beugte sich zu seinem Erzeuger hinab.
»So … na, soll sich der da oben seiner Seele erbarmen … Amen!« Er schlug ein schlampiges Kreuz vor die Brust und hievte den toten Blind Joe Morgan hoch.
»Amen!«, sagte auch Billy und folgte dem Vater, der den Großvater davontrug.
Da sah man sie gehen: den kräftigen Vater mit dem Wrack des blinden Sängers auf dem Buckel, daneben den betrübt den Kopf gesenkt haltenden Billy.
Jetzt war auch Joe Morgan bei den anderen.
Mochten sie im Himmel ihren ›Ramblin’ and Wand’rin’-Blues‹grölen.
© a. zeram 1975/2011
Begegnung
Kurzgeschichte
»He, hallo …Sie!«, rief ich den Mann an, der auf den Bootssteg hinausgetreten war und ungeachtet des tosenden Sees immer weiterging. »Hallo! – Vorsicht!«
Ich klappte den Kragen meines Mantels hoch und begann zu rennen. Offensichtlich träumte dieser Mensch und spazierte mit offenen Augen, ohne wahrzunehmen, wohin ihn seine Schritte führten.
Endlich hatte ich ihn erreicht und am Arm gepackt. Gerade noch rechtzeitig! Einen Schritt weiter und er wäre ins Wasser gestürzt – vielleicht sogar ertrunken! Wer sonst hätte ihn zurückhalten sollen? Bei diesem Sturm wagte sich niemand hinaus. Im ganzen Kurpark war kein Mensch zu sehen!
Mit einem höchst erstaunten, weniger fragenden als ärgerlichem Blick musterte mich der Fremde. Er war gut einen Kopf kleiner als ich und etwas dicklich. Seiner Kleidung nach zu urteilen, mochte er Kurgast in einem der luxuriösen Hotels am Ort sein. Auch die goldene Krawattennadel sprach für meine Vermutung – so unüblich dieses Kleinod heutzutage ohnehin war.
»Was machen Sie denn? Träumen Sie? Sie wären beinahe ins Wasser gefallen!«, brachte ich schwer atmend hervor. Der Lauf zum Bootssteg hatte mir bewiesen, dass ich meinen Zigarettenkonsum drosseln sollte.
»Träumen?« Der Mann schmunzelte hintergründig und warf den düster brodelnden Fluten des Sees einen abschätzenden Seitenblick zu.
»Mann, Sie wären jetzt da drinnen, wenn ich Sie nicht zurückgehalten hätte!«, schrie ich ihn unbeherrscht an. »Träumen Sie denn?«
»Nicht mehr!«, erklärte mir der Fremde ganz gelassen und trat einen Schritt zur Seite. »Nicht mehr, werter Herr!«
Wir standen immer noch bedrohlich nahe am Rand des Bootssteges und mir war nicht gerade wohl zumute. Der Wind blies fauchend und die Gischt der Wellenkämme berieselte uns wie aus einer defekten Brause. Immer wieder spritzte es bis auf die Planken des Steges hinauf.
»Was ist nur mit Ihnen los? Geht es Ihnen nicht gut? Brauchen Sie einen Arzt?«
»Ganz und gar nicht!«, konterte er. »Mir geht es ausgezeichnet!«
»Was haben Sie sich denn dabei gedacht? – Sie spazieren hier tagträumend auf dem Steg dahin und mit dem nächsten Schritt wären Sie im Wasser gelandet! Ohne mich …»
»… ohne Sie müsste ich jetzt die Entscheidung treffen, ob ich schwimmen wollte oder nicht!«, ergänzte der Mann meinen in Erregung abgebrochenen Satz. Aus Verlegenheit begann ich, mehrmals zu nicken. Die Ruhe dieses Menschen verwirrte mich, seine Worte verunsicherten mich. – Ein Lebensmüder, der keineswegs träumend dahin spaziert war …!
»Ach so …», murmelte ich schließlich, immer noch ungläubig.
»Ja, so!« Der Mann sah mich streng an und nickte kurz.
Seine Augen lagen ungewöhnlich dicht beieinander und die buschigen Brauen verliehen seinem Blick etwas Unergründliches. Die von kurzen Falten zerfurchte Stirn und die langen, tiefen Linien seitlich der Mundwinkel, die sich in kurzem Bogen leicht nach unten senkten, verrieten mir, dass dieser Mensch schon vieles durchgemacht haben musste. So sah kein glücklicher Mann aus! Vielleicht hatten ihn einige Unglücksfälle in Folge aus dem Lot geworfen. Mochte er der Chef einer bankrott-gegangenen Firma sein, gerade frisch verwitwet oder trauernder Vater. In seinem ausdrucksvollen Gesicht zeichnete sich Leid ab – Leid und Resignation. Mir schien es, als könnte ich in seinem Gesichtsausdruck lesen, was er sich vom Dasein noch erwartete: nämlich nichts!
»Kommen sie. Wir könnten zusammen einen Grog trinken und uns ein bisschen unterhalten. Das wird uns beiden gut tun!«, sagte ich und wollte ihn schon am Arm nehmen und mit mir ziehen.
»Ihnen würde das vielleicht gut tun!«, entgegnete er. »Mir sicherlich nicht! – Ich trinke keinen Alkohol!«
Diese lakonische Bemerkung verwirrte mich endgültig. Trieb er sich nur einen Scherz? Hatte ich mich verschätzt?
»Wir sollten miteinander reden!«, beharrte ich dennoch. »Sie … Sie sind nicht glücklich!«
»Nein, ich bin nicht glücklich!«, bestätigte er mich. »Ich bin sogar sehr unglücklich!«
»Und deshalb wollten Sie sich das Leben nehmen!«, folgerte ich jetzt – nach einer sehr kurzen Pause, die ich nötig gehabt hatte, um die direkte Feststellung auszusprechen.
»Ganz recht mein Herr! – Und ich will es noch immer!«
Diese Antwort trieb mir den Schweiß auf die Stirne. »Ich … ich verstehe, dass Sie unglücklich sind!«, stammelte ich und suchte nach Worten, die nach Möglichkeit tiefe Anteilnahme ausdrücken konnten. »Aber vielleicht wollen Sie mir sagen … warum? Mit etwas Glück werden Sie dann einsehen, dass Sie noch längst nicht aufzugeben bräuchten … und dann finden Sie wieder zurück in den geregelten Alltag!«
»Ein hübscher Gedanke!« Der Mann schmunzelte.
»Nicht wahr? – Wir könnten …»
»… aber leider ist dieser Gedanke völlig unsinnig!«, fuhr er, mich unterbrechend, fort.
»Ich … aber … hören sie: Sie können doch nicht vor meinen Augen ins Wasser gehen. Das lass’ ich einfach nicht zu! Abgesehen davon: Warum geben Sie sich selbst keine Chance?«
»Ich habe meine letzte Chance gestern Abend verspielt!«, erklärte er.
»Dann vergessen Sie’s und geben sich nochmals eine … die allerletzte, wenn’s sein muss! Es ist nie zu spät!«, drängte ich und zog ihn jetzt ein paar Schritte mit mir, weg von dem gefährlichen Rand des Bootssteges, mehr zur Mitte hin. Vielleicht konnte ich ihn sogar ganz auf den sicheren Spazierweg am Ufer lotsen.
Sanfte Gewalt musste ich anwenden, doch als der Mann plötzlich wie angewurzelt stehen blieb, brachte ich ihn nicht mehr weiter.
»Man kann nicht vergessen, wenn man nicht dazu veranlagt ist!«, sagte er. »Vergessen! – Ist es dem Wollen unterstellt oder dem Können? – Wer vergessen kann, dem ist es gegeben, über gewisse Dinge einfach nicht mehr nachzudenken. Ich aber, ich vergesse nie etwas … nichts! Ich kann es nicht. Ich kann nicht einen Gedanken einfach einfrieren und nie wieder überdenken. Es geht nicht! Ich kann das nicht!«
»Geben Sie sich trotzdem eine neue, eine letzte Chance!«, bat ich.
»Wozu?«
»Um meinetwillen! Um meinetwillen, wenn kein anderer Grund denkbar ist!«
»Um Ihretwillen?« Der Mann lachte jetzt leise.
»Um Ihrer Freunde willen – wenn Ihnen das·eher zusagt«
»Ich habe keine Freunde!«, konterte er.
»Dann tun Sie’s … einfach so!«, fuhr ich auf. »Sie sind doch ein Mensch! Warum sollten Sie sterben, bevor es an der Zeit ist?«
»Aber … es ist an der Zeit!«
»Woher wollen Sie das wissen? Bestimmt der Mensch selbst, wann er abtreten muss?«
»Offensichtlich nicht! – Wäre es so, dann würde ich mich gerne bereit erklären, mit ihnen in einem Café etwas zu trinken und mich mit ihnen zu unterhalten. Aber unabhängig vom Nutzen solch eines Unternehmens … ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Zeit gekommen ist!«
»Wie können Sie das behaupten?«
»Ich fühle es und ich weiß auch warum!«
»Sie haben angedeutet, dass Sie keine Freunde haben! Wie können Sie das mit Sicherheit wissen? Freunde zeigen sich immer erst in der Not, nicht dann, wenn es einem gut geht! Und wie Sie sehen, Sie sind in Not und ich bin hier bei ihnen! Wir könnten Freunde sein!«
»Diese vage Möglichkeit bestreite ich gar nicht, werter Herr! Aber vage Möglichkeiten sind zu wenig! Ein halbes Leben lang musste ich mich mit Möglichkeiten zufriedengeben. Ich habe mir zugeschworen, Klarheit zu schaffen und diese vagen Unsicherheiten von vorneherein auszuschalten. Ich sehe keinen Grund, diesen Schwur gerade jetzt zu brechen!«
»Aber … vielleicht bin ich bereits Ihr Freund! Ich kümmere mich normalerweise um niemanden. Dann hab’ ich Sie hier auf den Steg gesehen und ich musste einfach eingreifen. War das nicht so eine Art ›Wink des Schicksals‹?«
»Für Sie oder für mich?«, fragte der Mann ruhig.
»Für … für Sie natürlich!«, schrie ich ihn unbeherrscht an. Mein eigenes Unvermögen brachte mich aus der Fassung. »Ein … Wink, der bedeuten könnte: Hier kommt der Freund, den du immer gesucht hast. Jetzt, in deiner schwersten Stunde, findest du ihn endlich!«
»Ein interessanter Gedanke, aber leider allzu romantisch! Wie kann ich denn einen Menschen nur deshalb akzeptieren, weil er einmal mein Freund werden könnte? – Geben Sie zu, dass dieser Einfall auch aus Ihrer Sicht keinen Wert hat! Es ist absurd! Wir kennen uns überhaupt nicht und Sie reden von Freundschaft!«
»Das ist doch … Sie wehren sich ja dagegen! Sie wollen keine Freunde!«, brach es plötzlich aus mir heraus. Ich war drauf und dran, ihn zu packen und wie einen Schlaftrunkenen zu schütteln, den man rasch zur Besinnung bringen möchte.
»Möglicherweise war das immer mein größtes Problem! Ich habe mich einerseits nach einer Freundschaft gesehnt und andererseits wohl gefürchtet, mich zu binden und meine Unabhängigkeit zu verlieren. Genau weiß ich es nicht. Leider!«
»Dann versuchen sie’s doch endlich mal! Indem man vor sich selbst davonläuft, kommt man nicht ans Ziel!«
»Oh, das mag stimmen – auch wenn es nicht völlig überzeugend klingen kann! Ich persönlich habe mir allerdings schon viele Ziele gesteckt und Sie alle erreicht. Mein jüngstes Ziel ist der Tod. Auch dies’ werde ich erreichen!«