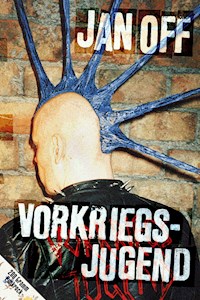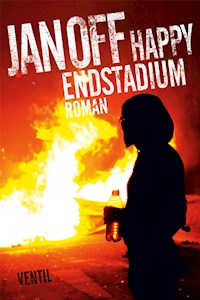Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsichtbar
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ob in der Psychiatrie, im Bordell oder beim Schnorren auf der Straße – die Geschichten dieses Buches spielen zumeist an trostlosen Orten. Auch die Figuren, die sie bevölkern, sind nur selten vom Glück begünstig. Vor die Wahl gestellt, würde man aber lieber mit den vermeintlichen Opfern tauschen, als mit jenen, die ihnen das Leben zur Hölle machen. Dafür sorgt allein schon der liebenswerte Witz, mit dem das Autorentrio Stein Of(f) Love seine Antihelden erzählen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©opyright 2014 by Autoren
Titelbildgestaltung: Nadja Riedl / D-ligo
Foto: Lucja Romanowska
Lektorat: Miriam Spies
Satz und Konvertierung: Fred Uhde, Leipzig (www.buch-satz-illustration.de)
ISBN: 978-3-95791-022-6
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist
nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Hat Dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter:
Mehr Infos jederzeit im Web unter www.unsichtbar-verlag.de
Unsichtbar Verlag | Wellenburger Str. 1 | 86420 Diedorf
Ellen Stein
Jan Off
Steffi Love
Bei uns kommt
der Hass
aus der Leitung
Wichsvorlagen für Scheintote
JAN OFF
Abbrucharbeiten im Bootcamp der Zweisamkeit
Abdrift
Lass mich bluten, Natalie
Zonenrand – Schlaraffenland: 0:6
Judgement Day, Digger!
Abbrucharbeiten im Bootcamp der Zweisamkeit
Wie Ronny und Anke auf den abwegigen Gedanken verfallen waren, ihrer mehr als dürftigen Beziehung den standesamtlichen Segen geben zu wollen, hätten sie wohl selber nur schwererklären können. Am Anfang war das Ganze sicher nichts weiter als ein Jux gewesen, eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie während der Dauerparty, die wir damals alle feierten, ständig aufkamen. Aber im Gegensatz zu den vielen anderen vom Alkohol befeuerten Hirngespinsten löste sich dieses hier nicht in Rauch auf, nachdem die Kotze neben dem Bett getrocknet und der barbarische Kopfschmerz mit einem Schluck aus der letzten, vor dem Wegdämmerngeöffneten Flasche bekämpft worden war. Vielmehr verselbstständigte sich das halbgare Geschwafel, begann Kreise zu ziehen und stieß dabei auf derartgroßenAnklang, dasseinRückzieher irgendwann nicht mehrmöglich war. Anders ausgedrückt: Der Druck derjenigen, die auf Freigetränke und den hohen Spaßfaktor spekulierten, den ein derart trashiges, ja, bizarres Ereignis versprach, nahm Ausmaße an, die es Ronny und Anke nur noch untergrößtenReputationsverlustenerlaubthätten, aus der Nummer herauszukommen.
AngesichtsdieserAusweglosigkeitglaubtendiebeiden am Ende selbst, dass der Bund fürs Leben die einzige Option darstellte. Also leiteten sie alles Notwendige in die Wege, und als der Termin dann feststand, stieg die Aufregung noch einmal richtig, zumindest bei Anke, die Ronny tatsächlich dazu brachte, Ringezukaufen; wennauchwelche, die kaum teurer waren als eine Familienpackung Eiernudeln.
Keine Frage, dass am VorabenddesgroßenEreignisses schon mal vorgeglüht werden musste. Ort dieser Aufwärmrunde im engsten Kreis (wie Marcel das nannte) war das Reihenhaus von Marcels Mutter, die für eine Woche nach Polen gefahren war, um sich die Kauleisten erneuern zu lassen.
Die Hütte, die ich – wie die meisten von uns – nie zuvor betreten hatte, war genauso geschmacklos eingerichtet, wie es von jemandem, der zu Marcels Verwandtschaft zählte, zu erwarten gewesen war. Ein Abklatsch dieses bedrückenden Stils, den Tine Wittler und Konsorten allwöchentlich im Privatfernsehen vorgaben, also dieses vermeintlich Farbenfrohe und Heitere, das in seiner Austauschbarkeit und seiner billigen Machart dann doch nur wieder bedrückend wirkt; natürlich durchsetzt mit den verlangten neckischen Accessoires. Als ob die vielen Kerzen und Kerzenleuchter, die buntgemusterten Zierkissen und die mit Weidenstäben gefüllten Vasen nicht gereicht hätten, waren auch noch überall Eulenplatziert – Nachbildungenaus Porzellan, Holz und Metall (ja, selbst einige in der Makramee-Technik produzierte Exemplare), die von einer geradezu manischen Sammelleidenschaft kündeten. Dankenswerterweise waren diese Figuren nicht das Einzige, was Marcels Mutter hortete. Auch die Bar war gut bestückt.
»Geil, lass Bowle machen«, schlug Basti vor, nachdem Marcel eine Doppeltür in der Schrankwand geöffnet und uns die etwa drei dutzend mit Feuerwasser gefüllten Flaschen präsentiert hatte.
DieserIdeemochtesichniemandverschließen. Alsowurdeausder Küche eine große Salatschüssel besorgt und auf der Basis einer 1,5-Liter-Jubiläumsflasche Bacardi ein Mix aus allen nur erdenklichen Spirituosen zusammengeschüttet. Hätte Marcel nicht noch in letzter Sekunde zwei Flachen Keller Geister herbeigeschafft, wäre das Gebräu wohl gänzlich ungenießbar geworden. So galt es nach allgemeinem Bekunden als gerade noch bekömmlich, beziehungsweise rustikal aber ehrlich, wie Ariane es formulierte.
»Fehlen nur noch die Früchte«, ließ Christin sich vernehmen und holte einen Plastikbeutel voller Ecstasy aus ihrer Jacke.
Schnell waren die bunten Pillen mithilfe einer besonders scheußlichenEule – einem tönernen Uhu, dem ein HSV-Trikot auf den Leib gepinselt worden war – zu Pulver zermahlen und in die Schüssel gekippt.
Während Christin dem MDMA durch stetiges Rühren mit der Schöpfkelle dabei behilflich war, sich vollständig aufzulösen, streuten Schorfbrocken und Schnorchel das erste Speed auf. Dabei kam den beiden die Beschaffenheit des Couchtischs entgegen, um den wir uns gruppiert hatten. Der nämlich war nicht nur mit einem penibel gesäuberten Glaseinsatz versehen, sondern auch derart überdimensioniert, dass man auf ihm – eine ausreichende Menge Amphetaminevorausgesetzt – problemlosdenkompletten Verlauf des Amazonas hätte nachzeichnen können. Ja, dieser Couchtisch war ein wahres Prachtstück; selbst die ihn umgebendeWohnlandschaft des Grauens konnte seiner majestätischen Ausstrahlung nichts anhaben.
Nachdem zwei oder drei Gramm zerhackt, die wichtigsten Vorbereitungen also abgeschlossen waren, konnten die Feierlichkeiten beginnen. Und das taten sie auch. Ariane, die gerade noch mit einem Fläschchen Poppers herumhantiert hatte, sprang mit einem Mal auf und fing damit an, Porzellankäuzchen aus den Fächern der Schrankwand zu fischen und gegen den Flachbildschirm fliegen zu lassen, um, wie sie uns zurief, ein bisschen Polterabend-Atmo zu schaffen. Dem wollten Basti und Mike in nichts nachstehen und suchten ihrerseits nach Gegenständen, die gemäß alter Väter Sitte zu Scherben verarbeitet werden konnten. Fündig wurden sie in einer Vitrine, die nicht nur das gute Tafelgeschirr beherbergte sondern auch ein einundzwanzigteiliges Kaffeeservice der Firma Rosenthal. Das zumindest war die Information, die Mike uns zukommen ließ, nachdem die erste Untertasse unter den Absätzen seiner Air Force 1 das Zeitliche gesegnet hatte.
Marcel hatte unterdessen das CD-Regal durchforstet und einen alten Eurodance-Sampler ausgegraben, dessen Klänge in kurzer Zeit dafür sorgten, dass sich ein Großteil der Anwesenden tänzerisch zu betätigen begann. Schon bald waren die ersten Oberteile ausgezogen, wurde die nackte Haut gegenseitig mit Geldscheinen beklebt, die man vorher ausgiebig mit Speichel benetzt hatte. Das alles untermalt von Krachern wie No Limit oder Mr. Vain sowie lautem Geschepper aus der Küche, wohin Ariane, Basti und Mike gemeinsam mit ein paar anderen gezogen waren, um ihr Glück bringendes Treiben fortzusetzen.
Es war also alles wie immer – ausgelassen, aber gediegen –, bis die Bullen sich das erste Mal bemüßigt fühlten, vorbeizuschauen. Hätte Dirk, dem es irgendwann zu dumm wurde, vor der verschlossenen Klotür darauf zu warten, dass Veit seinen Schwanz wieder aus einer von Jackies Körperöffnungen bekam, sich nicht entschieden, in den Vorgarten zu pissen, wäre das polizeiliche Klingeln und Klopfen wahrscheinlich gar nicht bemerkt worden. So aber stand die Ordnungsmacht plötzlich mitten im Zimmer und bat vehement darum, die Lautstärke der Anlage zu drosseln.
Schnorchel, der seit jeher Probleme mit Autoritäten hatte, nahm dieses Gesuch zum Anlass, um ein bisschen auszuflippen. Er beschimpfte die ungebetenen Gäste als Bockmelker, Fadenwürmer und Handtaschendiebe und bewarf sie zusätzlich mit den vergoldeten Tannenzapfen, die Marcels Mutter als Tischdeko verwendete. Als das nicht half, die beiden Beamten aus der Reserve zu locken, verstieg er sich schließlich zu folgender Ansage: »Ihr habt in einer Minute entweder eure albernen Uniformen abgelegt oder einen von diesen Zapfen derart tief im Arsch, dass ihr in Zukunft Tannennadeln scheißt.«
Nun endlich reagierte der Sicherheitsapparat.
»Wenn Sie derlei Drohungennichtaugenblicklichunterlassen, sehen wir uns gezwungen Sie mitzunehmen«, brüllte der ältere Bulle gegen die nach wie vor wummernden Bässe an, während sein Kollege schon mal nach dem Reizstoffsprühgerät griff.
Natürlichunterließ Schnorchel nicht, sondern intensivierte sein Forechecking noch, indem er aufsprang und mit ungelenken Bewegungen ein paar Handkantenschläge andeutete.
»Gleich ist Zapfenstreich, ihr Hurensöhne. Gleich könnt ihr euch die Koniferenvonuntenangucken«, schrie er währenddessen.
Und so kam es, dass er nach einem kurzen Ringkampf, den fair zu nennen nicht der Wahrheit entspräche – schließlich glich Schnorchels vom langjährigen Rauschmittelkonsum malträtierter Leib eher einer Fischerkate denn einer Bankiersvilla –, in den Streifenwagen verfrachtet wurde.
Schorfbrocken, derseinemlangjährigenFreundundSchicksalsgefährten zu Hilfe eilen wollte, wäre um ein Haar ebenfalls eingefahren, kam letztlich aber mit einer Ladung Pfeffer und den Worten davon, dass er, so man noch einmal antanzen müsse, der Erste wäre, an dem man sich schadlos halten würde.
Keine Frage, dass es nach diesen Unerfreulichkeiten ein wenig dauerte, bis die Party wieder in Schwung kam – zumal Schnorchel es vor seinem Abgang versäumt hatte, sich seiner Drogen zu entledigen. Aber zum Glück verfügte Schorfbrocken über einen recht erbaulichen Notvorrat und auch von der Bowle war noch etwas übrig; es gab also keinen Grund, dauerhaft in Agonie zu verfallen.
Kaum, dass die nächste Runde jedoch mit einer zünftigen Kissenschlacht eröffnet worden war, erwischte es Songül. Das bedauernswerte Mädchen verlor nach einem schweren Treffer mit einem gut und gerne neunzig Zentimeter großen Stoffbären aus dem Hause Steiff das Gleichgewicht, knallte mit dem Kopf gegen die Kante einer Kommode und zog sich eine klaffende Stirnwunde zu. Da sich partout nichts finden lassen wollte, mit dem die Blutung zu stoppen gewesen wäre – selbst die von Marcel eilig herbeigeschafften Leinennachthemden seiner Frau Mama erwiesen sich als untauglich –, hörte Songül nicht auf, den beigefarbenen Veloursteppich einzusauen. Sie selbst nahm das locker, wollte es unbedingt weiter krachen lassen und rannte, um ihre Feiertauglichkeit unter Beweis zu stellen, wie aufgedreht durch den Raum. Wäre sie dabei nicht erneut zu Fall gekommen – diesmal war es die Schrankwand, mit der sie kollidierte – und kurzzeitig k. o. gegangen, hätte wohl irgendwer den Rettungsdienst rufen müssen. So nutzte Mike, den ich schon länger verdächtigte, ein Auge auf Songül geworfen zu haben, die Gunst des Augenblicks und verfrachtete die Wehrlose mit Bastis Hilfe in den geleasten Polo, denMarcelsMutterdankenswerterweise zurückgelassen hatte. Der Anbieter, der ihre Reise in die Wunderwelt der polnischen Gebisswerkstätten organisierte, arbeitete wahrscheinlich mit einem Busunternehmen zusammen.
Mike versprachzurückzukommen, sobalddieWunde seiner Passagierin genäht worden war, und bei dieser Gelegenheit gleich noch ein bisschen Bier mitzubringen. Dann verabschiedete er sich Richtung Notaufnahme.
Derart dezimiert drohte unsere kleine Gesellschaft erneut in ein Stimmungstief zu fallen. Ronny steuerte dem entgegen, indem er jedem eine Kapsel Ketamin aushändigte.
»Wollte ich eigentlich erst direkt vor der Trauung, aber wo’s grad so schön passt …«, raunte er mir zu, während er wie ein Weihbischof durch die Reihen schritt und seine betäubenden Ersatzoblaten in die willigen Mäuler schob.
Nur kurze Zeit später begannen die Dinge dann ein wenig aus dem Ruder zu laufen.
Den Startpunkt einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen markierte Veit, der, die glimmende Zigarette noch in der Hand, im Fernsehsessel einschlief und kurzerhand die Armlehne in Brand setzte. Christin, die das Malheur als Erste bemerkte, rückte den Flammen mit dem Inhalt der nächstbesten Flasche zu Leibe. Dummerweise handelte es sich dabei um achtzigprozentigen Stroh-Rum, mit dem irgendwer die Bowle verfeinert hatte. Das Ergebnis dieses Löschversuchs war ein rasches Ausbreiten des Feuers. Und so musstedochnochderRettungsdienstkommen, um Veits angekokelten Leib zu verarzten.
Das Auftauchen der beiden Sanitäter versetzte nun wiederum Goran, der offenbar einen bösen Trip erwischt hatte, derart in Angst und Schrecken, dass er laut schreiend ins Untergeschossflüchtete und sich im Heizungskeller einschloss. Ich machte mich auf die Suche nach Marcel, um herauszufinden, ob ein zweiter Schlüssel existierte, mit dessen HilfemandenParanoikereventuell hätte befreien können, und musste zu meiner großen Erschütterung entdecken, dassauchunserGastgeber einen Anfall von Verfolgungswahn zu erdulden hatte. Vor wem oder was er sich fürchtete, vermochte ich nicht zu ermitteln; klar war nur, dass seine Angst gewaltig sein musste. Denn warum sonst hätte er sich in den zweiten Stock zurückziehen und dabei nach und nach die Treppenstufen entfernen sollen, die ebendiesen von der ersten Etage trennten?! Als ich den Bemitleidenswerten fand, hatte er unter Zuhilfenahme einesStemmeisens bereits die Hälfte der Stufen herausgebrochen, und wäre nur noch durch eine Klettereinlage zu erreichen gewesen.
Auf mein Zureden reagierte er nicht, jedenfalls nicht so, wie es für das Zustandekommen einer für beide Seiten gewinnbringenden Kommunikation vonnöten gewesen wäre. Denn wie bitte soll sich ein Dialog entwickeln, wenn einer der Beteiligten ohne Unterlass die Worte geht weg, geht weg, verschwindet endlich, ihr Arschfotzen wiederholt?
Also ließ ich Marcel allein und kehrte einigermaßen ratlos ins Wohnzimmer zurück. Noch während ich versuchte, mir dort einen groben Überblick zu verschaffen, tauchte Basti neben mir auf – in seinen Händen das Klobecken des Hauses. Wie er es geschafft hatte, den wuchtigen Porzellankorpus aus seiner Verankerung zu reißen, würde wohl auf ewig sein Geheimnis bleiben, jetzt schickte er sich jedenfalls an, das Teil gegen die Scheibe der Verandatür zu werfen.
»Polterabend, ne«, murmelte er und sah mich mit glasigen Augen an. Dann bahnte sich das Becken auch schon seinen Weg nach draußen.
Und dieses Bild, dieses Manifest der Sinnlosigkeit, das mein Gehirn seltsamerweise wie in Zeitlupe erreichte, ließ mich so müde werden, dass ich gar nicht anders konnte, als mich in den Sessel fallen zu lassen, in dem Veit keine Stunde zuvor die lebende Fackel gegeben hatte.
Als ichwiedererwachte, war es taghell. Ich rappelte mich auf, griff mir eine offene Flasche Prosecco und goss mir einen Schluck des lauwarmen Gesöffs in den Schlund. Dann drehte ich eine Runde durchs Erdgeschoss. Überall zerstörtes Mobiliar, Scherben, Essensreste, Daunenfedern. Dazwischen Pfützen von Erbrochenem und anderen Körperflüssigkeiten. Die Wände übersät mit schlechten Tags, die Böden von Brandlöchern gezeichnet. Und immer wieder Eulen, Eulen, Eulen – aufgeschlitzt, zertrampelt, zerquetscht.
In der Küche entdeckte ich Anke, die mit halb heruntergelassenen Hosen auf Schorfbrocken lag. Auch die anderen Gäste, an denen ich während meiner Erkundungstour vorbeistolperte, schienen ausnahmslos zu schlafen.
Nur Ronny war noch auf den Beinen. Ich fand ihn mit einer Flasche Bier in der Hand auf der Couch vor, als ich wieder im Wohnzimmer anlangte. Sein Anblick löste in mir die Erinnerung an den Grund unseres gemütlichen Beisammenseins aus.
»Hey, wie lange dauert’s denn eigentlich noch bis zur Trauung?« Ich ließ mich neben ihn in die Polster fallen und registrierte voller Staunen, dass der Glastisch das zurückliegende Inferno ohne einen einzigen Kratzer überstanden hatte.
»Die Trauung?« Ronny prostete mir unmotiviert zu. »Die wäre vor sechs oder sieben Stunden gewesen … Na, scheiß drauf.« Er lachte leise. »War auch so ’ne schöne Party.«
Ichwollteihm gerade beipflichten, als der Bräutigam a. D. die Flasche, die er mit einem letzten langgezogenen Schluck geleert hatte, auf dem Tisch abstellte. Dabei überschätzte er seinen Schwung ein wenig, aber wirklich nur minimal, so dass der Flaschenboden eine Nuance zu laut aufs Glas schlug. Diesem Geräusch folgte ein weiteres – ein leises Knirschen, wie es entsteht, wenn man auf hartgefrorenen Schnee tritt.
KeineZehntelsekundespäterwardiegesamteOberfläche des Couchtischs von einem Geflecht aus unzähligen Rissen überzogen.
Abdrift
»Jesus, ich brauch noch heute ’ne Professionelle, die mir korrekt die Pussy durchkaut«, sagte Cathy unvermittelt, wobei sie – wie sie es immer tat – den Namen des außerehelich gezeugten Wanderpredigers in Englisch aussprach.
Als niemand auf diesen Einwurf reagierte, schickte sie ein gespieltes Stöhnen in die Runde, das uns anderen die Botschaftübermittelnsollte, wiesattsieeshatte, ausschließlich von gottverdammten Langweilern umgeben zu sein. Dann griff sie sich das Telefon und rief die Auskunft an.
Während ich das Gespräch verfolgte, das sich in die Länge zog, da die Rufnummern von Freudenmädchen, die es auch Frauen besorgten, offenbar nicht gesondert erfasst waren, wurde mir einmal mehr bewusst, wie sehr Cathys offensiv zur Schau gestellte Sexualität uns alle im Griff hatte.
Es war noch keine Woche her, dass wir unsere kleine Tourneebegonnen hatten, aber schon schienen Patricia, Roman und Arne die Tatsache, dass in Deutschland jeweils eine Freundin auf sie wartete, verdrängt, wenn nicht gar gänzlich vergessen zu haben. Die Spannung, die sich in den letzten Minuten über den Raum gelegt hatte, kündete davon, wiesehrjeder von ihnen mit den Bildern beschäftigt war, die uns Cathys eben geäußerter Wunsch auf diekopfeigeneLeinwandgemalthatte. Inwieweit meine Begleiterdarübernachdachten, dieRolle der verlangten Prostituierten einzunehmen, konnte ich nur vermuten. Ich selbst hätte mich sofort zur Verfügung gestellt, auch wenn mir nicht ganz klar war, warum.
Cathysahunbestreitbargutaus: schwarzeLockenmähne; volle, wohlgeformteLippen; Mandelaugen. Daneben reizte ohne Zweifel ihre exotische Abstammung – ihre Mutter kam aus Java, ihr Vater war Nigerianer. Aber ihre Art gefiel mir überhaupt nicht. Ich fand sie zu laut, zu exaltiert, zu selbstbezogen kurz: zu anstrengend. Sex war zwarnichtihreinziges, aber doch mit Abstand ihr Lieblingsthema. Sie sprach mit steter Regelmäßigkeit über vergangene oder geplante Ausschweifungen, referierte ausführlich über Pornofilme und hatte diverse Fickgeschichten von Prominenten parat. Männer waren für sie grundsätzlich Toyboys, Geschlechtsgenossinnen bezeichnete sie gern mal als Bitches. Das wirkte nicht nur aufgesetzt, sondern in seiner Massivität geradezu grotesk. Und trotzdem war es unmöglich, sich der Faszination dieses Schauspiels zu entziehen. Es erinnerte in seiner Wirksamkeit an die Masche vom schwachen, hilfebedürftigen Mädchen – du durchschaust das Manöver zwar, reagierst am Ende aber doch wie gewünscht.
In Cathys Fall funktionierte der Trick unter gegenteiligen Voraussetzungen. Ihr Auftreten hätte eher zu einem Chefarzt gepasst, der sich im Kreise seiner Kollegen über die neuen Schwesternschülerinnen auslässt. Und darin schwang für Arne, Roman und mich, aber auch für Patricia, die in ihrer Beziehung den maskulinen Part übernommen hatte, offenbar eine permanente Kampfansage mit. Anders waren die pawlowschen Verhaltensauffälligkeiten, die wir seit unserer Abreise an den Tag legten, jedenfalls nicht zu erklären. Arne gab in einer Tour den Pausenclown; Patricia ließ keine Gelegenheit aus, ihren technischen Sachverstand und ihre Fähigkeiten als Organisatorin unter Beweis zu stellen; während Roman sich in der Rolle des dandyhaften Aufreißers gefiel. Es war noch keine vierundzwanzig Stunden her, dass er im Beisein von Cathy und mir allen Ernstes behauptet hatte, Selbstbefriedigung käme in seinem Leben nicht vor. Es hätte sich für diese Aufgabe bisher noch jedes Mal eine Frau gefunden. Daraufhin hatte ich mir den Einwurf, dass es um seine Libido offenbar nicht sonderlich gut bestellt sei, einfach nicht verkneifen können. Denn soweit ich das beobachtet hatte, war es Roman nur nach einem einzigen unserer bisherigen Auftritte gelungen, ein Mädchen abzuschleppen. Und das war dann wohl auch der Wandel im Gebaren, den ich mir attestieren musste. Ich war ungewohnt scharfzüngig und nur allzu schnell bereit, mich auf Hahnenkämpfe einzulassen.
Für den Moment waren wir allerdings von intellektuellen Kraftproben und anderen Balzritualen erlöst, denn hier in Zürich war es für Frauen offenbar gar nicht so einfach, gleichgeschlechtliche Begierden auf professionellem Wege befriedigenzulassen. Nachdem