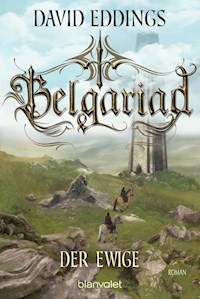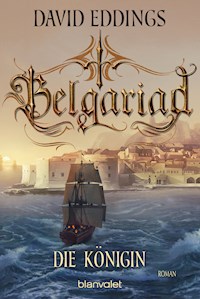9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Belgariad-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Fantasy-Klassiker endlich wieder verfügbar – in überarbeiteter Neuausgabe.
Der New-York-Times-Platz-1-Bestsellerautor David Eddings war in den 80er Jahren nicht nur einer der Helden der Fantasy-Leser, sondern ist für viele der erfolgreichen Fantasy-Autoren von heute ein Vorbild. Die Lektüre der Belgariad-Saga ist wie eine Begegnung mit Freunden. Die Charaktere dieser heroischen Coming-of-Age-Fantasy wachsen einem sofort ans Herz, und gemeinsam mit ihnen erforscht man eine wunderbare Welt und kämpft im epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Der naive Junge vom Land, der edelste Ritter, der cleverste Dieb, der mächtigste Magier – wer sonst könnte die Welt retten?
Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »Die Zaubermacht der Dame« im Knaur-Verlag und unter dem Titel »Der Zauber der Schlange« im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Er wurde komplett überarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Während ihrer Jagd nach dem Auge Aldurs, einem mächtigen magischen Artefakt, gelangen der junge Garion und seine Gefährten nach Arendien. Dort schließt sich ihnen Mandorallen an, der Baron von Vo Mandor. Er ist der mächtigste der mimbrischen Ritter und ein treuer Unterstützer des Königs. Und wenig später stößt dort auch noch der Bogenschütze Lelldorin zu ihnen. Der junge asturische Adelige hasst alle Mimbrer und ist in eine Rebellion gegen den König verstrickt. Garion gerät zwischen die Fronten. Wie soll er den König retten und gleichzeitig seinen Freund vor dem Verderben bewahren?
Autor
David Eddings wurde 1931 in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er 1982 seinen ersten großen Roman, Belgariad – Die Gefährten, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Im Jahr 2009 starb er in Caron City, Nevada.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DAVID EDDINGS
DER SCHÜTZE
ROMAN
DEUTSCH VON IRMHILD HÜBNER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1982 unter dem Titel »Queen of Sorcery (Book 2 of The Belgariad)« bei DelRey, New York. Dieser Roman ist bereits unter dem Titel Die Zaubermacht der Dame im Knaur-Verlag und unter dem Titel Der Zauber der Schlange im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Er wurde komplett überarbeitet.
Copyright der Originalausgabe © 1982 by David Eddings
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung und -illustration: Melanie Korte, Inkcraft
Karten: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22656-5 V002 www.blanvalet.de
Für Helen, die mir das Kostbarste im Leben schenkte, und für Mike, der mich gelehrt hat, wie man spielt.
PROLOG
Ein Bericht über die Invasion Kal Toraks und die darauf folgende Schlacht mit den Königreichen des Westens
– nach: Die Schlacht von Vo Mimbre
Als die Welt noch jung war, raubte der böse Gott Torak das Auge Aldurs und floh damit, denn er trachtete nach Herrschaft. Das Auge widerstand ihm, und sein Feuer entstellte ihn mit schrecklichen Verbrennungen. Dennoch vermochte der Gott es nicht aufzugeben, denn es schien ihm unendlich kostbar.
Gemeinsam mit Belgarath, dem Zauberer und Schüler des Gottes Aldur, holten der König der Alorner und seine drei Söhne das Auge aus dem eisernen Turm Toraks zurück. Torak setzte ihnen nach, doch der Zorn des Auges wehrte ihn ab und trieb ihn zurück.
Belgarath machte Cherek und seine Söhne zu Königen über vier große Reiche, um das Auge bis in alle Ewigkeit vor Torak zu schützen. Das Auge selbst übergab er Riva Eisenfaust, damit er es bewahre. Solange es in den Händen eines Nachkommen Rivas wäre, erklärte Belgarath, sei der Westen sicher.
Jahrhundert um Jahrhundert verging, ohne dass Torak noch einmal zu einer Gefahr geworden wäre – doch dann kam das Frühjahr 4865, als Drasnien von einer riesigen Schar Nadraker, Thulls und Murgos überfallen wurde. Inmitten dieses Meers von Angarakanern wurde das große eiserne Wappenzelt dessen getragen, den man Kal Torak nannte: König und Gott. Städte und Dörfer wurden in Brand gesteckt und dem Erdboden gleichgemacht, denn Kal Torak kam, um zu zerstören, nicht um zu erobern. Diejenigen, die überlebten, wurden den Grolim-Priestern mit ihren stählernen Masken übergeben und in den unaussprechlichen Ritualen der Angarakaner geopfert. Nur diejenigen kamen mit dem Leben davon, die nach Algarien flohen oder an der Mündung des Aldur von cherekischen Kriegsschiffen aufgenommen wurden.
Dann wandte sich das Heer nach Süden, um über Algarien herzufallen. Aber dort fanden sie keine Städte. Die nomadisierenden algarischen Reiter zogen sich vor ihnen zurück, um dann in machtvollen Vorstößen anzugreifen. Von altersher war der Sitz der algarischen Könige die Feste, ein von Menschen geschaffener Berg mit zehn Meter dicken Mauern. Vergebens rannten die Angarakaner dagegen an, ehe sie sich niederließen, um die Feste zu belagern. Acht Jahre dauerte diese aussichtslose Belagerung.
Dies gab dem Westen Zeit, mobilzumachen und Vorbereitungen zu treffen. Die Generäle versammelten sich in der Kaiserlichen Militärakademie zu Tol Honeth und planten ihre Strategie. Nationale Meinungsverschiedenheiten wurden zurückgestellt, und Brand, der Hüter von Riva, wurde zum Oberbefehlshaber gewählt. Mit ihm kamen zwei fremdartige Ratgeber: ein alter, aber kräftiger Mann, der behauptete, Kenntnis zu haben über die Reiche der Angarakaner, und eine auffallend schöne Frau mit einer silberweißen Locke an der Schläfe und königlichem Auftreten. Auf diese beiden hörte Brand, ihnen zollte er ehrerbietigen Respekt.
Im späten Frühjahr 4875 brach Kal Torak die Belagerung ab und wandte sich nach Westen, dem Meer zu, immer noch verfolgt von den algarischen Reiterscharen. In den Bergen kamen die Ulgoner des Nachts aus ihren Höhlen und richteten ein schreckliches Blutbad unter den schlafenden Angarakanern an. Aber noch immer waren Kal Toraks Heerscharen unermesslich groß. Um sich neu zu formieren, stieg der Feind ins Tal des Aldurflusses hinab auf Vo Mimbre zu und zerstörte alles, was auf seinem Weg lag. Zu Beginn des Sommers formierten sich die Angarakaner zum Überfall auf die Stadt.
Am dritten Tag der Schlacht erklang dreimal ein Horn. Dann öffneten sich die Tore der Stadt, und die Ritter Vo Mimbres stürmten hinaus, um die Front des Angarak-Heers anzugreifen, und die eisenbeschlagenen Hufe ihrer Pferde zertrampelten die Lebenden wie die Toten. Von links kam die algarische Reiterei, drasnische Pikeniere und verschleierte Freischärler aus Ulgo, von rechts kamen die kriegerischen Chereker und die tolnedranischen Legionen.
Als er nun von drei Seiten angegriffen wurde, setzte Kal Torak seine Reserven ein. Aber da attackierten die graugekleideten Rivaner, die Sendarer und die asturischen Bogenschützen sein Heer im Rücken. Die Angarakaner wurden niedergemäht und von Verwirrung heimgesucht.
Dann eilte der Abtrünnige, Zedar der Zauberer, zu dem schwarzen eisernen Zelt, das Kal Torak bislang noch nicht verlassen hatte. Und zu dem Verfluchten sagte er: »Herr, Eure Feinde haben Euch in großer Zahl umringt. Ja, selbst die grauen Rivaner sind zahlreich erschienen, um Eurer Macht zu trotzen.«
Kal Torak erhob sich zornig und erklärte: »Ich werde mich zeigen, auf dass die falschen Hüter von Cthrag Yaska, des Edelsteins, der mein sein sollte, mich sehen und mich fürchten lernen. Schick mir meine Könige.«
»Großer Herr«, sagte Zedar, »Eure Könige sind nicht mehr. Die Schlacht hat nicht nur ihr Leben gefordert, sondern auch das vieler Grolim.«
Bei diesen Worten wuchs Kal Toraks Zorn, wütende Blitze schossen aus seinem rechten Auge und dem anderen, das nicht mehr war. Er befahl seinen Dienern, ihm den Schild an seinen handlosen Arm zu binden, und nahm sein schreckliches schwarzes Schwert. Dann ging er, um zu kämpfen.
Darauf erklang eine Stimme aus den Reihen der Rivaner: »Im Namen Belars trete ich dir entgegen, Torak. Im Namen Aldurs schleudere ich dir meine Verachtung entgegen. Beende das Blutvergießen, und ich werde mit dir kämpfen, um die Schlacht zu entscheiden. Ich bin Brand, der Hüter von Riva. Kämpfe mit mir oder führe deine stinkende Horde fort und erhebe dich nie wieder gegen die Königreiche des Westens.«
Da trat Kal Torak vor und rief: »Welcher Sterbliche wagt es, sich gegen den König der Welt zu stellen? Wo ist er? Denn ich bin Torak, König der Könige und Gott der Götter. Ich werde diesen großmäuligen Rivaner vernichten. Meine Feinde werden untergehen, und Cthrag Yaska wird wieder mir gehören.«
Brand trat vor. Er trug ein mächtiges Schwert und einen Schild, der mit einem Tuch verhüllt war. Ein grauer Wolf lief an seiner Seite, und eine schneeweiße Eule schwebte über ihm. Brand sagte: »Ich bin Brand, und ich werde mit dir kämpfen, elender, missgestalteter Torak.«
Als Torak den Wolf erblickte, sagte er: »Fort mit dir, Belgarath. Flieh, wenn dir dein Leben lieb ist.« Und zu der Eule sagte er: »Schwöre deinem Vater ab, Polgara, und verehre mich. Ich will dich zu meinem Weib machen und zur Königin der Welt.«
Aber der Wolf heulte verächtlich, und die Eule kreischte spöttisch.
Torak hob sein Schwert und hieb auf Brands Schild ein. Lange kämpften sie, und zahlreich und heftig waren die Schläge, die sie austeilten. Diejenigen, die nahe genug standen, um alles beobachten zu können, staunten. Der Zorn Toraks wuchs, und sein Schwert fuhr auf Brands Schild nieder, bis der Rivanische Hüter vor dem wütenden Ansturm des Verfluchten zurückwich. Dann heulte der Wolf, und die Eule schrie zugleich, worauf Brands Kräfte sich erneuerten.
Mit einer einzigen Bewegung enthüllte der Rivanische Hüter seinen Schild, in dessen Mitte sich ein runder Edelstein befand, der so groß war wie das Herz eines Kindes. Als Torak ihn erblickte, begann der Stein zu glühen und zu lodern. Der Verfluchte schrak zurück. Er ließ Schwert und Schild fallen und hob die Arme vors Gesicht, um dem schrecklichen Feuer des Steins zu entgehen.
Da schlug Brand zu, und sein Schwert durchbohrte Toraks Visier und drang in das Auge, das nicht mehr war, und in den Kopf des Verfluchten. Torak fuhr zurück und stieß einen lauten Schrei aus. Er zog das Schwert heraus und warf seinen Helm ab. Diejenigen, die zusahen, wichen entsetzt zurück, denn sein Gesicht war von Feuer verzehrt und grauenhaft anzusehen. Torak weinte Blut und schrie nochmals auf, als er des Edelsteins ansichtig wurde, den er Cthrag Yaska nannte, und um dessentwillen er Krieg über den Westen gebracht hatte. Dann brach er zusammen, und die Erde erbebte bei seinem Sturz.
Ein einziger großer Schrei entrang sich dem Heer der Angarakaner, als sie sahen, was Kal Torak widerfahren war, und voller Panik wollten sie fliehen. Aber die Armeen des Westens verfolgten sie und erschlugen sie, und im Morgengrauen des vierten Tages war das feindliche Heer vernichtet.
Brand befahl, dass der Leichnam des Verfluchten zu ihm gebracht würde, damit er über den wachen konnte, der König der ganzen Welt hatte sein wollen. Aber der Leichnam war verschwunden. In der Nacht hatte Zedar der Zauberer einen Spruch gewirkt und war unbemerkt durch die Reihen des Westens gelangt. Dann hatte er jenen fortgebracht, den er sich zum Herrn erwählt hatte.
Später beriet Brand sich mit seinen Ratgebern. Und Belgarath sagte: »Torak ist nicht tot. Er schläft nur. Denn er ist ein Gott und kann nicht von Menschenhand erschlagen werden.«
»Wann wird er wieder erwachen?«, fragte Brand. »Ich muss den Westen auf seine Rückkehr vorbereiten.«
Polgara antwortete: »Wenn dereinst wieder ein König aus Rivas Geschlecht auf seinem Thron im Norden sitzt, dann wird der Dunkle Gott erwachen und gegen ihn in den Krieg ziehen.«
Brand runzelte die Stirn und sagte: »Aber das bedeutet niemals!« Denn jedermann wusste, dass der letzte Rivanische König zusammen mit seiner Familie im Jahre 4002 von den Nyissanern erschlagen worden war.
Doch die Frau erwiderte: »Wenn die Zeit gekommen ist, wird der Rivanische König aufstehen und sein Recht fordern, wie es die alte Prophezeiung voraussagt. Mehr kann jetzt nicht gesagt werden.«
Brand war zufrieden und befahl seinen Armeen, das Schlachtfeld von den Überresten der Angarakaner zu säubern. Als dies geschehen war, sammelten sich die Könige des Westens vor der Stadt Vo Mimbre und hielten Rat. Viele Stimmen erhoben sich zum Lobe Brands.
Schon bald begannen einige zu fordern, dass Brand zum Herrscher des ganzen Westens ausgerufen werden sollte. Einzig Mergon, der Botschafter des Kaiserreiches Tolnedra, protestierte im Namen seines Kaisers, Ran Borune IV. Brand schlug diese Ehre aus, und der Vorschlag wurde fallengelassen, so dass wieder Frieden herrschte unter denjenigen, die im Rat versammelt waren. Aber als Gegenleistung für den Frieden wurde eine Forderung an Tolnedra gestellt.
Zuerst sprach der Gorim der Ulgoner mit lauter Stimme: »In Erfüllung der Prophezeiung muss eine tolnedranische Prinzessin dem Rivanischen König, der kommen wird, um die Welt zu retten, als Gattin versprochen werden. Das fordern die Götter von uns.«
Wieder protestierte Mergon. »Die Halle des Rivanischen Königs ist leer und verlassen. Kein König sitzt auf dem Thron von Riva. Wie kann eine Prinzessin des Kaiserreichs von Tolnedra ein Phantom heiraten?«
Da erwiderte die Frau, die Polgara hieß: »Der Rivanische König wird zurückkehren und seinen Thron besteigen und seine Braut fordern. Deshalb soll vom heutigen Tage an jede Prinzessin von Tolnedra an ihrem sechzehnten Geburtstag in der Halle des Rivanischen Königs erscheinen. Sie soll ihr Hochzeitskleid tragen und dort drei Tage auf die Ankunft des Königs warten. Wenn er nicht kommt, sie zu fordern, ist sie frei, um zu ihrem Vater zurückzukehren, was er auch für sie entscheiden mag.«
Mergon rief aus: »Ganz Tolnedra wird sich gegen diese Demütigung erheben. Nein! Das darf nicht sein!«
Wieder sprach der weise Gorim der Ulgos. »Erkläre deinem Kaiser, dass es der Wille der Götter ist. Sag ihm auch, an dem Tag, an dem Tolnedra die Forderung nicht erfüllt, wird sich der Westen gegen ihn erheben und die Söhne Nedras in alle Winde zerstreuen und das Reich niederreißen, so dass nichts mehr existiert vom Kaiserreich Tolnedra.«
Und daraufhin, als er die Macht der Armeen vor sich sah, gab der Botschafter nach. Dann stimmten alle zu und waren von nun an daran gebunden.
Als dies geschehen war, kamen die Edlen des kriegsgebeutelten Arendien zu Brand und sagten: »Der König von Vo Mimbre ist tot und auch der Herzog der Asturier. Wer soll uns jetzt regieren? Seit zweitausend Jahren hat der Krieg zwischen Mimbre und Asturien Arendien gespalten. Wie können wir wieder ein Volk werden?«
Brand dachte nach. »Wer ist der Erbe des Mimbrer-Throns?«
»Korodullin ist Kronprinz von Mimbre«, antworteten die Edlen.
»Und wer ist Nachfolger in der asturischen Linie?«
»Mayaserana ist die Tochter des Herzogs von Asturien«, sagten sie ihm.
Brand sagte: »Führt sie zu mir.« Und als sie vor ihm standen, sagte Brand: »Das Blutvergießen zwischen Mimbre und Asturien muss ein Ende haben. Deshalb ist es mein Wille, dass ihr einander heiratet und die beiden Häuser, die so lange gegeneinander Krieg geführt haben, auf diese Weise miteinander verbindet.«
Die beiden sträubten sich gegen das Urteil, denn sie waren voll überlieferter Feindschaft und Stolz auf ihre eigene Abstammung. Aber Belgarath nahm Korodullin beiseite und sprach vertraulich mit ihm. Und Polgara ging mit Mayaserana außer Hörweite und unterhielt sich lange mit ihr. Niemand erfuhr damals oder später, was man den beiden jungen Leuten gesagt hatte. Aber als sie zu Brand, der auf sie wartete, zurückkehrten, waren Mayaserana und Korodullin einverstanden, einander zu heiraten. Das war das Ende der Ratsversammlung, die nach der Schlacht von Vo Mimbre abgehalten wurde.
Bevor Brand wieder nach Norden aufbrach, sprach er zum letzten Mal zu allen Königen und Edlen.
»Vieles ist hier bewirkt worden, das gut ist und von Dauer. Seht, wir haben zusammen gegen die Angarakaner gekämpft, und wir haben sie geschlagen. Torak ist überwunden. Und der Bund, den wir geschlossen haben, bereitet den Westen auf den Tag der Prophezeiung vor, wenn der Rivanische König zurückkehrt und Torak aus seinem langen Schlaf erwacht und wieder nach Macht und Herrschaft strebt. Alles, was an diesem Tag getan werden konnte, um den großen und letzten Krieg vorzubereiten, ist vollbracht. Mehr können wir nicht tun. Hier konnten außerdem noch die Wunden Arendiens geheilt werden, der Streit von mehr als zweitausend Jahren sieht seinem Ende entgegen. So weit bin ich mit alldem zufrieden. So lebt denn wohl!«
Er wandte sich ab und ritt mit dem grauhaarigen Mann an seiner Seite, der Belgarath war, und der königlichen Frau, die Polgara war, nach Norden. In Camaar in Sendarien bestiegen sie ein Schiff und segelten nach Riva. Und Brand kehrte nicht wieder in die Königreiche des Westens zurück.
Aber über seine Gefährten werden viele Sagen erzählt. Und was von diesen Geschichten wahr ist und was erfunden, vermögen nur Wenige zu sagen.
TEIL EINSARENDIEN
Kapitel 1
Vo Wacune existierte nicht mehr. Zweitausendvierhundert Jahre waren vergangen, seit die Stadt der Wacite-Arendier verwüstet worden war und die dunklen, endlosen Wälder Nordarendiens die Ruinen zurückerobert hatten. Die eingestürzten Mauern waren überwuchert von Moos und dem feuchtbraunen Farnkraut des Waldbodens, und nur die Trümmer der einst stolzen Türme ragten noch zwischen Bäumen und Nebelschleiern hervor und markierten die Stelle, an der sich Vo Wacune einst befunden hatte. Nasser Schnee lag auf den nebelverhangenen Ruinen, und Wassertropfen rannen an den uralten Steinen hinab wie Tränen.
Garion wanderte allein durch die von Bäumen überwucherten Straßen der toten Stadt. Er hatte sich in einen dicken grauen Wollumhang eingehüllt, um sich gegen die Kälte zu schützen. Seine Gedanken waren so trübselig wie die weinenden Steine, die ihn umgaben. Faldors Farm mit ihren grünen, sonnengetränkten Feldern lag so weit hinter ihm, dass sie sich im zurückweichenden Dunst zu verlieren schien. Er hatte heftiges Heimweh. Sosehr er sich auch bemühte, sie festzuhalten, die Einzelheiten entglitten ihm. Die reichen Düfte aus Tante Pols Küche waren nicht mehr als eine schwache Erinnerung. Der Klang von Durniks Hammer in der Schmiede verhallte wie das ersterbende Echo eines letzten Glockenschlages; und die klaren, scharfgeschnittenen Gesichter seiner Spielgefährten verschwammen in seiner Erinnerung, bis er nicht mehr sicher war, ob er sie überhaupt noch wiedererkennen würde. Seine Kindheit entschwand, und sosehr er sich auch bemühte, er konnte sie nicht aufhalten. Alles veränderte sich, das war das Problem. Der Kern seines Lebens, der Fels, auf den seine Kindheit aufgebaut war, war immer Tante Pol gewesen. In der einfachen Welt auf Faldors Farm war sie Herrin Pol gewesen, die Köchin, aber in der anderen Welt, außerhalb von Faldors Farm, war sie Polgara die Zauberin, die vier Jahrtausende hatte vorbeiziehen sehen und mit einer Aufgabe betraut war, die jenseits menschlichen Verstehens lag.
Und Meister Wolf, der alte, herumziehende Geschichtenerzähler, hatte sich gleichfalls verändert. Garion wusste jetzt, dass sein alter Freund in Wirklichkeit sein Ururgroßvater war – mit einer ungewissen Anzahl weiterer ›Urs‹ –, und sich hinter dem verschmitzten alten Gesicht stets der durchdringende Blick Belgaraths des Zauberers befunden hatte, der wartete und die Torheiten von Menschen und Göttern seit siebentausend Jahren beobachtete. Garion seufzte und stapfte weiter durch den Schnee.
Selbst ihre Namen waren beunruhigend. Garion hatte nie an Magie oder Hexerei glauben wollen. Solche Dinge waren unnatürlich, und sie brachten seine Vorstellung von einer stabilen, vernünftigen Wirklichkeit ins Wanken. Aber zu viele Dinge waren geschehen, die ihm nicht länger gestatteten, seine tröstliche Skepsis beizubehalten. In einem einzigen erschütternden Moment waren seine letzten Zweifel beiseitegefegt worden. In staunendem Unglauben hatte er beobachtet, wie Tante Pol den milchigen Schleier von den Augen Martjes der Hexe genommen hatte. Mit einer brutal gleichgültigen Geste und einem einzigen Wort hatte sie der Verrückten das Augenlicht wiedergeschenkt und ihr dafür die Macht genommen, in die Zukunft zu sehen. Garion schauderte bei dem Gedanken an Martjes verzweifeltes Wehgeschrei. Dieser Schrei hatte gewissermaßen den Punkt markiert, ab dem seine Welt weniger stabil, weniger vernünftig und schließlich weniger sicher geworden war.
Er befand sich fern von dem Ort, an dem er aufgewachsen war, er war unsicher, wer diese beiden Personen eigentlich waren, die ihm immer am nächsten gestanden hatten. Und er rang mit der Erkenntnis, dass die einstige Ordnung seiner Welt, die Unterteilung in Mögliches und Unmögliches, mittlerweile null und nichtig war. Stattdessen fand sich Garion nun auf einer seltsamen Pilgerfahrt wieder, deren Ziel er nicht begriff. Er hatte keine Ahnung, was sie in dieser zerstörten Stadt, die von den Bäumen verschlungen wurde, überhaupt taten, und er hatte nicht die leiseste Idee, wohin sie von hier aus gehen würden. Die einzige Gewissheit, die ihm blieb, war der grimmige Gedanke, an den er sich jetzt klammerte – irgendwo auf der Welt gab es einen Mann, der einst durch die frühmorgendliche Dunkelheit zu einem kleinen Haus in einem verlassenen Dorf geschlichen war und Garions Eltern ermordet hatte. Und selbst wenn es sein ganzes Leben dauern sollte, Garion würde diesen Mann finden, und wenn er ihn gefunden hatte, würde er ihn töten. In dieser Tatsache lag etwas seltsam Tröstliches.
Er kletterte vorsichtig über die Trümmer eines Hauses, das auf die Straße gestürzt war, und setzte seine schwermütige Erkundung der Ruinenstadt fort. Es gab eigentlich nichts zu sehen. Die geduldigen Jahrhunderte hatten nahezu alles ausgelöscht, was der Krieg hinterlassen hatte, und der feuchte Schnee und der dichte Nebel verbargen selbst jene letzten Überreste. Garion seufzte wieder und begann, seine Spur zurückzuverfolgen bis zu dem verfallenen Turmstumpf, wo sie die letzte Nacht verbracht hatten.
Als er näher kam, sah er, dass Meister Wolf und Tante Pol in einiger Entfernung von der Turmruine beisammenstanden und sich leise unterhielten. Der alte Mann hatte seine rostbraune Kapuze hochgezogen, Tante Pol hatte sich fest in ihren blauen Umhang gewickelt. Ein Ausdruck zeitlosen Bedauerns lag auf ihrem Gesicht, als sie auf die nebligen Ruinen blickte. Ihr langes dunkles Haar floss ihr über den Rücken, und die einzelne weiße Locke an ihrer Stirn schien heller zu sein als der Schnee zu ihren Füßen.
»Da ist er ja«, sagte Meister Wolf zu ihr, als Garion sich näherte. Sie nickte und sah Garion ernst an. »Wo warst du?«, fragte sie.
»Nirgends«, antwortete Garion. »Ich habe nur nachgedacht, das ist alles.«
»Du hast es jedenfalls fertiggebracht, dir nasse Füße zu holen, wie ich sehe.«
Garion hob einen seiner durchnässten braunen Stiefel und sah auf den schmutzigen Schneematsch, der daran klebte. »Der Schnee ist nasser, als ich dachte«, entschuldigte er sich.
»Fühlst du dich wirklich wohler, wenn du das Ding da trägst?«, fragte Meister Wolf und deutete auf das Schwert, das Garion jetzt immer trug.
»Alle sagen, in Arendien sei es gefährlich«, erklärte Garion. »Außerdem muss ich mich daran gewöhnen.« Er schob den knirschenden neuen Ledergürtel weiter nach hinten, bis das drahtumwickelte Heft nicht mehr so deutlich zu sehen war. Das Schwert war ein Geschenk zu Erastide von Barak gewesen, eines der Geschenke, die er bekommen hatte, als sie während des Feiertages auf See waren. »Es passt nicht recht zu dir, weißt du«, sagte der alte Mann missbilligend.
»Lass ihn in Ruhe, Vater«, sagte Tante Pol fast geistesabwesend. »Es ist schließlich seins, und er kann es tragen, wenn er will.«
»Sollte Hettar nicht inzwischen hier sein?«, fragte Garion, der das Thema wechseln wollte.
»Vielleicht ist er in den Bergen von Sendarien in tiefen Schnee geraten«, antwortete Wolf. »Er wird schon kommen. Hettar ist sehr verlässlich.«
»Ich verstehe nicht ganz, warum wir nicht einfach in Camaar Pferde gekauft haben.«
»Sie wären nicht so gut gewesen«, erwiderte Wolf und kratzte seinen kurzen weißen Bart. »Wir haben einen langen Weg vor uns, und ich möchte mir keine Sorgen darüber machen müssen, dass ein Pferd unterwegs zu lahmen anfängt. Es ist wesentlich besser, sich jetzt etwas Zeit zu nehmen, als später noch mehr Zeit zu verlieren.«
Garion rieb sich den Nacken, wo die Kette des seltsam geprägten Silberamuletts, das Wolf und Tante Pol ihm an Erastide geschenkt hatten, seinen Hals wundscheuerte.
»Mach dir keine Gedanken deswegen, mein Lieber«, sagte Tante Pol.
»Ich wünschte, ich dürfte es auf der Kleidung tragen«, beschwerte er sich. »Niemand kann es unter meiner Tunika sehen.«
»Es muss direkt auf der Haut getragen werden.«
»Es ist unbequem. Es ist schon hübsch, finde ich, aber manchmal scheint es kalt zu sein und manchmal warm, und ab und zu ist es schrecklich schwer. Die Kette scheuert immer an meinem Nacken. Ich glaube, ich bin an Schmuck nicht gewöhnt.«
»Es ist nicht einfach nur ein Schmuckstück, mein Junge«, sagte sie. »Mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen.«
Wolf lachte. »Vielleicht macht es dir die Sache leichter, wenn du weißt, dass deine Tante Pol zehn Jahre gebraucht hat, um sich an ihres zu gewöhnen. Ich musste sie ständig daran erinnern, es wieder anzulegen.«
»Ich weiß nicht, warum wir ausgerechnet jetzt darüber sprechen müssen, Vater«, sagte Tante Pol kühl.
»Hast du auch eins?«, fragte Garion den alten Mann, plötzlich neugierig geworden.
»Natürlich.«
»Heißt das, wir tragen alle eins?«
»Es ist ein Familienbrauch, Garion«, erklärte Tante Pol in einem Ton, der die Diskussion beendete. Der Nebel wogte um sie, und ein kalter, feuchter Wind heulte durch die Ruinen.
Garion seufzte. »Ich wünschte, Hettar käme. Ich möchte weg von hier. Hier ist es wie auf einem Friedhof.«
»Es war nicht immer so«, sagte Tante Pol leise.
»Wie war es denn?«
»Ich war glücklich hier. Die Mauern waren hoch, und die Türme ragten in den Himmel. Wir dachten alle, es würde für immer so bleiben.« Sie deutete auf ein paar winterbraune Brombeerranken, die über die geborstenen Steine krochen. »Dort drüben war ein Blumengarten, in dem Frauen in hellen Kleidern saßen und den jungen Männern lauschten, die ihnen von außerhalb der Gartenmauern vorsangen. Die Stimmen der jungen Männer waren lieblich, und die Damen seufzten und warfen ihnen rote Rosen über die Mauern zu. Und diese Straße hinunter lag ein marmorgepflasterter Platz, an dem die alten Männer sich trafen, um über vergessene Kriege und dahingegangene Gefährten zu reden. Dahinter lag ein Haus mit einer Terrasse, wo ich abends mit Freunden saß und die Sterne beobachtete, während ein Knabe uns gekühlte Früchte brachte und die Nachtigallen sangen, als wollte ihnen das Herz zerspringen.«
Ihre Stimme verlor sich. »Aber dann kamen die Asturier«, fuhr sie in verändertem Tonfall fort. »Du wärst erstaunt, wie wenig Zeit man braucht, um etwas einzureißen, das in tausend Jahren erbaut worden ist.«
»Denk nicht daran, Pol«, sagte Wolf. »Diese Dinge geschehen von Zeit zu Zeit. Wir können nicht viel dagegen tun.«
»Ich hätte etwas tun können, Vater«, antwortete sie und blickte auf die Ruinen. »Aber du wolltest es nicht zulassen, erinnerst du dich?«
»Müssen wir das wieder durchgehen, Pol?«, fragte Wolf gequält. »Du musst lernen, deine Verluste zu akzeptieren. Die Wacite-Arendier waren ohnehin dem Untergang geweiht. Im günstigsten Fall hättest du nur das Unvermeidliche um ein paar Monate hinausgezögert. Wir sind nicht, wer wir sind und was wir sind, um uns in Sachen verstricken zu lassen, die keinerlei Bedeutung haben.«
»Das hast du früher schon gesagt.« Sie blickte zu den Bäumen hinüber, die sich verschwommen im Nebel entlang der Straßen hinzogen. »Ich hatte nicht geglaubt, dass die Bäume so schnell zurückkommen«, sagte sie mit seltsam belegter Stimme. »Ich hatte gedacht, sie würden länger warten.«
»Es ist fast zweitausendfünfhundert Jahre her, Pol.«
»Wirklich? Es kommt mir vor wie letztes Jahr.«
»Grüble nicht weiter darüber. Dann wirst du nur melancholisch. Warum gehen wir nicht hinein? Der Nebel macht uns allmählich alle schwermütig.«
Unerwartet legte Tante Pol ihren Arm um Garions Schulter, als sie sich dem Turm zuwandten. Ihr Duft und das Gefühl ihrer Nähe schnürten ihm die Kehle zu. Die Distanz, die in den letzten paar Monaten zwischen ihnen entstanden war, schien sich bei ihrer Berührung aufzulösen.
Die Kammer im Untergeschoss des Turms war aus so dicken Steinen erbaut worden, dass weder der Lauf der Jahrhunderte noch die schweigenden, tastenden Ranken der Baumwurzeln in der Lage gewesen waren, sie zu zerstören. Große, flache Bögen trugen die niedrige Steindecke und ließen den Raum fast wie eine Höhle wirken. Am Ende des Raumes, gegenüber der schmalen Tür, bildete ein breiter Riss zwischen zwei rohbehauenen Steinblöcken einen natürlichen Kamin. Am Abend ihrer Ankunft hatte Durnik finster den Riss betrachtet, denn ihnen war kalt, und sie waren durchnässt gewesen, dann hatte er rasch aus Trümmern einen rohen, aber funktionsfähigen Kamin gebaut. »Das wird es tun«, hatte der Schmied gesagt. »Vielleicht nicht sehr elegant, aber gut genug für ein paar Tage.«
Als Wolf, Garion und Tante Pol den niedrigen, höhlenartigen Raum betraten, knisterte ein schönes Feuer im Kamin, das undeutliche Schatten zwischen den Gewölben warf und eine willkommene Wärme ausstrahlte. Durnik, in seiner braunen Ledertunika, stapelte Feuerholz an einer Wand auf. Barak, riesig, rotbärtig und mit Kettenhemd angetan, polierte sein Schwert. Silk, in ungebleichtem Leinenhemd und schwarzer Lederweste, saß müßig auf einem ihrer Gepäckballen und spielte mit ein paar Würfeln.
»Schon irgendein Zeichen von Hettar?«, fragte Barak aufblickend.
»Es ist noch einen Tag zu früh«, antwortete Meister Wolf und ging zum Kamin, um sich zu wärmen.
»Warum ziehst du nicht andere Stiefel an, Garion?«, schlug Tante Pol vor und hängte ihren blauen Umhang an einen der Haken, die Durnik in die Wand geschlagen hatte.
Garion hob sein Bündel von einem der Haken und durchwühlte es.
»Auch andere Strümpfe«, setzte sie hinzu.
»Hebt sich der Nebel eigentlich etwas?«, fragte Silk Meister Wolf.
»Kein bisschen.«
»Wenn ich euch überreden kann, vom Feuer wegzukommen, kümmere ich mich ums Abendessen«, sagte Tante Pol plötzlich sehr geschäftig. Sie fing an, einen Schinken, einige Laibe eines dunklen Bauernbrotes, einen Sack getrockneter Erbsen und einige ledrige Karotten auszupacken, und summte leise vor sich hin, wie sie es immer tat, wenn sie kochte.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück zog Garion eine wollgefütterte Überweste an, gürtete sein Schwert um und ging wieder hinaus in die nebelverhangenen Ruinen, um nach Hettar Ausschau zu halten. Es war eine Aufgabe, die er sich selbst auferlegt hatte, und er war dankbar, dass keiner seiner Freunde ihm sagte, dies sei eigentlich unnötig. Während er durch die mit Schneematsch bedeckten Straßen stapfte und auf das Westtor der Stadt zuhielt, bemühte er sich ganz bewusst darum, die melancholischen Grübeleien zu vermeiden, die den vergangenen Tag verdüstert hatten. Da er die Umstände absolut nicht ändern konnte, würde sich nur ein schaler Geschmack im Mund breitmachen, wenn er weiter darauf herumkaute. Er war nicht gerade fröhlich, als er das niedrige Mauerstück am Westtor erreichte, aber auch nicht schwermütig.
Die Mauer bot etwas Schutz, aber die feuchte Kälte kroch immer noch durch die Straßen, und seine Füße waren bereits kalt. Er schauderte und setzte sich, um zu warten. Es hatte keinen Zweck, bei dem Nebel versuchen zu wollen, weit zu sehen, also konzentrierte er sich darauf zu lauschen. Seine Ohren begannen, die Geräusche im Wald jenseits der Mauer auseinanderzuhalten, das Tröpfeln des Wassers von den Bäumen und hin und wieder das feuchte Plumpsen, wenn Schnee von den Ästen glitt, das Picken eines Spechts an einem toten Baumstumpf in einigen hundert Metern Entfernung.
»Das ist meine Kuh«, sagte plötzlich eine Stimme aus dem Nebel.
Garion erstarrte und lauschte schweigend.
»Dann halte sie auch auf deiner eigenen Weide«, entgegnete eine andere Stimme.
»Bist du das, Lammer?«, fragte die erste Stimme.
»Richtig. Du bist Detton, nicht wahr?«
»Ich habe dich nicht erkannt. Wie lang ist es her?«
»Vier oder fünf Jahre, glaube ich«, schätzte Lammer.
»Wie stehen die Dinge in deinem Dorf?«, fragte Detton.
»Wir hungern. Die Steuern verschlingen alles.«
»Wir auch. Wir haben schon gekochte Baumwurzeln gegessen.«
»Das haben wir noch nicht versucht. Wir essen unsere Schuhe.«
»Wie geht es deiner Frau?«, fragte Detton höflich.
»Sie ist letztes Jahr gestorben«, antwortete Lammer mit flacher, unbeteiligter Stimme. »Unser Herr hat unseren Sohn als Soldat eingezogen, und er ist irgendwo in einer Schlacht umgekommen. Sie haben kochendes Pech auf ihn gegossen. Danach hat sie aufgehört zu essen. Sie hat nicht lange gebraucht, um zu sterben.«
»Das tut mir leid«, sagte Detton mitfühlend. »Sie war sehr schön.«
»Sie sind jetzt beide besser dran«, erklärte Lammer. »Sie frieren und hungern nicht mehr. Was für Baumwurzeln habt ihr gegessen?«
»Birke ist am besten«, sagte Detton. »Fichte ist zu harzig und Eiche zu hart. Du musst etwas Gras zusammen mit den Wurzeln kochen, damit sie ein bisschen Geschmack bekommen.«
»Das werd ich mal versuchen.«
»Ich muss zurück«, sagte Detton. »Mein Herr hat mir befohlen, Bäume zu fällen, und er lässt mich auspeitschen, wenn ich zu lange fortbleibe.«
»Vielleicht sehen wir uns mal wieder.«
»Wenn wir beide dann noch leben.«
»Wiedersehen, Detton.«
»Wiedersehen, Lammer.«
Die Stimmen entfernten sich. Garion stand noch lange, nachdem sie fort waren, unbeweglich, betäubt vor Entsetzen und mit Tränen des Mitgefühls in den Augen. Am schlimmsten fand er die sachliche Art, in der die beiden alles hinnahmen. Ein schrecklicher Zorn begann in ihm zu brennen. Plötzlich hatte er das Bedürfnis, jemanden zu schlagen.
Dann hörte er ein weiteres Geräusch im Nebel. Irgendwo in der Nähe sang jemand im Wald. Die Stimme war ein heller, klarer Tenor, und Garion konnte sie deutlich hören, als sie näher kam. Das Lied handelte von uraltem Unrecht, und der Refrain war ein Kriegsruf. Unsinnigerweise konzentrierte sich Garions Zorn auf den unbekannten Sänger. Sein geistloses Geschrei über abstrakte Ungerechtigkeiten schien irgendwie obszön angesichts der stillen Verzweiflung von Detton und Lammer. Ohne zu überlegen, zog Garion sein Schwert und kauerte sich hinter die eingestürzte Mauer.
Das Lied erklang noch näher, und Garion konnte die Huftritte eines Pferdes in dem nassen Schnee hören. Vorsichtig streckte er den Kopf über die Mauer und sah, dass der Sänger sich bis auf etwa zwanzig Schritte genähert hatte. Es war ein junger Mann in gelber Hose und leuchtendroter Weste. Sein pelzgefütterter Umhang war zurückgeschlagen. Er trug einen langen, geschwungenen Bogen über der Schulter und ein Schwert in einer Scheide an der Hüfte. Sein rotgoldenes Haar floss ihm weich über den Rücken. Auf dem Kopf trug er eine spitze federgeschmückte Kappe. Obwohl sein Lied düster war und seine Stimme vor Leidenschaft vibrierte, lag in seinem jugendlichen Gesicht eine freundliche Offenheit, die kein noch so finsterer Blick trüben konnte. Garion starrte diesen hohlköpfigen jungen Edelmann an, sicher, dass der singende Narr noch nie eine Mahlzeit aus Baumwurzeln hatte zubereiten oder eine Frau beklagen müssen, die sich aus Kummer zu Tode gehungert hatte. Der Fremde wendete sein Pferd und ritt, noch immer singend, direkt auf den zerfallenen Torbogen zu, neben dem Garion in seinem Versteck hockte.
Garion war eigentlich nicht streitlustig, und unter anderen Umständen wäre er die Situation vielleicht anders angegangen. Der herausgeputzte junge Fremde erschien jedoch genau zum falschen Zeitpunkt. Garions rasch entwickelter Plan besaß den Vorzug der Einfachheit. Da es nichts gab, um ihn zu verkomplizieren, wirkte er bewundernswert – bis zu einem gewissen Punkt. Kaum hatte der singende junge Mann das Tor passiert, als Garion aus seinem Versteck trat, den Umhang des Reiters ergriff und ihn aus dem Sattel zog. Mit einem verblüfften Aufschrei und einem feuchten Platscher landete der Fremde unzeremoniell vor Garions Füßen. Der zweite Teil von Garions Plan ging jedoch völlig schief. Noch als er näher trat, um den gestürzten Reiter mit vorgehaltenem Schwert gefangen zu nehmen, rollte sich der junge Mann herum, kam auf die Füße und zog sein Schwert. All das geschah in einer einzigen fließenden Bewegung. Seine Augen funkelten vor Wut, und er schwang drohend sein Schwert.
Garion war kein Fechter, aber seine Reflexe waren gut, und die Arbeiten, die er auf Faldors Farm erledigt hatte, hatten seine Muskeln gekräftigt. Trotz des Zorns, der ihn dazu getrieben hatte, zuerst anzugreifen, wollte er den jungen Mann nicht wirklich verletzen. Sein Gegner schien sein Schwert locker, geradezu nachlässig zu halten, und Garion glaubte, dass ein kräftiger Hieb auf die Klinge es ihm aus der Hand schlagen würde. Er holte aus, aber die Klinge des Fremden zuckte außer Reichweite seines schweren Schlages und sauste mit stählernem Klang auf sein eigenes Schwert nieder. Garion sprang zurück und holte nochmals ungelenk aus. Wieder trafen die Schwerter aufeinander. Dann war die Luft erfüllt von Krachen, Knirschen und dröhnendem Geklirr, als die beiden mit ihren Klingen aufeinander einschlugen, parierten und täuschten. Garion brauchte nur einen Moment, um zu erkennen, dass sein Gegner wesentlich besser war als er und der junge Mann einige Gelegenheiten, ihn zu treffen, ignoriert hatte. Gegen seinen Willen begann er, in der Aufregung ihres lärmenden Kampfes zu grinsen, und der Fremde erwiderte sein Grinsen offen, sogar freundlich.
»Das reicht jetzt!« Das war Meister Wolf. Der alte Mann kam, von Barak und Silk gefolgt, auf sie zu.
Garions Gegner ließ nach einem überraschten Blick sein Schwert sinken. »Belgarath«, begann er.
»Lelldorin«, sagte Wolf schneidend, »hast du das bisschen Verstand, das du irgendwann einmal hattest, inzwischen völlig verloren?«
Einige Dinge schoben sich gleichzeitig in Garions Gedanken zurecht, als Wolf sich ihm kühl zuwandte. »Nun, Garion, möchtest du es mir erklären?«
Garion entschied, es mit List zu versuchen. »Großvater«, sagte er und betonte das Wort, wobei er dem jungen Fremden einen warnenden Blick zuwarf, »du hast doch nicht geglaubt, wir würden wirklich kämpfen, oder? Lelldorin hat mir nur gezeigt, wie man das Schwert eines Gegners abwehrt, wenn man angegriffen wird, das ist alles.«
»Wirklich?«, fragte Wolf skeptisch.
»Natürlich«, bekräftigte Garion in aller Unschuld. »Welchen Grund könnten wir schon haben, uns gegenseitig verletzen zu wollen?«
Lelldorin öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Garion trat ihm auf den Fuß.
»Lelldorin ist wirklich sehr gut«, redete er hastig weiter und legte freundschaftlich seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes. »Er hat mir in ein paar Minuten sehr viel beigebracht.«
Lass es gut sein, signalisierten Silks Finger ihm in den knappen Gesten der geheimen drasnischen Sprache. Eine Lüge muss immer einfach bleiben.
»Der Bursche ist ein gelehriger Schüler, Belgarath«, sagte Lelldorin, der endlich begriff, lahm.
»Er ist sehr flink, wenn schon nichts anderes«, antwortete Meister Wolf trocken. »Was soll der ganze Plunder?« Er deutete auf Lelldorins bunte Kleider. »Du siehst aus wie ein Maibaum.«
»Die Mimbrer halten seit einiger Zeit ehrliche Asturier auf, um sie zu verhören«, erklärte der junge Arendier, »und ich musste an einigen ihrer Befestigungen vorbei. Ich dachte, wenn ich so angezogen bin wie einer ihrer Gecken, würde man mich nicht belästigen.«
»Vielleicht hast du doch mehr Verstand, als ich dachte«, räumte Wolf widerwillig ein. Er wandte sich an Silk und Barak. »Das ist Lelldorin, Sohn des Barons von Wildantor. Er wird uns begleiten.«
»Darüber wollte ich mit dir sprechen, Belgarath«, warf Lelldorin rasch ein. »Mein Vater hat mir befohlen herzukommen, und ich muss ihm gehorchen, aber ich bin schon verpflichtet, in einer Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit.«
»Jeder junge Adelige in Asturien ist in mindestens zwei oder drei dringenden Angelegenheiten unterwegs«, erwiderte Wolf. »Es tut mir leid, Lelldorin, aber die Sache, in der wir stecken, ist viel zu wichtig. Sie darf nicht hinausgezögert werden, nur weil du ein paar mimbrischen Steuereintreibern auflauern möchtest.«
Tante Pol trat mit Durnik auf sie zu. »Was machen sie mit den Schwertern, Vater?«, fragte sie mit blitzenden Augen.
»Spielen«, antwortete Meister Wolf kurz. »Sagen sie wenigstens. Das ist Lelldorin. Ich glaube, ich habe dir von ihm erzählt.«
Tante Pol musterte Lelldorin mit hochgezogenen Brauen von oben bis unten. »Ein sehr farbenfroher junger Mann.«
»Die Kleider sind Tarnung«, erklärte Wolf. »Er ist nicht so leichtfertig, wie er aussieht – jedenfalls nicht ganz so. Er ist der beste Bogenschütze Asturiens, und wir könnten seine Fähigkeiten brauchen.«
»Ich verstehe«, sagte sie nicht recht überzeugt.
»Es gibt natürlich noch einen Grund«, fuhr Wolf fort, »aber ich glaube, wir sollten das nicht jetzt besprechen, oder?«
»Machst du dir immer noch Gedanken über diese Stelle, Vater?«, fragte sie empört. »Der Mrin-Codex ist sehr unklar, und keine der anderen Versionen sagt überhaupt etwas zu den Personen, die er erwähnt. Es könnte sich um reine Allegorien handeln, wie du weißt.«
»Ich habe einige Allegorien zu viel gesehen, die sich als Tatsachen herausstellten, um in diesem Punkt etwas zu riskieren. Warum gehen wir nicht zurück zum Turm?«, schlug er vor. »Es ist zu nass und zu kalt hier draußen für längere Debatten über Textauslegungen.«
Verblüfft über diesen Wortwechsel sah Garion Silk an, aber der kleine Mann erwiderte den Blick genauso verständnislos.
»Hilfst du mir, mein Pferd einzufangen, Garion?«, fragte Lelldorin höflich und steckte sein Schwert in die Scheide.
»Natürlich«, antwortete Garion und steckte ebenfalls seine Waffe ein. »Ich glaube, es ist in diese Richtung gelaufen.«
Lelldorin hob seinen Bogen auf, und die beiden folgten der Spur des Pferdes, die von den Ruinen wegführte.
»Es tut mir leid, dass ich dich vom Pferd gezogen habe«, entschuldigte sich Garion, als sie außer Sichtweite der anderen waren.
»Macht nichts.« Lelldorin lachte. »Ich hätte besser aufpassen müssen.« Er sah Garion fragend an. »Warum hast du Belgarath belogen?«
»Es war ja nicht wirklich gelogen«, antwortete Garion. »Wir wollten uns nicht wirklich verletzen, und manchmal dauert es Stunden, so etwas zu erklären.«
Lelldorin lachte wieder. Es war ein ansteckendes Lachen. Gegen seinen Willen musste Garion mitlachen.
Lachend gingen sie weiter, eine überwucherte Straße zwischen niedrigen, schneebedeckten Trümmerhaufen entlang.
Kapitel 2
Lelldorin von Wildantor war achtzehn Jahre alt, obwohl seine offene Art ihn jünger wirken ließ. Jede Gefühlsregung zeichnete sich sofort auf seinem Gesicht ab, und Aufrichtigkeit überstrahlte es. Er war impulsiv, ausgefallen in seinen Äußerungen, und vermutlich, wie Garion zögernd feststellte, nicht allzu klug. Trotzdem war es unmöglich, ihn nicht zu mögen.
Am nächsten Morgen, als Garion seinen Umhang holte, um weiter Ausschau nach Hettar zu halten, schloss Lelldorin sich ihm unverzüglich an. Der junge Arendier hatte seine geckenhafte Kleidung abgelegt und trug nun eine braune Hose, eine grüne Tunika und ein dunkelbraunes Wollcape. Er trug seinen Bogen über der Schulter und am Gürtel einen Köcher mit Pfeilen. Als sie durch den Schnee auf die zerfallene Westmauer zugingen, unterhielt er sich damit, auf Ziele zu schießen, die kaum sichtbar waren.
»Du schießt sehr gut«, sagte Garion nach einem besonders gelungenen Schuss bewundernd.
»Ich bin Asturier«, antwortete Lelldorin bescheiden. »Wir sind seit Jahrtausenden Bogenschützen. Mein Vater ließ diesen Bogen am Tag meiner Geburt schneiden. Ich konnte ihn spannen, als ich acht Jahre alt war.«
»Du jagst sicher viel«, meinte Garion, der an die dichten Wälder um sie herum dachte und an die Wildspuren, die er im Schnee entdeckt hatte.
»Es ist der am weitesten verbreitete Zeitvertreib bei uns.« Lelldorin blieb stehen, um den Pfeil, den er gerade abgeschossen hatte, aus einem Baumstumpf zu ziehen. »Mein Vater ist stolz darauf, dass bei uns nie Rind- oder Hammelfleisch auf den Tisch kommt.«
»Ich bin einmal auf der Jagd gewesen, in Cherek.«
»Rotwild?«, fragte Lelldorin.
»Nein. Wildschweine. Wir haben auch nicht Pfeil und Bogen benutzt. Die Chereker jagen mit Speeren.«
»Mit Speeren? Wie kann man denn nahe genug herankommen, um etwas mit einem Speer zu erlegen?«
Garion lachte, als er an seine geschundenen Rippen und an den schmerzenden Kopf dachte. »Das Problem ist nicht, nahe genug heranzukommen. Hinterher aus dem Weg zu kommen, wenn man das Tier durchbohrt, ist der schwierige Teil.«
Lelldorin schien nicht zu verstehen.
»Die Jäger bilden eine Kette«, erklärte Garion, »und sie brechen durch den Wald und machen so viel Lärm, wie sie nur können. Man nimmt seinen Speer und wartet an einer Stelle, wo die Wildschweine vermutlich entlangkommen, wenn sie vor dem Lärm flüchten. Sie bekommen ziemlich schlechte Laune, wenn man sie treibt, und wenn sie einen sehen, greifen sie an. Dann muss man mit dem Speer zustechen.«
»Ist das nicht gefährlich?«, fragte Lelldorin mit großen Augen.
Garion nickte. »Mir wurden fast alle Rippen gebrochen.« Er wollte nicht prahlen, musste sich aber eingestehen, dass Lelldorins Reaktion auf seine Geschichte ihn freute.
»In Asturien haben wir nicht viele wilde Tiere«, sagte Lelldorin fast bedauernd. »Ein paar Bären und ab und zu Wölfe.« Er zögerte und sah Garion scharf an. »Einige Männer finden allerdings interessantere Ziele als wilde Tiere.« Er sagte dies mit einem verschwörerischen Seitenblick.
»Ach?« Garion war nicht sicher, was er meinte.
»Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Mimbrerpferd ohne Reiter nach Hause kommt.«
Garion war entsetzt.
»Manche glauben, dass es zu viele Mimbrer in Asturien gibt«, erklärte Lelldorin mit Nachdruck.
»Ich dachte, der arendische Bürgerkrieg wäre vorüber.«
»Es gibt viele, die da anderer Meinung sind. Die glauben, dass der Krieg andauern wird, bis Asturien frei von der mimbrischen Krone ist.« Lelldorins Tonfall ließ keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er stand.
»Wurde das Land nach der Schlacht von Vo Mimbre nicht vereint?«, wandte Garion ein.
»Vereint? Wer glaubt denn so etwas? Asturien wird behandelt wie eine abhängige Provinz. Der Königshof ist in Vo Mimbre; jeder Gouverneur, jeder Steuereintreiber, jeder Landvogt, jeder Grafschaftsbeamte im Reich ist Mimbrer. Nirgendwo in Arendien gibt es auch nur einen einzigen Asturier in verantwortlicher Position. Die Mimbrer weigern sich sogar, unsere Titel anzuerkennen. Mein Vater, dessen Stammbaum tausend Jahre zurückreicht, wird einfach Grundbesitzer genannt. Ein Mimbrer würde sich eher die Zunge abbeißen, als ihn Baron zu nennen.« Lelldorins Gesicht war weiß vor Empörung.
»Das wusste ich nicht«, sagte Garion vorsichtig. Er konnte die Gefühle des jungen Mannes nicht einschätzen.
»Aber Asturiens Zeit der Unterdrückung ist bald vorüber«, erklärte Lelldorin feurig. »Es gibt noch Männer in Asturien, die wissen, was Patriotismus bedeutet, und der Moment ist nahe, an dem diese Männer zur königlichen Jagd aufrufen werden.« Er unterstrich seine Bemerkung dadurch, dass er einen Pfeil auf einen weit entfernten Baum abschoss.
Das bestätigte Garions schlimmste Befürchtungen. Lelldorin war zu vertraut mit den Einzelheiten, um nicht in diese Sache verwickelt zu sein.
Als ob er gerade festgestellt hätte, dass er zu weit gegangen war, starrte Lelldorin Garion erschrocken an. »Ich bin ein Idiot«, platzte er heraus und sah sich schuldbewusst um. »Ich kann meine Zunge nicht im Zaum halten. Bitte vergiss, was ich gerade gesagt habe, Garion. Ich weiß, dass du mein Freund bist, und ich weiß, du würdest nicht verraten, was ich in einem Augenblick der Erregung gesagt habe.«
Das hatte Garion befürchtet: Damit hatte Lelldorin seine Lippen versiegelt. Er wusste, dass er Meister Wolf vor dem Komplott warnen sollte, aber Lelldorins Bemerkung über Freundschaft und Vertrauen hatte es ihm unmöglich gemacht zu sprechen. Er knirschte unbehaglich mit den Zähnen, als ihm sein moralisches Dilemma voll bewusst wurde.
Sie gingen beide schweigend und etwas aufgewühlt weiter, bis sie das Mauerstück erreichten, wo Garion am Vortag auf der Lauer gelegen hatte. Eine Zeitlang starrten sie hinaus in den Nebel, und das angespannte Schweigen zwischen ihnen wurde mit jedem Moment ungemütlicher.
»Wie ist es in Sendarien?«, fragte Lelldorin plötzlich. »Ich bin noch nie da gewesen.«
»Es gibt nicht so viele Bäume«, antwortete Garion und sah über die Mauer auf die dunklen Stämme, die sich im Nebel abzeichneten. »Es ist ein ordentliches Land.«
»Wo hast du dort gelebt?«
»Auf Faldors Farm. In der Nähe des Erat-Sees.«
»Ist dieser Faldor ein Edelmann?«
»Faldor?« Garion lachte. »Nein, Faldor ist so gewöhnlich wie alte Schuhe. Er ist einfach nur ein Farmer – anständig, ehrlich und gutherzig. Ich vermisse ihn.«
»Ein Bürgerlicher also«, sagte Lelldorin, anscheinend bereit, Faldor als einen Mann abzutun, der nicht zählte.
»Stand bedeutet in Sendarien nicht sehr viel«, sagte Garion ziemlich scharf. »Was ein Mann tut, ist wichtiger als das, was er ist.« Er verzog das Gesicht. »Ich war Abwaschjunge. Nicht sehr spaßig, aber jemand muss es schließlich tun, finde ich.«
»Aber doch kein Leibeigener?« Lelldorin klang schockiert.
»In Sendarien gibt es keine Leibeigenen.«
»Keine Leibeigenen?« Der junge Arendier starrte ihn verständnislos an.
»Nein«, sagte Garion nachdrücklich. »Wir haben es nie für nötig gehalten, Leibeigene zu haben.«
Lelldorins Miene zeigte deutlich, dass er über diese Meinung erstaunt war. Garion erinnerte sich an die Stimmen, die er am Vortag aus dem Nebel gehört hatte, aber er widerstand dem Drang, etwas über Leibeigenschaft zu sagen. Lelldorin würde es nie verstehen, und sie waren gerade dabei, sich anzufreunden. Garion fühlte, dass er gerade jetzt einen Freund brauchte, und er wollte es sich nicht dadurch verderben, dass er etwas sagte, was diesen liebenswerten jungen Mann beleidigen könnte.
»Was macht dein Vater?«, fragte Lelldorin höflich.
»Er ist tot. Meine Mutter auch.« Wenn er es so schnell sagte, tat es weniger weh, fand Garion.
Lelldorin traten in plötzlichem, impulsivem Mitgefühl die Tränen in die Augen. Er legte tröstend seine Hand auf Garions Schulter. »Das tut mir leid«, sagte er mit erstickter Stimme. »Es muss ein schrecklicher Verlust gewesen sein.«
»Ich war noch ein Säugling.« Garion zuckte die Schultern und bemühte sich, gelassen zu klingen.
»Eine Seuche?«, fragte Lelldorin leise.
»Nein«, antwortete Garion in demselben unbeteiligten Tonfall. »Ein Mann schlich des Nachts in ihr Dorf und steckte ihr Haus in Brand. Mein Großvater hat ihn zu fangen versucht, aber er ist entkommen. Soweit ich weiß, ist dieser Mann ein sehr alter Feind meiner Familie.«
»Du lässt es aber doch sicher nicht auf sich beruhen?«, fragte Lelldorin.
»Nein«, erwiderte Garion und starrte hinaus in den Nebel. »Wenn ich alt genug bin, werde ich ihn finden und töten.«
»Tapferer Kerl!«, rief Lelldorin aus und umarmte Garion herzlich. »Wir werden ihn finden und in Stücke reißen.«
»Wir?«
»Ich gehe natürlich mit dir«, erklärte Lelldorin. »Kein wahrer Freund würde weniger tun.« Er sprach offensichtlich aus einem Impuls heraus, aber ebenso offensichtlich war es ihm völlig ernst. Er ergriff fest Garions Hand. »Ich schwöre dir, Garion, ich werde nicht eher ruhen, bis der Mörder deiner Eltern tot zu deinen Füßen liegt.«
Diese Erklärung war so vorhersehbar gewesen, dass sich Garion im Stillen schalt, nicht den Mund gehalten zu haben. Seine Gefühle in dieser Angelegenheit waren sehr persönlich, und er war sich überhaupt nicht sicher, ob er bei der Suche nach dem gesichtslosen Feind Gesellschaft haben wollte. Ein anderer Teil seines Verstandes freute sich jedoch über Lelldorins bedingungslose Unterstützung. Er beschloss, das Thema fallenzulassen. Er kannte Lelldorin nun gut genug, um zu begreifen, dass der junge Mann zweifellos ein Dutzend solch frommer Versprechungen machen würde, die in absoluter Aufrichtigkeit gegeben und ebenso rasch wieder vergessen waren.
Dann sprachen sie, neben der zerfallenen Mauer dicht beieinanderstehend und fest in ihre dunklen Mäntel gehüllt, von anderen Dingen.
Kurz vor Mittag hörte Garion das gedämpfte Geräusch von Huftritten draußen im Wald. Ein paar Minuten später erschien Hettar aus dem Nebel mit einem Dutzend kräftiger Pferde hinter sich. Der große Algarier trug ein kurzes, wollgefüttertes Ledercape. Seine Stiefel waren schlammverkrustet, und seine Kleider zeigten die Spuren der Reise, aber ansonsten schienen ihm die zwei Wochen im Sattel nichts ausgemacht zu haben. »Garion«, sagte er zur Begrüßung, und Garion und Lelldorin traten vor, um ihn ebenfalls zu begrüßen.
»Wir haben auf dich gewartet«, sagte Garion und stellte Lelldorin vor. »Wir bringen dich zu den anderen.«
Hettar nickte und folgten den beiden jungen Männern durch die Ruinen zu dem Turm, wo Meister Wolf und die anderen warteten. »Schnee in den Bergen«, sagte der Algarier lakonisch zur Erklärung, als er sich vom Pferd schwang. »Hat mich etwas aufgehalten.« Er zog die Kapuze von seinem rasierten Schädel und schüttelte die lange schwarze Skalplocke.
»Nicht weiter schlimm«, erwiderte Meister Wolf. »Komm hinein ans Feuer und iss etwas. Wir haben viel zu besprechen.«
Hettar sah zu den Pferden hinüber, und sein sonnengebräuntes, wettergegerbtes Gesicht wurde seltsam leer, als ob er sich konzentrierte. Die Pferde erwiderten seinen Blick mit wachsamen Augen und aufgestellten Ohren. Dann suchten sie sich ihren Weg zwischen den Bäumen hindurch.
»Werden sie nicht davonlaufen?«, erkundigte sich Durnik.
»Nein«, antwortete Hettar. »Ich habe sie gebeten, es nicht zu tun.«
Durnik sah ihn verblüfft an, sagte aber nichts.
Sie gingen in den Turm und setzten sich ums Feuer. Tante Pol schnitt dunkles Brot und hellen gelben Käse für sie, während Durnik noch mehr Holz aufs Feuer legte.
»Cho-Hag hat die Sippenältesten benachrichtigt«, erzählte Hettar und zog sein Cape aus. Er trug ein schwarzes jackenähnliches Hemd aus Fohlenleder, auf das Stahlplättchen genietet waren, wodurch eine bewegliche Rüstung entstand. »Sie versammeln sich in der Feste, um Rat zu halten.« Er legte den gebogenen Säbel, den er am Gürtel trug, ab und setzte sich zu den anderen, um zu essen.
Wolf nickte. »Versucht jemand, nach Prolgu durchzukommen?«
»Ich habe einen Trupp meiner eigenen Leute zu dem Gorim geschickt, ehe ich aufbrach«, antwortete Hettar. »Wenn es überhaupt jemand schafft, dann sie.«
»Ich hoffe es«, meinte Wolf. »Der Gorim ist ein alter Freund von mir, und ich werde seine Hilfe brauchen.«
»Haben deine Leute keine Angst vor dem Land der Ulgos?«, fragte Lelldorin höflich. »Ich habe gehört, sie wären Ungeheuer, die sich von Menschenfleisch ernähren.«
Hettar zuckte die Schultern. »Sie bleiben im Winter in ihren Lagern. Außerdem sind sie nur selten so mutig, einen ganzen Trupp Berittener anzugreifen.« Er sah zu Meister Wolf herüber. »Südsendarien wimmelt vor Murgos. Oder wusstest du das schon?«
»Ich habe es mir gedacht«, antwortete Wolf. »Sah es so aus, als ob sie nach etwas Bestimmtem suchten?«
»Ich rede nicht mit Murgos«, gab Hettar zurück. Seine Hakennase und die glühenden Augen ließen ihn wie einen Falken wirken, der jeden Moment auf seine Beute hinabstößt.
»Ich bin überrascht, dass du nicht länger gebraucht hast«, neckte ihn Silk. »Alle Welt weiß, was du von Murgos hältst.«
»Einmal habe ich es mir gegönnt«, gab Hettar zu. »Ich habe zwei von ihnen auf der Straße getroffen. Es hat nicht sehr lange gedauert.«
»Also zwei weniger, um die man sich Sorgen machen muss«, brummte Barak beifällig.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir offen miteinander reden«, sagte Meister Wolf und klopfte sich die Brotkrumen von seiner Tunika. »Die meisten von euch wissen ja, was wir tun, aber ich möchte nicht, dass jemand durch Zufall in irgendetwas hineinstolpert. Wir suchen einen Mann namens Zedar. Er war einer der Schüler meines Meisters – dann lief er zu Torak über. Im letzten Frühherbst gelangte er irgendwie in den Thronsaal in Riva und stahl das Auge Aldurs. Wir werden ihn jagen und es ihm wieder abnehmen.«
»Ist er nicht auch ein Zauberer?«, fragte Barak und zwirbelte geistesabwesend seinen dicken roten Zopf.
»Das ist nicht die Bezeichnung, die wir benutzen«, sagte Wolf. »Aber ein gewisses magisches Potenzial besitzt er schon. Wie wir alle – ich, Beltira und Belkira, Belzedar – und alle anderen. Das ist eins der Dinge, vor denen ich euch warnen wollte.«
»Ihr scheint alle die gleiche Art von Namen zu haben«, bemerkte Silk.
»Unser Meister hat unsere Namen geändert, als er uns als Schüler annahm. Es war eine einfache Änderung, aber sie bedeutete uns viel.«
»Bedeutet das, dass dein ursprünglicher Name Garath lautete?«, fragte Silk. Seine schlauen Wieselaugen verengten sich zu schmalen Schlitzen.
Meister Wolf sah ihn überrascht an und lachte dann. »Den Namen habe ich schon seit Jahrtausenden nicht mehr gehört. Ich bin schon so lange Belgarath, dass ich Garath fast völlig vergessen habe. Garath war ein unangenehmer Bursche – ein Dieb und Lügner unter anderem.«
»Manche Dinge ändern sich eben nie«, stellte Tante Pol fest.
»Niemand ist vollkommen«, gab Wolf zu.
»Warum hat Zedar das Auge gestohlen?«, fragte Hettar und stellte seinen Teller beiseite.
»Er wollte es schon immer für sich selbst haben«, antwortete der alte Mann. »Das könnte der Grund sein – aber wahrscheinlicher ist, dass er es Torak bringen will. Derjenige, der Einauge das Auge bringt, wird sicher sein Favorit.«
»Aber Torak ist tot«, wandte Lelldorin ein. »Der Rivanische Hüter hat ihn bei Vo Mimbre getötet.«
»Nein«, widersprach Wolf. »Torak ist nicht tot, er schläft nur. Brands Schwert war nicht dazu bestimmt, ihn zu töten. Zedar hat ihn nach der Schlacht weggetragen und ihn irgendwo versteckt. Eines Tages wird er erwachen – wahrscheinlich schon sehr bald, wenn ich die Zeichen richtig deute. Wir müssen das Auge zurückholen, ehe das geschieht.«
»Dieser Zedar hat schon einigen Ärger verursacht«, knurrte Barak. »Du hättest schon vor langer Zeit mit ihm abrechnen sollen.«
»Vermutlich«, gab Wolf zu.
»Warum winkst du nicht einfach mit der Hand und lässt ihn verschwinden?«, schlug Barak vor und machte mit seinen dicken Fingern eine entsprechende Geste.
Wolf schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht. Nicht einmal die Götter können das.«
»Dann haben wir ein echtes Problem«, sagte Silk stirnrunzelnd. »Jeder Murgo von hier bis Rak Goska wird versuchen, uns aufzuhalten, damit wir Zedar nicht erwischen.«
»Nicht unbedingt«, widersprach Wolf. »Zedar hat das Auge, aber Ctuchik befehligt die Grolim.«
»Ctuchik?«, fragte Lelldorin.
»Der Hohepriester der Grolim. Er und Zedar hassen sich. Ich glaube, wir können uns darauf verlassen, dass er Zedar daran hindern will, mit dem Auge zu Torak zu gelangen.«
Barak zuckte die Schultern. »Was macht das für einen Unterschied? Du und Polgara, ihr könnt doch Magie benutzen, wenn wir Schwierigkeiten haben, oder?«
»Auch dabei gibt es Grenzen«, sagte Wolf etwas ausweichend.
»Das verstehe ich nicht«, sagte Barak stirnrunzelnd.
Meister Wolf holte tief Luft. »Also gut. Da es zur Sprache gekommen ist, will ich es erklären. Zauberei – wenn ihr es so nennen wollt – ist die Zerschlagung der natürlichen Ordnung der Dinge. Manchmal hat sie unerwartete Nebeneffekte, deshalb muss man sehr vorsichtig mit dem sein, was man tut. Nicht nur, dass sie …«, er überlegte, »… eine Art Lärm verursacht. Das trifft die Sache nicht genau, aber es reicht als Erklärung. Andere mit den gleichen Fähigkeiten können diesen Lärm hören. Wenn Polgara und ich einmal anfangen, Dinge zu verändern, wird jeder Grolim im Westen genau wissen, wo wir sind und was wir tun. Sie werden uns dann Steine in den Weg legen, bis wir völlig erschöpft sind.«
»Man braucht fast so viel Energie, um etwas auf diese Art zu tun, wie mit Muskelkraft«, erklärte Tante Pol. »Es ist sehr ermüdend.« Sie saß dicht beim Feuer und flickte sorgfältig einen kleinen Riss in Garions Tunika.
»Das wusste ich nicht«, gestand Barak.
»Es wissen nur wenige.«
»Wenn wir müssen, können Pol und ich gewisse Schritte unternehmen«, fuhr Wolf fort, »aber wir können das nicht ewig machen, und wir können keine Dinge verschwinden lassen. Ihr versteht sicher, warum.«
»Aber natürlich«, behauptete Silk, obwohl sein Ton deutlich verriet, dass er keine Ahnung hatte.
»Alles, was existiert, hängt von allem anderen ab«, erklärte Tante Pol ruhig. »Wenn du etwas rückgängig machen willst, ist es gut möglich, dass alles verschwindet.«
Das Feuer knisterte, Garion zuckte leicht zusammen. Die gewölbte Kammer schien plötzlich dunkel zu sein, und in den Ecken lauerten Schatten.
»Das kann natürlich nicht geschehen«, sagte Wolf. »Wenn man etwas rückgängig zu machen versucht, fällt der Wille einfach nur auf einen selbst zurück. Wenn man sagt ›Sei nicht‹, dann ist man es selbst, der verschwindet. Deswegen sind wir sehr vorsichtig mit dem, was wir sagen.«
»Das kann ich verstehen«, sagte Silk mit großen Augen.
»Den meisten Dingen, denen wir begegnen werden, kann man mit normalen Mitteln entgegentreten«, fuhr Wolf fort. »Deswegen haben wir euch zusammengebracht – zumindest ist das einer der Gründe. Ihr könnt als Gruppe mit den meisten Dingen fertigwerden, die sich uns in den Weg stellen. Entscheidend ist, dass ihr unser wichtigstes Ziel nie aus dem Blick verliert: Polgara und ich müssen Zedar aufspüren, bevor er Torak mit dem Auge erreicht. Er hat einen Weg gefunden, das Auge zu berühren – ich weiß nicht wie. Wenn er Torak zeigt, wie man das macht, wird keine Macht auf Erden Einauge davon abhalten können, König und Gott über die ganze Welt zu werden.«
Eine ganze Weile saßen sie schweigend und mit ernsten Gesichtern im rötlichen flackernden Schein des Feuers und dachten über diese Möglichkeit nach.
»Ich glaube, das wäre so weit alles, nicht wahr, Pol?«
»Ich denke schon, Vater«, antwortete sie und glättete ihr graues selbstgefertigtes Gewand.
Später, als außerhalb des Turms der graue Abend in die nebligen Ruinen von Vo Wacune kroch und der Duft des dicken Eintopfes, den Tante Pol zum Abendessen kochte, zu ihnen herüberwehte, wandte sich Garion an Silk. »Ist das wirklich alles wahr?«, fragte er.
Der kleine Mann sah hinaus in den Nebel. »Wir wollen so tun, als ob wir daran glauben«, schlug er vor. »Unter den gegebenen Umständen wäre es wohl nicht ratsam, einen Fehler zu machen.«
»Hast du auch Angst?«, fragte Garion.
Silk seufzte. »Ja«, gab er zu, »aber wir können so tun, als ob wir glaubten, wir hätten keine, nicht wahr?«
»Wir können es ja versuchen«, sagte Garion, und die beiden gingen zurück zu der Kammer am Fuße des Turms, wo der Feuerschein auf den niedrigen Steingewölben tanzte und Nebel und Kälte abhielt.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen, als Silk aus dem Turm kam, trug er eine reich verzierte braune Weste und eine beutelähnliche schwarze Samtkappe, deren Zipfel keck über einem Ohr hing.
»Was soll das?«, fragte Tante Pol.
»Ich habe in einem der Gepäckstücke zufällig einen alten Freund gefunden«, antwortete Silk munter, »und zwar Radek von Boktor.«
»Was ist mit Ambar von Kotu geschehen?«
»Ambar ist schon ein ganz brauchbarer Bursche, finde ich«, sagte Silk abweisend, »aber ein Murgo namens Asharak kennt ihn, und er hat vielleicht hier und dort seinen Namen erwähnt. Wir wollen uns doch nicht freiwillig Ärger aufhalsen, wenn wir nicht unbedingt müssen.«
»Keine schlechte Verkleidung«, sagte Meister Wolf anerkennend. »Ein drasnischer Kaufmann mehr wird keinerlei Aufmerksamkeit auf der Großen Weststraße auf sich lenken – wie auch immer er heißen mag.«
»Bitte«, widersprach Silk gekränkt. »Der Name ist sehr wichtig. Die ganze Verkleidung hängt an dem Namen.«
»Ich kann keinen Unterschied erkennen«, erklärte Barak offen.
»Aber da ist ein himmelweiter Unterschied. Sicher kannst du sehen, dass Ambar ein Vagabund mit wenig Achtung für ethische Werte ist, während Radek ein grundsolider Mann ist, dessen Wort in allen Handelszentren des Westens geschätzt wird. Außerdem wird Radek immer von Dienern begleitet.«
»Diener?« Tante Pols Augenbrauen hoben sich.
»Nur um der Verkleidung willen«, versicherte ihr Silk rasch. »Du, edle Polgara, könntest natürlich nie eine Dienerin sein.«
»Danke.«
»Niemand würde das glauben. Nein, du wirst meine Schwester sein, die in meiner Begleitung reist, um die Sehenswürdigkeiten von Tol Honeth zu besichtigen.«