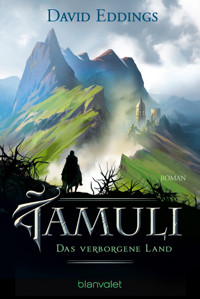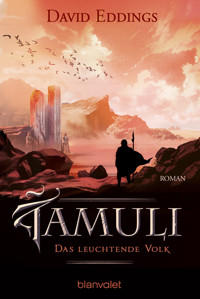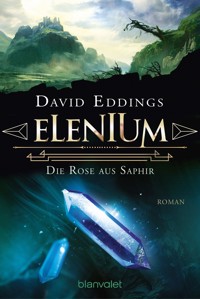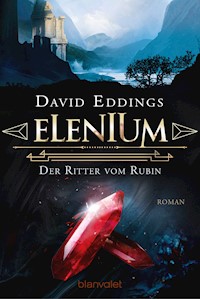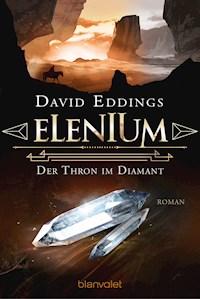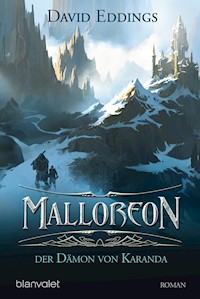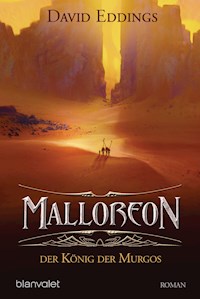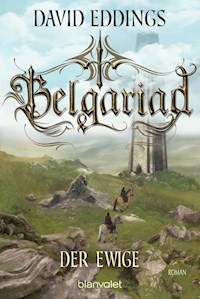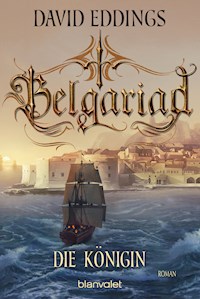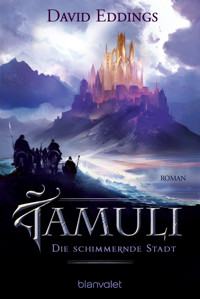
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Tamuli-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der packende Auftakt der Tamuli-Trilogie – »David Eddings ermöglicht den perfekten Einstieg in die Fantasy.« Christopher Paolini
Seit Sperber, der Ritter vom Rubin, den finsteren Gott Azash erschlug, herrscht Frieden in Elenien. Bis eines Tages ein Gesandter des Tamulischen Imperiums am Königshof eintrifft. Finstere Magie bedroht das Reich, und der Kaiser ist überzeugt, dass allein der Gottbezwinger Rettung bringen kann. Also machen sich Sperber und seine Gefährten auf die weite Reise in das ferne Reich des Ostens. Am Ziel erwartet sie die Schimmernde Stadt, erfüllt von Korruption, Verrat – und der größten Gefahr, der Sperber je gegenübertreten musste.
Die Tamuli-Trilogie:
1. Die schimmernde Stadt
2. Das leuchtende Volk
3. Das verborgene Land
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Seit Sperber, der Ritter vom Rubin, den finsteren Gott Azash erschlug, herrscht Frieden in Elenien. Bis eines Tages ein Gesandter des Tamulischen Imperiums am Königshof eintrifft. Finstere Magie bedroht das Reich, und der Kaiser ist überzeugt, dass allein der Gottbezwinger Rettung bringen kann. Also machen sich Sperber und seine Gefährten auf die weite Reise in das ferne Reich des Ostens. Am Ziel erwartet sie die Schimmernde Stadt, erfüllt von Korruption, Verrat – und der größten Gefahr, der Sperber je gegenübertreten musste.
Autor
David Eddings wurde 1931 in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er 1982 seinen ersten großen Roman, »Belgariad – Die Gefährten«, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Den Höhepunkt seiner Autorenkarriere erreichte er, als der Abschlussband seiner Malloreon-Saga Platz 1 der »New York Times«-Bestsellerliste erreichte. Im Jahr 2009 starb er in Caron City, Nevada.
Von David Eddings bei Blanvalet:
Die Belgariad-Saga:
Die Gefährten
Der Schütze
Der Blinde
Die Königin
Der EwigeDie Malloreon-Saga
1. Die Herren des Westens
2. Der König der Murgos
3. Der Dämon von Karanda
4. Die Zauberin von Darshiva
5. Die Seherin von KellDie Elenium-Trilogie:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus SaphirDie Tamuli-Trilogie:
1. Die schimmernde Stadt
2. Das leuchtende Volk
3. Das verborgene Landwww.blanvalet.de
DAVID EDDINGS
DIE SCHIMMERNDE STADT
ROMAN
Deutsch von Lore Strassl
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »The Tamuli I: Domes of Fire« bei Del Rey, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 1993 by David Eddings
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzungsnutzung mit freundlicher Genehmigung der Edition Bärenklau / Literaturagentur
Redaktion: Gerhard Seidl / textinform
© Covergestaltung und Illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung der Motive von Shutterstock (Liu zishan; maticeee)
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30942-8V001
www.blanvalet.de
Prolog
Auszugaus dem zweiten Kapitel vonDie Cyrga-Affäre: Eine Untersuchung der kürzlichen Krise.Herausgegeben von der Fakultät für Zeitgeschichteder Universität von Matherion.
Der Reichsrat erkannte zu diesem Zeitpunkt, dass dem Imperium ernste Gefahr drohte – eine Gefahr, auf welche die Regierung Seiner Kaiserlichen Majestät kaum vorbereitet war. Seit langer Zeit verließ das Imperium sich auf die Streitkräfte Atans, seine Interessen zu vertreten, wenn es zu periodischen Unruhen kam, mit denen in einer gemischten Bevölkerung unter einer starken Zentralregierung stets zu rechnen ist. Doch die Situation, der sich die Regierung Seiner Majestät diesmal gegenübersah, schien nicht von spontanen Demonstrationen einiger unzufriedener Hitzköpfe auszugehen, die zu Beginn der Semesterferien, nach den Abschlussexamen, aus den verschiedenen Universitäten auf die Straßen drängen. Solcherlei Demonstrationen ist man gewöhnt, und die Ordnung lässt sich fast immer mit einem Minimum an Blutvergießen wiederherstellen.
Der Regierung wurde bald bewusst, dass es sich diesmal um etwas anderes handelte. Die Demonstranten waren keine jugendlichen Heißsporne, und der bürgerliche Friede kehrte auch nicht wieder ein, als die Universitäten ihre Pforten zu Semesterbeginn wieder öffneten. Die Obrigkeit hätte die Ordnung vielleicht wiederherstellen können, wären die verschiedenen Unruhen das Ergebnis revolutionären Fanatismus gewesen. Schon die Anwesenheit von Atankriegern kann unter normalen Umständen die Begeisterung selbst der Besessensten dämpfen. Diesmal überschritten die mutwilligen Zerstörungen im Zuge der Demonstrationen jedoch jedes bisher gewohnte Maß. Natürlich bedachte die Regierung des Imperiums zuerst die Styriker in Sarsos mit misstrauischem Blick. Eine Untersuchung durch styrische Mitglieder des Reichsrats, deren Loyalität zum Thron über jeden Verdacht erhaben war, ergab jedoch zweifelsfrei, dass das Styrikum absolut nichts mit den Unruhen zu tun hatte. Die paranormalen Vorfälle gingen offenbar von noch unbekannten Quellen aus und waren so weitverbreitet, dass unmöglich vereinzelte styrische Renegaten dafür verantwortlich sein konnten. Die Styriker vermochten nicht, die Urheber ausfindig zu machen, ja sogar der legendäre Zalasta, obwohl der hervorragendste Zauberer im ganzen Styrikum, musste verlegen eingestehen, dass er ratlos war.
Zu seiner Ehre sei gesagt, dass Zalasta den Weg vorschlug, dem Seiner Majestät Regierung schließlich folgte. Er riet, auf dem eosischen Kontinent Unterstützung zu suchen, im Besonderen die eines Mannes namens Sperber.
Sämtliche diplomatischen Vertreter des Imperiums auf dem eosischen Kontinent wurden sogleich beauftragt, alle Arbeit ruhen zu lassen und ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf diesen Mann zu richten. Es sei unabdingbar, dass Seiner Majestät Regierung alles über diesen Sperber erfahre. Als die Berichte aus Eosien eintrafen, bekam der Reichsrat ein umfassendes Bild von Sperber, von seiner äußeren Erscheinung, seiner Persönlichkeit und seinem Lebenslauf.
Ritter Sperber, wie sich herausstellte, ist Angehöriger einer der halbreligiösen Orden der elenischen Kirche. Der seine nennt sich »Orden der Pandionischen Ritter«. Sperber ist ein großer, fast hagerer Mann am Anfang seiner mittleren Jahre, mit einem von Narben gezeichneten Gesicht, scharfer Intelligenz und unbeherrschter, manchmal gar kränkender Offenheit. Die Ritter der Elenischen Kirche sind Furcht einflößende Recken, und Ritter Sperber steht an ihrer Spitze. Einmal in der Geschichte des eosischen Kontinents – zu einer Zeit, als die vier Kriegerorden der Kirche gegründet wurden –, befanden die Elenier sich in einer so verzweifelten Lage, dass sie gar ihre althergebrachten Vorurteile ablegten und den Kriegerorden Unterricht in den geheimen Künsten des Styrikums gestatteten. Dieses Wissen half den Ordensrittern damals, vor gut fünf Jahrhunderten, sich im Ersten Zemochischen Krieg zu behaupten. Ritter Sperber hatte ein Amt inne, desgleichen in unserem Imperium unbekannt ist. Er war der erbliche »Streiter« des elenischen Königshauses. Die westlichen Elenier haben eine ritterliche Kultur, die viele Altertümlichkeiten aufweist. Die »Herausforderung« (im Wesentlichen eine Aufforderung zum Zweikampf) ist die übliche Entgegnung von Edelleuten, die sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen. Es ist erstaunlich, dass nicht einmal Monarchen davor gefeit sind, Herausforderungen annehmen zu müssen. Um die Unannehmlichkeit zu meiden, auf die Unverschämtheiten irgendwelcher Querköpfe eingehen zu müssen, ernennen die regierenden Häupter Eosiens für gewöhnlich einen überragenden – und meist weithin als unübertrefflich gerühmten – Kämpfer zu ihrem Vertreter. Ritter Sperbers Wesen und Ruf sind von der Art, dass selbst die streitsüchtigsten Edlen des Königreichs Elenien nach genauerer Überlegung zu dem Schluss kommen, auf eine Herausforderung verzichten zu können, da sie gar nicht wirklich beleidigt worden seien. Es ist Ritter Sperbers Waffengeschick und seiner Besonnenheit zuzuschreiben, dass er sich selten gezwungen sah, jemanden zu töten, der dennoch auf einem Kampf bestand, da nach altem Brauch ein schwer verwundeter Gegner sein Leben retten kann, indem er sich ergibt und seine Herausforderung zurücknimmt.
Nach dem Tod seines Vaters nahm Ritter Sperber bei König Aldreas, dem Vater der derzeitigen Königin, seine Pflichten auf. König Aldreas war jedoch ein schwacher Monarch. Er wurde vollkommen von seiner Schwester Arissa und Annias beherrscht, dem Primas von Cimmura, der Arissas heimlicher Liebhaber und Vater ihres unehelichen Sohnes Lycheas war. Der Primas von Cimmura – de facto Herrscher von Elenien – erhoffte sich, zum Erzprälaten der Elenischen Kirche in der Heiligen Stadt Chyrellos aufzusteigen. Aus diesem Grund betrachtete er die Anwesenheit des sittenstrengen Ordensritters am Hofe als Gefährdung. Er überredete König Aldreas, Ritter Sperber ins Exil in das Königreich Rendor zu schicken.
Alsbald wurde Annias auch der König unbequem, worauf er und die Prinzessin den Monarchen vergifteten. Prinzessin Ehlana, Aldreas’ Tochter, bestieg den Thron. Zwar war die Königin Ehlana noch sehr jung an Jahren, doch hatte sie in ihrer frühen Kindheit Ritter Sperber zum Lehrer gehabt, und sie erwies sich als weit stärkerer Monarch, als ihr Vater es gewesen war. Deshalb betrachtete Primas Annias sie als mehr denn nur lästig. Er vergiftete auch Ehlana, doch Ritter Sperbers Kameraden aus dem Pandionischen Orden schützten sie mithilfe ihrer Lehrerin in den geheimen Künsten, einer Styrikerin namens Sephrenia. Dieser Schutz war ein Zauber, der Ehlana in Kristall hüllte und sie, wenngleich nur für begrenzte Zeit, am Leben hielt.
So war die Lage, als Ritter Sperber aus seinem Exil zurückkehrte. Da die Kriegerorden allesamt gegen eine Ernennung des Primas von Cimmura zum Erzprälaten waren, wurden bestimmte Streiter der drei übrigen Orden abgestellt, Ritter Sperber bei der Suche nach einem Gegenmittel oder einer sonstigen Heilmethode zu unterstützen, die Gesundheit Königin Ehlanas wiederherzustellen. Da die Königin dem Annias den freien Zugang zur Reichsschatzkammer verwehrt hatte, folgerten die Ordensritter, dass Ehlana dem Primas auch nach ihrer Genesung nicht jene Mittel überlassen würde, die für seine Kandidatur unabdingbar waren.
Annias verbündete sich mit Martel, einem aus dem pandionischen Orden ausgestoßenen Renegaten. Dieser Martel war in styrischer Magie bewandert, wie alle Pandioner. Er behinderte Sperber mit natürlichen wie übernatürlichen Mitteln, doch der Ritter und seine Kameraden fanden schließlich heraus, dass Königin Ehlanas Gesundheit nur mithilfe eines magischen Steins wiederhergestellt werden konnte, der als »Bhelliom« bekannt war.
Westliche Elenier sind ein eigenartiges Volk. In weltlicher Hinsicht hoch entwickelt, sind sie uns in manchen Dingen sogar überlegen, jedoch von einem beinahe kindlichen Glauben an Schwarze Magie geprägt. Dieser »Bhelliom« ist, wie wir erfuhren, ein sehr großer Saphir, der vor langer Zeit mit größter Sorgfalt und Kunstfertigkeit in Form einer Rose geschliffen wurde. Die Elenier sind davon überzeugt, dass es sich bei dem Künstler um einen Troll gehandelt hat – ein so absurder Gedanke, dass wir nicht näher darauf eingehen wollen.
Jedenfalls gelang es Ritter Sperber und seinen Gefährten, zahlreiche Hindernisse zu überwinden und schließlich diesen eigenartigen Talisman an sich zu bringen, der (wie sie behaupten) Königin Ehlana errettete. Doch wahrscheinlicher ist, dass ihre Lehrerin Sephrenia, die Lehrmeisterin der Ordensritter, dies ohne jedes Hilfsmittel bewerkstelligte und dass die angebliche Benutzung des Bhellioms nicht mehr denn eine List war, die sie vor der schrecklichen Bigotterie der Westelenier schützen sollte.
Als Erzprälat Cluvonus im Sterben lag, begab sich die Hierokratie der Elenischen Kirche nach Chyrellos, um an der »Wahl« seines Nachfolgers teilzunehmen. Eine Wahl ist ein eigenartiger Vorgang, bei der jeder seinen Wunschkandidaten nennt. In das betreffende Amt wird erhoben, wer die Stimmen des Großteils der Wähler bekommt. Ein solches Verfahren ist wider die Natur; doch da die elenische Geistlichkeit das Zölibat auf ihre Fahnen geschrieben hat, gibt es keine Möglichkeit, das Erzprälatenamt zu vererben. Der Primas von Cimmura hatte eine beachtliche Zahl hoher Kirchenleute bestochen, sich während der Beratungen der Hierokratie für ihn zu entscheiden, dennoch gelang es ihm nicht, die Mehrheit zu erringen. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Helfer, der bereits erwähnte Martel, eine Armee gegen die Heilige Stadt, um die Hierokratie unter Druck zu setzen, auf dass sie Annias wählte. Ritter Sperber und einer kleinen Schar von Ordensrittern gelang es, die Basilika vor Martels Horden zu schützen, während die Hierokratie beriet. Der Großteil der Stadt Chyrellos wurde jedoch während der Kämpfe stark beschädigt oder zerstört.
Als die Situation gefahrvoll wurde, kamen den Belagerten die Streitkräfte der Westelenischen Königreiche zu Hilfe. (Elenische Politik, wie vermerkt werden muss, ist kein allzu zartes Pflänzchen.) Die Verbindung zwischen dem Primas von Cimmura und dem Renegaten Martel kam ans Licht, ebenso die Tatsache, dass diese beiden eine geheime Abmachung mit Otha von Zemoch hatten. Empört über den Hochverrat des Primas distanzierte sich die Hierokratie von diesem Kandidaten und wählte stattdessen einen gewissen Dolmant, den Patriarchen von Demos, einen tüchtigen Mann, wie es scheint. Doch wäre es verfrüht, Näheres daraus zu schließen.
Königin Ehlana von Elenien war kaum dem Kindesalter entwachsen, schien jedoch eine energische junge Frau mit festem, eigenem Willen zu sein. Sie hegte seit Langem starke Zuneigung zu Ritter Sperber, wenngleich dieser zwanzig Jahre älter ist als sie; und bald nach ihrer Genesung gab Ehlana ihre Verlobung mit Ritter Sperber kund. Erzprälat Dolmant traute die beiden kurz nach seiner Amtseinsetzung. Merkwürdigerweise behielt die Königin ihr Herrscheramt. Indes müssen wir davon ausgehen, dass Ritter Sperber beachtlichen Einfluss auf sie ausübte, sowohl was Staatsgeschäfte als auch häusliche Angelegenheiten betrifft.
Die Verwicklung des Kaisers von Zemoch in die inneren Angelegenheiten der Elenischen Kirche war natürlich ein casus belli, und die Armeen von Westeosien marschierten unter der Führung der Ordensritter ostwärts durch Lamorkand, um gegen die an der Grenze harrenden zemochischen Horden zu kämpfen. Der lange befürchtete Zweite Zemochische Krieg begann.
Ritter Sperber und seine Kameraden jedoch ritten gen Norden, um nicht in die Schlachten verwickelt zu werden, bogen dann nach Osten ab, überquerten das Gebirge von Nordzemoch und begaben sich unerkannt zu Othas Residenz, der Stadt Zemoch, offenbar auf den Fersen von Annias und Martel.
Trotz aller Bemühungen gelang es unseren Agenten im Westen nicht, Genaueres über die Ereignisse in Zemoch herauszufinden. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass Annias, Martel, ja sogar Otha dort den Tod fanden, indes sind sie für die Geschichte von geringerem Interesse. Viel bedeutsamer ist die Tatsache, dass Azash, ein Älterer Gott vom Styrikum und die treibende Kraft hinter Otha und dessen Zemochern, ebenfalls sein Ende fand. Es besteht kein Zweifel, dass Ritter Sperber dafür verantwortlich war. Wir müssen gestehen, dass wir die Art von Zauber, die in Zemoch ausgeübt wurde, nicht begreifen und dass Ritter Sperber über eine Macht verfügt wie noch kein Sterblicher vor ihm. Als Beweis für die ungeheuren Kräfte, die bei dieser Konfrontation eingesetzt wurden, soll nur darauf hingewiesen werden, dass die Stadt völlig zerstört wurde.
Zweifellos hatte Zalasta, der Styriker, recht. Nur Ritter Sperber, Prinzgemahl der Königin Ehlana, hätte die Krise in Tamuli bewältigen können. Doch bedauerlicherweise war Sperber kein Bürger des Tamulischen Imperiums; aus diesem Grund konnte der Kaiser ihn nicht wie einen Untertanen in die Reichshauptstadt Matherion zitieren. Die Regierung Seiner Majestät befand sich in einer Zwickmühle: Zum einen hatte der Kaiser keine Befehlsgewalt über Sperber, zum anderen wäre es eine undenkbare Erniedrigung gewesen, den Bürger eines fremden Reiches um Hilfe zu bitten.
Die Lage im Imperium verschlechterte sich von Tag zu Tag, es wurde immer dringlicher, dass Ritter Sperber einschritt. Andererseits war es unerlässlich, die Würde des Imperiums zu wahren. Der fähigste Diplomat der kaiserlichen Gesandtschaften, Minister Oscagne, fand schließlich einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wir werden den brillanten diplomatischen Schachzug seiner Exzellenz im folgenden Kapitel näher beleuchten.
Erster Teil EOSIEN
1
Der Frühling war noch jung, und der Regen trug weiterhin die anhaltende Kälte des Winters mit sich. Ein weiches, silbriges Nieseln sank aus dem Nachthimmel herab. Es umwob Cimmuras quadratische Wachtürme mit Schleiern, ließ die Fackeln zu beiden Seiten des breiten Tores zischen und verlieh den Pflastersteinen der zum Tor führenden Straße einen schwarzen Glanz. Ein einsamer Reiter näherte sich der Stadt. Er hatte einen schweren Reiseumhang um sich geschlungen und ritt einen hochbeinigen zottigen Fuchshengst mit langer Nase und wilden Augen. Der Reiter war ein großer Mann mit schwerem Knochenbau und kräftigen Muskeln, doch ohne eine Spur überschüssigen Fetts. Sein Haar war dicht und schwarz, und seine Nase verriet, dass sie irgendwann einmal gebrochen worden war. Er ritt lässig, doch mit der eigentümlichen Wachsamkeit eines ausgebildeten Kriegers.
Der mächtige Fuchs schüttelte abwesend die Nässe aus Mähne und Zottelfell, als sie sich dem Osttor der Stadt näherten und schließlich im rötlichen Fackelschein unmittelbar außerhalb der Mauer hielten.
Ein stoppelbärtiger Torwächter in rostbeflecktem Harnisch und Helm und einem nachlässig über eine Schulter hängenden, mit Flicken besetzten grünen Umhang trat aus der Wachstube, blieb schwankend stehen und blickte den Reisenden fragend an.
»Bin nur auf der Durchreise, Nachbar«, sagte der große Mann ruhig.
Er schob die Kapuze zurück.
»Oh!«, sagte der Wächter. »Ihr seid es, Prinz Sperber. Hab Euch nicht erkannt. Willkommen zu Hause.«
»Danke«, antwortete Sperber. Er roch den billigen Wein im Atem des Mannes.
»Möchtet Ihr, dass ich dem Schloss Eure Rückkehr melde, Hoheit?«
»Nicht nötig. Ich kann mein Pferd selbst versorgen.« Sperber konnte Zeremonien nicht ausstehen – schon gar nicht mitten in der Nacht. Er lehnte sich aus dem Sattel und steckte dem Wächter eine kleine Münze zu. »Geht wieder in die Wachstube, Nachbar. Ihr erkältet Euch nur, wenn Ihr im Regen stehen bleibt.« Er stupste sein Pferd und ritt durchs Tor.
Das Stadtviertel gleich hinter der Mauer war ärmlich. Die heruntergekommenen, armseligen Häuser kauerten dicht beieinander, ihr erster Stock ragte über die schmutzigen, nassen Straßen. Sperber ritt eine schmale Kopfsteingasse entlang. Das Klappern der beschlagenen Hufe seines Fuchses hallte von den Häuserwänden wider. Ein Wind war aufgekommen, der an Fensterläden rüttelte und die primitiven Aushängeschilder an ihren rostigen Haken schüttelte.
Ein streunender Hund kam aus einer Seitengasse gerannt und bellte Sperber und sein Pferd wichtigtuerisch an. Der Hengst drehte den Kopf und bedachte den Köter mit einem drohenden Blick. Der Hund hörte zu bellen auf, zog den dünnen Schwanz ein und wich ein Stück zurück. Herausfordernd stapfte das Pferd auf ihn zu. Der Hund winselte, dann warf er sich jaulend herum und ergriff die Flucht. Sperbers Hengst schnaubte abfällig.
»Fühlst du dich jetzt besser, Faran?«, fragte Sperber den Fuchs.
Farans Ohren zuckten.
»Können wir dann weiterreiten?«
An einer Kreuzung brannte flackernd eine Fackel. Eine vollbusige junge Hure in billigem Kleid stand durchnässt im rötlichen Lichtkreis. Ihr dunkles Haar klebte am Kopf, Streifen durchzogen ihre Schminke, und sie wirkte niedergeschlagen.
Sperber zügelte sein Pferd. »Was machst du hier mitten im Regen, Naween?«
»Ich habe auf Euch gewartet, Sperber«, antwortete sie kokett mit verschmitztem Blick.
»Oder auf sonst jemand?«
»Natürlich. Das ist schließlich mein Gewerbe, Sperber. Aber ich schulde Euch noch etwas. Soll ich meine Schuld nicht endlich begleichen?«
Sperber ging gar nicht erst auf die Bemerkung ein. »Wieso arbeitest du auf der Straße?«
»Shanda und ich hatten Streit.« Sie zuckte mit den Schultern. »Da beschloss ich, mich selbstständig zu machen.«
»Du bist nicht ausgekocht genug für ein Straßenmädchen, Naween.« Er steckte die Finger in den Beutel an seiner Seite, fischte mehrere Münzen heraus und gab sie ihr. »Nimm dir eine Kammer in irgendeinem Gasthaus und bleib ein paar Tage von der Straße weg. Ich werde mit Platime reden. Mal sehen, ob wir nicht etwas für dich finden.«
Sie kniff die Augen zusammen.
»Das braucht Ihr nicht, Sperber. Ich kann für mich selbst sorgen.«
»Natürlich kannst du das. Deshalb stehst du ja im Regen. Tu jetzt erst einmal, was ich sage, Naween. Für Diskussionen ist es zu spät und zu nass!«
»Jetzt schulde ich Euch noch mehr, Sperber. Seid Ihr wirklich sicher …«
»Ganz sicher, kleine Schwester. Ich bin jetzt verheiratet, du erinnerst dich doch?«
»Na und?«
»Schon gut. Sieh zu, dass du ins Trockene kommst.« Sperber ritt kopfschüttelnd weiter. Er mochte Naween, aber sie war nie und nimmer imstande, für sich selbst zu sorgen.
Er ritt über einen stillen Platz, an dem alle Läden und Verkaufsstände geschlossen hatten. In dieser Nacht waren nur wenige Leute unterwegs; so gab es kaum Gelegenheiten, Geschäfte zu machen.
Sperbers Gedanken schweiften zurück in die vergangenen anderthalb Monate. Niemand in Lamorkand war bereit gewesen, mit ihm zu reden. Erzprälat Dolmant war ein weiser Mann, erfahren in Politik und Kirchenlehre, aber er wusste bedauerlich wenig darüber, was das einfache Volk dachte. Geduldig hatte Sperber ihm zu erklären versucht, wie sinnlos es war, einen Ordensritter auszuschicken, sich umzuhören. Dolmant jedoch hatte darauf bestanden, und Sperbers Eid verpflichtete ihn zum Gehorsam. So hatte er sechs Wochen in den hässlichen Städten von Südlamorkand vergeudet, wo niemand bereit gewesen war, sich über mehr als das Wetter mit ihm zu unterhalten. Und was das Schlimmste war, Dolmant gab ganz offensichtlich Sperber die Schuld für seine eigene Fehleinschätzung.
In einer dunklen Nebenstraße, wo das Wasser von den Traufen eintönig auf das Kopfsteinpflaster tropfte, spürte Sperber, wie sich Farans Muskeln plötzlich spannten. »Tut mir leid«, sagte er leise, »ich hab nicht aufgepasst.« Jemand beobachtete ihn. Er konnte ganz deutlich die Feindseligkeit spüren, die sein Pferd alarmiert hatte, denn Faran war ein Streitross und reagierte instinktiv darauf. Sperber murmelte einen Zauber in styrischer Sprache, die dazugehörenden Handbewegungen verbarg sein Umhang. Langsam gab er den Zauber frei, um zu verhindern, dass der Fremde es bemerkte, wer immer er sein mochte.
Der heimliche Beobachter war kein Elenier. Das spürte Sperber sogleich. Er forschte tiefer. Dann runzelte er die Stirn. Es waren mehrere, und keine Styriker. Geduldig wartete er auf einen Hinweis, was die Identität der Fremden betraf.
Die Erkenntnis traf Sperber wie ein Schock. Er fröstelte. Die Beobachter waren nicht menschlich. Sperber verlagerte sein Gewicht im Sattel und ließ die Hand unmerklich zum Schwertgriff gleiten.
Abrupt schwand das Gefühl, beobachtet zu werden, und Faran erschauderte vor Erleichterung. Er drehte seinen hässlichen Kopf und warf seinem Reiter einen argwöhnischen Blick zu.
»Frag mich nicht, Faran«, sagte Sperber, »ich weiß es auch nicht.« Aber das stimmte nicht ganz. Die Geistberührung in der Dunkelheit war ihm vage vertraut gewesen. Doch diese Vertrautheit weckte Fragen in Sperber, denen er sich lieber nicht stellen wollte.
Am Schlosstor hielt Sperber nur kurz inne und wies die Soldaten streng an, nicht das ganze Haus zu wecken. Dann saß er im Hof ab.
Ein junger Mann trat aus der Stallung auf den regennassen Hof. »Warum habt Ihr nicht Bescheid geben lassen, dass Ihr heimkommt, Sperber?«, fragte er leise.
»Weil ich Paraden und wilde Feiern mitten in der Nacht nicht mag«, antwortete Sperber seinem Knappen, während er die Kapuze zurückwarf. »Was machst du so spät noch? Ich habe deiner Mutter versprochen, dafür zu sorgen, dass du genügend Schlaf bekommst. Du wirst mich in Schwierigkeiten bringen, Khalad.«
»Soll ich darüber lachen?« Khalads Stimme war schroff. Er nahm Farans Zügel. »Kommt herein, Sperber. Ihr werdet rosten, wenn Ihr so lange im Regen bleibt.«
»Du bist genauso schlimm, wie dein Vater es war!«
»Das ist eine alte Eigenart unserer Familie.« Khalad führte den Prinzgemahl und sein übellauniges Streitross in den nach Heu duftenden Stall, den der goldene Schein von zwei Laternen erhellte. Khalad war ein stämmiger Bursche mit borstigem schwarzem Haar und einem kurz gestutzten Bart. Er trug eine enge Kniehose und eine ärmellose Weste, beides aus schwarzem Leder. Von seinem Gürtel hing ein schwerer Dolch, und an seinen Handgelenken prangten stählerne Armreifen. Er hatte ganz die Art seines Vaters und sah ihm so ähnlich, dass die wehmütige Erinnerung Sperber einen Stich gab. »Ich dachte, Talen würde mit Euch zurückkommen«, sagte Sperbers Knappe, während er Faran den Sattel abnahm.
»Er ist erkältet. Seine Mutter – und deine – war dagegen, dass er sich bei diesem Wetter ins Freie begibt, und ich hatte wahrhaftig keine Lust, mich mit ihnen anzulegen.«
»Kluge Entscheidung.« Khalad klatschte Faran abwesend auf die Nase, als der mächtige Fuchs ihn zu beißen versuchte. »Wie geht es ihnen?«
»Euren Müttern? Gut. Aslade bemüht sich immer noch, Elys ein paar Pfunde anzufüttern, aber damit hat sie nicht viel Glück. Wie hast du erfahren, dass ich in der Stadt bin?«
»Einer von Platimes Gaunern sah Euch durchs Tor kommen und gab sofort Bescheid.«
»Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Du hast doch nicht etwa meine Gemahlin aufgeweckt?«
»Das würde ich nie, solange Mirtai vor ihrer Tür Wache hält! Gebt mir Euren nassen Umhang, Hoheit. Ich werde ihn in der Küche zum Trocknen aufhängen.«
Sperber brummte und nahm den durchgeweichten Umhang ab.
»Das Kettenhemd ebenfalls, Sperber«, fügte Khalad hinzu, »bevor es sich ganz in Rost auflöst.«
Sperber nickte, öffnete den Schwertgürtel und plagte sich aus dem Kettenhemd. »Wie kommt ihr mit eurer Ausbildung voran?«
Khalad brummelte etwas Unverständliches. »Ich habe noch nichts gelernt, was ich nicht bereits konnte. Unser Vater war ein viel besserer Lehrmeister als der beste Ausbilder des Ordenshauses. Eure Idee wird sich nicht verwirklichen lassen, Sperber. Die anderen Novizen sind allesamt Edelleute, und wenn meine Brüder und ich sie auf dem Übungsplatz besiegen, nehmen sie es krumm. Wir machen uns jedes Mal Feinde, wenn wir uns nur umdrehen.« Er hob den Sattel von Farans Rücken und über eine Boxenabtrennung. Flüchtig legte er die Hand auf den Rücken des großen Fuchses, dann bückte er sich, nahm eine Handvoll Stroh auf und begann ihn abzureiben.
»Weck irgendeinen Stallburschen und überlasse ihm das«, wies Sperber ihn an. »Ist in der Küche noch irgendjemand wach?«
»Ich glaube, die Bäcker sind bereits auf.«
»Bitte einen, dass er mir etwas zum Essen herrichtet. Es ist lange her seit dem Mittag.«
»Wird erledigt. Was habt Ihr so lange in Chyrellos getan?«
»Ich musste einen kleinen Abstecher nach Lamorkand machen. Der Bürgerkrieg dort wird immer erbitterter, und der Erzprälat hatte den Wunsch, dass ich mich ein bisschen umsehe.«
»Ihr hättet Eurer Gemahlin eine Botschaft senden sollen. Sie hat vorhin beschlossen, Mirtai nach Euch suchen zu lassen.« Khalad grinste. »Ich fürchte, Ihr müsst wieder mit einer Standpauke rechnen, Sperber.«
»Daran bin ich gewöhnt. Ist Kalten im Schloss?«
Khalad nickte. »Das Essen ist hier besser, und man erwartet nicht, dass er dreimal am Tag betet. Außerdem hat er ein Auge auf die Kammerzofen geworfen, glaube ich.«
»Das überrascht mich nicht. Schick ihn in die Küche, ich möchte mit ihm reden. Aber vorher will ich noch ins Badehaus.«
»Ich fürchte, das Wasser ist kalt. Hier lässt man die Feuer nachts ausgehen.«
»Wir sind Soldaten Gottes, Khalad. Man erwartet von uns, dass wir alle Unbilden tapfer ertragen.«
»Ich werde versuchen, mir das zu merken, Hoheit.«
Das Wasser im Badehaus war tatsächlich ziemlich kalt, und Sperber blieb nicht lange. Er schlüpfte in einen weichen weißen Morgenrock und schritt durch die dämmrigen Korridore des Schlosses zur hell erleuchteten Küche, wo Khalad mit dem verschlafen aussehenden Kalten wartete.
»Heil, edler Prinzgemahl«, begrüßte Kalten ihn trocken. Der alte Freund war offenbar nicht sehr erfreut darüber, dass man ihn mitten in der Nacht aus dem warmen Bett geholt hatte.
»Heil, edler Jugendgefährte des edlen Prinzgemahls«, entgegnete Sperber.
»Also, das ist ein umständlicher Titel«, brummte Kalten säuerlich. »Was ist so wichtig, dass es nicht warten könnte?«
Sperber setzte sich an einen der Tische, und ein Bäcker in weißem Kittel brachte ihm eine Platte mit Roastbeef und einem noch dampfenden Brotlaib, frisch aus dem Ofen.
»Danke, Nachbar«, sagte Sperber zu ihm.
»Wo warst du, Sperber?«
Kalten setzte sich ihm gegenüber an den breiten Tisch; er hielt eine Weinkaraffe in der einen, einen Zinnbecher in der anderen Hand.
»Sarathi hat mich nach Lamorkand geschickt«, erwiderte Sperber und riss ein großes Stück Brot vom Laib.
»Deine teure Gemahlin hat inzwischen jedem im Schloss die Hölle heiß gemacht, weißt du.«
»Schön, dass sie sich um mich sorgt.«
»Wir waren hier weniger darüber erfreut. Was wollte Dolmant denn aus Lamorkand?«
»Informationen. Er hatte Zweifel an der Wahrheit einiger Berichte.«
»Zweifel? Verstehe ich nicht. Die Lamorker gehen doch nur ihrem üblichen Zeitvertreib nach, dem Bürgerkrieg.«
»Diesmal scheint es ein bisschen anders zu sein. Erinnerst du dich an Graf Gerrich?«
»Der uns in Baron Alstroms Burg belagerte? Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber seinen Namen hab ich mir gemerkt.«
»Es hat den Anschein, als wäre Gerrich der große Nutznießer aller Streitigkeiten in Westlamorkand, und fast jeder dort ist überzeugt, dass er ein Auge auf den Thron geworfen hat.«
»Na und?« Kalten bediente sich von Sperbers Brotlaib. »Jeder Baron in Lamorkand würde gern auf dem Thron sitzen. Was beunruhigt Dolmant in diesem Fall?«
»Gerrich hat Bündnisse außerhalb der lamorkischen Grenzen geschlossen. Ein paar von diesen pelosischen Grenzbaronen sind mehr oder minder unabhängig von König Soros.«
»In Pelosien ist jeder unabhängig von Soros. Man kann ihn nicht gerade als guten König bezeichnen. Für meinen Geschmack betet er ein bisschen zu viel.«
»Ein seltsamer Standpunkt für einen Soldaten Gottes«, murmelte Khalad.
»Alles Übertriebene ist ungesund, Khalad«, erklärte Kalten ihm. »Zu viel beten trübt den Verstand.«
»Wie dem auch sei«, fuhr Sperber fort, »falls es Gerrich gelingt, diese pelosischen Barone ins Schlepptau zu nehmen, wenn er nach König Friedahls Thron greift, wird dem König nichts anderes übrig bleiben, als Pelosien den Krieg zu erklären. Die Kirche ist bereits in einen Krieg in Rendor verwickelt, und Dolmant legt keinen Wert auf eine zweite Front.« Er machte eine Pause. »Aber ich bin noch auf etwas anderes gestoßen«, fuhr er fort. »Zufällig hörte ich ein Gespräch, das nicht für meine Ohren bestimmt war. Dabei fiel der Name ›Fyrchtnfles‹. Sagt er dir etwas?«
Kalten zuckte mit den Schultern. »Er war einst der Nationalheld der Lamorker, aber das ist schon lange her. Angeblich war Fyrchtnfles etwa zwölf Fuß groß, aß jeden Morgen einen Ochsen zum Frühstück und trank jeden Abend ein großes Fass Met. Der Sage nach konnte er Felsen mit einem einzigen Blick zerschmettern und die Sonne mit einer Hand anhalten. Aber das könnte natürlich ein bisschen übertrieben sein.«
»Sehr komisch. Die Gruppe, die ich belauschte, sprach davon, dass er zurückgekehrt sei.«
»Na, das wär was! Man erzählt, dass sein engster Freund ihn umgebracht hat. Stach ihn in den Rücken und stieß einen Speer durch sein Herz. Ihr wisst ja, wie Lamorker sind.«
»Es ist ein merkwürdiger Name«, meinte Khalad. »Was bedeutet er?«
»Fyrchtnfles?« Kalten kratzte sich am Kopf. »›Furcht einflößender‹, würde ich sagen. Lamorker Mütter lassen sich so was einfallen, wenn ihre Kinder nicht artig sind.« Er leerte seinen Becher und hielt die Kanne darüber, bis sie auch die letzten paar Tropfen hergab. »Sprechen wir noch länger?«, fragte er. »Wenn wir auch den Rest der Nacht hier sitzen, gehe ich noch Wein holen. Aber um ehrlich zu sein, Sperber, ich würde lieber in mein kuscheliges, warmes Bett zurück!«
»Und zu Eurer kuscheligen, warmen Kammerzofe?«, fügte Khalad hinzu.
»Sie wird sich einsam und verlassen fühlen.« Kalten zuckte die Achseln. Dann wurde er ernst. »Wenn die Lamorker wieder von Fyrchtnfles zu reden anfangen, fühlen sie sich bedroht. Fyrchtnfles wollte die Welt beherrschen. Jedes Mal, wenn die Lamorker ihn beschwören, ist es ein Anzeichen dafür, dass sie sich außerhalb ihrer Grenzen Ellbogenfreiheit verschaffen wollen.«
Sperber schob seine Platte zur Seite. »Jetzt, mitten in der Nacht, ist es zu spät, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Geh wieder ins Bett, Kalten. Du auch, Khalad. Morgen reden wir weiter darüber. Ich sollte meiner Gemahlin jetzt wirklich einen Höflichkeitsbesuch abstatten.« Er erhob sich.
»Mehr nicht?« Kalten blickte ihn an. »Nur einen Höflichkeitsbesuch?«
»Es gibt viele Arten von Höflichkeit, Kalten.«
Die Korridore im Schloss wurden von den Kerzen, die in großen Abständen in Wandhalterungen steckten, schummrig beleuchtet. Sperber ging leise am Thronsaal vorbei zu den königlichen Gemächern. Wie üblich döste Mirtai in einem Sessel vor der Tür. Sperber blieb stehen und betrachtete die tamulische Riesin. Wenn sie schlief, war ihr Gesicht von ergreifender Schönheit. Die Haut sah im Kerzenschein golden aus, und ihre Wimpern waren so lang, dass sie die Wangen berührten. Sie hatte ihr Schwert auf dem Schoß und die Rechte leicht um den Griff gelegt.
»Glaubt nicht, dass Ihr Euch unbemerkt anschleichen könnt, Sperber«, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen.
»Woher habt Ihr gewusst, dass ich es bin?«
»Ich kann Euch riechen. Ihr Elenier vergesst offenbar, dass wir Nasen haben.«
»Aber wie konntet Ihr riechen, dass ich es bin? Ich habe eben erst gebadet!«
»Auch das ist mir nicht entgangen. Ihr hättet Euch die Zeit nehmen sollen, das Wasser ein bisschen mehr aufzuheizen.«
»Manchmal versetzt Ihr mich wirklich in Erstaunen, wisst Ihr das?«
»Dann seid Ihr leicht in Erstaunen zu versetzen, Sperber.« Sie hob die Lider. »Wo seid Ihr gewesen? Ehlana war der Verzweiflung nahe!«
»Wie geht es ihr?«
»Wie immer. Wollt Ihr sie denn nie erwachsen werden lassen? Ich bin’s allmählich leid, einem Kind zu gehören.« Mirtai betrachtete sich als Eigentum Königin Ehlanas – was sie jedoch nicht daran hinderte, die königliche Familie von Elenien mit eiserner Hand zu regieren und zu entscheiden, was für sie gut war und was nicht. Brüsk hatte sie alle Versuche der Königin unterbunden, sie zur Gefährtin zu machen. Eine atanische Tamulerin und ihre Rasse, behauptete Mirtai, seien vom Wesen her ungeeignet für die Freiheit. Sperber neigte stark dazu, Mirtai beizupflichten, denn er bezweifelte nicht, dass Mirtai binnen kürzester Zeit ganze Städte entvölkern könnte, wenn man sie ihren Instinkten folgen ließ.
Mit unbeschreiblicher Anmut erhob sie sich. Sie war gut vier Zoll größer als Sperber, und wieder hatte er das seltsame Gefühl zu schrumpfen, als er zu der Riesin aufblickte. »Weshalb habt Ihr so lange gebraucht?«, fragte sie.
»Ich musste nach Lamorkand.«
»War das Eure Idee?«
»Nein. Dolmant hat mich geschickt.«
»Sagt das Ehlana. Klipp und klar! Falls sie glaubt, Ihr hättet Euch selbst zu der Reise entschlossen, wird die Streiterei wochenlang dauern, und dieses ständige Gezänk geht mir auf die Nerven.« Sie brachte den Schlüssel zum königlichen Schlafgemach zum Vorschein und blickte Sperber durchdringend an. »Seid sehr nett zu ihr, Sperber. Sie hat Euch unbeschreiblich vermisst und braucht jetzt einen greifbaren Beweis Eurer Zuneigung. Und vergesst nicht, die innere Tür des Schlafgemachs zu verriegeln. Für gewisse Dinge ist Eure Tochter noch ein wenig zu jung.« Sie schloss die Tür auf.
»Mirtai, müsst Ihr uns wirklich jede Nacht einsperren?«
»Ja. Bevor ich nicht sicher bin, dass keiner von Euch hier draußen herumwandert, kann ich nicht schlafen.«
Sperber seufzte. »Ach übrigens«, sagte er. »Kring war in Chyrellos. Wahrscheinlich taucht er in einigen Tagen hier auf, um wieder mal um Eure Hand anzuhalten.«
»Wird auch Zeit!« Sie lächelte. »Seit seinem letzten Heiratsantrag sind drei Monate vergangen. Ich dachte schon, er liebt mich nicht mehr.«
»Werdet Ihr ihn je erhören?«
»Das wird sich zeigen. Weckt jetzt Eure Gemahlin, Sperber. Ich werde Euch am Morgen wieder herauslassen.« Sie schob ihn sanft durch die Tür und verschloss sie hinter ihm sogleich wieder.
Sperbers Tochter, Prinzessin Danae, lag zusammengekuschelt in einem großen Sessel am Kamin. Danae war jetzt sechs. Sie hatte schwarzes Haar, eine Haut so weiß wie Milch, große dunkle Augen und ein rosiges Mündchen. Sie war ganz junge Dame, gab sich ernst und sehr erwachsen. Dennoch war ein arg mitgenommenes Plüschtier namens Rollo ihr ständiger Begleiter. Prinzessin Danae hatte Rollo von ihrer Mutter geerbt. Wie üblich hafteten Grasflecken an den zierlichen Füßen des kleinen Mädchens. »Du hast dir Zeit gelassen, Sperber«, tadelte sie ihren Vater.
»Danae«, rügte er sie seinerseits, »du weißt genau, dass du mich nicht beim Namen nennen sollst! Wenn deine Mutter das hört, wird sie anfangen, Fragen zu stellen.«
»Sie schläft.« Danae zuckte mit den Schultern.
»Bist du ganz sicher?«
Sie bedachte ihn mit einem niederschmetternden Blick. »Natürlich bin ich sicher! Ich mache keine Fehler! Wie du weißt, kann ich dafür sorgen, dass niemand uns hört. Wo warst du?«
»Ich musste nach Lamorkand.«
»Und auf den naheliegenden Gedanken, Mutter Bescheid zu geben, bist du wohl nicht gekommen? Die letzten paar Wochen war sie unerträglich!«
»Ich weiß. Das habe ich inzwischen von mehreren Seiten gehört. Aber ich wusste nicht, dass ich so lange fort sein würde. Ich bin froh, dass du wach bist. Vielleicht kannst du mir helfen.«
»Ich werd’s mir überlegen – wenn du lieb zu mir bist.«
»Ich will es versuchen. Was weißt du über Fyrchtnfles?«
»Er war ein Barbar. Aber schließlich war er Elenier; da kann man ja nichts anderes erwarten.«
»Deine Vorurteile kommen wieder mal durch!«
»Niemand ist vollkommen. Woher rührt dein plötzliches Interesse an alten Geschichten?«
»In Lamorkand geht das Gerücht, dass Fyrchtnfles zurückgekehrt ist. Dort sitzt alle Welt mit ehrfürchtiger Miene herum und wetzt die Schwerter. Was steckt wirklich dahinter?«
»Fyrchtnfles war vor drei- oder viertausend Jahren ihr König. Kurz nachdem ihr Elenier das Feuer entdeckt hattet und aus euren Höhlen gekrochen seid.«
»Ein bisschen mehr Respekt, bitte.«
»Gewiss, Vater. Dieser Barbar, Fyrchtnfles, schmiedete die Lamorker zu einer Art Einheit zusammen. Dann machte er sich daran, die Welt zu erobern. Die Lamorker waren sehr beeindruckt von ihm. Er betete jedoch die alten lamorkischen Götter an, und deine elenische Kirche fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass ein Heide auf dem Thron der ganzen Welt sitzen könnte. Deshalb ließ sie ihn ermorden.«
»So etwas würde die Kirche niemals tun!«, sagte Sperber entschieden.
»Möchtest du die Geschichte hören oder ein theologisches Streitgespräch führen? Nachdem Fyrchtnfles beseitigt war, schlitzten lamorkische Priester ein paar Hühnern den Bauch auf und spielten mit ihren Eingeweiden herum, um die Zukunft daraus zu lesen. Ein wirklich abscheulicher Brauch, Sperber. Und der Geruch!« Sie schauderte.
»Was siehst du mich an? Ich hab’s nicht erfunden.«
»Ihre Augurien, wie die Lamorker es nannten, sagten ihnen voraus, dass Fyrchtnfles eines Tages zurückkehren und dort weitermachen würde, wo er aufgehört hatte, und dass er die Lamorker zu den Beherrschern der Welt machen würde.«
»Soll das heißen, sie glauben wirklich daran?«
»Früher haben sie’s geglaubt.«
»Es gibt auch Gerüchte über eine Rückkehr zur Anbetung alter heidnischer Götter.«
»Damit ist zu rechnen. Wenn ein Lamorker über Fyrchtnfles nachzudenken beginnt, holt er dabei die alten Götter aus der Versenkung. Ist das nicht töricht? Gibt es denn nicht genügend echte Götter für sie?«
»Die alten lamorkischen Götter sind also nicht echt?«
»Natürlich nicht! Wo hast du deinen Verstand gelassen, Sperber?«
»Die Trollgötter sind echt. Was ist da für ein Unterschied?«
»Ein riesiger, Vater. Das weiß doch jedes Kind.«
»Wenn du es sagst, wird es schon stimmen. Wie wär’s, wenn du jetzt wieder ins Bett verschwindest?«
»Erst, wenn du mir einen Kuss gegeben hast.«
»Oh, entschuldige. Ich war in Gedanken.«
»Achte lieber auf die wirklich wichtigen Dinge, Sperber. Oder möchtest du, dass ich dahinwelke?«
»Natürlich nicht!«
»Dann gib mir einen Kuss.«
Er tat es. Wie immer duftete sie nach Gras und Bäumen. »Wasch dir die Füße«, riet er ihr.
»Muss das sein?«
»Möchtest du deiner Mutter diese Grasflecken eine Woche lang erklären müssen?«
»Ist das alles, was ich von dir bekomme?«, protestierte sie. »Einen dürftigen Kuss und Badeanweisungen?«
Er lachte, hob sie hoch und küsste sie wieder – mehrmals. Dann setzte er sie zu Boden. »Und jetzt marsch, ab mit dir!«
Sie verzog schmollend den Mund, dann seufzte sie. Sie kehrte zu ihrem Schlafgemach zurück und zog Rollo an einem Bein hinter sich her. »Halt Mutter nicht die ganze Nacht wach«, sagte sie über die Schulter. »Und bitte, versuch wenigstens leise zu sein. Warum müsst ihr überhaupt immer so laut dabei herumpoltern?« Sie blickte verschmitzt drein. »Wieso wirst du rot, Vater?«, fragte sie unschuldsvoll. Dann lachte sie, ging in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
Sperber war nie ganz sicher, ob seine Tochter wirklich begriff, was solche Bemerkungen andeuteten, wenngleich er natürlich nicht im Geringsten daran zweifelte, dass sie es auf einer Ebene ihrer eigenartig vielschichtigen Persönlichkeit durchaus verstand. Er schob den Riegel vor ihre Tür, dann begab er sich ins Schlafgemach, das er mit seiner Gemahlin teilte. Auch diese Tür schloss er hinter sich und verriegelte sie.
Das Feuer war fast bis zur Glut heruntergebrannt, spendete aber noch genügend Licht, dass Sperber die junge Frau sehen konnte, die der Mittelpunkt seines Lebens war. Die üppige Fülle ihres aschblonden Haares bedeckte ihr Kopfkissen, und im Schlaf sah sie unsagbar jung und verwundbar aus. Er blieb am Fuß des Bettes stehen und blickte sie an. In ihrem Gesicht konnte er immer noch das kleine Mädchen sehen, das er ausgebildet und geformt hatte. Er seufzte. Solche Gedanken stimmten ihn stets melancholisch, denn sie erinnerten ihn daran, dass er im Grunde genommen viel zu alt für Ehlana war. Sie hätte einen jungen Gemahl haben müssen – einen, der nicht so zernarbt und von Kämpfen gezeichnet war, einen, der besser aussah als er. Sperber fragte sich müßig, wann und wie er jenen Fehler begangen hatte, der Ehlanas Zuneigung so sehr auf ihn lenkte, dass sie sich weigerte, die Wahl eines anderen Gatten auch nur in Erwägung zu ziehen. Wahrscheinlich war es etwas Geringfügiges – ja Unbedeutendes – gewesen. Wer konnte schon wissen, welche Wirkung selbst die kleinste Geste auf einen anderen Menschen haben mochte?
»Ich weiß, dass du da bist, Sperber«, sagte auch Ehlana, ohne die Augen zu öffnen. Ihre Stimme klang ein wenig gereizt.
»Ich habe die Aussicht bewundert.« Ein bisschen Schmeichelei konnte das heraufziehende Gewitter vielleicht vertreiben, obwohl Sperbers Hoffnung nicht sehr groß war.
Ehlana schlug die grauen Augen auf.
»Komm her!«, befahl sie und streckte ihm die Arme entgegen.
»Ich war immer schon Eurer Majestät gehorsamster Diener.« Er grinste sie an und trat an die Seite des Bettes.
»Ach, ja?« Sie legte ihm die Arme um den Hals und küsste ihn.
»Meinst du, wir könnten den Ehekrieg auf morgen früh verschieben, Liebling?«, fragte Sperber. »Ich bin ein bisschen müde. Wie wär’s, wenn wir uns zuerst mit dem Versöhnen und erst dann mit dem Streiten beschäftigen?«
»Mach dich nicht lächerlich! Dann würde ich ja meinen ganzen Ärger überspringen müssen. Was glaubst du, was ich mir alles an Vorwürfen für dich zurechtgelegt habe?«
»Ich kann es mir vorstellen. Aber weißt du, Dolmant hat mich nach Lamorkand geschickt, und die Reise hat leider länger gedauert, als ich erwartet habe.«
»Das ist nicht fair, Sperber«, sagte sie schmollend.
»Was meinst du damit?«
»Du solltest damit warten, bis ich eine Erklärung von dir verlangt hätte. Jetzt hast du mir die ganze Freude verdorben!«
»Kannst du mir je verzeihen?« Er bemühte sich um eine übertrieben zerknirschte Miene und küsste seine Gemahlin auf den Hals. Er hatte entdeckt, dass sie diese kleinen Spielchen liebte.
»Ich werde darüber nachdenken.« Ehlana lachte und erwiderte seinen Kuss. »Na gut«, ließ sie sich schließlich herab. »Nachdem du mir den Spaß nicht gelassen hast, kannst du mir gleich erzählen, was du getan und warum du mich nicht benachrichtigt hast, dass es länger dauern würde.«
»Politische Erwägungen, Liebling. Du kennst Dolmant. Die Lage in Lamorkand ist sehr bedrohlich. Sarathi wollte eine fachmännische Einschätzung der dortigen Situation. Aber es durfte niemand erfahren, dass ich auf seine Anweisung dorthin reiste. Er hat untersagt, Botschaften zu schicken, da sie abgefangen werden könnten.«
»Ich glaube, ich muss mit unserem hochverehrten Erzprälaten mal ein klärendes Gespräch führen«, stellte Ehlana fest. »Er hat offenbar Schwierigkeiten, sich zu erinnern, wer ich bin.«
»Davon rate ich dir ab, Ehlana.«
»Oh, ich habe nicht vor, einen Streit mit ihm anzuzetteln, Schatz. Ich werde ihn lediglich darauf aufmerksam machen, dass er es an der nötigen Höflichkeit mangeln lässt. Dolmant soll mich gefälligst erst fragen, bevor er meinen Gemahl in der Welt herumschickt. Ich werde Seiner Erhabenheit ein wenig müde. Jawohl, ich werde ihn Manieren lehren!«
»Darf ich dabei sein? Das möchte ich um nichts in der Welt versäumen.«
Sie funkelte ihn an. »Wenn du dir nicht auch eine Rüge einfangen möchtest, dann fange jetzt lieber mit der Versöhnung an.«
»Das wollte ich gerade«, versicherte Sperber und drückte sie fester an sich.
»Warum hast du so lange gewartet?«, hauchte sie.
Es war viel später, und der Unmut der Königin von Elenien war spürbar geschwunden. »Was hast du in Lamorkand herausgefunden, Sperber?«, fragte sie und streckte sich genüsslich.
»Westlamorkand ist zurzeit in hellem Aufruhr. Ein Graf steckt dahinter – er heißt Gerrich. Wir sind ihm auf unserer Suche nach dem Bhelliom begegnet. Er war in einen dieser verschlagenen Pläne verwickelt, mit denen Martel während der Wahl des neuen Erzprälaten die Ritterorden von Chyrellos fernhalten wollte.«
»Das spricht Bände über den Charakter dieses Grafen.«
»Vielleicht. Aber Martel war ein Meister, wenn es um die Beeinflussung der richtigen Leute ging. Jedenfalls gelang es ihm, einen kleinen Krieg zwischen Gerrich und Patriarch Ortzels Bruder vom Zaun zu brechen. Dieser Krieg hat den Horizont des Grafen ein wenig geweitet. Jetzt interessiert er sich sogar für den Thron.«
»Armer Freddie.« Ehlana seufzte. König Friedahl von Lamorkand war ein entfernter Vetter. »Ich möchte seinen Thron nicht geschenkt. Aber worüber macht die Kirche sich Sorgen? Freddies Streitkräfte sind stark genug, sich eines ehrgeizigen Grafen zu erwehren.«
»So einfach ist das nicht, Liebling. Gerrich hat Bündnisse mit anderen Edlen in Westlamorkand geschlossen und inzwischen eine Armee um sich geschart, die fast so mächtig ist wie die des Königs. Und er hat offenbar Gespräche mit den pelosischen Baronen um den Vennesee geführt.«
»Diese Banditen!«, sagte Ehlana abfällig. »Jeder kann sie kaufen!«
»Du kennst dich in der Politik dieser Region gut aus, Ehlana.«
»Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, Sperber. Pelosien liegt hinter der Nordostgrenze des Reiches. Stellen diese Unruhen eine Bedrohung für uns dar?«
»Im Moment nicht. Gerrich hat den Blick begehrlich nach Osten gerichtet – auf die Hauptstadt.«
»Vielleicht sollte ich Freddie unsere Unterstützung anbieten«, überlegte sie laut. »Falls es dort tatsächlich zu einem Krieg kommt, dann könnte ich ein schönes Stück von Südwestpelosien für uns abzweigen.«
»Haben wir territoriale Ambitionen, Majestät?«
»Nicht heute Nacht, Sperber«, versicherte sie ihm. »Da beschäftigt mich etwas ganz anderes.« Und sie schlang wieder die Arme um ihn.
Es war noch viel später, fast schon Morgen. Ehlanas regelmäßiger Atem verriet Sperber, dass sie schlief. Er glitt aus dem Bett und trat ans Fenster. Seine Jahre militärischer Ausbildung hatten es ihm zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag, noch vor Sonnenaufgang, einen Blick aufs Wetter zu werfen.
Der Regen hatte nachgelassen, doch der Wind blies stürmischer. Das Frühjahr war gerade erst angebrochen, und in den nächsten Wochen konnte man noch kaum mit schönem Wetter rechnen. Sperber war froh, dass er bereits zu Hause war, denn der kommende Tag sah nicht sehr vielversprechend aus. Er blickte hinaus auf die flackernden, unregelmäßig brennenden Fackeln auf dem windigen Hof.
Wie immer bei schlechtem Wetter, wanderten Sperbers Gedanken zurück zu den Jahren, die er in der heißen Stadt Jiroch an der von Dürre heimgesuchten Nordküste Rendors zugebracht hatte, wo die verschleierten und schwarz vermummten Frauen im ersten stahlgrauen Licht des Morgens zum Brunnen pilgerten, und wo die Frau, die sich Lillias nannte, ihm jede Nacht die Zeit mit ihrer Liebe vertrieben hatte – dem, was sie für Liebe hielt. Auch an die Nacht in Cippria, als es Martels Henkersknechten beinahe gelungen wäre, ihm den Lebensfaden zu durchschneiden, dachte Sperber zurück. Doch er hatte die Rechnung mit Martel in Azashs Tempel in Zemoch beglichen; deshalb bestand kein Grund, sich den Viehhof in Cippria oder die Klosterglocken in Erinnerung zu rufen, die ihn aus der Dunkelheit gerufen hatten.
Das flüchtige Gefühl, beobachtet zu werden, das Sperber auf der engen Gasse befallen hatte, ließ ihm noch immer keine Ruhe. Irgendetwas ging vor sich, das er nicht verstand. Sperber wünschte sich inbrünstig, mit Sephrenia darüber reden zu können.
2
»Majestät!«, rief Graf von Lenda bestürzt. »Ihr könnt Euch doch dem Erzprälaten gegenüber nicht einer solchen Sprache bedienen!« Lenda starrte stirnrunzelnd auf das Schreiben, das die Königin ihm soeben zu lesen gegeben hatte. »Fehlt nur noch, dass Ihr ihn einen Dieb und Schurken schimpft!«
»Ach, habe ich das vergessen?«, fragte Ehlana. »Wie konnte ich nur!« Sie hatten sich in der blauen Ratskammer eingefunden, wie üblich zu dieser Vormittagsstunde.
»Könnt Ihr nicht mit ihr reden, Sperber?«, flehte Lenda.
»Oh Lenda!« Ehlana lachte und schenkte dem gebrechlichen alten Mann ein Lächeln. »Das ist doch bloß ein Entwurf! Ich war ein wenig verärgert, als ich ihn verfasste.«
»Ein wenig?«
»Ich weiß, dass wir das Schreiben nicht in dieser Form absenden können, Graf. Ich wollte lediglich, dass Ihr meine Gefühle in dieser Angelegenheit kennt, ehe wir es umformulieren und uns einer diplomatischen Sprache bedienen. Ich will nur deutlich machen, dass Dolmant seine Befugnisse überschreitet. Er ist Erzprälat, nicht Kaiser. Die Kirche hat ohnedies bereits zu viel Autorität in weltlichen Dingen, und wenn Dolmant nicht gezügelt wird, sind die Monarchen Eosiens bald nur noch seine Vasallen. Tut mir leid, meine Herren. Ich bin zwar eine wahre Tochter der Kirche, aber ich werde mich vor Dolmant nicht auf die Knie werfen und eine Krönungszeremonie über mich ergehen lassen, die keinen anderen Zweck hat, als mich zu demütigen.«
Sperber staunte insgeheim über die politische Reife seiner Gemahlin. Die Machtstruktur auf dem eosischen Kontinent war schon immer von dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen kirchlicher Autorität und königlicher Macht bestimmt worden. Geriet dieses Gleichgewicht ins Schwanken, kamen die Dinge aus dem Lot. »Es spricht einiges für den Standpunkt Ihrer Majestät, Lenda«, sagte Sperber nachdenklich. »Die letzte Generation eosischer Monarchen war alles andere denn stark. Aldreas war …« Er suchte nach einem angemessenen Wort.
»Unfähig«, charakterisierte Ehlana ihren Vater kühl.
»Na ja, ganz so krass hätte ich es nicht ausgedrückt«, murmelte Sperber. »Wargun ist launenhaft, Soros ein religiöser Hysteriker, Obler ein Greis, und Friedahl ist nur eine Marionette seiner Barone. Dregos tut, was seine Sippschaft entscheidet, König Brisant von Cammorien ist ein Lüstling, und vom derzeitigen König von Rendor weiß ich nicht einmal den Namen.«
»Ogyrin«, warf Kalten ein.
»Jedenfalls«, Sperber lehnte sich in seinem Sessel zurück und rieb sich nachdenklich die Wange, »gerade in Aldreas’ Amtszeit hatten wir einige sehr tüchtige Kirchenmänner in der Hierokratie. Cluvonus’ Siechtum ermutigte die Patriarchen, mehr oder weniger selbstständig vorzugehen. Stand irgendwo ein Thron leer, hätte man eine viel schlechtere Wahl treffen können, als Emban darauf zu setzen – oder Bergsten. Ja sogar Annias war politisch außerordentlich geschickt. Wenn Könige schwach sind, wird die Kirche stark – manchmal zu stark.«
»Nur heraus mit der Sprache, Sperber«, brummte Platime. »Wollt Ihr damit sagen, wir sollen der Kirche den Krieg erklären?«
»Nicht sofort, Platime. Wir sollten den Gedanken jedoch für den Notfall in Erwägung ziehen. Momentan halte ich es für angebracht, Chyrellos einen Wink zu geben, und unsere Königin ist vielleicht genau die Richtige dafür. Nach dem Aufruhr, den sie bei Dolmants Wahl in der Hierokratie verursacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass die Kirchenleute alles, was sie sagt, sehr sorgfältig bedenken werden. Ich glaube nicht, dass wir dieses Schreiben allzu sehr entschärfen sollten, Lenda. Schließlich gilt es, die Kirchenfürsten auf unsere Sorgen aufmerksam zu machen.«
Lendas Augen glänzten. »Ja, genau so muss dieses Spiel gespielt werden, meine Freunde!«, rief er begeistert.
»Euch ist doch klar, dass es Dolmant möglicherweise gar nicht bewusst war, dass er seine Befugnisse überschritt«, gab Kalten zu bedenken. »Vielleicht hat er Sperber als den Interimspräzeptor des Pandionischen Ordens nach Lamorkand gesandt und dabei völlig übersehen, dass der gute Mann auch Prinzgemahl ist. Der Sarathi hat momentan ziemlich viel um die Ohren.«
»Wenn er so vergesslich ist, hat er auf dem Erzprälatenthron nichts verloren«, sagte Ehlana entschieden. Sie kniff die Augen zusammen, was bei ihr immer ein bedrohliches Zeichen war. »Wir müssen ihm deutlich klarmachen, dass er meine Gefühle verletzt hat. Dann wird er sich mit allen Kräften bemühen, mich zu besänftigen. Das kann ich vielleicht dazu nutzen, mir dieses Herzogtum nördlich von Vardenais zurückzuholen. Lenda, gibt es irgendeine Möglichkeit, die Leute daran zu hindern, ihre Ländereien der Kirche zu vermachen?«
»Das ist ein sehr alter Brauch, Majestät.«
»Ich weiß, aber das Land gehörte ursprünglich der Krone! Sollten wir da nicht ein Wörtchen mitzureden haben, wer es erbt? Man sollte meinen, dass das Land an mich zurückgeht, wenn ein Edelmann ohne Nachkommen stirbt. Aber jedes Mal, wenn ein Edler kinderlos bleibt, scharen sich die Kirchenmänner wie Geier um ihn und tun ihr Möglichstes, dass er ihnen das Land vermacht.«
»Schafft ein paar Titel ab«, schlug Platime vor. »Macht es zum Gesetz, dass ein kinderloser Adeliger keine testamentarischen Verfügungen über sein Land treffen kann.«
Lenda stöhnte auf. »Die Aristokratie würde rebellieren!«, sagte er.
»Um Aufstände niederzuschlagen, haben wir die Armee.« Platime zuckte mit den Schultern. »Wisst Ihr was, Ehlana? Ihr erlasst das Gesetz, und ich sorge dafür, dass den lautesten Schreihälsen einige sehr öffentliche und sehr blutige Unfälle zustoßen. Aristokraten sind nicht besonders klug, aber ich glaube, das werden sie begreifen.«
»Was meint Ihr?«, wandte Ehlana sich an den Grafen von Lenda. »Käme ich damit durch?«
»Aber Majestät! Das könnt Ihr doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen!«
»Irgendetwas muss ich tun, Lenda. Die Kirche verschlingt mein Land Morgen um Morgen, und kaum übernimmt sie einen Landbesitz, sehe ich keinen Heller Steuer mehr dafür!« Sie hielt nachdenklich inne. »Das könnte eine Möglichkeit sein, die Aufmerksamkeit der Kirche zu erlangen, wie Sperber vorschlug. Wie wär’s, wenn wir ein übertrieben entrechtendes Gesetz entwerfen und dafür sorgen, dass eine Kopie ›zufällig‹ in die Hände eines Kirchenmannes mittelhohen Ranges fällt? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Dolmant sie in den Fingern hat, noch ehe die Tinte trocken ist.«
Lenda schüttelte den Kopf. »Das ist skrupellos, Majestät!«
»Freut mich, dass Ihr mir beipflichtet, Graf.« Ehlana schaute sich um. »Sonst noch etwas, meine Herren?«
»Bei Cardos treiben sich ein paar Banditen ohne Genehmigung im Gebirge herum, Ehlana«, brummte Platime. Der fette, schwarzbärtige Mann hatte im Sitzen die Füße auf den Tisch gelegt. Sein Wams war zerknittert und wies eine ganze Speisekarte von Flecken auf. Sein zotteliges Haar hing über Stirn und Augen. Er brachte einfach keine Titel über die Lippen, doch die Königin hatte sich daran gewöhnt.
»Banditen ohne Genehmigung?«, fragte Kalten amüsiert.
»Ihr wisst, was ich meine«, knurrte Platime. »Sie haben keine Erlaubnis des Diebesrats, in der Gegend ihrem Gewerbe nachzugehen, und verstoßen gegen sämtliche Regeln. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, es sind ehemalige Helfershelfer des Primas von Cimmura. Da habt Ihr einen Fehler gemacht, Ehlana. Ihr hättet sie festnehmen lassen sollen, bevor Ihr sie für gesetzlos erklärt.«
»Na ja«, Ehlana zuckte die Achseln, »niemand ist unfehlbar.« Ehlanas Beziehung zu Platime war höchst ungewöhnlich. Sie hatte erkannt, dass er beim besten Willen keine höfischen Phrasen über die Lippen brachte; deshalb erlaubte sie ihm eine Offenheit, ja, Vertraulichkeit, die sie bei jedem anderen als Beleidigung erachtet hätte. Trotz seiner vielen Fehler entwickelte Platime sich zu einem wertvollen Ratgeber, dessen Meinung sie sehr schätzte. »Es überrascht mich nicht, dass Annias’ alte Kumpane in ihrer Notlage zu Wegelagerern geworden sind. Banditen waren sie im Grunde genommen von Anfang an. Doch es hat in diesen Bergen immer schon Gesetzlose gegeben. Da bezweifle ich, dass eine Bande mehr oder weniger viel ausmacht.«
»Ehlana!« Er seufzte. »Ich könnte eine kleine Schwester nicht mehr lieben als Euch, aber manchmal seid Ihr schrecklich unwissend. Ein Bandit mit Genehmigung kennt die Regeln. Er weiß, welche Reisenden ausgeraubt oder getötet werden dürfen und von welchen er die Pfoten lassen muss. Niemand regt sich übermäßig auf, wenn einem feisten Kaufmann der pralle Beutel geraubt und die Gurgel durchgeschnitten wird. Findet man jedoch einen Regierungsbeamten oder hohen Edelmann tot im Gebirge, müssen die Ordnungshüter einschreiten und zumindest den Eindruck von Zuständigkeit erwecken. Eine derartige behördliche Aufmerksamkeit ist sehr schlecht fürs Geschäft. Völlig unschuldige Banditen werden festgenommen und aufgehängt. Wegelagerei ist nichts für Amateure. Aber da gibt es noch ein weiteres Problem. Diese Banditen machen den Landleuten weis, dass sie gar keine wirklichen Räuber sind, sondern Patrioten, die sich gegen einen grausamen Tyrannen auflehnen – gegen Euch, kleine Schwester. Unter den Bauern herrscht stets ein wenig Unzufriedenheit, sodass einige dergleichen begrüßen. Ihr Edelleute habt kein Recht, Verbrechen zu begehen. Ihr vermischt das immer mit Politik!«
»Aber mein lieber Platime«, sagte Ehlana verschmitzt, »ich dachte, Ihr wüsstet es: Politik ist ein Verbrechen.«
Der Fette brüllte vor Lachen. »Ich liebe dieses Mädchen!«, sagte er zu den anderen. »Macht Euch keine allzu großen Sorgen, Ehlana. Ich werde versuchen, ein paar Männer in ihre Bande einzuschleusen, und mir einen Plan ausdenken, wie ich diese Leute brotlos machen kann.«
»Ich wusste, dass ich mich auf Euch verlassen kann.« Ehlana erhob sich. »Wenn das für heute Vormittag alles ist, bitte ich Euch, mich zu entschuldigen, meine Herren. Ich habe eine Anprobe bei meiner Schneiderin.« Sie blickte sich um. »Kommst du, Sperber?«
»In ein paar Minuten«, antwortete er, »ich möchte noch etwas mit Platime besprechen.«
Sie nickte und ging zur Tür.
»Worum geht es, Sperber?«, fragte Platime.
»Letzte Nacht, als ich durch die Stadt ritt, habe ich Naween gesehen. Sie arbeitet auf der Straße.«
»Naween? Das ist lächerlich. Meist vergisst sie sogar, Geld für ihre Dienste zu nehmen.«
»Das habe ich ihr auch gesagt. Sie und Shanda hatten Streit. Jedenfalls stand Naween an einer Ecke beim Osttor. Ich habe sie in einen Gasthof geschickt, damit sie nicht mehr im Regen herumstehen musste. Können wir irgendetwas für sie tun?«
»Ich kümmere mich darum«, versprach Platime.
Ehlana hatte die Ratskammer noch nicht verlassen. Sperber vergaß mitunter, wie scharf ihre Ohren waren. Sie drehte sich an der Tür um. »Wer ist Naween?«, fragte sie schroff.
»Eine Hure.« Platime zuckte mit den Schultern. »Eine besondere Freundin Sperbers.«
»Platime!«, entrüstete sich Sperber.
»Stimmt das etwa nicht?«
»Nun, ich glaube schon. Aber so, wie Ihr es sagt …« Sperber suchte fieberhaft nach den richtigen Worten.
»Oh! So habe ich es nicht gemeint, Ehlana. Soviel ich weiß, ist Euer Gemahl Euch absolut treu. Naween ist eine Hure. Das ist ihr Gewerbe, aber es hat nichts mit der Freundschaft zu Sperber zu tun. Gewiss, sie hat sich Sperber angeboten, aber das tut sie bei jedem. Sie ist ein sehr großzügiges Mädchen.«
»Bitte, Platime«, Sperber stöhnte, »hört lieber auf, mich zu verteidigen.«
»Naween ist ein braves Mädchen«, fuhr Platime fort, an Ehlana gewandt. »Sie arbeitet fleißig, nimmt sich ihrer Kunden von Herzen an und bezahlt ihre Steuern.«
»Steuern?«, rief Ehlana. »Soll das heißen, dass meine Regierung dieses Gewerbe gutheißt? Dass sie es legitimiert, indem sie es besteuert?«
»Habt Ihr auf dem Mond gelebt, Ehlana? Natürlich bezahlt Naween Steuern. Das tun wir alle. Dafür sorgt schon Lenda. Naween hat Sperber einmal geholfen, als Ihr krank wart. Er suchte nach diesem Krager. Naween hat ihm dabei geholfen. Wie ich schon sagte, sie bot Sperber auch andere Dienste an, doch er lehnte ab – sehr höflich natürlich. Er hat sie damit ein bisschen enttäuscht.«
»Wir werden uns eingehend darüber unterhalten müssen, Sperber«, sagte Ehlana bedeutungsvoll.
»Wie Majestät wünschen.« Er seufzte, als sie kühl aus der Kammer rauschte.
»Sie hat nicht viel Ahnung, wie’s da draußen zugeht, nicht wahr, Sperber?«
»Das liegt an ihrer wohlbehüteten Erziehung.«
»Ich dachte, Ihr habt sie erzogen.«
»Stimmt.«
»Dann seid Ihr selbst schuld. Ich werde Naween zu ihr schicken, damit sie ihr alles erklärt.«
»Habt Ihr den Verstand verloren?«
Talen kehrte am nächsten Tag aus Delos zurück, in Begleitung von Ritter Berit. Sperber und Khalad empfingen sie an der Tür des Pferdestalls. Der Prinzgemahl versuchte, sich so unauffällig wie möglich zu machen, bis die Neugier der Königin nachließ, was Naween betraf.
Talens Nase war rot, die Augen verquollen. »Ich dachte, du würdest auf dem Hof bleiben, bis deine Erkältung auskuriert ist«, sagte Sperber.
»Ich hab diese Bemutterung nicht mehr ausgehalten.« Talen rutschte aus dem Sattel. »Eine Mutter ist schlimm genug, aber meine Brüder und ich haben jetzt gleich zwei. Ich glaube nicht, dass ich je wieder auch nur einen Löffel Hühnerbrühe hinunterbringe. Hallo,
Khalad.«
»Talen«, brummte Sperbers stämmiger junger Knappe. Er musterte seinen Halbbruder. »Deine Augen sehen ja furchtbar aus!«
»Du solltest sie mal von innen sehen!« Talen war jetzt etwa fünfzehn und machte gerade eine dieser »Phasen« durch. Sperber war überzeugt, dass der junge Dieb in den vergangenen sechs Wochen um gut drei Zoll gewachsen war. Ein beachtliches Stück Arm und Handgelenk ragten aus seinen Wamsärmeln. »Glaubt ihr, die Köche haben noch etwas zu essen?«, fragte der Junge. Seines schnellen Wachstums wegen entwickelte Talen einen unglaublichen Appetit.
»Ich habe einige Schriftstücke zum Unterzeichnen für Euch, Sperber«, sagte Berit. »Nichts Dringendes, aber ich dachte, ich reite am besten gleich mit Talen.« Berit trug ein Kettenhemd und ein Breitschwert am Gürtel. Seine Lieblingswaffe war jedoch nach wie vor die schwere Axt, die von seinem Sattel hing.
»Kehrst du ins Ordenshaus zurück?«, fragte Khalad, der sich mit Berit angefreundet hatte.
»Ja. Es sei denn, Sperber hat hier etwas für mich zu tun.«
»Dann komme ich mit dir. Ritter Olart will heute Nachmittag noch ein paar Lanzenübungen mit uns machen.«
»Warum hebst du ihn nicht einfach ein paarmal aus dem Sattel, dann lässt er dich in Ruhe«, riet ihm Berit. »Du kannst es, das weißt du. Du bist jetzt schon besser als er.«
Khalad zuckte die Achseln. »Ich würde seine Gefühle verletzen.«
Berit lachte. »Ganz zu schweigen von seinen Rippen, Schultern und dem Rücken.«
»Es wirkt ein wenig angeberisch, wenn man den Ausbilder übertrumpft«, gab Khalad zu bedenken. »Die anderen Novizen sind ohnehin schon verärgert, weil sie sich mit meinen Brüdern und mir nicht messen können. Wir haben versucht, es ihnen zu erklären, aber sie nehmen es uns übel, weil wir nur einfache Bauern sind. Du weißt ja, wie das ist.« Er blickte Sperber fragend an. »Braucht Ihr mich heute Nachmittag, Hoheit?«
»Nein. Geh nur und verbeul Ritter Olarts Rüstung ein bisschen. Er bildet sich ohnehin zu viel auf seine Geschicklichkeit ein. Lehr ihn die Tugend der Demut.«
»Ich habe wirklich Hunger, Sperber«, beklagte sich Talen.
»Dann wollen wir in die Küche gehen.« Sperber betrachtete seinen jungen Freund kritisch. »Danach werde ich wohl wieder nach dem Schneider schicken müssen. Du wächst wie Unkraut.«
»Ich kann nichts dafür.«
Khalad machte sich daran, sein Pferd zu satteln, während sich Sperber und Talen zur Schlossküche begaben.
Etwa eine Stunde später, als die beiden die königlichen Gemächer betraten, fanden sie Ehlana, Mirtai und Danae vor dem Kamin vor. Die Königin blätterte einige Schriftstücke durch, Danae spielte mit Rollo, und Mirtai wetzte einen ihrer Dolche.
Ehlana blickte von den Dokumenten auf. »Ah«, sagte sie, »da sind ja mein edler Gemahl und mein wandernder Page.«
Talen verbeugte sich, dann zog er die Nase hoch.
»Nimm ein Taschentuch!«, befahl ihm Mirtai.
»Jawohl, Herrin.«