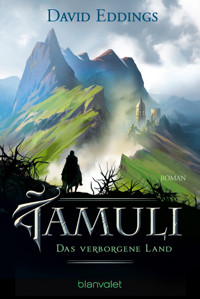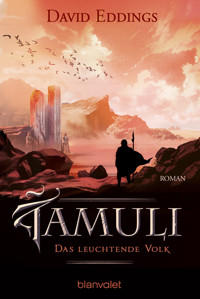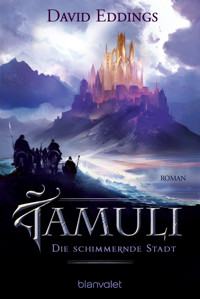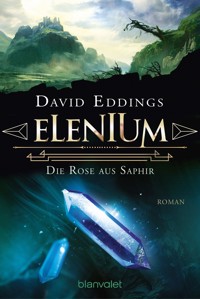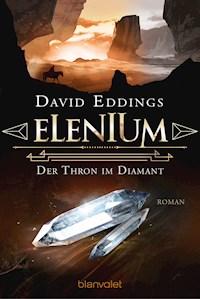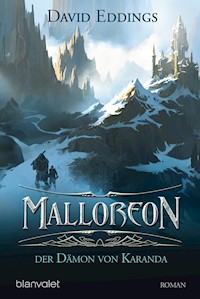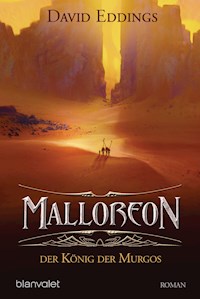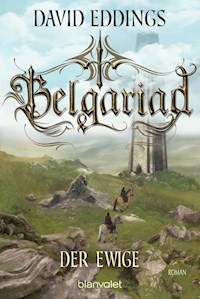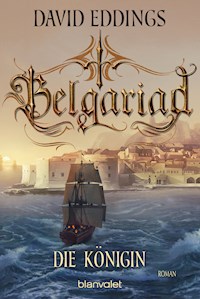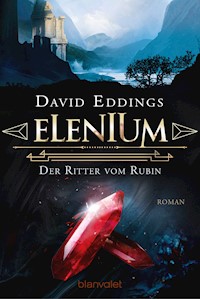
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elenium-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Tapfere Ritter, mutige Königinnen, Götter und Magie - der zweite Band der Elenium-Trilogie von Bestsellerautor David Eddings.
Ritter Sperber und seine Gefährten haben nur noch wenig Hoffnung, die tödlich vergiftete Königin Ehlana zu retten. Doch solange es eine Chance gibt, werden sie nicht aufgeben. Denn sie haben von einem mächtigen magischen Saphir in Form einer Rose erfahren, der Ehlana heilen könnte. Dieser befand sich einst in der Krone des Königs von Thalesien, die seit vielen Jahrhunderten verschollen ist. Allerdings hat Sperber bereits eine neue Spur. Aber als er fast am Ziel ist, erkennt er, dass er nicht der Einzige ist, der die verlorene Krone für sich beanspruchen will. Der zaubermächtige Ghwerig ist ihm einen Schritt voraus …
Die Elenium-Trilogie bei Blanvalet:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus Saphir
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Ritter Sperber und seine Gefährten haben nur noch wenig Hoffnung, die tödlich vergiftete Königin Ehlana zu retten. Doch solange es eine Chance gibt, werden sie nicht aufgeben. Denn sie haben von einem mächtigen magischen Saphir in Form einer Rose erfahren, der Ehlana heilen könnte. Dieser befand sich einst in der Krone des Königs von Thalesien, die seit vielen Jahrhunderten verschollen ist. Allerdings hat Sperber bereits eine neue Spur. Aber als er fast am Ziel ist, erkennt er, dass er nicht der Einzige ist, der die verlorene Krone für sich beanspruchen will. Der zaubermächtige Ghwerig ist ihm einen Schritt voraus …
Autor
David Eddings wurde 1931 in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er 1982 seinen ersten großen Roman, »Belgariad – Die Gefährten«, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Den Höhepunkt seiner Autorenkarriere erreichte er, als der Abschlussband seiner Malloreon-Saga Platz 1 der »New York Times«-Bestsellerliste erreichte. Im Jahr 2009 starb er in Caron City, Nevada.
Von David Eddings bei Blanvalet:
1. Die Gefährten
2. Der Schütze
3. Der Blinde
4. Die Königin
5. Der Ewige
Die Malloreon-Saga:
1. Die Herren des Westens
2. Der König der Murgos
3. Der Dämon von Karanda
4. Die Zauberin von Darshiva
5. Die Seherin von Kell
Die Elenium-Trilogie:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus Saphir
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
David Eddings
Elenium
Der Ritter vom Rubin
Roman
Deutsch von Lore Strassl
Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel »The Ruby Knight. The Elenium-Trilogy 2« bei Del Rey, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 1990 by David Eddings
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Digital Store/Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-6412-9366-6V001
www.blanvalet.de
Inhalt
Prolog
ERSTERTEILRANDERASEE
ZWEITERTEILGHASEK
DRITTERTEILDIETROLLHÖHLE
Für den kleinen Mike»Bitte mit Auto!«Und für Peggy»Wo sind meine Ballons?«
Prolog
DIEGESCHICHTEDESHAUSESSPERBER
(Aus der Chronik der Pandionischen Bruderschaft)
Im fünfundzwanzigsten Jahrhundert fielen die Horden Othas von Zemoch in die elenischen Königreiche von Westeosien ein und trieben auf ihrem Marsch gen Westen alle mit Feuer und Schwert vor sich her. Otha schien unbesiegbar zu sein, bis seine Streitkräfte am Randerasee von den verbündeten Armeen der westlichen Reiche und den vereinigten Kräften der Kirchenritter zu einer gewaltigen Schlacht gestellt wurden. Diese Schlacht in Mittellamorkand tobte wochenlang, bevor die zemochischen Invasoren schließlich zurückgeworfen wurden und zu ihren eigenen Grenzen flohen.
Doch der Sieg der Elenier war teuer erkauft; gut die Hälfte der Kirchenritter blieb auf dem riesigen Schlachtfeld, und die Armeen der elenischen Könige zählten ihre Gefallenen zu Hunderttausenden. Als die siegreichen, aber erschöpften Überlebenden nach Hause zurückkehrten, fanden sie dort einen noch grimmigeren Feind vor: Hungersnot, wie sie üblicherweise die Folge eines Krieges ist.
In Eosien hielt die Hungersnot Generationen an und drohte zeitweilig, den Kontinent zu entvölkern. Es blieb unvermeidlich, dass die Gesellschaftsordnung sich auflöste und in den elenischen Reichen politisches Chaos herrschte. Manche Barone hielten sich nur noch dem Schein nach an ihren Lehnseid. Private Meinungsverschiedenheiten führten oft zu grausamen Kleinkriegen, und Räuber trieben offen ihr Unwesen. Diese Zustände herrschten bis zum Beginn des siebenundzwanzigsten Jahrhunderts.
In diesen unruhigen Zeiten des Aufruhrs und Zerfalls erschien ein Akolyt vor den Toren unseres Mutterhauses in Demos und tat seinen ernsthaften Wunsch kund, in unseren Orden einzutreten. Schon zu Beginn seiner Ausbildung erkannte unser Hochmeister, dass dieser junge Postulant namens Sperber kein gewöhnlicher Mann war. In kürzester Zeit übertraf er seine Mitnovizen und besiegte sogar einige erfahrene Pandioner auf dem Übungsplatz. Doch nicht nur seine körperlichen Leistungen hoben ihn hervor, sondern auch seine überragende Intelligenz. Sperbers Begabung, in die Mysterien von Styrikum einzudringen, war die Freude seines styrischen Lehrers, und er führte seinen Schüler in Gebiete der Magie ein, die weit über das Wissen hinausgingen, das pandionischen Rittern üblicherweise gelehrt wurde. Der Patriarch von Demos war nicht minder erfreut über den wachen Verstand dieses Novizen, und als Sperber sich seine Sporen verdient hatte, war er auch in Philosophie und in theologischen Disputationen bewandert.
Etwa zu der Zeit, da Sperber zum Ritter geschlagen wurde, bestieg der jugendliche König Antor den elenischen Thron in Cimmura, und das Leben der beiden jungen Männer war bald eng miteinander verflochten. König Antor war ein hitziger, ja tollkühner Jüngling, und Überfälle durch Banditen an der Nordgrenze seines Reiches hatten seinen Zorn so sehr erregt, dass er alle Vorsicht in den Wind schrieb und mit viel zu wenig Mannen an der Spitze einer Strafexpedition gen Norden zog. Als dies in Demos kundwurde, stellte der Hochmeister der Pandioner sogleich einen Trupp zu des Königs Entsatz zusammen, und einer der Streiter war Ritter Sperber.
König Antor musste derweil rasch die Erfahrung machen, dass er sich arg übernommen hatte. Obwohl sein persönlicher Mut unbezweifelbar war, führte sein Mangel an Kriegserfahrung häufig dazu, dass er schwere taktische und strategische Fehlentscheidungen traf. Er wusste nichts von den Bündnissen zwischen den verschiedenen Räuberbaronen der nördlichen Marschen, und so kam es immer wieder, dass er seine Männer gegen einen dieser Gegner führte, ohne darauf vorbereitet zu sein, dass ein anderer seinem Verbündeten zu Hilfe eilte. Und so wurden König Antors zahlenmäßig ohnehin deutlich unterlegene Truppen durch Überraschungsangriffe auf den Tross mehr und mehr dezimiert. Ja, die Barone des Nordens spielten mit ihm, indem sie immer wieder an den Flanken angriffen, während er wie ein Stier voranstürmte.
So stand es, als Sperber und die anderen pandionischen Ritter das Kriegsgebiet erreichten. Die Armeen, die den jungen König so schrecklich bedrängt hatten, waren zum größten Teil nicht ausgebildet, sondern aus den Räuberbanden der Gegend rekrutiert. Die Barone, die sie anführten, wichen zurück, um die Lage einzuschätzen. Zwar waren sie zahlenmäßig noch weit überlegen, doch kannten sie den Ruf der Pandioner. Einige, denen ihre bisherigen Erfolge zu Kopf gestiegen waren, bedrängten ihre Verbündeten, mit vereinten Kräften anzugreifen, doch ältere und weisere Männer gemahnten zur Vorsicht. Zweifellos sahen manche der Barone, jüngere und ältere gleichermaßen, den Weg zum Thron von Elenien bereits so gut wie offen vor ihnen. Sollte König Antor im Kampf fallen, würde seine Krone dem gehören, der stark genug war, sie an sich zu reißen.
Die ersten Angriffe der Barone auf die vereinten Truppen König Antors und der Pandioner waren eher Versuche, die Kräfte und die Entschlossenheit der Kirchenritter und ihrer Verbündeten zu erkunden. Als sie feststellten, dass deren Gegenmaßnahmen hauptsächlich der Verteidigung dienten, griffen sie mit geballter Kraft an, und es kam nahe der pelosischen Grenze zur Schlacht. Sobald die Pandioner erkannten, dass die Barone ihre gesamte Streitmacht eingesetzt hatten, handelten sie mit der ihnen eigenen Wildheit. Die Verteidigungstaktik, derer sie sich bei den vorausgegangenen Scharmützeln bedient hatten, war eine List gewesen, die Barone zu einer Großoffensive zu verleiten.
Die Schlacht tobte beinahe einen ganzen Frühlingstag, und am Spätnachmittag, als die Sonnenstrahlen schräg über das Schlachtfeld fielen, wurde König Antor von seinen Truppen und seiner Leibgarde abgeschnitten. Ohne Pferd und in schwerer Bedrängnis war er dennoch entschlossen, sein Leben so teuer wie nur möglich zu verkaufen. Es war in jener Stunde, als Ritter Sperber sich ins Gefecht stürzte. Er hieb sich rasch einen Weg zum König durch, und wie es Kämpfer in allen Schlachten der Geschichte getan hatten, hielten die beiden Rücken an Rücken ihre Feinde zurück. Antors verwegene Tapferkeit, gepaart mit Sperbers Kraft und Geschicklichkeit, hielt die Gegner in Schach, bis Sperbers Schwertklinge durch ein Missgeschick brach. Mit Triumphgebrüll stürzten die Feinde auf sie los. Es erwies sich als tödlicher Fehler.
Sperber, der einem Gefallenen den breitklingigen Kampfspeer entrissen hatte, wütete schrecklich unter den Angreifern. Es kam zum Höhepunkt der Schlacht, als der dunkelhäutige Baron herbeistürmte, welcher den Angriff führte. Doch statt dem schwer verwundeten Antor den Todesstreich zu versetzen, fiel der Baron, von Sperbers Speer durchbohrt. Sein Tod nahm seinen Mannen den Mut. Sie wichen zurück, und schließlich flohen sie.
Antors Verwundungen waren schwer, und die Sperbers kaum minder. Erschöpft sanken beide zu Boden, Seite an Seite, als die Abenddämmerung sich auf das Schlachtfeld senkte. Es ist nicht überliefert, was Antor und Sperber in jenen frühen Nachtstunden auf dem blutigen Feld sprachen, da keiner der beiden je ein Wort darüber verlor. Man weiß jedoch, dass sie irgendwann im Verlauf dieses Gespräches die Waffen tauschten. Antor verehrte Ritter Sperber das Königsschwert Eleniens und nahm stattdessen den Kampfspeer, mit dem Ritter Sperber ihm das Leben gerettet hatte. Der König hielt diese schmucklose Waffe sein Leben lang in Ehren.
Es war fast Mitternacht, als die beiden Verwundeten ein Fackellicht bemerkten, das sich durch die Dunkelheit näherte. Da sie nicht wussten, ob der Fackelträger Freund oder Feind war, kämpften sie sich müde auf die Füße und machten sich bereit, ihr Leben zu verteidigen.
Der Näherkommende war jedoch kein Elenier, sondern eine weiß vermummte Styrikerin. Wortlos versorgte sie die Wunden der beiden Krieger. Dann sprach sie kurz mit melodischer Stimme zu ihnen und reichte ihnen ein Paar Ringe, die zum Symbol ihrer lebenslangen Freundschaft wurden. Nach der Überlieferung sollen die ovalen Steine an diesen Ringen so klar wie Diamanten gewesen sein, als die zwei sie erhielten, doch das vermischte Blut aus ihren Wunden färbte die Steine auf Dauer, sodass sie noch heute wie tiefrote Rubine aussehen. Nachdem sie Antor und Sperber die Ringe gegeben hatte, wandte die Styrikerin sich um, ohne noch ein Wort zu sagen, und wandelte hinaus in die Nacht, und es war, als leuchte ihr weißes Gewand im Mondschein.
Ein dunstiger Morgen graute, als Antors Leibgardisten und mehrere Pandioner endlich die beiden Verwundeten fanden. Sie wurden auf Tragen zu unserem Mutterhaus in Demos gebracht. Ihre Gesundung dauerte Monate, und als sie so weit genesen waren, dass sie reisen konnten, waren sie enge Freunde. Gemächlich, in kleinen Etappen, begaben sie sich nach Antors Hauptstadt Cimmura, wo der König dann Erstaunliches verkünden ließ. Er erklärte den pandionischen Ritter Sperber zu seinem, des Königs Streiter, und bestimmte, dass auch die Nachkommen Sperbers den Herrschern von Elenien als Streiter dienen sollten, solange ihrer beider Familien existierten.
Wie an einem Königshof unvermeidlich, wurde auch an Antors Hof in Cimmura intrigiert. Einflussreiche Höflinge waren einerseits bestürzt über das Erscheinen des kriegerischen Sperber, versuchten andererseits jedoch, sich seiner Unterstützung zu versichern. Nachdem diese Versuche gescheitert, ja, von Sperber entschieden abgewiesen worden waren, erkannten die Höflinge voll Unbehagen, dass der Streiter des Königs nicht bestechlich war. Zudem machte die Freundschaft zwischen Antor und Sperber den pandionischen Ritter zum Vertrauten und Berater des Königs. Da Sperber, wie wir bereits erwähnten, von überragender Intelligenz war, fiel es ihm leicht, die Intrigen und Ränke der Höflinge zu durchschauen und seinen weniger begnadeten Freund darauf aufmerksam zu machen. Innerhalb eines Jahres war König Antors Hof erstaunlicherweise frei von Korruption, denn Sperber prägte seiner Umgebung seine eigene strenge Sittlichkeit auf.
Von noch tiefgreifenderer Konsequenz für die verschiedenen Machtgruppen in Elenien war der wachsende Einfluss der Pandionischen Bruderschaft im Königreich. Antor war nicht nur Ritter Sperber unendlich dankbar, sondern auch seinen Ordensbrüdern. Der König und sein Streiter reisten des Öfteren nach Demos, um sich mit dem Hochmeister unseres Ordens zu beraten, und wichtige politische Entscheidungen wurden häufiger im Mutterhaus getroffen als in der königlichen Ratskammer, wo Höflinge Antors Regentschaft eher zu ihrem eigenen Vorteil zu beeinflussen versuchten denn zum Wohle des Reiches.
Ritter Sperber heiratete in mittlerem Alter, und seine Gemahlin gebar ihm bald einen Sohn. Auf Antors Bitte erhielt auch das Kind den Namen Sperber: eine Tradition, die sich seit jener Zeit bis zum heutigen Tag bewahrt hat. Zum Jüngling gereift, begann auch Sperbers Sohn im pandionischen Mutterhaus seine Ausbildung für jenes Amt, das er einst übernehmen würde. Zur Freude ihrer Väter waren der junge Sperber und Antors Sohn, der Kronprinz, von frühester Kindheit an beste Freunde, und so war der Treueschwur zwischen dem elenischen König und seinem Streiter auch für die Zukunft gesichert.
Als Antor, reich an Jahren und Ehren, auf dem Sterbebett lag, überreichte er als letzte Handlung seinem Sohn den Rubinring und den kurzschäftigen, breitklingigen Speer, und auch Sperber gab seinen Ring und das Königsschwert an den Sohn weiter, eine Tradition, die ebenfalls bis zum heutigen Tag erhalten blieb.
Unter den Bürgern Eleniens hat sich der Glaube verbreitet, dass das Reich blühen und gedeihen wird und ihm nichts Böses widerfahren kann, solange die königliche Familie und das Haus Sperber bestehen. Wie so mancher Volksglaube besitzt auch dieser einen wahren Kern. Die Nachkommen Sperbers waren von jeher hochbegabte Männer, und neben ihrer pandionischen Ausbildung wurden sie in Staatskunst und Diplomatie unterrichtet, um sie auf ihr erbliches Amt vorzubereiten.
In letzter Zeit kam es jedoch zu einer Entfremdung zwischen der Königsfamilie und dem Hause Sperber. Der wankelmütige König Aldreas, der gänzlich unter dem Einfluss seiner ehrgeizigen Schwester und des Primas von Cimmura stand, übertrug seinem eigenen Streiter sehr kühl die geringere, ja sogar erniedrigende Aufgabe, die Erziehung von Prinzessin Ehlana zu übernehmen – möglicherweise in der Hoffnung, dass dies den Streiter so sehr kränken würde, dass er sein erbliches Amt niederlegte. Ritter Sperber jedoch nahm seine Aufgabe sehr ernst und unterrichtete das Kind, die zukünftige Königin, in jenen Fächern, die sie auf ihre Regentschaft vorbereiteten.
Als offensichtlich wurde, dass Sperber sein Amt als Streiter des Königs nicht freiwillig niederlegen würde, sandte Aldreas ihn auf Einflüsterung seiner Schwester und des Primas Annias ins Exil in das Königreich Rendor.
Nachdem König Aldreas verstorben war, bestieg seine Tochter Ehlana den Thron. Als Sperber dies erfuhr, kehrte er nach Cimmura zurück, musste jedoch feststellen, dass seine junge Königin schwer erkrankt war und nur ein Zauber sie am Leben hielt, den die styrische Magierin Sephrenia zu ihrem Schutz gewirkt hatte – ein Zauber, der jedoch nach einem Jahr seine Kraft verlieren würde.
Die Hochmeister der vier Kriegerorden der Kirchenritter beschlossen nach eingehender Beratung zusammenzuarbeiten, um ein Mittel gegen die Krankheit der Königin zu finden und ihre Gesundheit und Macht zurückzubringen, ehe der korrupte Primas Annias sein Ziel – den Erzprälatenthron in der Basilika von Chyrellos – erreichen konnte. Zu diesem Zweck stellten die Hochmeister der Cyriniker, der Alzioner und der Genidianer ihre eigenen Streiter ab, auf dass sie gemeinsam mit den Pandionern Sperber und Kalten – seit frühester Kindheit dessen Freund – ein Mittel suchten, das nicht nur Königin Ehlana heilen würde, sondern auch deren Reich, das unter einer anderen Art von Krankheit schwer litt.
So steht es gegenwärtig. Die Genesung der Regentin ist nicht nur lebenswichtig für das Königreich Elenien, sondern auch für die anderen Elenischen Königreiche, denn sollte es dem verruchten Primas Annias gelingen, den Erzprälatenthron zu gewinnen, können wir sicher sein, dass die Elenischen Königreiche von Unruhen geschüttelt untergehen werden, während unser uralter Erzfeind, Otha von Zemoch, bereits an der östlichen Grenze unseres Reiches darauf lauert, Spaltungen oder Kriege zu nützen. Und das Mittel, das unserer Königin helfen kann, die dem Tod schon so nahe ist, könnte selbst ihren Streiter und seine wackeren Gefährten das Fürchten lehren! Betet um ihren Erfolg, meine Brüder, denn sollten sie versagen, wird der gesamte Eosische Kontinent unvermeidlich von Krieg überzogen werden, und die Welt, wie wir sie kennen, wird nicht mehr lange existieren.
ERSTERTEIL
RANDERASEE
1
Mitternacht war längst vorüber, und der dichte graue Nebel von Cimmura hatte sich mit dem allgegenwärtigen Holzrauch aus Hunderten von Kaminen vermischt und verhüllte die nahezu verlassenen Straßen der Stadt. Dennoch hielt sich Ritter Sperber vom Orden der Pandioner, wann immer möglich, im Schatten der Hausmauern. Die Straßen glitzerten feucht, und blasse regenbogenfarbene Strahlenkränze umgaben die Fackeln, die mit ihrem flackernden, schwachen Schein versuchten, die Straßen und Gassen zu beleuchten, obwohl zu dieser Stunde kein vernünftiger Mensch sie betrat. Die Häuser entlang der Straße, durch die Sperber kam, waren kaum mehr als hohe schwarze Schatten. Er verließ sich stärker auf seine Ohren denn auf seine Augen, da in diesem dichten Nebel drohende Gefahr früher zu hören als zu sehen war.
Es war die unheimlichste Zeit in den Straßen. Bei Tag war Cimmura nicht gefährlicher als irgendeine andere Stadt, doch des Nachts wurde sie zum Urwald, in dem die menschlichen Bestien über Schwache und Unachtsame herfielen. Unter seinem einfachen Reiseumhang trug Sperber Kettenrüstung. Ein großes Schwert hing an seiner Seite, und einen kurzen Kampfspeer mit breiter Klinge hielt er locker in der Hand. Zudem war er in Kampfarten ausgebildet, in denen sich kein Straßenräuber mit ihm messen konnte, und momentan erfüllte ihn brennende Wut. Während er mit den Fingern über die gebrochene Nase strich, hoffte er grimmig, irgendein Dummkopf würde auf den Gedanken kommen, ihn zu überfallen. Mit Sperber war nicht gut Kirschen essen, wenn man ihn gereizt hatte – und das hatte man vor Kurzem.
Er war sich jedoch der Dringlichkeit seiner Aufgabe nur allzu bewusst. Sosehr ihn auch ein schneller Hieb- und Stichwechsel mit irgendeinem unbekannten und unwichtigen Angreifer befriedigt hätte, sein Verantwortungsbewusstsein war stärker. Seine bleiche junge Königin schwebte in Todesgefahr und verlangte in ihrer Hilflosigkeit vollkommene Treue von ihrem Streiter. Nein, er würde sie nicht im Stich lassen. Wenn er bei einem sinnlosen Straßenkampf in einer schmutzigen Gosse starb, würde das seiner Königin, die zu beschützen er geschworen hatte, wenig nützen. Das war der Grund, weshalb er vorsichtig und auf noch leiseren Sohlen dahinschlich als ein gedungener Meuchler.
Nicht weit voraus sah er das Flackern verschwommen erkennbarer Fackeln und hörte den Gleichschritt eines kleineren Trupps. Lautlos fluchend tauchte er in eine schmale, übel riechende Gasse.
Ein halbes Dutzend Männer marschierte vorüber. Ihre roten Röcke waren feucht vom Nebel, ebenso die langen Piken, die sie schräg über der Schulter trugen. »Es ist die Spelunke in der Rosenstraße«, sagte der Offizier soeben arrogant, »hinter der sich die Herberge der Pandioner verbirgt. Sie wissen natürlich, dass wir auch dort Streife gehen, aber immerhin hemmt unsere Anwesenheit ihre Bewegungsfreiheit, und dadurch bleibt Seine Exzellenz von unliebsamen Überraschungen verschont.«
»Wir kennen die Gründe, Leutnant«, erinnerte der Korporal ihn gelangweilt. »Immerhin machen wir das bereits seit einem guten Jahr.«
»Ich wollte nur sichergehen, dass es allen klar ist«, entgegnete der wichtigtuerische junge Leutnant ein bisschen pikiert.
»Jawohl«, sagte der Korporal unbewegt.
»Wartet hier, Männer«, befahl der Leutnant und bemühte sich, seiner jungen Stimme einen barschen Tonfall zu geben. »Ich schaue mich erst einmal um.« Er marschierte weiter die Straße entlang, und seine genagelten Absätze schmetterten auf das Kopfsteinpflaster.
»So ein Esel«, sagte der Korporal kopfschüttelnd zu seinen Kameraden.
»Werd erst mal selber erwachsen, Korporal«, knurrte ein grauhaariger Veteran. »Wir streichen den Sold ein, also haben wir auch zu gehorchen und unsere Meinung für uns zu behalten. Führe die Befehle aus und überlass das Denken den Offizieren.«
Der Korporal brummelte säuerlich. »Ich war gestern am Hof«, erzählte er. »Annias hat den jungen Hüpfer gerufen, und der Dummkopf bestand auf einer Eskorte. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Leutnant diesem Bastard Lycheas regelrecht hinten reingekrochen ist?«
»Das können Leutnants am besten.« Der Veteran zuckte mit den Schultern. »Sie sind die geborenen Speichellecker, und immerhin ist der Bastard der Prinzregent. Ich weiß zwar nicht, ob sein Speichel besser schmeckt, aber wahrscheinlich hat der Leutnant inzwischen bereits Schwielen auf der Zunge.«
Der Korporal lachte. »Na, das wär vielleicht ein Schock für ihn, wenn die Königin wieder gesund würde und er den ganzen Speichel umsonst geleckt hätte!«
»Hoffe lieber, dass sie nicht gesund wird, Korporal«, fiel ein anderer ein. »Denn sollte sie aufwachen und wieder selber nach ihrer Schatzkammer schauen, wird Annias kein Geld für unseren Sold mehr haben.«
»Er kann sich doch jederzeit aus der Kirchenkasse bedienen.«
»Nicht ohne genaue Abrechnung. Die Hierokratie in Chyrellos dreht jedes Kupferstück dreimal um, bevor sie es ausgibt.«
»Also gut, Männer«, rief der junge Offizier aus dem Nebel, »die Pandionerspelunke ist ganz in der Nähe. Ich habe die Wache bereits abgelöst, also kommt her und nehmt eure Posten ein.«
»Ihr habt ihn gehört«, sagte der Korporal. »Voran mit euch!« Die Kirchensoldaten marschierten in den Nebel.
Sperber lächelte in der Dunkelheit. Er hatte selten Gelegenheit, beiläufige Gespräche des Feindes mitzuhören. Er vermutete schon lange, dass die Soldaten dem Primas von Cimmura mehr der Bezahlung wegen denn aus Loyalität oder Frömmigkeit dienten. Er verließ die Gasse, sprang jedoch sogleich lautlos zurück, als er neuerlich Schritte vernahm, die in seine Richtung kamen. Aus irgendeinem Grund herrschte auf den sonst so leeren nächtlichen Straßen heute reges Treiben. Die Schritte waren laut, also konnte es kein Räuber sein, der einem Ahnungslosen auflauern wollte. Sperber nahm den kurzen Speer in die Hand. Da sah er den Burschen auch schon aus dem Nebel auftauchen. Er trug einen dunklen Kittel und balancierte einen großen Korb auf einer Schulter. Er war offenbar irgendein Handwerker, doch er konnte genauso gut irgendetwas anderes sein. Sperber verhielt sich still und wartete, bis die Schritte des Mannes verklangen, ehe er wieder auf die Straße trat. Er blieb wachsam, und seine weichen Stiefel verursachten kaum einen Laut auf den nassen Pflastersteinen. Auch hatte er den grauen Umhang eng um sich geschlungen, sodass seine Rüstung nur gedämpft klirrte.
Er überquerte eine leere Straße, um dem flackernden gelben Licht zu entgehen, das durch die offene Tür einer Schenke fiel, wo grölende Stimmen ein derbes Lied zum Besten gaben. Wieder nahm er den Speer in die Linke und zog die Kapuze seines Umhangs noch tiefer über die Stirn, um sein Gesicht zu verdecken, während er durch den nebelgedämpften Lichtschein trat.
Er blieb stehen und durchforschte mit Augen und Ohren die neblige Straße vor ihm. Er wollte zum Osttor, aber es musste nicht auf direktem Weg sein. Leute, die geradenwegs gehen, sind berechenbar, und berechenbare Leute geraten leicht in einen Hinterhalt. Es war lebenswichtig für ihn, die Stadt zu verlassen, ohne von Annias’ Leuten gesehen und erkannt zu werden, auch wenn er die ganze Nacht dazu brauchen würde.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Straße leer war, ging er weiter und hielt sich auch jetzt wieder im tiefsten Schatten. An einer Ecke lehnte ein zerlumpter Bettler unter dem trüb orangefarbenen Glühen einer Fackel an einer Hauswand. Er hatte eine Binde um die Augen und mehrere offenbar echte Wunden an Armen und Beinen. Nur war jetzt nicht die rechte Zeit zum Betteln, und so vermutete Sperber, dass der Mann aus einem anderen Grund hier saß. In diesem Augenblick fiel unweit von ihm ein Dachziegel krachend auf die Straße.
»Almosen«, flehte der Bettler mit verzweifelter Stimme, obwohl Sperbers Stiefel keinen Laut verursacht hatten.
»Guten Abend«, grüßte der große Ritter leise und überquerte die Straße. Er warf ein paar Münzen in die Schale des Bettlers.
»Habt Dank, hoher Herr. Gott segne Euch.«
»Ihr dürftet mich eigentlich gar nicht sehen können, Nachbar«, erinnerte ihn Sperber. »Und deshalb auch nicht wissen, ob ich ein hoher Herr oder ein einfacher Bürger bin.«
»Es ist spät«, entschuldigte sich der Bettler, »und ich bin ein bisschen müde. Da vergesse ich es manchmal.«
»Sehr nachlässig«, rügte Sperber. »Ihr müsst besser aufpassen. Übrigens, grüßt Platime von mir.« Platime war ein ungeheuerlich fetter Mann, der die Unterwelt von Cimmura mit eiserner Faust regierte.
Der Bettler schob die Augenbinde ein Stückchen hoch und starrte Sperber an. Seine Augen weiteten sich, als er ihn wiedererkannte.
»Und sagt Eurem Freund da oben auf dem Dach, er soll sich nicht aufregen. Aber trotzdem kann es nicht schaden, wenn er besser aufpasst, wo er hinsteigt. Der letzte Ziegel, den er losgetreten hat, hätte mich fast erschlagen.«
»Er ist neu bei uns!« Der Bettler rümpfte die Nase. »Er hat noch viel zu lernen, bevor er ein guter Einbrecher wird.«
»Da kann ich Euch nur beipflichten.« Sperber blickte ihn an. »Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Talen hat mir von einer Schenke an der Ostmauer der Stadt erzählt. Sie soll eine Dachkammer haben, die der Wirt manchmal vermietet. Wisst Ihr zufällig, wo ich sie finden kann?«
»Die Schenke ist in der Ziegengasse, Ritter Sperber. Ihr erkennt sie an dem Schild, das ein Bündel Trauben darstellen soll. Ihr könnt sie nicht verfehlen.« Der Bettler blinzelte zu Sperber hoch. »Wo treibt Talen sich eigentlich herum? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.«
»Sein Vater kümmert sich um ihn.«
»Ich hab gar nicht gewusst, dass er einen Vater hat. Der Junge wird es weit bringen, wenn er nicht vorher am Galgen baumelt. Ich glaub, er ist der beste Dieb in ganz Cimmura.«
»Ich weiß«, bestätigte Sperber. »Mir hat er schon ein paarmal die Taschen ausgeleert.« Er ließ noch ein paar Münzen in die Schale fallen. »Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr es für Euch behieltet, dass Ihr mich heute Nacht gesehen habt.«
»Ich habe Euch doch gar nicht gesehen, Ritter Sperber.« Der Bettler grinste.
»Genauso wenig, wie ich Euch und Euren Freund gesehen habe.«
»Dann sind wir uns ja einig.«
»Zweifellos. Viel Glück bei Eurem Vorhaben.«
»Und bei Eurem.«
Sperber lächelte und setzte seinen Weg fort. Seine Verbindungen zur unteren Schicht der cimmuranischen Gesellschaft hatten sich wieder einmal bezahlt gemacht. Obwohl Platime nicht gerade ein Freund war, konnten er und die Unterwelt, über die er herrschte, recht nützlich sein. Sperber wich in die Parallelstraße aus, um zu vermeiden, dass er den Wächtern in die Arme lief, falls der unachtsame Einbrecher auf dem Dach entdeckt würde.
Wie immer, wenn er allein war, beschäftigte sich Sperber in Gedanken mit seiner Königin. Er kannte Ehlana, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war, hatte sie allerdings zehn Jahre lang, während er im Exil in Rendor gewesen war, nicht gesehen. Es drehte ihm das Herz um, wenn er daran dachte, dass sie nun auf ihrem Thron vollkommen in diamanthartem Kristall eingeschlossen war. Er bedauerte bereits, dass er an diesem Abend die Gelegenheit nicht genutzt hatte, Primas Annias zu töten. Ein Giftmörder ist immer verabscheuungswürdig, und der Mann, der Sperbers Königin vergiftete, hatte sich damit in Todesgefahr gebracht, denn Sperber pflegte alte Rechnungen zu begleichen, sobald sich die Chance bot.
Da hörte er verstohlene Schritte hinter sich im Nebel. Er trat rasch in einen Hauseingang und verhielt sich völlig still.
Es waren zwei Männer in unauffälliger Kleidung. »Kannst du ihn noch sehen?«, flüsterte einer dem anderen zu.
»Nein, der Nebel ist dichter geworden. Aber er kann nicht weit vor uns sein.«
»Bist du sicher, dass er ein Pandioner ist?«
»Wenn man so lange in diesem Geschäft ist wie ich, lernt man sie zu erkennen, schon daran, wie sie gehen, an der Haltung ihrer Schultern. Oh ja, er ist ganz bestimmt ein Pandioner.«
»Was macht er denn zu dieser nachtschlafenden Zeit auf der Straße?«
»Das herauszufinden sind wir ja hier. Der Primas will über jeden ihrer Schritte unterrichtet werden!«
»Aber allein die Vorstellung, in einer nebligen Nacht hinter einem Pandioner herzuschleichen, macht mich ein wenig nervös. Sie benutzen doch allesamt Magie und fühlen es, wenn jemand kommt. Ich möchte nicht gern sein Schwert in den Bauch kriegen. Hast du eigentlich sein Gesicht gesehen?«
»Nein, er hatte die Kapuze tief in die Stirn gezogen. Sein Gesicht war in der Dunkelheit überhaupt nicht zu sehen.«
Die beiden schlichen weiter die Straße hinauf, ohne zu ahnen, dass ihr Leben für einen Augenblick an einem dünnen Faden gehangen hatte. Hätte auch nur einer der beiden Sperbers Gesicht gesehen, hätte er es auf der Stelle mit dem Leben bezahlt. In solchen Dingen war Sperber sehr konsequent. Er wartete, bis die Schritte der beiden verklangen. Dann kehrte er zu einer Kreuzung zurück und folgte einer Nebenstraße.
Die Schenke war leer, wenn man vom Wirt absah, der, die Füße auf dem Tisch und die Hände über dem Wanst verschränkt, vor sich hin döste. Er war ein dicker Mann mit Bartstoppeln und schmutzigem Kittel.
»Guten Abend«, grüßte Sperber ruhig.
Der Wirt öffnete ein Auge. »Morgen trifft es wohl eher«, brummte er.
Sperber schaute sich um. Die Schenke war eine typische Arbeiterspelunke mit niedriger, verrußter Decke und dem Schanktisch vor der hinteren Wand. Bänke und Stühle waren arg mitgenommen, und das Sägemehl auf dem Boden war offenbar seit Monaten nicht mehr zusammengekehrt und erneuert worden. »Nicht viel los hier«, sagte Sperber ruhig.
»Um diese Zeit selten. Was darf ich Euch bringen?«
»Arzischen Roten – falls Ihr welchen habt.«
»Arzium steckt hüfthoch in roten Trauben. Arzischer Roter geht nie aus.« Mit müdem Seufzer plagte der Wirt sich auf die Beine und schenkte Sperber einen Becher Rotwein ein. Der Becher war nicht übermäßig sauber, wie Sperber feststellte. »Ihr seid noch spät unterwegs, Freund«, bemerkte der Wirt und reichte dem hochgewachsenen Ritter den klebrigen Becher.
»Geschäftlich.« Sperber zuckte mit den Schultern. »Ein Freund hat mir gesagt, dass Ihr eine Dachkammer habt.«
Der Wirt kniff argwöhnisch die Augen zusammen. »Ihr seht mir nicht wie einer aus, der sich für Dachkammern interessiert. Hat Euer Freund auch einen Namen?«
»Keinen, den er in aller Munde wissen möchte«, erwiderte Sperber und trank einen Schluck Wein. Es war ein ausgesprochen schlechter Jahrgang.
»Ich kenne Euch nicht, und Ihr seht so aus, als würdet Ihr von irgendeiner Behörde kommen. Wie wär’s, wenn Ihr Euren Wein austrinkt und wieder geht? Es sei denn, Ihr könnt mir einen Namen nennen, der mir etwas sagt.«
»Dieser Freund von mir arbeitet für einen Mann namens Platime. Vielleicht sagt Euch dieser Name etwas.«
Des Wirtes Augen weiteten sich leicht. »Platime ist offenbar nicht die Art von Schuster, die bei ihren Leisten bleibt. Ich hatte keine Ahnung, dass er was mit Edelleuten zu tun hat – außer, dass er sie bestiehlt.«
»Er war mir eine Gefälligkeit schuldig.« Sperber zuckte die Achseln.
Der Bartstoppelige war immer noch nicht überzeugt. »Jeder könnte mit Platimes Namen aufwarten.«
»Wirt«, Sperber setzte ungeduldig seinen Becher ab, »ich habe allmählich genug. Entweder wir gehen zu Eurer Mansarde hinauf, oder ich hole die Wache. Ich bin sicher, dass sie sich sehr für Euren kleinen Nebenerwerb interessieren wird.«
Der Wirt machte ein mürrisches Gesicht. »Es kostet Euch eine silberne Halbkrone.«
»Gut.«
»Ihr wollt nicht einmal feilschen?«
»Ich bin ein wenig in Eile. Wir können den Preis das nächste Mal aushandeln.«
»Ihr seid offenbar mehr als nur ein bisschen in Eile. Ihr habt doch nicht etwa heute Nacht mit Eurem Speer da jemand aufgespießt?«
»Noch nicht«, antwortete Sperber gleichmütig.
Der Wirt schluckte schwer. »Lasst mich Euer Geld sehen.«
»Sogleich. Und dann gehen wir hinauf und schauen uns diese Dachkammer an.«
»Wir müssen vorsichtig sein. Bei diesem Nebel werdet Ihr nicht sehen können, wenn die Wachen auf dem Wehrgang daherkommen.«
»Macht Euch deshalb keine Gedanken.«
»Ihr dürft sie nicht umbringen. Ich mache mit meiner Dachkammer ein nettes kleines Nebengeschäft. Wenn da oben ein Wächter ins Jenseits befördert wird, ist Schluss damit.«
»Keine Angst. Ich glaube nicht, dass ich heute Nacht jemand zu Gott befehlen muss.«
Die Dachkammer war staubig und machte den Eindruck, als würde sie nie benutzt. Der Wirt öffnete lautlos das Giebelfenster und lugte in den Nebel. Sperber flüsterte hinter ihm in Styrisch und sandte den Zauber aus. Er konnte den Kerl da draußen fühlen. »Vorsicht!«, mahnte er. »Ein Wächter kommt auf dem Wehrgang herbei.«
»Ich sehe niemanden.«
»Ich habe ihn gehört«, entgegnete Sperber. Er hatte nicht die Absicht, eine längere Erklärung abzugeben.
»Ihr müsst scharfe Ohren haben, Freund.«
Die beiden warteten im Dunkeln, während der schläfrige Wächter den Wehrgang entlangschlurfte und im Nebel verschwand.
»Helft mir«, forderte der Wirt Sperber auf. Er bückte sich, um ein Ende eines schweren Brettes auf den Fenstersims zu heben. »Wir schieben es auf die Brustwehr, dann steigt Ihr hinüber. Wenn Ihr drüben seid, werf ich Euch dieses Ende des Seils zu, das hier gesichert ist, dann könnt Ihr daran die Außenmauer hinunterrutschen.«
»Gut«, murmelte Sperber. Sie schoben das Brett über den Abgrund, bis es auf der Brustwehr auflag. »Danke, Nachbar«, sagte Sperber. Er setzte sich rittlings auf das Brett und rutschte darauf Zoll um Zoll zum Wehrgang. Dort angelangt, erhob er sich und fing die Seilrolle auf, die aus der nebligen Dunkelheit angeflogen kam. Er warf sie über die Außenmauer und glitt daran hinunter. Augenblicke später war er unten angelangt. Das Seil verschwand alsbald nach oben im Nebel, und gleich darauf hörte er, wie das Brett in die Dachkammer zurückgezogen wurde. »Sehr ordentlich«, murmelte Sperber und entfernte sich leise von der Stadtmauer. »Ich muss mir diese Schenke merken.«
Im Nebel fiel es ihm nicht so leicht, sich zu orientieren, aber indem er das hohe Schwarz der Stadtmauer links von sich behielt, konnte er sich einigermaßen zurechtfinden. Er setzte die Füße behutsam auf, denn die Nacht war still, und wenn er einen dürren Zweig knickte, würde es weithin zu hören sein.
Abrupt hielt er an. Sperber konnte sich auf seinen Instinkt verlassen: Er wusste, dass er beobachtet wurde. Ganz vorsichtig, um verräterische Geräusche zu vermeiden, zog er sein Schwert. Mit dem Schwert in der einen und dem Speer in der anderen Hand spähte er in den Nebel.
Da sah er es. Es war nur ein gedämpftes Glühen in der Dunkelheit, so schwach, dass kaum jemand es überhaupt bemerkt hätte. Das Glühen kam näher, und bald sah Sperber, dass es einen grünlichen Farbton besaß. Sperber stand völlig regungslos im Dunkel und wartete.
Dort draußen im Nebel befand sich eine Gestalt, zwar nicht richtig zu erkennen, aber zweifellos eine Gestalt. Sie schien schwarz vermummt zu sein, und das schwache Glühen drang unter der Kapuze hervor, dort, wo das Gesicht sein müsste. Die Gestalt war sehr groß und unglaublich dünn, fast wie ein Gerippe. Unwillkürlich rann Sperber ein Schauder über den Rücken. Er murmelte einige styrische Worte; dabei bewegten seine Finger sich über den Schwertgriff und den Speerschaft. Dann hob er den Speer und gab den Zauber durch dessen Spitze frei. Es war ein verhältnismäßig simpler Zauber, der lediglich dazu diente, ihn diese ausgemergelte Gestalt im Nebel erkennen zu lassen. Sperber keuchte beinahe, als er die Wellen des Bösen spürte, die von der schattenhaften Gestalt ausgingen. Was immer sie auch war – menschlich ganz gewiss nicht.
Nach einem Augenblick klang ein gespenstisch metallisches Lachen aus der Nacht. Die Gestalt drehte sich um und ging davon. Ihre Bewegungen waren ruckartig, als säßen die Knie verkehrt herum an den Beinen. Sperber blieb stehen, bis die Ausstrahlung des Bösen schwand. Was immer dieses … Wesen auch war, jetzt war es fort. »Ich frage mich, ob das wieder so eine kleine Überraschung von Martel war«, murmelte Sperber. Martel war ein abtrünniger pandionischer Ritter, den man aus dem Orden ausgestoßen hatte. Er und Sperber waren früher einmal Freunde gewesen, doch das war lange her. Martel arbeitete jetzt für den Primas Annias. Er hatte das Gift besorgt, mit dem es Annias beinahe gelungen wäre, die Königin zu töten.
Sperber setzte seinen Weg langsam und lautlos fort. Schwert und Speer behielt er in den Händen. Schließlich sah er die Fackeln vor dem geschlossenen Osttor und orientierte sich daran.
Da vernahm er ein schwaches Schnüffeln, ähnlich dem eines Spürhunds. Kampfbereit drehte er sich um. Erneut hörte er dieses metallische Lachen. Nein, verbesserte er sich, es war nicht so sehr ein Lachen, mehr eine Art Zirpen. Und erneut spürte er die Ausstrahlung von etwas überwältigend Bösem – das erneut schwand.
Sperber ließ nun die Stadtmauer und das verwaschene Licht der beiden Fackeln am Tor schräg hinter sich. Nach etwa einer Viertelstunde sah er den hohen eckigen Umriss des pandionischen Ordenshauses aus dem Nebel auftauchen.
Er ließ sich in das nebelnasse Gras fallen, murmelte aufs Neue den Suchzauber, schickte ihn aus und wartete.
Nichts.
Er erhob sich, schob das Schwert in die Scheide zurück und schlich über das Feld. Das burgähnliche Ordenshaus wurde wie üblich beobachtet. Kirchensoldaten, als Arbeiter verkleidet, lagerten unweit des Haupttores. Um ihre Zelte herum häuften sich Kopfsteine, mit denen sie zur Tarnung tagsüber die Straße pflasterten. Sperber schlich zur Rückseite und tastete sich vorsichtig durch den tiefen, mit spitzen Pfählen gespickten Graben, der rings um die Ordensburg verlief.
Das Seil, an dem er hinuntergeklettert war, als er das Haus verließ, baumelte noch hinter einem schützenden Busch. Er schüttelte es ein paarmal, um sich zu vergewissern, dass der Enterhaken am oberen Ende noch hielt. Dann schob er den Speer unter den Schwertgürtel, griff nach dem Seil und zog mit aller Kraft daran.
Über ihm konnte er hören, wie die Hakenspitzen sich scharrend fester in die Steine der Brustwehr bohrten. Er machte sich daran, am Seil hochzuklettern.
»Wer da?«, klang es scharf aus dem Nebel über ihm. Es war eine jugendliche Stimme – und eine vertraute.
Sperber fluchte lautlos. Dann spürte er ein Zerren am Seil. »Lasst es los, Berit!«, knirschte er, während er sich hinaufhangelte.
»Ritter Sperber?«, fragte der Novize verblüfft.
»Zieht nicht am Seil!«, befahl Sperber. »Die Pfähle im Graben sind sehr spitz!«
»Gestattet, dass ich Euch heraufhelfe.«
»Das schaffe ich schon. Achtet lieber darauf, dass Ihr den Haken nicht bewegt.« Sperber ächzte, als er sich über die Brustwehr stemmte. Berit griff helfend nach seinem Arm. Sperber schwitzte. In Kettenrüstung ein Seil hochzuklettern konnte ziemlich anstrengend sein.
Berit war Novize, ein großer, hagerer junger Mann in Kettenhemd, der ein guter Pandioner zu werden versprach. Über dem Kettenhemd trug er einen einfachen Umhang, und er hielt eine schwere Streitaxt in einer Hand. Da er höflich und wohlerzogen war, stellte er keine Fragen, aber in seinem Gesicht war die Neugier zu lesen. Sperber spähte hinunter auf den Hof des Ordenshauses. Im Schein einer flackernden Fackel erkannte er Kurik und Kalten. Sie waren beide bewaffnet, und die Geräusche aus den Stallungen verrieten, dass Pferde gesattelt wurden, zweifellos für die beiden. »Bleibt hier!«, rief Sperber zu ihnen hinunter.
»Was tust du da oben, Sperber?«, rief Kalten überrascht.
»Ich hab mir gedacht, ich mache Fassadenklettern zu meiner Freizeitbeschäftigung«, erwiderte Sperber trocken. »Wartet, ich bin gleich unten! Kommt mit, Berit.«
»Ich bin hier zur Wache eingeteilt, Ritter Sperber.«
»Wir schicken jemanden zur Ablösung hinauf. Es geht um etwas Wichtiges.« Sperber ging den Wehrgang voraus zur steinernen Treppe, die auf den Hof führte.
»Wo warst du, Sperber?«, fragte Kurik verärgert, als die beiden unten angekommen waren. Sperbers Knappe trug wie üblich sein schwarzes Lederwams, und seine muskulösen Arme und Schultern glänzten im gelben Fackelschein.
»Ich musste in den Dom«, antwortete Sperber ruhig.
»Hast du religiöse Anwandlungen?« Kaltens Stimme klang amüsiert. Der große blonde Ritter, Sperbers Jugendfreund, trug Kettenrüstung, und ein schweres Breitschwert hing an einer Seite vom Gürtel.
»Nicht gerade«, entgegnete Sperber. »Tanis ist tot. Sein Geist kam um Mitternacht zu mir.«
»Tanis?«, wiederholte Kalten bestürzt.
»Er war einer der zwölf Ritter, die bei Sephrenia waren, als sie Ehlana in Kristall hüllte. Ehe sein Geist sich zu Sephrenia aufmachte, um ihr sein Schwert zu übergeben, wies er mich an, in die Krypta des Doms zu gehen.«
»Und du bist gegangen? Mitten in der Nacht?«
»Es war dringend.«
»Was hast du dort gemacht? Ein paar Grabstätten geschändet? Bist du so zu dem Speer gekommen?«
»Wohl kaum. König Aldreas hat ihn mir gegeben.«
»Aldreas?«
»Na ja, sein Geist. Sein vermisster Ring ist im Klingenaufsatz.« Sperber blickte seine beiden Freunde neugierig an. »Wo wolltet ihr eigentlich hin?«
»Hinaus. Dich suchen.« Kurik zuckte mit den Schultern.
»Woher wusstest du, dass ich das Ordenshaus verlassen habe?«
»Ich habe ein paarmal nach dir gesehen«, antwortete Kurik. »Ich hab gedacht, du weißt, dass ich das gewöhnlich mache.«
»Jede Nacht?«
»Mindestens dreimal«, bestätigte Kurik. »Ich mach das, seit du ein Junge warst – natürlich nicht, während du dich in Rendor aufgehalten hast. Das erste Mal heut Abend hast du im Schlaf geredet. Das zweite Mal – kurz nach Mitternacht – warst du verschwunden. Ich hab mich umgeschaut, und nachdem ich dich nirgends finden konnte, hab ich Kalten aufgeweckt.«
»Und jetzt sollten wir lieber auch die anderen aufwecken«, sagte Sperber düster. »Aldreas hat mir so einiges erzählt, und wir müssen Entscheidungen treffen.«
»Schlechte Neuigkeiten?«, erkundigte sich Kalten.
»Schwer zu sagen. Berit, schickt einen der Novizen bei den Pferden als Eure Ablösung auf den Wehrgang. Wir werden eine Zeit lang brauchen.«
Sie versammelten sich in Hochmeister Vanions Studiergemach im Südturm. Sperber, Berit, Kalten und Kurik waren natürlich anwesend, außerdem Ritter Bevier, ein Cyriniker, Ritter Tynian, der Alzioner, und Ritter Ulath, der riesenhafte Genidianer. Die drei waren die Streiter ihrer Orden und hatten sich Sperber und Kalten angeschlossen, als die Hochmeister befunden hatten, dass die Rettung Prinzessin Ehlanas ihrer aller Angelegenheit war. Sephrenia, die zierliche, dunkelhaarige Styrikerin, welche die Pandioner in die Geheimnisse von Styrikum einwies, saß am Feuer, das kleine Mädchen, das sie Flöte nannten, an ihrer Seite. Talen, der Junge, hatte sich ans Fenster gesetzt und rieb sich die Augen. Er schlief immer tief und fest und mochte es gar nicht, wenn man ihn aus dem Schlummer riss. Vanion hatte an dem Tisch Platz genommen, den er für gewöhnlich als Schreibtisch benutzte. Sein Studiergemach war ein gemütliches Zimmer, niedrig, mit dunklen Deckenbalken und einem tiefen Kamin, in dem stets ein Feuer brannte, zumindest kannte Sperber dies nicht anders. Wie immer stand Sephrenias Teekessel dampfend auf dem Kamineinsatz.
Vanion sah gar nicht gut aus. Der Hochmeister des pandionischen Ordens – ein grimmiger Ritter mit tiefen Sorgenfalten, der wahrscheinlich sogar noch älter war, als er aussah – trug bei dieser unerwarteten nächtlichen Zusammenkunft einen unpassenden styrischen Morgenrock aus grob gewebter weißer Wolle. Sperber war die Veränderung Vanions im Lauf der Jahre nicht entgangen. Wenn man ihn in einem unbewachten Augenblick überraschte, konnte man den Hochmeister, eine der tragenden Säulen der Kirche, beinahe für einen Styriker halten. Als Elenier und Ordensritter war es Sperbers Pflicht, seine Beobachtungen der Kirchenbehörde zu melden. Er tat es jedoch nicht. Seine Loyalität gegenüber der Kirche war eine Sache – ein Gebot Gottes. Seine Treue zu Vanion war eine andere, etwas Tieferes, Persönlicheres.
Das Gesicht des Hochmeisters war aschgrau, seine Hände zitterten leicht. Er hatte Sephrenia überreden können, ihm die drei Schwerter der toten Ritter anzuvertrauen, doch diese Bürde belastete Vanion offenbar mehr, als er zugeben wollte. Sephrenia hatte der Hilfe von zwölf pandionischen Rittern bedurft, um im Thronsaal jenen Zauber zu wirken, der die Königin am Leben erhielt. Diese zwölf Ritter würden sterben, einer nach dem andern, und der Geist eines jeden würde Sephrenia sein Schwert übergeben. Wenn der letzte gestorben war, würde Sephrenia den zwölf Rittern ins Haus der Toten folgen. An diesem Abend hatte Vanion sie beinahe zwingen müssen, ihm die drei Schwerter zu überlassen. Es war nicht allein das Gewicht dieser Waffen, die sie zu einer solchen Last machten: Irgendetwas war mit ihnen verbunden, von dem Sperber keine Vorstellung besaß. Vanion hatte unerbittlich darauf beharrt, die Schwerter zu übernehmen. Er hatte ein paar vage Gründe dafür angeführt, doch Sperber vermutete, dass der Hochmeister Sephrenia zu schonen versuchte, so gut es ging. Sperber glaubte, dass Vanion ungeachtet aller Verbote, die dergleichen untersagten, diese zierliche Frau liebte, die seit Generationen alle Pandioner die Geheimnisse von Styrikum lehrte. Jeder pandionische Ritter liebte und verehrte sie. Doch Sperber vermutete, dass in Vanions Fall Liebe und Verehrung tiefer gingen. Ihm war auch aufgefallen, dass Sephrenia eine besondere Zuneigung für den Hochmeister empfand, die über die einer Lehrerin für ihren Schüler hinausging – eine weitere Beobachtung, die ein Ordensritter der Hierokratie in Chyrellos melden sollte. Doch auch dies behielt Sperber für sich.
»Weshalb die Zusammenkunft zu dieser unziemlichen Zeit?«, fragte Vanion müde.
»Wollt Ihr es ihm sagen?«, fragte Sperber Sephrenia.
Die Frau im weißen Gewand seufzte und wickelte den länglichen, schmalen Gegenstand aus. Sie brachte ein weiteres pandionisches Zeremonienschwert zum Vorschein. »Ritter Tanis ist ins Haus der Toten eingegangen«, sagte sie traurig zu Vanion.
»Tanis?«, wiederholte Vanion erschüttert. »Wann ist es passiert?«
»Es kann nicht lange her sein«, antwortete sie.
»Sind wir deshalb jetzt zusammengekommen?«, fragte Vanion, an Sperber gewandt.
»Nicht nur. Ehe Tanis sich daranmachte, sein Schwert Sephrenia zu übergeben, kam er zu mir – vielmehr sein Geist. Er teilte mir mit, dass jemand mich in der Domkrypta zu sehen wünschte. Ich habe mich dorthin geschlichen, und Aldreas’ Geist erwartete mich. Er erzählte mir so allerhand, und dann gab er mir dies.« Sperber drehte den Speerschaft aus dem Klingenaufsatz und schüttelte den Rubinring aus seinem Versteck.
»Dort also hat Aldreas ihn versteckt!«, rief Vanion. »Vielleicht war er weiser, als wir dachten. Ihr habt gesagt, dass er Euch so allerhand erzählt hat. Was denn?«
»Dass er vergiftet wurde«, antwortete Sperber. »Wahrscheinlich das gleiche Gift, das man auch Ehlana eingegeben hat.«
»Wer? Annias?«, fragte Kalten grimmig.
Sperber schüttelte den Kopf. »Nein, Prinzessin Arissa.«
»Seine eigene Schwester? Das ist ja ungeheuerlich!«, entsetzte sich Bevier, der als Arzier unverrückbare Moralbegriffe besaß.
»Arissa ist ein Ungeheuer«, versicherte ihm Kalten. »Sie duldet kein Hindernis auf ihrem Weg. Aber wie konnte sie das Kloster in Demos verlassen, um Aldreas zu beseitigen?«
»Dafür hat Annias gesorgt«, antwortete Sperber. »Sie hat Aldreas auf ihre übliche Art die Zeit vertrieben und ihm, als er erschöpft war, den vergifteten Wein kredenzt.«
»Ich fürchte, ich verstehe das nicht so recht.« Bevier runzelte die Stirn.
»Das Verhältnis zwischen Arissa und Aldreas ging über ein geschwisterliches ein wenig hinaus«, erklärte Vanion ihm behutsam.
Beviers Augen weiteten sich, und sein dunkles Gesicht erbleichte, als ihm die Bedeutung von Vanions Worten allmählich klar wurde.
»Warum hat sie ihn getötet?«, fragte Kalten. »Aus Rache, weil er sie im Kloster einsperrte?«
»Nein, das glaube ich nicht«, erwiderte Sperber. »Ich vermute, es gehörte zu dem Plan, den sie und Annias ausgeheckt hatten. Erst vergifteten sie Aldreas, dann Ehlana.«
»Damit der Weg zum Thron für Arissas Bastard frei würde?«, schloss Kalten.
»Es ist logisch«, bestätigte Sperber, »und noch verständlicher, wenn man weiß, dass Lycheas Annias’ Sohn ist.«
»Eines Kirchenmannes?« Tynian blickte erstaunt auf. »Habt ihr hier in Elenien andere Gesetze als wir?«
»Das nicht«, versicherte Vanion ihm. »Aber Annias bildet sich ein, dass er über den Gesetzen steht, und Arissa hat ihre Freude daran, Gesetze zu brechen.«
»Arissa war auch noch nie sonderlich wählerisch«, fügte Kalten hinzu. »Wenn man den Gerüchten glauben darf, hat sie ihre Reize so gut wie jedem Mann in Cimmura angeboten.«
»Das dürfte wohl etwas übertrieben sein.« Vanion stand auf und trat ans Fenster. »Ich werde dem Patriarchen Dolmant diese Neuigkeit mitteilen«, sagte er und blickte hinaus in die Nebelnacht. »Vielleicht kann er Nutzen daraus ziehen, wenn es zur Wahl eines neuen Erzprälaten kommt.«
»Möglicherweise kann auch der Graf von Lenda sie nutzen«, meinte Sephrenia. »Die königlichen Räte sind zwar korrupt, aber selbst ihnen wird es missfallen, dass Annias versucht, seinen eigenen unehelichen Sohn auf den Thron zu heben.« Sie blickte Sperber an. »Was hat Aldreas Euch sonst noch erzählt?«
»Nur noch eines. Wir wissen ja inzwischen, dass wir einen magischen Gegenstand benötigen, um Ehlana zu heilen. Aldreas hat mir gesagt, welchen. Den Bhelliom. Es gibt sonst nichts auf der Welt, das genügend Kraft besitzt.«
Sephrenia erbleichte. »Nein!«, keuchte sie. »Nicht den Bhelliom!«
»Das hat er mir jedenfalls gesagt.«
»Damit ergibt sich ein gewaltiges Problem«, fiel Ulath ein. »Der Bhelliom ist seit dem Zemochischen Krieg verschwunden. Und selbst wenn es uns gelingen sollte, ihn zu finden, wird er seine Kraft nur entfalten, wenn wir die Ringe haben.«
»Ringe?«, fragte Kalten.
»Der Trollzwerg Ghwerig hat den Bhelliom gemacht«, erklärte Ulath, »und danach ein Ringpaar, mit dem des Bhellioms Kräfte freigesetzt werden konnten. Ohne die Ringe ist der Bhelliom nutzlos.«
»Die Ringe haben wir bereits«, sagte Sephrenia abwesend und mit immer noch beunruhigtem Gesicht.
»Wir haben sie?«, fragte Sperber verblüfft.
»Ihr tragt den einen«, belehrte sie ihn, »und Aldreas hat Euch den zweiten heute Nacht anvertraut.«
Sperber starrte auf den Rubinring an seiner Linken, dann wandte er den Blick wieder seiner Mentorin zu. »Wie ist das möglich? Wie kamen mein Ahnherr und König Antor zu diesen Ringen?«
»Ich gab sie ihnen«, antwortete sie.
Er blinzelte. »Sephrenia, das war vor dreihundert Jahren!«
»Ja«, bestätigte sie. »Ungefähr.«
Wieder starrte Sperber sie an und schluckte schwer. »Dreihundert Jahre?«, rief er ungläubig. »Sephrenia, wie alt seid Ihr eigentlich?«
»Ihr wisst sehr wohl, dass ich diese Frage nicht beantworten werde, Sperber. Das sage ich Euch heute ja nicht zum ersten Mal.«
»Wie seid Ihr zu diesen Ringen gekommen?«
»Aphrael, meine Göttin, hat sie mir gegeben – mit einigen Anweisungen. Sie erklärte mir, wo ich Euren Ahnen und König Antor finden würde, und trug mir auf, ihnen die Ringe auszuhändigen.«
»Kleine Mutter …«, begann Sperber und verstummte, als er ihre düstere Miene bemerkte.
»Psst, Liebes«, befahl sie. »Ich werde dies nur ein einziges Mal sagen, meine Herren Ritter«, wandte sie sich an die Anwesenden. »Was wir tun, bringt uns mit den Älteren Göttern in Konflikt, und das ist kein leichtes Unterfangen. Eure elenischen Götter vergeben; die Jüngeren Götter von Styrikum können zur Nachsicht überzeugt werden. Die Älteren Götter jedoch verlangen absoluten Gehorsam gegenüber jeder ihrer Launen. Wider die Befehle eines Älteren Gottes zu handeln oder seinen Verboten zu trotzen bedeutet, Schlimmeres als den Tod fürchten zu müssen. Die Älteren Götter vernichten jene, die sich ihnen widersetzen – auf eine Weise, die Ihr Euch gar nicht vorzustellen vermögt. Wollt Ihr den Bhelliom wahrhaftig wieder ans Licht bringen?«
»Sephrenia! Wir müssen es!«, rief Sperber. »Nur so können wir Ehlana retten – ganz abgesehen von Euch selbst und von Vanion.«
»Annias wird nicht ewig leben, Sperber, und Lycheas ist nicht von Bedeutung. Vanion und ich sind sterblich und so der Zeit untertan, und – welche persönlichen Gefühle Ihr auch immer hegen mögt – dies gilt auch für Ehlana. Die Welt wird keinen von uns so sehr vermissen«, sagte Sephrenia schlicht. »Beim Bhelliom sehen die Dinge ganz anders aus – ebenso bei Azash. Falls wir versagen und dadurch den Stein in die Hand dieses furchtbaren Gottes spielen, stürzen wir die Welt in die ewige Verdammnis. Ist die Sache dieses Risiko wert?«
»Ich bin der Streiter der Königin«, erinnerte Sperber sie. »Ich muss alles tun, was ich nur kann, um ihr Leben zu retten.« Er erhob sich und schritt durch das Gemach zur Styrikerin hinüber. »Möge Gott mir beistehen, Sephrenia, ich würde selbst das Höllentor aufbrechen, um dieses Mädchen zu retten.«
»Er ist manchmal noch so kindisch«, sagte Sephrenia seufzend zu Vanion. »Wisst Ihr nicht, wie man ihm helfen könnte, endlich erwachsen zu werden?«
»Ich habe mir gerade überlegt, ob ich ihn auf seinem Feldzug begleiten sollte«, entgegnete der Hochmeister lächelnd. »Ich könnte Sperbers Umhang halten, während er das Höllentor einrennt. Einen Sturmangriff auf die Hölle erlebt man nicht alle Tage.«
»Auch Ihr?« Sie barg das Gesicht in den Händen. »Dann hilft es nichts«, seufzte sie. »Nun denn, meine Herren«, sagte sie resignierend, »da Ihr alle so versessen darauf seid, wollen wir es versuchen – doch nur unter einer Bedingung. Falls wir den Bhelliom finden, müssen wir ihn vernichten, sobald Ehlana gesundet ist.«
»Vernichten?«, fuhr Ulath auf. »Sephrenia, er ist das wertvollste Kleinod auf der Welt!«
»Und auch das gefährlichste. Sollte der Bhelliom je in Azashs Besitz kommen, ist die Welt verloren, und die gesamte Menschheit wird in eine Sklaverei gestürzt, wie man sie sich grauenvoller nicht vorstellen könnte. Ich muss auf dieser Bedingung bestehen, meine Herren. Wenn Ihr mir nicht Euer Wort darauf gebt, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass Ihr diesen verfluchten Stein findet.«
»Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben«, sagte Ulath ernst zu den anderen. »Ohne Sephrenias Hilfe dürfte die Hoffnung gering sein, den Bhelliom aufzuspüren.«
»Oh, irgendjemand wird ihn ganz bestimmt finden«, entgegnete Sperber überzeugt. »Aldreas hat gesagt, dass die Zeit gekommen ist, da der Bhelliom wieder erscheint, und dass keine Macht der Welt dies verhindern kann. Mir bereitet nur Sorge, dass ihn irgendein Zemocher vor uns finden und Otha übergeben könnte.«
»Oder dass der Bhelliom aus eigener Kraft auftaucht«, fügte Tynian düster hinzu. »Könnte er das, Sephrenia?«
»Wahrscheinlich.«
»Wie hast du eigentlich das Ordenshaus verlassen, ohne dass dich des Primas’ Spione entdeckten?«, fragte Kalten Sperber neugierig.
»Ich habe ein Seil über die hintere Mauer geworfen und bin daran hinuntergeklettert.«
»Und wie hast du die Stadt betreten und verlassen, nachdem alle Tore geschlossen waren?«
»Auf dem Hinweg hatte ich Glück, das Osttor war noch offen. Und um herauszugelangen, habe ich mich eines anderen Weges bedient.«
»Diese Dachkammer, von der ich Euch erzählt hatte?«, fragte Talen.
Sperber nickte.
»Was hat er dafür verlangt?«
»Eine silberne Halbkrone.«
Talen starrte ihn entrüstet an.
»Und mich nennt man einen Dieb! Er hat Euch ganz schön ausgenommen, Sperber.«
»Ich musste hinaus aus der Stadt.« Sperber zuckte mit den Schultern.
»Ich werde es Platime erzählen«, versprach der Junge. »Er wird sich Euer Geld zurückholen. Eine halbe Krone? In Silber? Das ist Wucher!«
Sperber erinnerte sich plötzlich an einen weiteren Vorfall. »Sephrenia, auf dem Rückweg hat irgendetwas mich durch den Nebel beobachtet. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch war.«
»Der Damork?«
»Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, es war ein anderes Wesen. Der Damork ist doch nicht die einzige Kreatur, die Azash dient, oder?«
»Nein. Der Damork ist zwar sein mächtigster Diener, aber er ist dumm. Die anderen haben zwar nicht seine Kräfte, sind jedoch viel schlauer. In so mancherlei Hinsicht können sie deshalb gefährlicher sein.«
»Also gut, Sephrenia«, sagte Vanion. »Gebt mir jetzt Tanis’ Schwert.«
»Aber, mein Lieber …«, protestierte sie mit gequältem Gesicht.
»Wir haben uns gestern Abend eingehend darüber unterhalten«, unterbrach er sie. »Wir wollen nicht noch einmal beginnen!«
Sie seufzte. Dann sprachen sie gemeinsam die styrischen Worte. Vanions Gesicht wurde noch ein bisschen fahler, als Sephrenia ihm schließlich das Schwert aushändigte und sich ihre Hände berührten.
»Also.« Sperber wandte sich an Ulath, nachdem die Übergabe beendet war. »Wo fangen wir an? Wo war König Sarak, als er seine Krone verlor?«
»Das weiß niemand genau«, antwortete der riesenhafte Genidianer. »Er verließ Emsat, als Otha in Lamorkand einfiel, und nahm nur ein paar Gefolgsleute mit sich. Er hinterließ seiner Armee den Befehl, ihm zum Schlachtfeld am Randerasee zu folgen.«
»Hat ihn dort jemand gesehen?«, fragte Kalten.
»Nicht, dass ich wüsste. Die thalesische Armee erlitt jedoch schwere Verluste. Es ist möglich, dass Sarak vor Ausbruch der Schlacht dort anlangte, aber keiner der wenigen Überlebenden hatte ihn gesehen.«
»Dann würde ich sagen, dass wir dort mit der Suche beginnen«, schlug Sperber vor.
»Sperber«, wandte Ulath ein, »das Schlachtfeld war riesig. Selbst wenn alle Ordensritter dort ihr ganzes Leben lang die Erde umgrüben, wäre nicht sicher, dass sie dabei die Krone fänden.«
»Es gäbe noch eine andere Möglichkeit«, sagte Tynian und kratzte sich am Kinn.
»Und die wäre, Freund Tynian?«, fragte Bevier.
»Ich verstehe ein wenig von Nekromantie«, antwortete Tynian. »Ich habe nicht viel dafür übrig, aber ich weiß, wie man es macht. Wenn wir herausfinden können, wo die Thalesier begraben sind, können wir sie fragen, ob irgendeiner König Sarak auf dem Schlachtfeld gesehen hat und vielleicht sogar weiß, wo er begraben sein könnte. Es ist zwar sehr anstrengend, aber vielleicht der Mühe wert.«
»Ich werde Euch unterstützen können, Tynian«, sagte Sephrenia. »Ich selbst praktiziere Nekromantie zwar nicht, aber ich kenne die notwendigen Beschwörungen.«
Kurik stand auf. »Dann kümmere ich mich am besten gleich um alles, was wir brauchen werden. Kommt mit, Berit und Talen.«
»Wir werden zehn Leute sein«, rief Sephrenia ihm nach.
»Zehn?«
»Wir nehmen Talen und Flöte mit.«
»Ist das wirklich nötig?«, wandte Sperber ein. »Klug erscheint es mir nicht.«
»Ja, es ist nötig. Wir werden uns an einige der Jüngeren Götter um Hilfe wenden, und diese lieben Beständigkeit und Symmetrie. Wir waren zehn Leute, als wir diese Suche begannen, und wir müssen den ganzen Weg über zehn Leute sein. Die Jüngeren Götter mögen keine plötzlichen Änderungen.«
»Ihr müsst es wissen.« Sperber zuckte mit den Schultern.
Vanion erhob sich und stapfte auf und ab. »Dann machen wir uns am besten sofort daran. Es ist vielleicht sicherer, wenn Ihr das Ordenshaus vor Tagesanbruch verlasst. Ehe sich der Nebel auflöst. Wir wollen es den Spitzeln, die die Burg überwachen, auf keinen Fall zu leicht machen.«
»Ganz meine Meinung.« Kalten nickte. »Mir ist es lieber, wenn wir nicht den ganzen Weg zum Randerasee vor Annias’ Soldaten herhetzen müssen.«
»Also gut«, pflichtete Sperber bei, »dann wollen wir keine Zeit mehr vergeuden.«
»Bleibt noch einen Moment, Sperber«, bat Vanion, als die anderen das Zimmer verließen.
Sperber wartete, bis sie allein waren, und schloss die Tür.
»Ich habe gestern Abend eine Nachricht vom Grafen von Lenda erhalten«, sagte der Hochmeister zu seinem Freund.
»Ach?«
»Er bat mich, Euch zu beruhigen. Annias und Lycheas unternehmen keine weiteren Schritte gegen die Königin. Das Scheitern ihres Komplotts in Arzium hat Annias offenbar in große Verlegenheit gebracht. Er möchte das Risiko nicht eingehen, noch einmal so unliebsam auf sich aufmerksam zu machen.«
»Da fällt mir ein Stein vom Herzen.«
»Lenda hat noch etwas hinzugefügt, das ich nicht so recht verstehe. Er hat mich ersucht, Euch auszurichten, dass die Kerzen noch brennen. Habt Ihr eine Ahnung, was er damit meint?«
»Der gute alte Lenda!« Sperbers Stimme war voller Wärme. »Ich bat ihn, Ehlana nicht in der Finsternis im Thronsaal sitzen zu lassen.«
»Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle für die Königin spielt, Sperber.«
»Aber für mich«, erwiderte Sperber.
2
Als sie sich eine Viertelstunde später auf dem Hof versammelten, war der Nebel noch dichter geworden. In der Stallung sattelten die Novizen die Pferde.
Vanion trat durch den Haupteingang ins Freie. Sein styrischer Morgenrock schimmerte verschwommen in der Dunkelheit. »Ich gebe Euch zwanzig Ritter mit«, sagte er leise zu Sperber. »Ihr könntet verfolgt werden, und sie werden Euch ein bisschen Schutz bieten.«
»Wir müssen schnell reiten, Vanion«, protestierte Sperber. »Wenn wir andere mitnehmen, kommen wir nicht schneller voran als deren langsamstes Pferd.«
»Das weiß ich, Sperber«, erwiderte Vanion geduldig. »Ihr braucht nicht lange mit ihnen zusammenzubleiben. Wartet, bis Ihr auf freiem Feld seid und die Sonne aufgeht. Vergewissert Euch, dass niemand zu dicht hinter Euch ist, dann verlasst die Kolonne. Die Ritter werden weiter nach Demos reiten. Falls Euch jemand folgt, werden sie nicht bemerken können, dass Ihr nicht mehr bei dem Trupp seid.«
Sperber grinste. »Jetzt weiß ich, wie Ihr es zum Hochmeister gebracht habt, mein Freund. Wer führt den Trupp?«
»Olven.«
»Gut. Olven ist verlässlich.«
»Gott behüte Euch, Sperber.« Vanion drückte dem großen Ritter die Hand. »Und seid vorsichtig.«
»Ich werde mein Möglichstes tun.«
Ritter Olven war ein stämmiger Pandioner mit mehreren fast glühend roten Narben im Gesicht. In voller, schwarz emaillierter Rüstung trat er aus dem Ordenshaus, gefolgt von seinen Männern. »Schön, dich wiederzusehen, Sperber«, sagte er, als Vanion ins Haus zurückkehrte. Olven redete sehr leise, damit es die Kirchensoldaten nicht hören konnten, die vor dem Haupttor lagerten. »Also«, fuhr er fort, »du reitest mit deinen Begleitern in unserer Mitte. Bei diesem Nebel werden die Soldaten euch wahrscheinlich nicht sehen. Wir lassen die Zugbrücke hinunter und galoppieren. So werden wir nicht länger als ein oder zwei Minuten in ihrer Sichtweite sein.«
»Das sind mehr Worte, als ich in den vergangenen zwanzig Jahren je auf einmal von dir gehört habe.« Sperber lächelte seinen sonst so wortkargen Freund an.
»Ich weiß«, gab Olven zu. »Soll nicht wieder vorkommen.«
Sperber und seine Freunde trugen Kettenhemden und feste Umhänge, da Panzerrüstung bei Soldaten, die durch die Weite des Landes ritten, unliebsame Aufmerksamkeit erregen würde. Doch sie führten Rüstungen mit sich, sorgfältig verpackt und auf dem halben Dutzend Tragtiere verstaut, für die Kurik verantwortlich war. Sie saßen auf, und die Ritter in ihren Paraderüstungen formierten sich rings um sie. Olven gab den Männern an der Winde, mit der die Zugbrücke hoch- und niedergelassen wurde, ein Zeichen, und die Männer lösten die Sperrklinken. Ketten rasselten ohrenbetäubend, und die Brücke schlug krachend auf. Olven galoppierte hinüber, kaum dass sie auf der anderen Grabenseite auflag.
Der dichte Nebel war eine große Hilfe. Olven bog sofort scharf nach links ab und führte den Trupp querfeldein zur Straße nach Demos. Sperber vernahm die überraschten Schreie hinter ihnen, als die Kirchensoldaten aus ihren Zelten eilten und dem Trupp voller Bestürzung hinterherstarrten.
»Sehr geschickt«, lobte Kalten. »In weniger als einer Minute über die Zugbrücke und im dichten Nebel verschwunden.«
»Olven versteht sein Handwerk«, erwiderte Sperber. »Und noch erfreulicher ist, dass die Soldaten mindestens eine Stunde brauchen werden, bevor sie aufsitzen und uns verfolgen können.«
Kalten lachte erfreut. »Bei einer Stunde Vorsprung holen sie mich nie ein! Das ist schon mal ein guter Beginn, Sperber.«
»Erfreue dich daran, solange du kannst. Später wird bestimmt noch genug schiefgehen.«
»Du bist ein Pessimist, weißt du das?«
»Nein, ich bin nur an kleine unerfreuliche Überraschungen gewöhnt.«