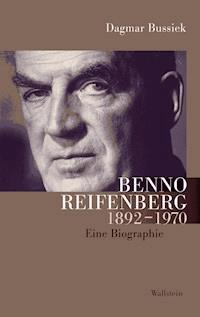
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Redakteur der Frankfurter Zeitung und Herausgeber der FAZ war einer der bedeutendsten deutschen Journalisten des 20. Jahrhunderts. Benno Reifenbergs Vita ist auf das Engste verbunden mit der Geschichte der »Frankfurter Zeitung", die im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik zu den wichtigsten Stimmen des deutschen Liberalismus zählte. In der NS-Zeit konnte das Blatt als Vorzeige-Zeitung für das Ausland bis 1943 weiter erscheinen und genoss dabei größere Freiräume als die meisten anderen deutschen Medien. Dennoch musste die Redaktion täglich einen heiklen Balanceakt zwischen Anpassung und Widerstand leisten. Als »Halbjude" war Reifenbergs Situation dabei besonders prekär. Von 1945 bis 1958 wirkte er als Herausgeber der Halbmonatsschrift »Die Gegenwart", die sich in der rasch wandelnden Medienlandschaft der jungen Bundesrepublik nicht behaupten konnte. Nach der Fusion der »Gegenwart" mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war Reifenberg von 1959 bis 1966 FAZ-Herausgeber und zählte damit erneut zu den tonangebenden Publizisten in Deutschland. Dagmar Bussiek porträtiert Reifenberg als politischen Kommentator und leidenschaftlichen Feuilletonisten, der fünf Jahrzehnte deutscher Geschichte schreibend mitgestaltet hat. Reifenberg war Demokrat und zugleich mental verankert in der Bürgerwelt des 19. Jahrhunderts. Seine Mission war die Bewahrung der bürgerlichen Lebenswelt und Deutungsmacht über historische Zäsuren hinweg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dagmar Bussiek
Benno Reifenberg 1892–1970
Dagmar Bussiek
Benno Reifenberg
1892–1970
Eine Biographie
WALLSTEIN VERLAG
Gedruckt mit Unterstützung
der FAZIT-Stiftung
Bibliografische Information der deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2011
www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus der Adobe Garamond
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
Umschlagfoto: DLA Marbach, Bildstelle
ISBN (Print) 978-3-8353-0898-5 ISBN (eBook, pdf) 978-3-8353-2118-2 ISBN (eBook, epub) 978-3-8353-2117-5
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Inhalt
Einleitung
Prägungen
Bürgerliche Herkunft und Fronterfahrung
Kindheit, Schulzeit, Studium (1892-1914)
Herkunft und Familie
Humanistisches Gymnasium
Frankfurt am Main
Studienjahre
Der Erste Weltkrieg (1914-1918)
Kriegsfreiwilliger an der Westfront
Artillerieoffizier
Nachwirkung und Verarbeitung
Konsolidierung
Aufstieg bei der »Frankfurter Zeitung«
Der Weg in den Journalismus (1919-1924)
Heimkehr nach Frankfurt
Die Entstehung eines Netzwerkes
Beruf: Journalist
Leiter des Feuilletons (1924-1930)
Redaktioneller Alltag
Das Feuilleton als Diskursraum
Revirement
Politisierung (1930-1933)
Korrespondent in Paris
Ressort: Innenpolitik
Gratwanderungen
Vom Leben und Schreiben in der Diktatur
Publizist im NS-Staat (1933-1937/38)
Der Prozess der Machtübernahme
Die Redaktion im NS-Staat
Anpassung und Zustimmung
Die »Resistenz« des Bildungsbürgers
Rückzug in Etappen (1938-1945)
Eine Bildbesprechung und ihre Folgen
Krankheit und Rekonvaleszenz
Rückkehr in die Redaktion
»Innere Emigration«
Das Ende der »Frankfurter Zeitung«
Zuflucht im Schwarzwald
Unterstützung durch die IG Farben
Vergangenheitsbewältigung und neue Herausforderungen
Eine Karriere im Westen
»Die Gegenwart« (1945-1958)
Die Zeitschrift
Die Schatten der Vergangenheit
Politische Positionen
Persönlicher Lebenszuschnitt und publizistische Produktivität
Das Scheitern der »Gegenwart« und die Übernahme durch die FAZ
Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (1959-1970)
Der Herausgeber
Die späten Jahre
Schlussbetrachtung
Quellen und Literatur
Bildnachweis
Dank
Einleitung
Benno Reifenberg (1892-1970) war einer der bedeutendsten deutschen Journalisten des 20. Jahrhunderts. Sein Name und seine Vita sind auf das Engste verbunden mit der Geschichte der »Frankfurter Zeitung« (FZ), die im Kaiserreich und in der Weimarer Republik zu den wichtigsten Stimmen des deutschen Liberalismus gezählt und in der strikt reglementierten Presselandschaft des NS-Staates eine besondere Rolle gespielt hatte: Obschon den Machthabern als bürgerliches Blatt mit einem traditionell hohen Anteil jüdischer Mitarbeiter prinzipiell verhasst, konnte sie aus politisch-strategischem Kalkül bis Mitte 1943 weiter erscheinen und genoss als Vorzeigeorgan fürs Ausland größere Spielräume für eine partiell nichtnationalsozialistische Berichterstattung als das Gros der übrigen deutschen Medien. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte eine intensive Legendenbildung um das »Weltblatt« vom Main ein, dessen ehemalige Mitarbeiter eine maßgebliche Position beim Wiederaufbau der deutschen Presse in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland beanspruchten und de facto auch übernahmen. Die Abgrenzung erfolgte dabei nicht nur gegenüber den einstigen nationalsozialistischen »Schriftleitern«, sondern auch gegenüber den heimkehrenden Emigranten, denen ein Urteil über die jüngste deutsche Geschichte und damit zugleich auch die Berechtigung zur Gestaltung der deutschen Gegenwart und Zukunft nicht oder nur in geringerem Maße zugestanden wurde. An der schwierigen Gratwanderung der FZ-Redaktion zwischen politischer Anpassung und Dissens in den Jahren 1933 bis 1943 war Benno Reifenberg maßgeblich beteiligt. Nach 1945 agierte er in seiner eigenen wie in der Wahrnehmung der Zeitgenossen als eine Art »Gralshüter der FZ-Tradition«1.
Reifenberg entstammte dem wohlhabenden städtischen Bürgertum und damit jener sozialen Schicht, der sich die FZ seit ihrer Gründung als »Börsenblatt« in den 1850er Jahren politisch, ökonomisch und kulturell verbunden und verpflichtet gesehen hatte. Im August 1914 hatte sich der Student der Kunstgeschichte – wie so viele Angehörige seiner Generation – freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet; er erlebte den gesamten Ersten Weltkrieg an der Westfront. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt Frankfurt am Main ebneten ihm persönliche Beziehungen den Weg in die Redaktion der FZ. Er begann seine Laufbahn als freier Mitarbeiter, zuständig für das lokale Frankfurter Kunstgeschehen, und machte in den Weimarer Jahren rasch und reibungslos Karriere: als Leiter des renommierten FZ-Feuilletons von 1924 bis 1930, als Pariser Korrespondent des Blattes 1930/31, als führender Kopf in der politischen Zentralredak tion in Frankfurt 1932/33. Intern galt Reifenberg bei der FZ als Zögling und möglicher Nachfolger von Heinrich Simon, dem Enkel und Erben des Zeitungsbegründers Leopold Sonnemann. Als die jüdische Familie Simon-Sonnemann nach der Machtübernahme Hitlers emigrieren musste, entschloss sich Reifenberg, der – obschon katholisch getauft und erzogen – nach den »Rassegesetzen« der Nationalsozialisten als »Halbjude« galt, zum Verbleiben in Deutschland und zur Fortsetzung seiner Tätigkeit bei der FZ. In dem Kreis prominenter Publizisten, die sich nach Kriegsende vergeblich um eine Wiederbegründung des traditionsreichen Blattes bemühten, spielte er eine Schlüsselrolle. Von 1945 bis 1958 wirkte er als Herausgeber der Halbmonatsschrift »Die Gegenwart«, die als Provisorium bis zur geplanten Neugründung der FZ und Auffangbecken für einen Stamm ehemaliger FZ-Redakteure konzipiert worden war und sich in der expandierenden und rasch wandelnden Medienlandschaft der jungen Bundesrepublik nicht behaupten konnte. 1958 erfolgte die Fusion der »Gegenwart« mit der ungleich erfolgreicheren, 1949 gegründeten »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (FAZ), die sich bis heute auf das Erbe der alten FZ beruft. Reifenberg wurde in die Riege der FAZ-Herausgeber aufgenommen und war in dieser Position bis zum Eintritt in den Ruhestand 1966 tätig. Als freier Mitarbeiter wirkte er bis zu seinem Tod im Jahre 1970 für die FAZ.
Die Rolle der FZ im »Dritten Reich« wird bis heute in der historischen Forschung kontrovers diskutiert. Dies wurde augenfällig deutlich im Februar 2005 auf einer Tagung der »Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944«, auf der unterschiedliche Aspekte der Pressegeschichte in der NS-Zeit verhandelt wurden. Angesichts der Tatsache, dass es »publizistischen Widerstand im engeren Sinne«2 im totalitären Staat lediglich in Form von illegal angefertigten und verbreiteten Flugschriften hatte geben können, nicht aber in den allgemein zugänglichen, permanent kontrollierten und der Zensur unterworfenen Zeitungen und Zeitschriften, lag der Focus auf jenem »moralischen Respekt erhaschende[n] ›Schreiben zwischen den Zeilen‹«, mit dem in legal existierenden, staatlich reglementierten Publikationsorganen »vorsichtige Distanzierungen, ja gelegentlich sogar partielle Dissidenz« im Hinblick auf die ideologischen Vorgaben des Regimes signalisiert wurden.3 »Der Verlauf der Tagung«4, so berichtet Christoph Studt, der Herausgeber eines nachfolgend publizierten Sammelbandes, veranlasste den Berliner Historiker Bernd Sösemann dazu, den Schwerpunkt seines das Gesamtthema reflektierenden Einführungsvortrages für die Druckfassung zu ändern: Im Zentrum stand nun die Auseinandersetzung mit der FZ im NS-Staat5 – ein Gegenstand, der im Kolloquium von dem Historiker und ehemaligen Redaktionsmitglied der FAZ Günther Gillessen behandelt worden war6, so dass man im Tagungsband auf die »Doppelung eines Themas«7 stößt. Der Grund erschließt sich bei der Lektüre der beiden Aufsätze rasch: Vorgelegt werden zwei Darstellungen, die gleiche Vorgänge mit stark unterschiedlicher Wertung präsentieren.
In Anlehnung an seine großangelegte Studie von 1986 sieht Gillessen die FZ im »Dritten Reich«8 als Organ einer »getarnte[n] öffentliche[n] Opposition«9. Mit Hilfe ausgefeilter Codes habe das Bürgerblatt zu seinen Lesern gesprochen und dabei einen »Widerstandswillen« an den Tag gelegt, der von den Zeitgenossen wohl verstanden worden sei, von den Nachgeborenen jedoch nicht nachvollzogen werden könne oder schlicht abgeleugnet werde – »[v]erständlich vielleicht«, wie Gillessen angesichts der Menschheitsverbrechen des Regimes einräumt, aber in seiner Lesart Ausdruck von »Nachher-Wissen, auch Nachher-Besser-Wissen«10. Die Replik Sösemanns fiel scharf aus: Mangelnde Quellenkritik bei umfangreicher Erschließung des zur Verfügung stehenden Materials warf er Gillessen vor, »forcierte Rechtfertigungsbemühungen«, »thematischkonzeptionelle Enge«, »fehlenden Nuancenreichtum« und eine »Emotionalisierung der Debatte«, die statt zu einer »Klärung« zu einer »Verzeichnung der Sachverhalte« führe.11 Selbst ehemalige Mitarbeiter der FZ hätten rückblickend differenzierter über ihr eigenes Tun geurteilt als der Historiker Gillessen. Als zeitgenössischen Kronzeugen eines solchen »vorsichtigeren« Urteils zitiert Sösemann den langjährigen FZ-Redakteur Reifenberg, der gegenüber dem Kollegen Oskar Stark erklärt habe, »›[d]ie einzige Konsequenz, die er [Reifenberg, DB] daraus [aus der NS-Diktatur, DB] gezogen hatte, sei die, daß man den allerersten Anfängen widerstehen müsse; wenn man einmal im Geschirr sei, sei es mit der Freiheit der Entschließung vorbei.‹«12
Zweierlei wird an dieser Stelle deutlich. Zum einen: Obwohl die Geschichte der FZ gründlich erforscht und intensiv diskutiert worden ist, besteht bis heute kaum ein Minimalkonsens im Hinblick auf ihre Rolle in der NS-Zeit; am versöhnlichsten zeigte sich noch Martin Broszat in seiner 1987 im »Spiegel« veröffentlichten Replik auf Gillessens Buch mit dem beziehungsreichen Titel »Sanfte Gegenrede«.13 Zum anderen: Über Benno Reifenberg, der in der Wahrnehmung der Zeitgenossen über lange Jahre der – zumindest informelle – »Steuermann«14 der FZ und die »Seele«15 des Unternehmens gewesen ist, ist bis heute wenig bekannt: so wenig, dass sich der ansonsten gut informierte und prägnant argumentierende Sösemann auf Zitate aus zweiter Hand stützt, um Reifenbergs (vermeintlichen) Standpunkt zu verdeutlichen. Während Leben und Werk anderer ehemaliger Redakteure und Mitarbeiter der FZ im Zentrum wissenschaftlicher Arbeiten stehen16, spielte Reifenberg bisher die Rolle des in unterschiedlichen Kontexten immer wieder gern zitierten, bei Bedarf zur moralischen Leitfigur stilisierten großen Unbekannten des Mythos FZ.17 Diese Lücke zu schließen und Reifenbergs Bedeutung und Position bei der FZ und den mit ihr verbundenen personellen Netzwerken sowie nachfolgend im westdeutschen Nachkriegsjournalismus und in der Bundesrepublik Deutschland einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen ist das Ziel der vorliegenden Biographie. In diesem Kontext wird zunächst ein knapper Blick auf die entscheidenden Sozialisationsinstanzen Reifenbergs gewährt werden: das Bürgertum als Herkunftsmilieu, die Stadt Frankfurt am Main als Lebensraum, schließlich die Zugehörigkeit zur »Frontgeneration« des Ersten Weltkrieges.
Bürgertum und Bürgerlichkeit
Jenes Milieu, dem Benno Reifenberg entstammte und in dem er lebenslang sozial wie mental verankert blieb, an das sich auch die FZ zuvörderst wandte, war das Bürgertum, wie es sich als gesellschaftliche Formation seit der Aufklärung herausgebildet und etabliert hatte. Es war Dolf Sternberger, einer der Begründer der bundesdeutschen Politikwissenschaft in der Nachkriegszeit, langjähriger Mitarbeiter der FZ und persönlicher Freund Reifenbergs, der im Jahre 1975 in einem schmalen Band mit dem programmatischen Titel »Gerechtigkeit für das neunzehnte Jahrhundert« die Metapher des »Schiffbruchs« analysierte, die das Scheitern eines Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft an deren Maßstäben und Anforderungen beschreibt:
»Mit Bedauern wohl, das vielleicht mit einem gewissen Genusse gemisch t ist, wird es ausgesprochen, wenn jemand ›im Leben Schiffbruch erlitten‹ habe. Wenn aber ein Unterton von moralischem Hochmut mitklingt – in der Gesinnung: er hat es sich selber zuzuschreiben, er war zu waghalsig (oder so ähnlich) –, so ist dies doch dem Bilde selber keineswegs wesentlich. Denn dieses ist vielmehr gänzlich außerhalb aller Moral gelegen […]. Mag der ›Schiffbruch‹ sich dem empirischen Sinn im einzelnen als Folge wirtschaftlicher Verwicklungen, falscher Spekulationen, als Zerrüttung der Familie, Krankheit, Prestigeverlust oder was immer darstellen – die allegorische Wendung […] stempelt ihn sofort zum Naturereignis […]. Jenseits von Gut und Böse, ja von Glaube und Unglaube, ohne Gott und ohne Teufel, jenseits überhaupt aller Verknüpfungen und Verpflichtungen menschlichen Zusammenlebens vollzieht sich der allegorische Schiffbruch«.18
Wenn die Grundfesten des bürgerlichen Daseins – materielle Sicherheit, überschaubare Ordnung der beruflichen wie privaten Lebensverhält nisse, öffentliche Respektabilität, physische wie mentale Gesundheit – ins Wanken, in Umsturz geraten, dann entsteht ein krisenhaft, ja: mitunter katastrophal empfundenes Szenario. Abhilfe verspricht allein die Rettung durch Orientierung an einem »festen Punkt« im »aufgewühlten Meere«19 als Ausgangsbasis zur Reorganisation der Existenz, zum Neuaufbau.
Die Historiker Manfred Hettling und Stefan-Ludwig Hoffmann rekurrierten auf Sternbergers Ausführungen, als sie im Jahre 1997 das Bild der »hohen See« des Lebens und der stets drohenden Gefahr des »Schiffbruchs« aufnahmen, um Werte und Normen des deutschen Bürgertums im »langen« 19. Jahrhundert zu beschreiben. Dabei begriffen sie Bürgerlichkeit als »moralische Ordnung«, deren Grundsätze und Überzeugungen dem Bürger als Kompass dienten, die Turbulenzen seiner persönlichen Lebensgestaltung zu meistern: »Wie sich ein Seemann an den Sternen orientiert, um sein Schiff sicher auf das gewünschte Ziel hinzulenken, so bildeten Normen und Vorstellungen einen gemeinsamen Wertehimmel, an dem sich jeder individuell ausrichten konnte und mußte.«20 Während im 18. Jahrhundert die Selbsterziehung des Menschen, der sich an seinen persönlichen Maßstäben zu messen habe, im Vordergrund gestanden habe, sei im 19. Jahrhundert die Konfrontation des Individuums mit den Anforderungen »der Welt« in den Mittelpunkt gerückt, so dass bürgerliche Erziehung, Sozialisation und Lebensführung im Wesentlichen in der Aneignung von allgemein akzeptierten Grundsätzen und Werten, Verhaltensweisen und Spielregeln bestanden habe. Dabei umfasste das bürgerliche Wertesystem, wie Hettling und Hoffmann ausführen, einerseits den Bereich gesellschaftlicher Konventionen und »Tugenden« wie Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit, Pflichterfüllung, Mäßigung und Selbständigkeit, andererseits aber auch »emotionale Fixsterne wie etwa Liebe, Glaube, Anmut, Hingabe, Freundschaft.«21 Diese Werte, die dem jeweiligen »Kapitän« der eigenverantwortlich gestalteten bürgerlichen Existenz behilflich sein sollten, die »Untiefen des Lebens«22 sicher zu umschiffen oder zu bewältigen, mussten individuell angeeignet werden, wobei die damit verbundene Freiheit nicht selten auch als Überforderung erfahren wurde. Als zentraler Wert fungierte die Bildung, die den (männlichen) Bürger in den Stand versetzen sollte, einerseits das gesellschaftliche Versprechen auf Entwicklung der eigenen Persönlichkeit einzulösen, andererseits zum Leben in Gemeinschaften, zum Handeln in Gruppen, zum Zusammenschluss in Verbänden in der Lage zu sein: »Die Verbindung von Individuen zu selbständig gebildeten und freiwilligen Verbänden bildete den Kern des bürgerlichen Sozialmodells seit dem späten 18. Jahrhundert.«23
Benno Reifenberg hat seine publizistische Nachkriegsschöpfung »Die Gegenwart« in einer redaktionsinternen Denkschrift von 1951 als »bürgerliche Zeitschrift« bezeichnet, die – ganz in der Tradition der FZ – »nur selbständig denkende« Menschen zu erreichen beabsichtige.24 Legt man den Maßstab der Berufszugehörigkeit als Messlatte für bürgerliche Existenz an, so ist dieses Ziel erreicht worden. Das Leserprofil der »Gegenwart« erschließt sich über eine Statistik vom 19. August 1950, der 1.381 Leserzuschriften zugrunde lagen, die von der Redaktion akribisch sortiert und ausgewertet worden waren. Demnach gehörten 28,2 Prozent den »freien akademischen Berufen« (Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, freiberufliche Ingenieure) an, 11,1 Prozent arbeiteten in »höheren akademischen Berufen« im Staatsdienst, 6,1 Prozent waren Universitätsprofessoren und sonstige Wissenschaftler, 5,2 Prozent akademisch gebildete Lehrkräfte an Schulen und 1,6 Prozent Geistliche (ausschließlich protestantischer Konfession), summa summarum 52,2 Prozent Angehörige des Bildungsbürgertums im herkömmlichen Sinne. Hinzu kamen insgesamt 28,4 Prozent Leser(briefschreiber) aus den gehobenen Schichten des Wirtschaftslebens wie etwa selbständige Unternehmer, Direktoren, Bankleiter, Prokuristen und sonstige leitende Angestellte größerer Firmen. 13,1 Prozent entfielen auf die »kleinbürgerlichen« Gruppen der kaufmännischen Angestellten und mittleren Beamten; die übrigen ausgewerteten Leserzuschriften waren von Rentnern, Hausfrauen oder Personen ohne Berufsangabe verfasst worden. Arbeiter, Landwirte, Handwerker und kleine Gewerbetreibende wie etwa Gastwirte fehlten in der Aufstellung vollständig.25
Doch ist überhaupt legitim, für die junge Bundesrepublik Deutschland noch von einer »bürgerlichen« Zeitschrift, von einem »bürgerlichen« Lesepublikum zu sprechen und damit Begrifflichkeiten und Denktraditionen, die in der Zeit der Französischen Revolution begründet worden und für das 19. Jahrhundert zutreffend gewesen waren, auf eine Gesellschaft zu übertragen, die unter dem Eindruck zweier Weltkriege und einer totalitären, bei allen Ausgrenzungsmechanismen in vielerlei Hinsicht egalisierend wirkenden Diktatur stand? Vieles spricht dafür, dass die bürgerliche Gesellschaft als Kultur- und Wertegemeinschaft bereits Jahrzehnte zuvor im Ersten Weltkrieg erloschen war, buchstäblich versunken »im Schlamm der Schlachtfelder«26, wie Elisabeth Domansky formuliert. Schon in der Weimarer Republik konnte unter dem Eindruck von Kriegsschulddebatte, Inflation, Massenarbeitslosigkeit und politischer Radikalisierung immer weiterer Bevölkerungskreise von einer dominanten bürgerlichen Leitkultur nur noch eingeschränkt die Rede sein, und ab 1933 ließ die Ideologie der klassen- und schichtenübergreifenden, rassisch definierten NS-»Volksgemeinschaft« kaum noch Raum für originär bürgerlichen Gestaltungswillen. Dennoch haben Fragmente überlieferter Bürgerlichkeit bis heute überdauert, prägten noch die bundesrepublikanische Geschichte in vielfältiger Weise und sind bis in unsere Gegenwart im 21. Jahrhundert wirkmächtig geblieben.27
Die profundeste Darstellung und Analyse zum Bürgertum im 20. Jahrhundert findet sich bei Hans-Ulrich Wehler, der im vierten Band seiner »Deutschen Gesellschaftsgeschichte« von 2003 den Prozess der sukzessiven Auflösung der vertrauten Sozialordnung zwischen 1914 und 1949 nachzeichnet. Wehler arbeitet zunächst heraus, dass die bürgerlichen Klassen mit ihrer »Doppelspitze aus Großbourgeoisie und Bildungsbürgertum«28 von den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges in höchst unterschiedlichem Maße betroffen waren: Während der Krieg in den Bildungsschichten durch den Rückgang der Realeinkommen und den Statusverlust, unter dem namentlich die privilegierte Gruppe der höheren Beamten litt, »verheerende Spuren«29 hinterließ, zeigte sich bei Unternehmern und Geschäftsleuten eine tiefe Kluft zwischen Rüstungsindustrie und Kriegsgewinnlern auf der einen und den Verlierern aus den Reihen der notleidenden Konsumgüter- und Baubranche auf der anderen Seite. Wie das Bildungs- und Teile des Wirtschaftsbürgertums ging auch das von massiven Gehaltsreduktionen betroffene Kleinbürgertum 1918/19 ökonomisch geschwächt und mental angeschlagen in die junge, von großen Teilen der bis dato tonangebenden Schichten ungeliebte Republik. Vielen einstmals Privilegierten war die materielle Basis des gewohnten Lebensstils abhandengekommen; hinzu kamen politische Verunsicherung angesichts des Zusammenbruchs der Monarchie, Revolutionsangst und die Konfrontation mit einer partiell bürgertumskritischen Linken: Das »traditionell selbstbewußte Ensemble von Berufsklassen und Funktionseliten [befand sich] in einem Zustand fataler Schwächung und tiefreichender Verstörung.«30
Dennoch: Die Weimarer Republik bedeutete nicht das Ende des bürgerlichen Hegemonialanspruches auf gesellschaftliche Geltung und politischkulturelle Deutungsmacht. Der Adel als »Konkurrent« des Bürgertums war durch Kriegsniederlage und Revolution diskreditiert und seines politi schen und sozialnormativen Spitzenranges verlustig gegangen. Die städtische Arbeiterschaft hatte dem bürgerlichen Modell ebenso wenig entgegenzusetzen wie die bäuerliche und proletarische Landbevölkerung. Das Bürgertum, das zahlenmäßig nach Wehlers Berechnungen nun etwa ein Sechstel der Bevölkerung bildete31, konnte »seine eigentümliche Ausstrahlungs- und Prägekraft« demnach bewahren und blieb führend »[i]m Verfassungs- und Kulturleben, in Recht und Wissenschaft, in Lebensführung und Arbeitsethos«. Zugleich war die soziale Ordnung jedoch auch von Erosionstendenzen geprägt, denn namentlich das Bildungsbürgertum, eine schmale Schicht von 0,8 Prozent der Bevölkerung32, sah sich nach ökonomischen Verlusten und der Zerstörung seiner in den letzten Jahrzehnten des Kaiserreiches weitgehenden Symbiose mit dem Staat »einer Einflußminderung ausgesetzt, die es in nostalgischer Bitterkeit mit den goldenen Vorkriegsjahren verglich.«33 Hinzu kam die immer lauter werdende Kritik von der Linken wie auch von der radikalen völkischen Rechten, denen die »Bürgerliche Gesellschaft« mit all ihren Leitzielen, Werten und Normen als Projekt gescheitert schien.
Die Nationalsozialisten, angetreten mit der Zielutopie einer klassenlosen, rassisch definierten »Volksgemeinschaft« unter Ausschluss von Juden, Sinti und Roma, Farbigen und anderen »Fremdrassigen«, von sogenannten »Erbkranken« und »Asozialen« sowie politisch Oppositionellen, hat das soziale Gefüge zunächst kaum verändert. Die traditionellen Sozialformationen behaupteten ihre gesellschaftliche Stellung und Funktion, rekrutierten sich weiterhin mit Hilfe erlernter und über Generationen eingeübter Mechanismen, pflegten einen spezifischen Habitus und bewahrten charakteristische Eigenarten; die Volksgemeinschaft war und blieb insofern ein Mythos – aber auch Mythen haben »eine verändernde Kraft, vor allem wenn sie sich der Suggestion des technischen und zivilisatorischen Fortschritts bedienen.«34 Volksempfänger und Volkswagen, KDF-Reisen und sonntägliche Eintopfessen brachten – teils lediglich symbolisch, teils jedoch real spürbar – den Willen des Regimes zur Durchbrechung der Klassenschranken zum Ausdruck und schufen in weiten Teilen der Bevölkerung ein Gefühl wachsender sozialer Gleichheit. In Parteiapparat und Staatsbürokratie, in SS, Gestapo und Wehrmacht eröffneten sich neue Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Mit den Juden wurde ein Teil des deutschen Bürgertums auf brutale Weise aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet: entrechtet, enteignet, außer Landes getrieben, interniert oder umgebracht. Der Krieg beschleunigte den Elitenwandel; auf das Attentat vom 20. Juli folgte die Liquidierung von Teilen der Aristokratie, die qua NS-Programm langfristig ohnehin vom »Neuadel aus Blut und Boden« zu ersetzen war, noch bevor das einst machtvolle preußische Junkertum durch den Ausgang des Zweiten Weltkrieges zugleich mit seinen ostelbischen Stammgebieten die Basis seiner überkommenen politischen Vorrangstellung verlor. Die Bombardierungen der deutschen Städte durch die Alliierten in den letzten Kriegsjahren und die Folgen der totalen militärischen Niederlage ließen schließlich ein Szenario sozialer Gleichheit entstehen, das von den Machthabern in dieser Form gewiss nicht intendiert gewesen war.
Und das Bürgertum? – Wehlers Urteil fällt vernichtend aus. Mit einer »abstoßenden Apathie«35 habe die überkommene Elite von Besitz und Bildung die Politik der Nationalsozialisten, namentlich die Verbrechen an Juden und Oppositionellen hingenommen; mit einem »Schulterzucken« oder sogar »mit hämischer Schadenfreude darüber, daß endlich hartes Durchgreifen gegen ›die Linken‹ auf der Tagesordnung stand«, habe es sich der Bürger in den Zuschauerrängen bequem gemacht, während auf der Bühne die Tragödie von der Zerstörung des bürgerlichen Rechtsstaates gegeben wurde: »Wohin man auch blickt: Der Frontalangriff auf die Leitideen und Institutionen einer zeitgemäßen ›Bürger lichen Gesellschaft‹ ist ebenso unübersehbar wie die schmähliche Kapi tulation aller bürgerlichen Klassen vor den Anmaßungen des Hitler- Regimes.«36 Dies gelte im Rechtswesen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft sowie in den Medien, die sich nun der harten Zensur und den Anweisungen der braunen Propagandamaschinerie zu unterwerfen hatten. Fakt ist: Die bürgerliche Öffentlichkeit als zentrales Strukturelement der bürgerlichen Gesellschaft war mit dem Jahr 1933 in Deutschland außer Kraft gesetzt worden. Künftig leisteten Printmedien und Rundfunk geradezu das Gegenteil von kritischer Information. Fakt ist aber auch: Es hat – gleichsam unterhalb der Ebene aktiven politischen Widerstandes – auch und gerade von bürgerlicher Seite und von deutschen Intellektuellen Versuche gegeben, den Totalitätsanspruch des Regimes zu unterlaufen. Die Breite der wissenschaftlichen Debatte über die Grauzone zwischen politischer Anpassung auf der einen und risikobereitem Widerstand auf der anderen Seite spricht für sich.
»Widerstand«, »Innere Emigration«, »(bürgerliche) Resistenz«: Eine aufgelassene Debatte zur Geschichte der NS-Zeit
Dass sich gegen den Nationalsozialismus in Deutschland zwischen 1933 und 1945 von unterschiedlichen Seiten und in unterschiedlicher Art und Ausprägung Widerstand erhoben hat, ist unbestritten; die Frage, wie der Begriff des »Widerstandes« zu definieren und von anderen, »weicheren« Formen oppositionellen oder unangepassten Verhaltens abzugrenzen ist, ist jedoch in der historischen Forschung bis heute nicht abschließend geklärt. Sicher ist, dass von einer einheitlichen Widerstandsbewegung im Sinne einer geschlossenen, planmäßig handelnden Organisation nicht gesprochen werden kann. Der Widerstand in Deutschland bestand vorwiegend aus kleinen Gruppen oder »Einzeltätern«, die zum Teil in starker Isolation und unter größten persönlichen Risiken arbeiteten. Während in diesen Fällen des prinzipiellen und bis in letzter Konsequenz durchgestandenen Kampfes gegen das NS-Regime kein Zweifel an der Widerstandsleistung, an der Berechtigung des Wortes »Widerstand« bestehen kann, existiert daneben ein breites Spektrum oppositionellen bzw. abweichenden Verhaltens, das begrifflich sehr viel schwieriger zu fassen ist. Die Termini »Zivilcourage« und »ziviler Ungehorsam«, »Protest«, »Verweigerung«, »Dissidenz«, »Dissenz«, »Resistenz«, Nonkonformität«, »Innere Emigration«, »loyale Widerständigkeit« usw. spuken durch eine Debatte, die den Historiker späterer Zeiten vor das nahezu unlösbare Problem stellt, das häufig höchst individuelle Handeln von Menschen unter den Bedingungen einer nicht am eigenen Leibe erfahrenen Diktatur zu analysieren, zu bewerten und in eine möglichst »objektiven« Kriterien standhaltende Wissenschaftssprache zu pressen; Gillessen hat sich mit seiner Analyse der »Frankfurter Zeitung« im NS-Staat nicht zuletzt deswegen angreifbar gemacht, weil er der Redaktion wiederholt einen »Widerstand« bescheinigte, den er an keiner Stelle definiert oder auch nur zu definieren versucht hat. Was ist beispielsweise von einem kirchlichen Protest zu halten, der sich überwiegend oder sogar ausschließlich auf die Abwehr staatlicher Übergriffe und den Einsatz für die freie Verkündigung des Evangeliums bezog und zu der systematischen Entrechtung, Verfolgung und schließlich Ermordung der deutschen und europäischen Juden weitgehend geschwiegen hat, der für seine Protagonisten aber dennoch Gefahr für Leib und Leben bedeutete und auf jeden Fall eine beachtliche Mutleistung darstellte? Und was ist mit den kleinen Verweigerungshaltungen im Alltag? Wie ist das Verhalten von Menschen zu bewerten, die den Hitlergruß vermieden oder sich demonstrativ zu ihrem christlichen Glauben bekannten, obwohl sie befürchten mussten, dass es sich womöglich nachteilig auf ihre Berufskarrieren auswirken könnte? War das öffentliche Grüßen des jüdischen Nachbarn an einem Novembertag des Jahres 1938 oder das heimliche Abhören der BBC an einem wolkenlosen Sommerabend des Jahres 1943 Ausdruck von Opposition?
Hören wir, was ein Zeitgenosse zu sagen hat. Der konservative Historiker Hans Rothfels37, der wegen seiner jüdischen Herkunft im »Dritten Reich« in die Vereinigten Staaten hatte emigrieren müssen, sprach am 20. Juli 1947 in der Universität Chicago über das Thema »Die deutsche Opposition gegen Hitler«; der Inhalt dieses Vortrages liegt einem später veröffentlichten Buch mit gleichem Titel zugrunde. Rothfels teilt die deutsche Bevölkerung in vier Gruppen ein: »tatsächliche Nazis«, d.h. politische Überzeugungstäter, »nominelle Nazis«, die meist aus Gründen der Opportunität, des beruflichen oder gesellschaftlichen Ehrgeizes in die Partei oder eine ihre Formationen eingetreten waren oder sich zumindest politisch überzeugt und angepasst zeigten, »Nicht-Nazis« und engagierte »Anti-Nazis«, wobei er betont, dass die Grenzen alles andere als statisch gewesen seien. Von besonderem Interesse scheinen ihm die »Nicht-Nazis« zu sein, die er als eine »Reserve-Front«38 des Widerstandes bezeichnet und folgendermaßen charakterisiert:
»Während sie das unerläßliche Minimum von Konzessionen machten, blieben sie moralisch unberührt. Sie nahmen das Regime nicht als Dauerzustand an und gaben die Hoffnung auf sein Ende nie auf […]. Diese Verhaltensweise entzieht sich zwar der ausdrücklichen Definition, aber sie ließ sich in vielen Fällen mit überraschender Anschaulichkeit beobachten. In Fabriken und Dienstzimmern pflegte das Gesprächsthema automatisch zu wechseln, sobald die wohlbekannten Parteimitglieder oder die Aufpasser außer Hörweite waren. […] Es gab zwischen Nicht-Nazis eine schweigende, mitunter fast geheimnisvolle Verständigung.«39
Jene »fast geheimnisvolle Verständigung« der »Nicht-Nazis« ist nach dem Krieg auch von den führenden Köpfen der einstigen FZ, ist namentlich von Benno Reifenberg immer wieder angeführt worden, um die besondere Leistung und Bedeutung des Blattes im »Dritten Reich« zu betonen – und damit das Fortbestehen der FZ nach 1933, die Entscheidung gegen eine Schließung des Blattes, gegen eine mögliche Emigration zu begründen. Die Redaktion habe mit Anspielungen, mit Zitaten, mit Wortwitz, Satiren und Fabeln, mit der exponierten Platzierung bestimmter Artikel im Blatt, mit doppeldeutigen Überschriften usw. gearbeitet, um den Lesern, die für diese Art der Ansprache durchaus empfänglich und sogar dankbar gewesen seien, »zwischen den Zeilen« Kritik am System zu vermitteln. Zugleich sei auf diese Weise erreicht worden, dass in Deutschland bis 1943 eine Tageszeitung existiert habe, die in Anspruch, Sprache und Niveau bürgerlichen Lesegewohnheiten entsprochen habe. – Nachträgliche Rechtfertigung? Zur »Reserve-Front« des aktiven politischen Widerstandes zählte Reifenberg eindeutig nicht, auch wenn es offenbar Gruppen gab, die ihn als attraktiven potenziellen Mitstreiter betrachteten: Als 1944 der Pädagoge Adolf Reichwein, Mitglied des »Kreisauer Kreises«, auf Reifenberg zukam, um ihn für eine politische Mitarbeit zu gewinnen, lehnte er ab. Reifenberg hat den Krieg überlebt und konnte 25 Jahre westdeutsche Nachkriegsöffentlichkeit federführend mitgestalten. Reichwein, Vater von vier kleinen Kindern, wurde Opfer der Hinrichtungswelle nach dem 20. Juli.
Ein gelungener Versuch aus jüngerer Zeit, die unterschiedlichen Formen von Widerstand und Verweigerung im nationalsozialistischen Deutschland voneinander abzugrenzen und sprachlich fassbar zu machen, stammt von Richard Löwenthal. Er unterscheidet drei Grundformen des »Widerstandes« gegen den NS-Totalitarismus: 1.) politische Opposition, 2.) gesellschaftliche Verweigerung, 3.) weltanschauliche Dissidenz40 – Letzteres als ein Feld, das besonders wichtig ist, wenn es um die Bewertung der Arbeit von Intellektuellen unter den »Nicht-Nazis« geht. Unter »politischer Opposition« versteht Löwenthal sämtliche Aktivitäten, die bewusst und gezielt gegen die NS-Diktatur gerichtet waren, ihre Untergrabung und in letzter Konsequenz ihren Sturz anstrebten und aus diesem Grund notwendig illegal waren und konspirativ betrieben werden mussten. Als »gesellschaftliche Verweigerung« bezeichnet er konkrete, praktische und relativ offene Formen des Widerstandes gegen Eingriffe der Nationalsozialisten in das gesellschaftliche Leben – wie etwa in die Organisation der Betriebe oder Kirchen – »ohne politische Flagge«41, wobei zwischen institutioneller und individueller Verweigerung zu unterscheiden sei. Als deutlichstes Zeichen institutioneller Verweigerung betrachtet er die Proteste der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, gegen die Verbrechen der Krankentötungen im Krieg, als stärkste Ausdrucksform individueller Verweigerung die aktive Hilfe für Verfolgte des Regimes. »Weltanschauliche Dissidenz« finde man, meist ebenfalls ohne politisches Etikett, in Teilen von Literatur, Kunst und Wissenschaft; der Begriff könne synonym mit dem älteren Terminus »Innere Emigration« gebraucht werden. Löwenthal bezieht Stellung, wenn er betont, dass diese Haltung »die Aktionen des Regimes zunächst kaum praktisch behindert« habe, dass jedoch »durch ihre Wirkung auf das Bewußtsein wichtiger Minderheiten die kulturellen Traditionen des früheren Deutschland über die Jahre des Schreckens hinweg« gerettet werden konnten:
»Ich will nicht verhehlen, daß ich den Vorwurf der politischen ›Hilflosigkeit‹ gegen solche Autoren für unfair und irrelevant halte. Ihr Widerstand wirkte nicht im Sinne eines aktuell-politischen Programms […], sondern im Sinne der Bewahrung der humanen und humanistischen Tradition unserer Zivilisation«.42
Ein vergleichbarer Ansatz stammt von Martin Broszat, der 1981 im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Geschichte von »Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945« den ursprünglich aus dem medizinischen Bereich stammenden Begriff der »Resistenz« in die Debatte einführte, der Löwenthals Definition der »gesellschaftlichen Verweigerung« ähnelt, jedoch zusätzlich auch Erscheinungsformen der »weltanschaulichen Dissidenz« abdeckt. Broszat wandte sich gegen »die Tendenz zur Identifizierung des Widerstandes mit dem großen Märtyrertum«43, gegen »das Bild eines Totalitarismus, demgegenüber nur eine alles aufopfernde, alles riskierende Oppositions-Haltung möglich gewesen sei«, und forderte, »neben dem kämpferischen, konspirativen Widerstand, der Leib und Leben aufs Spiel setzte, die vielen ›kleinen‹ Formen des zivilen Mutes […] in vollem Maße in die Betrachtung einzubeziehen.« Die sich daraus ergebende Ausweitung des Themas solle keineswegs »einer inflationären Entwertung des Widerstandsbegriffs oder gar einer irreführenden Vergrößerung seiner quantitativen und qualitativen Bedeutung Tür und Tor öffnen«; Ziel sei vielmehr, »die breite Skala […] der Ausdrucksformen des Widerstandes« darzulegen und neben dem grundsätzlichen, aus politisch-weltanschaulicher Überzeugung geborenen Widerstand »auch die vielfältigen ad-hoc-Widerstände zu berücksichtigen, die das NS-Regime im Laufe seiner Geschichte durch einzelne seiner Maßnahmen selbst produzierte.« »Resistenz« im Sinne dieser Begriffsbildung bedeutet bei Broszat:
»Wirksame Abwehr, Begrenzung, Eindämmung der NS-Herrschaft und ihres Anspruches, gleichgültig von welchen Motiven, Gründen und Kräften her. Solche ›Resistenz‹ konnte begründet sein in der Fortexistenz relativ unabhängiger Institutionen (Kirchen, Bürokratie, Wehrmacht), der Geltendmachung dem NS widerstrebender sittlichreligiöser Normen, institutioneller und wirtschaftlicher Interessen oder rechtlicher, geistiger, künstlerischer o.a. Maßstäbe.«44
Entscheidend ist demnach, dass die unterschiedlichen Formen der Einstellung, des Verhaltens oder Reagierens »tatsächlich eine die NS-Herrschaft und NS-Ideologie einschränkende Wirkung hatten.« Unter »Resistenz« lassen sich subsumieren: das kollektive oder individuelle aktive Gegenhandeln, etwa im Rahmen eines verbotenen Streiks oder der sonntäglichen Kritik eines Pfarrers von der Kanzel herab, der zivile Ungehorsam, der beispielsweise in der Nichtteilnahme an NS-Versammlungen, der Verweigerung des Hitler-Grußes oder der Nichtbeachtung des Umgangsverbots mit Juden, Kriegsgefangenen usw. zum Ausdruck kommen konnte, die Aufrechterhaltung von Gesinnungsgemeinschaften außerhalb der gleichgeschalteten NS-Organisationen oder auch die »bloße innere Bewahrung dem NS widerstrebender Grundsätze und [die] dadurch bedingte Immunität gegenüber nationalsozialistischer Ideologie und Propaganda (Ablehnung von Antisemitismus und Rassenideologie, Pazifismus o.a.).«
Broszats Ausführungen sind zum Teil scharf kritisiert worden, so etwa 1985 von Ian Kershaw, der den Begriff »Dissenz« für das so schwer zu fas sende Phänomen bevorzugt45, und 1993 von Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul, die in einem Beitrag in der »Zeitschrift für Geschichtswissenschaft« die Formulierung »loyale Widerwilligkeit« ins Spiel brachten.46 Mallmann/Paul argumentierten, der Terminus »Resistenz« sei ungeeignet, weil er »das unrealistisch-exkulpierende Bild einer breit gefächerten Widerständigkeit gegen das Dritte Reich«47 zeichne, wobei vielfach als »Resistenz« begriffen werde, was den Weg in die Akten der NS-Sicherheitsbehörden gefunden habe, womit der Historiker sich zwangs läufig deren »Optik« zu eigen mache. Zudem reanimiere der Begriff eine Totalitarismus-Vorstellung vom NS-Regime als »eines weitgehend wider spruchsfreien, effizienten, allseits mächtigen und alle Lebensbereiche durchdringenden politischen Systems« und unterschlage systematisch die in der gesellschaftlichen Realität der Diktatur durchaus vorhandenen »Konsensdimensionen«. Der entscheidende Vorwurf an Brozat zielte sowohl bei Mallmann/Paul als auch bei Kershaw auf eine angeblich mit der Aufwertung passiver Verweigerungshaltungen verbundene Abwertung des aktiven Widerstandes. Demgegenüber sei an dieser Stelle betont, dass Broszat das große Verdienst gebührt, vernehmlich darauf hingewiesen zu haben, dass es im »Dritten Reich« unterhalb der Ebene einer planmäßig arbeitenden, politisch motivierten Opposition zahlreiche gesellschaftliche Verhaltensweisen gegeben hat, die nicht angepasst, nicht systemkonform waren, und dass er versucht hat, für diese breite Grauzone zwischen eindeutiger Anpassung und aktivem Widerstand eine brauchbare Vokabel zu etablieren. Obschon seine Wortwahl etwas unglücklich ist, v.a. weil die Unterscheidung von »Widerstand« und »Resistenz« im internationalen Diskurs nicht zu vermitteln ist (»Widerstand« heißt im Englischen »resistance«, im Französischen »résistance«) und der Begriff »Resistenz« zudem mit der französischen Widerstandsbewegung in der Zeit der deutschen Besatzung assoziiert wird, ist sein Vorschlag grundsätzlich ähnlich brauchbar wie die von Löwenthal getroffene Unterscheidung, in mancher Hinsicht sogar besser zu handhaben: So findet man in der Redaktion der FZ und in den Spalten des Blattes zwischen 1933 und 1943 sowohl Anzeichen von »gesellschaftlicher Verweigerung« als auch von »weltanschaulicher Dissidenz« – und die Grenzen sind dermaßen fließend, dass der beide Bereiche abdeckende Resistenz-Begriff sich geradezu aufdrängt.
Einen Ansatz auch zur Beschreibung jener gesellschaftlichen Erscheinung, die in der Sprache der Zeitgenossen als »Innere Emigration« firmierte, bietet das von Broszat Mitte der 1980er Jahre entwickelte Modell einer »Sozialgeschichte des deutschen Widerstandes«48, das sowohl die Frage der zeitlichen Abfolge unterschiedlicher Ausdrucksformen widerständischen Verhaltens im NS-Staat als auch ihre jeweiligen gesellschaftlichen Trägerschichten berücksichtigt. Die erste Phase des Widerstandes umfasst demnach die Aktivitäten der Arbeiterbewegung, die im Wesentlichen bis 1934/35 gereicht hätten und »in gewisser Weise noch Fortsetzung der zum Teil bürgerkriegsähnlichen Konfrontation zwischen der sozialistischen Linken und den Nationalsozialisten«49 vor 1933 gewesen seien. Als zweite Phase gelten unterschiedliche Erscheinungen von Resistenz, vor allem in den Reihen des Bürgertums und insbesondere in der »Konsolidierungs- und Erfolgsphase des NS-Regimes zwischen 1934/35 und 1940/41«50. Der Widerstand der konservativen Eliten, unter ihnen zahlreiche Adelige aus Diplomatie und Offizierskorps, kulminierend im Attentat vom 20. Juli 1944, stellt für Broszat die dritte Ausformung dar. Michael Philipp hat Broszats Ansatz in seinem 1994 publizierten, außergewöhnlich dicht angelegten und überzeugend argumentierenden Beitrag »Distanz und Anpassung. Sozialgeschichtliche Aspekte der Inneren Emigration« ausdrücklich gewürdigt.51 Für die Untersuchung der FZ und ihrer Redaktion zwischen 1933 und 1943 bietet Broszats Modell eine einzigartige Zugangsweise: Wer die Zeitung aufschlägt, findet – nicht täglich, nicht in jedem Beitrag, aber doch mit großer Regelmäßigkeit – »bürgerliche Resistenz« in Reinkultur und im doppelten Sinne: eine partielle Abstinenz von den Programmen und Parolen der Machthaber, die von gebildeten Bürgern für gebildete Bürger in Druckerschwärze gegossen worden war, zumindest tendenziell nur ihnen zugänglich und nur von ihnen zu dechiffrieren.52
Urbanes Leben
Das Bürgertum des 19. und 20. Jahrhunderts hat sich aus dem vormodernen Stadtbürgertum entwickelt, griff aber im sozialen Radius sowie im ideengeschichtlichen Anspruch weit über diese Formation der überkommenen Ständegesellschaft hinaus. Das Frankfurter Forschungsprojekt »Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert« unter Leitung des Historikers Lothar Gall sah in dem Zugang über die Stadt sogar »den Königsweg zur Erforschung des modernen Bürgertums«53, das als »soziale Einheit am besten in seinem genuinen und konstitutiven Lebensraum, der Stadt, erfaßt werden«54 könne. Auch Anhänger eines stärker auf den kulturellen Habitus abzielenden Ansatzes wie etwa Hans-Walter Schmuhl betonen die innige Verbindung zwischen Urbanität und Bürgerlichkeit bzw. die Bedeutung der Urbanität als »das formbildende Element in der Genese eines bürgerlichen Habitus«55, dessen Prägekraft freilich in dem Maße nachließ, in dem urbane Lebensformen – und das meint in erster Linie die Teilnahme am politischen wie am kulturellen öffentlichen Leben – über die Grenzen der Großstädte hinausgriff und die Gesamtgesellschaft durchdrang. In diesem Sinne hat Klaus Tenfelde die nachlassende Bedeutung des Faktors Urbanität für das bürgerliche Selbstverständnis im 20. Jahrhundert herausgearbeitet.56 Fragt man nach der politischen Ausrichtung des Bürgertums am Ort seiner ursprünglichen Herkunft, so hat Wolfgang Hardtwig mit der Formulierung von der »Stadt als gefährdete[m] Rückzugsort des Liberalismus«57 eine ebenso eingängige wie zutreffende Formel gefunden, zumindest wenn es um das späte 19. und das 20. Jahrhundert geht. Obwohl die Städte lange eine Domäne bürgerlicher Honoratiorenpolitik und dem »Primat des Liberalismus«58 verpflichtet blieben, waren bereits im späten Kaiserreich Auflösungstendenzen zu beobachten: Der Aufstieg der Sozialdemokratie in den Arbeiterquartieren, die Etablierung des Zentrums als gewichtiger politischer Faktor in katholisch dominierten Städten, die räumliche Mobilität der Menschen und die Tatsache, dass sich die großen Unternehmer, die vielbeschäftigten Bankiers und leitenden Angestellten zunehmend aus dem Ehrenamt zurückzogen, waren für diesen Prozess ausschlaggebend.
Selbstredend waren die deutschen Städte, die urbanen Wiegen des moder nen Bürgertums, in ihrer Geschichte, politischen Verfasstheit, ökonomischen, sozialen und kulturellen Entwicklung und in dem Selbstverständnis wie in den Traditionen ihres Bürgertums keine gleichförmigen Gebilde; nicht zufällig hat der Frankfurter Bürger Reifenberg sein publizistisches Loblied der Urbanität immer wieder mit dem Hinweis auf den individuellen Charakter jeder einzelnen Stadt verknüpft, ja: die Städte sogar mit »Lebewesen« verglichen.59 Frankfurt am Main, Reifenbergs Heimatstadt und Lebensmittelpunkt, ist von Gall als Beispiel für die Handels- und Gewerbestadt älterer Tradition, die im 19. Jahrhundert weiter florierte, in einem Atemzug mit Köln, Hamburg und Bremen genannt worden.60 Frankfurt am Main wurde dominiert von einer selbstbewussten Schicht besitzender Bürger, die ihr Geld überwiegend im Bereich von Handel und Banken verdienten und – beinahe schon traditionell – bei den Wahlen für die liberalen Parteien und örtlichen Honoratioren stimmten. Ralf Roth hat in seiner herausragenden Arbeit über den Frankfurter Weg zur modernen Bürgergesellschaft61 das gesellschaftliche Klima in der ehemals Freien Stadt beschrieben, die mit der preußischen Besetzung nach dem Krieg von 1866 zwar ihre Selbständigkeit verloren, ihre wirtschaftliche Bedeutung und politisch-kulturelle Sonderstellung jedoch nicht eingebüßt hatte. Frankfurt war ein »Mikrokosmos mit liberaleren Rahmenbedingungen als die umliegenden Regionen Deutschlands«62. Politische Aktivitäten gehörten zum Selbstverständnis der führenden Vertreter des selbstbewussten städtischen Bürgertums. Wichtige städtische Innovationen gingen auf die Spendenfreudigkeit reicher Frankfurter Bürgerfamilien zurück, zuletzt sogar die Errichtung der Frankfurter Stiftungsuniversität 1914.63 Ein Strukturmerkmal der überwiegend protestantischen Stadt war die Existenz einer der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland in Verbindung mit einer besonders frühen und gelungenen Integration der Juden in das kulturelle und wirtschaftliche Leben bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts – ein Prozess, der mit der rechtlichen und politischen Gleichberechtigung im Jahre 1864 abgeschlossen wurde. Zahlreiche Stiftungen und Institutionen gingen auf jüdische Mäzene bzw. Begründer zurück64 – so auch die von dem Bankier Leopold Sonnemann in der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufene FZ, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem »Kristallisationskern der demokratischen Bewegung«65 zunächst in Südwestdeutschland und bald auch überregional entwickeln sollte. Für Benno Reifenberg, dessen Eltern mit der Familie Sonnemann-Simon befreundet waren, war das Bürgertum Frankfurts prägende Sozialisationsinstanz; Frankfurt am Main sollte immer die Stadt bleiben, mit der und über die er sich identifizierte.
»Generation Frontkämpfer«
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation ist eine Alltagserfahrung, die jeder Mensch macht – in der Familie zunächst, aber auch in Ausbildung, Studium und Erwerbsleben sowie in sämtlichen denkbaren sozialen Zusammenhängen. Der Soziologe Heinz Bude bemüht die einprägsame Formulierung von der Generationenzugehörigkeit und dem Generationengefühl als »Zeitheimat«: Generation als Verwurzelung »in der Zeit und nicht in einem Ort«66. Dies schließt Bilder und Assoziationen, Erinnerungen und Stimmungen ein, denen sich der Mensch nicht unmittelbar entziehen kann und die »ein unausgesprochenes Wir-Gefühl mit den ungefähr Gleichaltrigen«67 begründen. Darüber hinaus ist »Generation« ein soziologischer Grundbegriff, der in jüngster Zeit auch Eingang in die geschichtswissenschaftliche Forschung gefunden hat und namentlich für die Arbeit des Biographen von größtem Wert ist. Ebenso wie die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Schicht bzw. die Einbindung in ein spezifisches kulturelles Milieu und die räumliche Verortung in einer bestimmten Stadt oder Region gibt die Alterskohorte Aufschluss über Sozialisationserfahrungen und kollektive Zäsuren, die das Individuum beeinflusst und geprägt haben. Karl Mannheim hat in seinem bahnbrechenden Aufsatz »Das Problem der Generationen« von 1928 von einem »Lebensfond«68 gesprochen, der sich aus einer »verwandten Lagerung« der Generationsangehörigen, das heißt aus der parallelen Teilnahme an einem bestimmten Abschnitt des historischen Prozesses, speise; hier geht es einerseits um die »ersten Eindrücke« des Menschen, andererseits um eine spezifische »Erlebnisschichtung«, die nicht von Anfang an feststeht, sondern sich im Laufe der Lebensjahre vollzieht und von den etwa Gleichaltrigen geteilt wird. Zur Semantik des Begriffs gehört seit Mannheim die Übertragung der familiären Generationenfolge auf die Gesellschaft, verbunden mit dem Anspruch der Jüngeren auf Übernahme der Macht von den Älteren, kurz: »das stete Neueinsetzen neuer Kulturträger«69.
Ulrike Jureit und Michael Wildt verweisen auf die enge Verbindung der »Konstruktion von ›Generationen‹ […] mit der Entstehung der europäischen Moderne«, namentlich »mit der Differenzierung der einstigen Großfamilie und der Entdeckung von ›Jugend‹ als Entwicklungsbegriff«70. Generationen, zunächst auf rund 30 Jahre, heute auf deutlich kürzere Intervalle festgelegt, werden demnach als soziale Akteure mit einem quasi natürlichen Anspruch auf die Übernahme der gesellschaftlichen Leitungsfunktionen in einem bestimmten Lebensalter begriffen: »›Generation‹ entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Kollektivitäts- wie Kollektivierungsbegriff, der neben Stand, Schicht und Klasse den Rang einer sozialkulturellen Ordnungskategorie für sich beanspruchte.« Der Aufstieg der Psychologie und Psychoanalyse und die damit verbundene Entdeckung der frühen, mutmaßlich sogar vorgeburtlichen Prägung des Menschen wie des lebenslang dominanten Einflusses der ersten Kindheitserfahrungen, die Erforschung der Prozesse von Pubertät, Adoleszenz usw. mag den Aufstieg der »Ordnungskategorie« Generation befördert haben. Zugleich ist festzuhalten, dass sich bis heute die meisten gängigen Generationenmodelle überwiegend oder sogar ausschließlich an männlichen Kollektiverfahrungen und Lebensmodellen orientieren und auf Frauen nicht oder nur eingeschränkt anwendbar sind.71 Dies gilt nicht zuletzt auch für die ansonsten wegweisende Studie von Helmut Fogt über »Politische Generationen« von 1982, die insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen der vom Ersten Weltkrieg betroffenen Alterskohorten, zu denen auch Benno Reifenberg gehörte, ausschließlich aus einem männlichen Blickwinkel argumentiert.72
Wenn in der Zwischenkriegszeit der 20er und 30er Jahre eine »Hochkonjunktur der Generationsentwürfe«73 zu verzeichnen war, so mag dies nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass Deutschland in dieser Phase mit einer zur politischen wie gesellschaftlichen Führung drängenden Generation von Männern konfrontiert war, die ihre prägenden Sozialisationserfahrungen – oder besser gesagt: ihren prägenden Sozialisationsbruch – in den Massen- und Materialschlachten des Ersten Weltkrieges erfahren hatten. Es handelte sich um Männer, die in der wilhelminischen Ära des Deutschen Kaiserreiches, in einem Klima von überschwänglichem Nationalismus, anmaßendem Militarismus und Imperialismus, in einem vergleichsweise ausgeformten und nur partiell durchlässigen Klassensystem herangewachsen und dann im Alter zwischen etwa 18 und 25 Jahren an die Front gegangen waren. Als sie, die Überlebenden ihrer Generation, nach Hause zurückkehrten, standen sie oft genug in vielerlei Hinsicht vor dem Nichts – entwurzelt, traumatisiert, in keinem zivilen Beruf ausgebildet, aus ehemals funktionierenden sozialen Netzwerken gerissen, beladen mit Erfahrungen, die sie mit Eltern, älteren oder jüngeren Geschwistern und Freunden und last not least mit ihren Freundinnen, Geliebten und Ehefrauen nicht teilen konnten, belastet von der Erfahrung der militärischen Niederlage, konfrontiert mit dem Zusammenbruch des vertrauten politischen Systems, der ökonomischen Basis und der sozialen und mentalen Gewissheiten. Der Weltkriegsteilnehmer Reifenberg – das darf hier vorweggenommen werden – war im Jahre 1918 ein privilegierter Heimkehrer, aufgefangen in Familie, Partnerschaft und einem einflussreichen und materiell wohlbestellten Freundeskreis. Dennoch haben ihn die Bilder, Eindrücke und Erlebnisse seiner Generation nie losgelassen. In seinem publizistischen Werk hat er ihnen – häufig in einer eigentümlich apolitischen, auf die rein individuelle Erfahrung abzielenden Art und Weise – eine Stimme verliehen. In Kombination mit den Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend im Frankfurter Bürgertum zur Zeit des Kaiserreiches bildeten die Ereignisse an der Westfront, um mit Karl Mannheim zu sprechen, seinen »Lebensfond«.
Quellen
Ermöglicht wurde das vorliegende Buch durch die Tatsache, dass Benno Reifenberg von seinem zwanzigsten Lebensjahr bis zum Beginn seiner kurzen, tödlichen Krankheit im Januar 1970 als eine Art Archivar in eigener Sache tätig gewesen ist. Sein voluminöser Nachlass im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar74, der für dieses Buch erstmals systematisch ausgewertet wurde, zeugt von einer erstaunlichen Akribie, wenn es um das Sammeln und Bewahren von Dokumenten geht, die in der Zusammenschau seine Vita und v.a. seine Einbindung in personelle Netzwerke rekonstruierbar machen. Die ausgewerteten Unterlagen lassen sich im Wesentlichen in folgende Kategorien einordnen:
– Zeugnisse, Urkunden und amtliche Papiere: Hierzu gehören u.a. das Abiturzeugnis aus dem Jahre 191275, die Studienbücher der besuchten Universitäten Genf, München, Berlin und Frankfurt mit Angaben zu Immatrikulationszeiträumen und belegten Lehrveranstaltungen76, der NS-»Fragebogen zur Durchführung des Schriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933, ausgefüllt am 13.8.1936«77 sowie mehrere Fragebögen aus der Zeit der alliierten Militärregierung zum politischen Verhalten während und vor Beginn der NS-Zeit78, ferner Urkunden und Auszeichnungen wie etwa das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1952, die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt 1957 und der Goethepreis 1964, die Ehrendoktorwürde der Frankfurter Universität 1964 und die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt 1967.79
– Lebensläufe und autobiographische Aufzeichnungen: Reifenberg hat im Laufe der Jahrzehnte aus unterschiedlichen Anlässen mehrfach seinen Lebenslauf in Stichworten oder in ausformulierter Form zu Papier gebracht.80 Besonders ausführlich geriet ihm im September 1945 eine Lebensbeschreibung mit dem Titel »Summa vitae meae«81, die in der dritten Person formuliert ist; der Adressat der sechsseitigen Skizze ist unbekannt, möglicherweise entstand der Text aus Gründen der Selbstreflexion. Von Reifenbergs Bemühen, der Nachwelt Einblick in seine Lebensgeschichte zu gewähren, zeugt ein Manuskript mit dem Titel »Beginn der Autobiographie«, das in den Jahren 1963, 1966 und 1967 entstand und Erinnerungen an die Kinder- und Jugendjahre umfasst.82
– Tagebücher: Tagebücher Reifenbergs liegen grundsätzlich für den Zeitraum zwischen Frühjahr 1912 und Anfang 1970 vor83, unterscheiden sich jedoch sowohl im Hinblick auf die Quantität als auch auf die Nutzbarkeit und den Quellenwert. Kaum zu entziffern sind die Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, da sie zum größten Teil nicht nur in äußerst flüchtiger Schrift verfasst, sondern zudem auch zerrissen und verschmutzt sind. Für die Weimarer Zeit sind sporadisch vollständige Bände vorhanden, während andere Jahrgänge komplett fehlen; aus den Jahren 1933 bis 1945 existieren Tagebuch-Fragmente. Vollständig erhalten und mühelos lesbar sind dagegen die Tagebücher der Jahre 1945 bis 1969/70, die zum Teil in hand- wie maschinenschriftlicher Fassung (also doppelt) angefertigt wurden, wobei keine wesentlichen Abweichungen zwischen den jeweiligen Fassungen zu konstatieren sind. Es darf vermutet werden, dass diese späten Tagebücher in der Absicht einer Publikation erstellt wurden oder als Grundlage für die geplante Autobiographie dienen sollten. Sie enthalten so gut wie nie politische Analysen und nur selten Angaben, die auf private Lebensumstände schließen lassen (Ausnahmen sind besondere Anlässe wie etwa die Hochzeit des Sohnes, die Geburten der Enkelkinder, größere Reisen, Krankheiten oder gelegentlich auch nächtliche Träume des Verfassers), sondern bestehen zumeist aus stichwortartigen Notizen über das Wetter und die Lektüre des Tages, berufliche Projekte, Pläne und Konflikte sowie über Treffen mit Kollegen, Freunden und anderen Zeitgenossen. Von besonderem Wert sind diese Notizen im Hinblick auf die Rekonstruktion der persönlichen Kontakte bzw. Netzwerke Reifenbergs.
– Briefe: Zum Nachlass Reifenbergs gehört eine umfangreiche Korrespondenz mit Tausenden verschiedener Personen, Institutionen und Organisationen, angefangen von einem ausführlichen Briefwechsel mit dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Theodor Heuss bis hin zu belanglosen Schreiben an Einwohner meldeämter oder Reisebüros. Unter den Korrespondenzpartnern seien an dieser Stelle exemplarisch erwähnt: die Kollegen Margret Boveri, Bernard von Brentano, Max von Brück, Wolf von Dewall, Walter Dirks, Michael Freund, Rudolf Kircher, Herbert Küsel, Carl Linfert, Albert Oeser, Alfons Paquet, Fritz Sänger, Oskar Stark, Friedrich Sieburg und Erich Welter, ferner die Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz, der Hirnforscher Oskar Vogt und der hochrangige I.G.-Farben- Man a ger Georg von Schnitzler, die Reifenberg – jeweils auf unterschied lichen Wegen – zu Hilfe kamen, als er zwischen 1943 und 1945 nicht mehr in seinem Beruf als Journalist arbeiten durfte, sowie der CDU-Politiker Heinrich von Brentano, ein Bruder Bernards, und der Politik wissenschaftler Dolf Sternberger, der zu Reifenbergs engeren Vertrauten zählte. Unter den persönlichen Freunden sind neben Sternberger vor allem der Kunsthistoriker, FZ-Mitarbeiter und spätere Diplomat Wilhelm Hausenstein und der Schweizer Buchautor und Kulturkritiker Max Picard zu nennen. Reifenbergs Kriegserleben der Jahre 1914 bis 1918 konnte anhand eines großen Konvoluts erhalten gebliebener Feldpostbriefe an die Freundin und spätere Ehefrau Maryla von Mazurkiewicz rekonstruiert werden. Persönliche Einblicke gestatten auch Reifenbergs Briefe an seine Eltern, die besonders für die Studienjahre ergiebig sind, sowie an seine Geschwister Ada Brunthaler, Hans Reifenberg und Lieselotte Reifenberg und in den 50er und 60er Jahren an den Sohn Jan Reifenberg, den langjährigen USA-Korrespondenten der FAZ. In den meisten Fällen liegen sowohl die Briefe Reifenbergs an die betreffenden Personen als auch deren Briefe an Reifenberg vor; darüber hinaus sind im Nachlass zahlreiche Schriftwechsel Dritter erhalten, die zwar in Verbindung mit einem Reifenberg betreffenden Thema entstanden, aber nicht von ihm stammen.84
– Das Redaktionsarchiv der Zeitschrift »Die Gegenwart«: Der Nachlass enthält das Redaktionsarchiv der Zeitschrift »Die Gegenwart« von der Gründung 1945 bis zur Fusion mit der FAZ 1958: interne Denkschriften zur inhaltlichen Konzeption und politischen Ausrichtung, Auflage und wirtschaftlichen Entwicklung des Blattes, Protokolle der Redaktionskonferenzen, Briefwechsel zwischen den Herausgebern und den festen und freien Mitarbeitern, Leserbriefe usw.85
– Sammlung veröffentlichter Artikel Reifenbergs: Neben dem angegebenen Archivmaterial boten die drei Publikationsorgane, für die Reifenberg im Laufe seines Lebens tätig gewesen ist, den zweiten großen Quellenfundus. Die Auswertung der zeitweise drei Mal täglich erschienenen FZ zwischen 1918/19 und 1943, der Halbmonatsschrift »Die Gegenwart« zwischen 1945 und 1958 und der täglich in Druck gegangenen FAZ zwischen 1959 und 1970 im Hinblick auf die Rolle, Bedeutung und inhaltliche Positionierung Reifenbergs wäre aufgrund der riesigen Zahl anonym publizierter Artikel unmöglich gewesen, wenn nicht auch in diesem Fall der Nachlass wertvolle Hilfe geboten hätte: In der Dokumentationsstelle des Literaturarchivs Marbach fand sich ein Stapel Kladden mit den sorgfältig ausgeschnittenen und aufgeklebten, mit Datum und mitunter auch mit handschriftlichen Anmerkungen versehenen Artikeln Reifenbergs, die er in der Frühphase seiner Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei der FZ zur Berechnung seiner Honorare angelegt und dann vermutlich aus Gewohnheit und/oder in dem Wunsch, das eigene Lebenswerk systematisch zu dokumentieren, kontinuierlich fortgesetzt hatte.86 Lediglich für die dreizehn Jahre bei der »Gegenwart« fehlen entsprechende Bände, wobei nicht geklärt werden konnte, ob sie einmal vorhanden gewesen sind oder nicht.
– Die Presseorgane: Neben den Artikeln Reifenbergs, die durch den Nachlass systematisch verfügbar wurden, sind die FZ der Jahrgänge 1918/19 bis 1943, »Die Gegenwart« der Jahrgänge 1945 bis 1958 und die FAZ der Jahrgänge 1958 bis 1970, soweit erforderlich, im Original eingesehen worden. Dies gilt insbesondere für »Die Gegenwart«, da es hier – im Gegensatz v.a. zur FZ, aber auch zu FAZ – so gut wie keine wissenschaftliche Literatur gibt, auf die sich die Ausarbeitung stützen konnte.87
– Selbständige Veröffentlichungen Reifenbergs: Bei den selbständigen, d.h. außerhalb der fraglichen Presseorgane veröffentlichten Schriften handelt es sich überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich um Sammelbände mit ausgewählten Beiträgen zu einem bestimmten Thema, die Reifenberg vorab in der FZ, der »Gegenwart« und der FAZ veröffentlicht hatte oder die postum von seiner Sekretärin Helga Hummerich herausgegeben wurden. Inhaltlich sind v.a. zwei Schwerpunkte auszumachen: zum einen Schriften zu Kunst und Kunstgeschichte88, zum anderen zur Geschichte, Kultur und Architektur der Stadt Frankfurt am Main.89 Eine Sammlung mit z.T. autobiographisch inspirierten Feuilletons erschien 1953 unter dem Titel »Lichte Schatten«90; ein vergleichbares Konzept liegt dem von Hummerich verantworteten Band »Offenbares Geheimnis« von 1992 zugrunde.91 Das 1973 erschienene Werk »Landschaften und Gesichter« versammelt Feuilletons, die Reifenberg zwischen 1939 und 1943 in der FZ publiziert hatte und von denen ein gewichtiger Teil Erinnerungen an seine Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg beinhaltet.92 Gesprochene Rundfunkbeiträge Reifenbergs aus den 50er und frühen 60er Jahren liegen in Druckfassung von 1962 unter dem Titel »In den Tag gesprochen« vor.93 Ein Verzeichnis der selbständigen Schriften Reifenbergs befindet sich im Quellen- und Literaturverzeichnis im Anhang dieser Arbeit.
– Erinnerungen von Zeitgenossen: Zu nennen sind hier in erster Linie die Erinnerungen der ehemaligen FZ-Mitarbeiter Karl Apfel94, Margret Boveri95 und Artur Lauinger96 und des einstigen FAZ-Herausgebers Karl Korn97. Eine besondere Rolle nehmen die Memoiren von Helga Hummerich mit dem programmatischen Titel »Wahrheit zwischen den Zeilen. Erinnerungen an Benno Reifenberg und die Frankfurter Zeitung«98 ein: Während Hummerich einerseits einzigartige Einblicke in Reifenbergs beruflichen Alltag der Jahre 1933 bis 1943 gewährt und deshalb auf keinen Fall ignoriert werden kann, sind ihre Bewertungen doch mit Vorsicht zu genießen, da die Verfasserin ihrem ehemaligen Chef mit einer Form von Heldenverehrung begegnet, durch die der Quellenwert ihres Buches deutlich gemindert wird. Reifenbergs Ehefrau Maryla hat im Jahre 1936 ihre Jugenderinnerungen unter dem Titel »Antike und junge Mädchen«99 veröffentlicht und darin Erinnerungen an die Kriegsjahre verwoben, in denen sie mit Reifenberg verlobt war. Berücksichtigung findet in diesem Kontext auch eine schmale Broschüre mit den Gedenkreden, die von Freunden und Weggefährten 1970 an Reifenbergs Grab gehalten worden waren.100
1 Jens Flemming: »Neues Bauen am gegebenen Ort«. Deutschland, Europa und Die Gegenwart, in: Michel Grunewald/Hans Manfred Bock (Hrsg.): Der Europadiskurs in den deutschen Zeitschriften (1945-1955), Bern u.a. 2001, S. 187-218, hier S. 210.
2 Christoph Studt: Einleitung, in: Ders. (Hrsg.): »Diener des Staates« oder »Widerstand zwischen den Zeilen«? Die Rolle der Presse im »Dritten Reich«. XVIII. Königswinterer Tagung Februar 2005 (Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli, Band 8), Berlin 2007, S. 3-9, hier S. 3. Dort auch die folgenden Zitate.
3 Vgl. insbesondere Jürgen Fröhlich: »Die Umformung des deutschen Seins erlaubt keine passive Resignation«. Die Zeitschrift »Die Hilfe« im Nationalsozialismus, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 115-130; Maria Theodora Freifrau von dem Bottlenberg-Landsberg: Die »Weißen Blätter« als Kristallisationspunkt konservativer Opposition im »Dritten Reich«, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 143-160; Volker Mauers berger: »Zwischen den Zeilen?« – Rudolf Pechel und sein publizistischer Kampf für Freiheit und Recht, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 175-182; Birgit Rätsch: »Der Tätige ist stets wichtiger als der Tote oder auch nur der Gefesselte«. Das Dilemma Fritz Sängers zwischen Mittun und Opposition, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 183-194.
4 Studt: Einleitung, in: Ders., »Diener des Staates«, S. 3-9, hier S. 3.
5 Vgl. Bernd Sösemann: Journalismus im Griff der Diktatur. Die ›Frankfurter Zeitung‹ in der nationalsozialistischen Pressepolitik, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 11-38. Vgl. auch Ders.: Die Frankfurter Zeitung im Nationalsozialismus. Zwischen Distanz und Anpassung, in: Die Zeit, Nr. 11, 6.3.1987.
6 Vgl. Günther Gillessen: Eine bürgerliche Zeitung »auf verlorenem Posten« – Die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich, in: Studt, »Diener des Staates«, S. 161-174.
7 Studt: Einleitung, in: Ders., »Diener des Staates«, S. 3. Dort auch das folgende Zitat.
8 In der vorliegenden Arbeit wird die überarbeitete, 2. Auflage von 1987 herangezogen: Günther Gillessen: Auf verlorenem Posten. Die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich, 2., überarb. Auflage, Berlin 1987.
9 Gillessen: Eine bürgerliche Zeitung, S. 172. Dort auch das folgende Zitat.
10 Ebd., S. 173.
11 Sösemann, Journalismus im Griff der Diktatur, S. 11.
12 Reifenberg zitiert nach: Oskar Stark an Margret Boveri, 20.11.1965, Nachlass Boveri, zitiert nach: Sösemann, Journalismus im Griff der Diktatur, S. 37/38, hier S. 38.
13 Martin Broszat: Sanfte Gegenrede zur kriegerischen Sprache, in: Der Spiegel, Nr. 22/1987, S. 101-108.
14 Norbert Schandry, in: Stuttgarter Nachrichten, 11.2.1970, abgedruckt in: Benno Reifenberg 1892-1970. Worte des Gedenkens, Frankfurt am Main 1970, S. 30-32,hier S. 30.
15 Margret Boveri an Winfried Martini, 16.1.1950, Nachlass Boveri, zitiert nach Gillessen: Auf verlorenem Posten, S. 67.
16 Zu nennen sind u.a.: Erich Achterberg: Albert Oeser. Aus seinem Leben und hinterlassenen Schriften (Studien zur Frankfurter Geschichte 13), Frankfurt a.M. 1978; David Bronsen: Joseph Roth. Eine Biographie, Köln 1974; Reiner Burger: Theodor Heuss als Journalist. Beobachter und Interpret von vier Epochen deutscher Geschichte, Münster 1999; Heike B. Görtemaker: Ein deutsches Leben. Die Geschichte der Margret Boveri, München 2005; Bergita Gradl: Rudolf Geck – Theaterkritiker der »Frankfurter Zeitung« (1898-1936), Diss., FU Berlin 1968; Ulrich P. Schäfer: Rudolf Kircher als Londoner Korrespondent der Frankfurter Zeitung 1920-1923 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 40: Kommunikationswissenschaft und Publizistik 43), Frankfurt a.M. 1994, zugl. Diss. Univ. Dortmund 1991; Helmut Stalder: Siegfried Kracauer. Das journalistische Werk in der »Frankfurter Zeitung« 1921-1933 (Epistemata: Reihe Literaturwissenschaft 438), Würzburg 2003, zugl. Diss. Univ. Zürich 2002; Johannes Werner: Wilhelm Hausenstein. Ein Lebenslauf, München 2005. – Es fehlt bis zur Stunde eine Studie zum publizistischen Werk Dolf Sternbergers.
17 Die ausführlichste, freilich apologetische und wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügende Lebensbeschreibung stellt ein FAZ-Beitrag Gillessens von 2004 dar. Vgl. Günther Gillessen: Der Zweifel, in: FAZ, Nr. 24, 29.1.2004.
18 Dolf Sternberger: Hohe See und Schiffbruch. Zur Geschichte einer Allegorie, in: Ders.: Gerechtigkeit für das neunzehnte Jahrhundert. Zehn historische Studien, Frankfurt a.M. 1975, S. 151-164, hier S. 151.
19 Sternberger, Hohe See und Schiffbruch, S. 158.
20 Manfred Hettling/Stefan-Ludwig Hoffmann: Der bürgerliche Wertehimmel. Zum Problem individueller Lebensführung im 19. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft, 23. Jahrgang, 1997, S. 333-359, hier S. 337.
21 Hettling/Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel (1997), S. 339.
22 Ebd., S. 340.
23 Hettling/Hoffmann, Der bürgerliche Wertehimmel (1997), S. 348.
24 Benno Reifenberg: »Die Gegenwart«. Zur Entwicklung einer politischen Zeitschrift, 5.12.1951, in: LAM NL BR, 79.7696.
25 Statistik Leserprofil Gegenwart, 19.8.1950, in: LAM NL BR, 79.7701.
26 Elisabeth Domansky: Der Erste Weltkrieg, in: Lutz Niethammer u.a. (Hrsg.): Bürgerliche Gesellschaft in Deutschland. Historische Einblicke, Fragen, Perspektiven, Frankfurt am Main 1990, S. 285-319, hier S. 285.
27 Vgl. Manfred Hettling: Bürgerlichkeit im Nachkriegsdeutschland, in: Ders./ Bernd Ulrich (Hrsg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005, S. 7-37.
28 Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band: Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949, München 2003, S. 306.
29 Ebd., S. 76.
30 Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band, S. 294.
31 Ebd., S. 307. Dort auch die folgenden Zitate.
32 Vgl. ebd., S. 294.
33 Ebd., S. 308.
34 Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945 (Die Deutschen und ihre Nation, Bd. 5), Berlin 1986, S. 503.
35 Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band, S. 719. Dort auch das folgende Zitat.
36 Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band, S. 720.
37 Der Historiker Hans Rothfels (1891-1976) wurde als deutscher Jude 1934 von seinem Lehrstuhl an der Universität Königsberg vertrieben und emigrierte 1939 über England in die USA. 1950/51 kehrte er unter Beibehaltung der amerikanischen Staatsbürgerschaft nach Deutschland zurück und nahm einen Ruf an die Universität Tübingen an. Der konservative Remigrant war Mitherausgeber und führender Kopf der 1953 erschienenen »Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte«. Vgl. Jan Eckel: Hans Rothfels. Eine intellektuelle Biographie im 20. Jahrhundert, Göttingen 2005.
38 Hans Rothfels: Die deutsche Opposition gegen Hitler, neue, erweiterte Ausgabe, Frankfurt a. Main/Hamburg 1969, S. 31.
39 Ebd., S. 31/32.
40 Vgl. Richard Löwenthal: Widerstand im totalen Staat, in: Ders./Patrick von zur Mühlen (Hrsg.): Widerstand und Verweigerung in Deutschland, Neuausgabe, Bonn 1997, S. 11-24.
41 Ebd., S. 14. Dort auch die folgenden Zitate.
42 Löwenthal, Widerstand im totalen Staat, S. 23.
43 Martin Broszat: Resistenz und Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojektes, in: Ders./Elke Fröhlich/Anton Grossmann (Hrsg.): Bayern in der NSZeit. Band IV: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil C, München/Wien 1981, S. 691-709, hier S. 693. Dort auch die folgenden Zitate.
44 Ebd., S. 697. Dort auch die folgenden Zitate.
45 Vgl. Ian Kershaw: Widerstand ohne Volk? Dissens und Widerstand im Dritten Reich, in: Jürgen Schmädecke/Peter Steinbach (Hrsg.): Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, München/Zürich 1985, S. 779-798.
46 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul: Resistenz oder loyale Widerwilligkeit? Anmerkungen zu einem umstrittenen Begriff, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (1993), Heft 41, S. 99-116.
47 Ebd., S. 99. Dort auch die folgenden Zitate.
48 Vgl. Martin Broszat: Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstands, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 34 (1986), Heft 3, S. 293-309.
49 Ebd., S. 296.
50 Ebd., S. 300.
51 Vgl. Michael Philipp: Distanz und Anpassung. Sozialgeschichtliche Aspekte der Inneren Emigration, in: Aspekte der künstlerischen Inneren Emigration 1933 bis 1945. Exilforschung – ein internationales Jahrbuch, Bd. 12, hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung von Claus-Dieter Krohn, München 1994, S. 11-30, hier S. 13-15.
52 Vgl dazu auch Heidrun Ehrke-Rotermund/Erwin Rotermund: Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte und Vorstudien zur »Verdeckten Schreibweise« im »Dritten Reich«, München 1999.
53 Hans-Walter Schmuhl: Bürgertum und Stadt, in: Peter Lundgreen (Hrsg.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereichs 1886-1997, Göttingen 2000, S. 224-248, hier S. 224.
54 Frank Möller: Bürgerliche Herrschaft in Augsburg 1790-1880, München 1998, S. 11.
55 Schmuhl: Bürgertum und Stadt, S. 248.
56 Vgl. Klaus Tenfelde: Stadt und Bürgertum im 20. Jahrhundert, in: Ders. und Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.): Wege zur Geschichte des Bürgertums, Göttingen 1994, S. 347-353, hier S. 334/335.
57 Wolfgang Hardtwig: Großstadt und Bürgerlichkeit in der politischen Ordnung des Kaiserreiches, in: Lothar Gall (Hrsg.): Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert (Stadt und Bürgertum, Band 1), München 1990, S. 19-64, hier S. 46.
58 Ebd., S. 48.
59 Vgl. u.a. Benno Reifenberg: Die Alte Frankfurter Brücke, in: FAZ, 25.6.1959, abgedruckt in: Ders: Das Einzigartige von Frankfurt. Ausgewählte Schriften, hrsg. von Helga Hummerich mit Bildern von Max Beckmann und Friedrich Philipp Usener, Frankfurt a.M. 1979, S. 53-63, hier S. 54.
60 Vgl. Lothar Gall: Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert. Ein Problemaufriß, in: Ders.: Stadt und Bürgertum, S. 1-11, hier S. 17.
61 Ralf Roth: Stadt und Bürgertum in Frankfurt am Main. Ein besonderer Weg von der ständischen zur modernen Bürgergesellschaft 1760-1914 (Stadt und Bürgertum, Band 7), München 1996.
62 Ebd., S. 401.
63 Vgl. Gudrun-Christine Schimpf: Geld, Macht, Kultur. Kulturpolitik in Frankfurt am Main zwischen Mäzenatentum und öffentlicher Finanzierung 1866-1933, Frankfurt am Main 2007 sowie Bruno Müller: Stiftungen in Frankfurt am Main: Geschichte und Wirkung, neubearbeitet und fortgesetzt durch Hans-Otto Schembs (Mäzene, Stifter, Stadtkultur, Band 7), Frankfurt am Main 2006.
64 Vgl. v.a. Hans-Otto Schembs: Jüdische Mäzene und Stifter in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 2007.
65 Roth: Stadt und Bürgertum, S. 469.
66 Heinz Bude: Generation im Kontext. Von den Kriegs- zu den Wohlfahrtsstaatsgenerationen, in: Ulrike Jureit/Michael Wildt (Hrsg.): Generationen. Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs, Hamburg 2005, S. 28-44, hier S. 28. Bude bezieht sich hier auf den Schriftsteller Wilfried G. Sebald (1994-2001).
67 Ebd., S. 28.
68 Karl Mannheim: Das Problem der Generationen, in: Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, Jg. 7, 1928, Heft 2/3, S. 157-185 sowie S. 309-330, hier S. 182.
69 Ebd., S. 175.
70 Ulrike Jureit/Michael Wildt: Generationen, S. 7. Dort auch die folgenden Zitate.
71 Vgl. Christina Benninghaus: Das Geschlecht der Generation. Zum Zusammenhang von Generationalität und Männlichkeit um 1930, in: Jureit/Wildt, S. 127 158.
72 Vgl. Helmut Fogt: Politische Generationen (Beiträge zur sozialwissenschaft lichen Forschung, Bd. 32), Opladen 1982.
73 Jureit/Wildt: Generationen, S. 8.
74 Nachlass Benno Reifenberg im Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Neckar, im Folgenden in der gesamten Arbeit abgekürzt: NL BR, DLA.
75 Zeugnis der Reife, in: NL BR, DLA, 79.3556.
76 Studienbuch der Universität Genf, LAM NL BR 79.3556; Studienbuch der Universität München, NL BR, DLA, 79.3556; Studienbuch der Universität Berlin, NL BR, DLA, 79.3556; Abgangszeugnis der Universität Frankfurt am Main, 6.4.1922, NL BR, DLA, 79.3556.
77 Fragebogen zur Durchführung des Schriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933, ausgefüllt am 13.8.1936, NL BR, DLA, 79.3552.
78 Konvolute aus der Zeit der Militärregierung, Military Government of Germany, Fragebogen, ohne Datum, NL BR, DLA, 79.3554.
79 Konvolut Urkunden, NL BR, DLA, 79.3555.
80 Undatierter Lebenslauf, Konvolut Lebenserinnerungen, NL BR, DLA, 79.12333.
81 »Summa vitae meae«, NL BR, DLA, 79.12334.
82 Beginn der Autobiographie, NL BR, DLA, 79.12333.
83





























