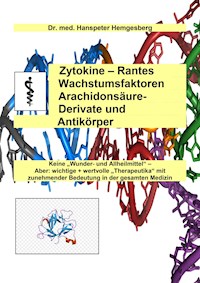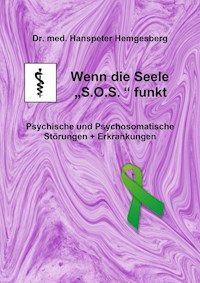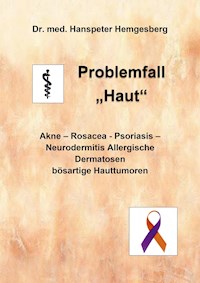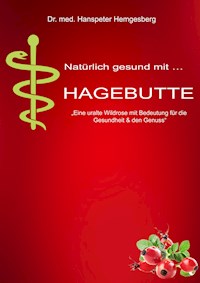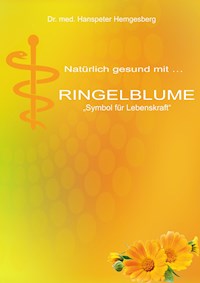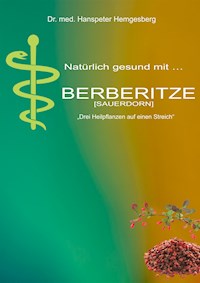
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Berberitze … mehr als "nur eine (Heil-)Pflanze" Schon seit vielen Jahrhunderten hatten zahlreiche Pflanzen rund um den Erdball nicht nur eine wichtige Bedeutung für die Ernährung, sondern sie waren insbesondere auch als "Heilpflanzen" hoch angesehen und wert-geschätzt. Die Ver- und Anwendung der uralten Pflanze "Berberitze", bei uns in Deutschland besser bekannt unter dem Namen "Sauerdorn"– in ihren regional unterschiedlichen Varietäten – zu gesundheitlichen Zwecken, also im Sinne von "medizinisch", reicht weit zurück in die verschiedenen Ausrichtungen der Volks- und Erfahrungs-Heilkunde, ganz gleich, ob in Indien, in China, in Nord- wie Süd-Amerika oder in (Nord-)Afrika oder ob bei uns in Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 30
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berberitze
mehr als „nur
eine (Heil-)Pflanze“
Schon seit vielen Jahrhunderten hatten zahlreiche Pflanzen rund um
den Erdball nicht nur eine wichtige Bedeutung für die Ernährung,
sondern sie waren insbesondere auch als „Heilpflanzen“ hoch
angesehen und wert-geschätzt.
Die Ver- und Anwendung der uralten Pflanze „Berberitze“, bei uns in
Deutschland besser bekannt unter dem Namen „Sauerdorn“– in ihren
regional unterschiedlichen Varietäten – zu gesundheitlichen Zwecken,
also im Sinne von „medizinisch“, reicht weit zurück in die
verschiedenen Ausrichtungen der Volks- und Erfahrungs-Heilkunde,
ganz gleich, ob in Indien, in China, in Nord- wie Süd-Amerika oder in
(Nord-)Afrika oder ob bei uns in Europa.
Die einzelnen ‚Bestandteile‘ der Berberitze – Blätter & Fürchte, Zweige,
Wurzeln und Rinden – mit ihren unterschiedlichen Wirkstoffen [die
allerdings in früherer Zeit unbekannt waren] wurden weltweit und in allen
Heilrichtungen verwendet zur Behandlung bzw. gesundheitlichen
Verbesserung bei Störungen & Erkrankungen von Leber und Galle
sowie
von
Nieren
und
Harnwegen
und
insgesamt
zur
gesundheitlichen Stabilisierung.
So kann mit Fug und Recht ausgesagt werden:
„Berberitze
mehr als nur eine einzige (Heil-)Pflanze!“
Dieses Buch Natürlich gesund mit
Berberitze [Sauerdorn] „Drei
Heilpflanzen auf einen Streich!“ will Sie – als aktiven Menschen, allgemein an
der eigenen Gesundheit Interessierten und ganz besonders aber auch alle
biologisch-naturheilkundlich (insbesondere ganzheitlich) orientierte Therapeuten –
informieren und beraten.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine
Verbindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Natürlich gesund mit
Berberitze
Verfasser:
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Wissenschaftliche Recherche
Rosemarie Hemgesberg
Redaktionelle Mitarbeit & Lektorat
© Copyright 2019
für das Buch Natürlich gesund mit
Berberitze liegt ausschließlich bei
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg.
Nutzung – auch auszugs- und teilweise – in Wort, Schrift und allen elektronischen
(auch den zukünftigen) Kommunikationssystemen und in irgendeiner sonstigen
Form (Fotokopie, Mikrofilm und andere Dokumentations- & Archivierungs-
Verfahren) sowie die Weitergabe an Dritte und/oder die Vervielfältigung und
sonstige Verbreitung ist verboten und strafbewehrt!
Gerichtsstand: Jeweiliger Wohnort Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
© Copyright 2019
für die Gestaltung des Covers und das Layout liegt bei M. Schlosser
In Memoriam
Meinem Patenonkel und hoch-verehrtem
‚Homöopathie-Lehrmeister, Herrn
– Prof. Dr. med. Georg Wünstel –
[1921-1996 – Mainz]
in dankbarer & bleibender Erinnerung
Gedicht „Berberitze“
Jetzt reifen schon die roten Berberitzen,
alternde Astern atmen schwach im Beet.
Wer jetzt nicht reich ist, da der Sommer geht,
wird immer warten und sich nie besitzen.
Wer jetzt nicht seine Augen schließen kann,
gewiss, dass eine Fülle von Gesichtern
in ihm nur wartet bis die Nacht begann,
um sich in seinem Dunkel aufzurichten:
der ist vergangen wie ein alter Mann.
Dem kommt nichts mehr, dem stößt kein Tag mehr zu,
und alles lügt ihn an, was ihm geschieht;
auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du,
welcher ihn täglich in die Tiefe zieht.
Rainer Maria Rilke
(1875-1926 – deutscher Lyriker; er gilt als einer der bedeutendsten Dichter der
‚literarischen Moderne‘)
Kräuter & Pflanzen:
„Gestern & Heute“
Die Nutzung von Kräutern und Pflanzen beginnt mit der
Menschheits-Geschichte:
Schon immer wurden Kräuter & Co. in allen Winkeln der Erde für
Mensch und Tier genutzt. Sei es zur Ernährung, sei es als
‚Heilkräuter & Heilpflanzen‘ oder auch als Duft- & Aromapflanzen.
Ein mehrbändiges ‚Pflanzen-Lexikon‘ müsste zu Papier gebracht
werden, sollten alle die bekannten und besonders die weniger bis
unbekannten Kräuter & Pflanzen besprochen und gewürdigt werden.
Aus der schier unendlichen Anzahl will ich lediglich stellvertretend
einige wenige auflisten und zwar jene, die sich bei uns in
Mitteleuropa – bes. dem deutschsprachigen Raum – einen ‚Namen‘
gemacht haben und die in der Bevölkerung beliebt und in Ver- &
Anwendung sind und zwar im Haushalt (Küche), zur Verschönerung
und zur gesundheitlichen Anwendung, so z.B. von „A“ bis „Z“:
- Achillea millefolium (Schafgarbe)
- Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)
- Allium cepa (Zwiebel)
- Allium sativum (Knoblauch)
- Allium ursinatum (Bärlauch)
- Arnica montana (Arnika/Bergwohlverleih)
- Avena sativa (Hafer)
- Bellis perennis (Gänseblümchen)
- Bryonia dioica (Rotbeerige Zaunrübe)
- Cactus grandiflorus (Königin der Nacht)
- Calendula officinalis (Ringelblume)
- Carduus marianus (Mariendistel)
- Cetraria islandica (Isländisch Moos)
- Chamomilla recutita (Echte Kamille)
- Chelidonium majus (Schöllkraut)
- Coffea arabica (Kaffee)
- Convallaria majalis (Maiglöckchen)
- Crataegus oxyacantha (Weißdorn)
- Curcuma longa (Kurkuma/Javan. Gelbwurz-Wurzel/Safranwurzel)
- Daminana (Turnera diffusa / Liebeszauberkraut)
- Digitalis purpurea (roter Fingerhut)
- Drosera rotundifolia (Sonnentau)
- Echinacea angustifolia (Sonnenhut)
- Eucalyptus globulus (Fieberbaum)
- Euphrasia officinalis (Augentrost)
- Equisetum biemale (Schachtelhalm)
- Foeniculum vulgare (Fenchel)
- Gelsemium sempervirens (Falscher Jasmin)
- Gentiana lutea (Enzian)
- Ginseng quinquefolia (Ginseng)
- Hamamelis virginica (Virgin. Zaubernuss)
- Hedera helix (Efeu)
- Helleborus niger (Christrose)
- Humulus lupulus (Hopfen)
- Hypericum perforatum (Johanniskraut)
- Ignatia amara (Ignatiusbohne)
- Juniperus communis (Wacholder)
- Lavandula angustifolia (Lavendel)
- Ledum palustre (Sumpfporst)
- Lycopodium clavatum (Bärlapp)
- Melissa officinalis (Zitronen-Melisse)
- Millefolium oder Achillea millefolium (Schafgarbe)
- Nux vomica (Brechnuß)
- Opium (Papaver somniferum * Schlafmohn)
- Passioflora incarnata (Passionsblume)
- Phytolacca americana (Kermesbeere)
- Plantago major (Breitblättriger Wegerich)
- Pulsatilla pratensis (Wiesenküchenschelle)
- Rauwolfia serpentina (Indische Schlangenwurzel)
- Rhododendron campylocarpum (Goldgelbe Alpenrose)
- Rhus toxicodendron (Giftsumach)
- Rumex crispus (Krauser Ampfer)
- Ruta graveolens (Weinraute)
- Salvia officinalis (Echter Salbei)
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
- Scilla maritima (Meerzwiebel)
- Secale cornutum (Mutterkorn)
- Solidago virgaurea (Goldrute)
- Spartium scoparium (Besenginster)
- Staphisagria (Delphinium staphisagria / Stephanskraut)
- Symphytum officinale (Beinwell)
- Taraxcacum officinale (Löwenzahn)
- Thuja occidentalis (Abendländischer Lebensbaum)
- Thymus vulgaris (Thymian)
- Urtica urens (Brennnessel)
- Valeriana officinalis (Baldrian)
- Veratrum album (Weiße Nieswurz)
- Verbascum densiflorum (Königskerze)
- Viola tricolor (Feld-Steifmütterchen)
- Viscum album (Mistel)
- Zingiber officinalis (Ingwer)
Das mag als kleine Auswahl genügen.
Etliche der genannten Pflanzen & Kräuter sind bei uns zum festen
Bestandteil in der Küche geworden, andere wiederum haben einen
hohen Stellenwert in der naturheilkundlichen Medizin. Insbesondere
auch in der Selbstanwendung als sogen. „Hausmittel“. Gerade bei
den Pflanzen & Kräutern zur gesundheitlichen Anwendung hat
sicherlich jeder von uns so seine ‚Favoriten‘.
Zuletzt:
Nicht zu vergessen die
„Berberitze“ (Berberis vulgaris L. / Sauerdorn).
Dazu vorab nur so viel:
Die uralte Pflanze „Berberitze“ ist eine hochpotenten Heilpflanze; sie
beinhaltet in ein- und derselben Pflanze gleich „3 Heilpflanzen“ in
sich: Einmal die Wurzel (bzw. die Wurzelrunde), dazu die Rinde und
dann drittens die Sauerdorn-Früchte.
Dazu ist später eingehend zu reden.
Was nun aber die An- & Verwendung von Pflanzen – insbesondere
auch als Heilpflanzen – angeht, so erleben wir in den letzten Jahren
eine erfreuliche „Renaissance“.
Heute besinnt sich immer stärker auch die ‚moderne Medizin‘ im
ganzheitlichen Sinne dieses natürlichen Mittels, um den Menschen
schonende Linderung und Hilfe bei einer Vielzahl von Beschwerden
zu verschaffen.
Darüber will und werde ich nunmehr schreiben.
Berberitze: Ein „allererster
(Ein-)Blick“
Um gleich zu Beginn mit einer ‚irrigen Annahme‘ aufzuräumen:
Wer glaubt, dass die Anwendung der Berberitze (Sauerdorn) zu
gesundheitlichen
Zwecken
geradezu
eine
„Entdeckung
der
Gegenwart“ sei, der irrt da sehr!
Tatsache ist vielmehr, dass die Pflanze „Berberis vulgaris L.“ [zu „L“:
s.u.] schon seit sehr langen Zeiten rund um den Globus insbesondere
auch als „Heilpflanze“ bekannt und wertgeschätzt war.
Immer schon kamen die „2 Heilpflanzen in einer Pflanze“ – eigentlich
sogar deren „3“ – zur Anwendung: Einmal die Sauerdorn-Früchte und
dann die Wurzel und besonders die Wurzel-Rinde. Und dabei zu
völlig unterschiedlichen Indikationen.
Die Berberitze war uns ist aber „nicht ohne“!
Will heißen:
Auch bei der Anwendung – sprich Dosierung – gilt unverändert die alte
Weisheit des hochangesehenen Paracelsus (1493-1541 * eigentlich:
Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim * Arzt & Naturforscher) „Alle
Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass
ein Ding kein Gift sei!“
Bezogen auf die Anwendung von Sauerdorn heißt das:
„So wirkungsvoll und hilfreich die wichtigen Inhaltsstoffe in den
einzelnen Pflanzenteile der Berberitze auch immer sind, so gilt stets
zu beachten, dass eine Überdosierung gesundheitlich-gefährlich sein
kann & ist, d.h.: die positive Wirkung wird umgekehrt in eine giftige =
schädliche!“
Für diese „toxische“ Wirkung sind verantwortlich die in der Pflanze
enthaltenen „Alkaloide“ [s.u.] und ganz intensiv mit ca. 15% finden
sich deren Anteile in den Wurzeln der Essigbeeren.
Erklärungen zu Fachbegriffen:
Das „L.“ im botanischen Pflanzen-Namen
Das „L.“ nach dem lateinischen botanischen Pflanzen-Namen steht für den
berühmten schwedischen Botaniker & Naturforscher Carl von Linné – 23.05.1707
bis 10.01.1778 – (er schuf mit der binären Nomenklatur die Grundlagen der
modernen botanischen und zoologischen Bezeichnung).
Alkaloid(e)
[der Name ist hergeleitet aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie
„Pflanzenaschen-ähnlich“]
Es handelt sich dabei um chemische Verbindungen, welche heterozyklisch
gebundene Stickstoff-Atome enthalten. Durch das freie Elektronenpaar am
Stickstoff-Atom bedingt reagieren Alkaloide zumeist basisch, also wie Basen bzw.
Alkalien. Die Bezeichnung bezieht sich somit auf die Ähnlichkeit zu Alkalien.
Es sind circa 10.000 Alkaloide bekannt. Sie können nach ihrer chemischen
Struktur, ihrem Ursprung (den produzierenden Organismen), ihrem Bio-
Syntheseweg und ihrer Pharmakologie eingeteilt werden.
a) Einteilung nach der chemischen Struktur
Alkaloide besitzen stickstoffhaltige Heterozyklen als Grundgerüst, wobei
Kombinationen verschiedener Ringsysteme möglich sind. Anhand dieser
Grundkörper lassen sich die Substanzen einteilen. Die bekanntesten Gruppen
sind: Pyrrol-Alkaloide, Pyrridolin-Alkaloide, Pyridin-Alkaloide, Piperidin-Alkaloide,
Tropan-Alkaloide,
Pyrrolizidin-Alkaloide,
Indolizidin-Alkaloide,
Chinolizidin-
Alkaloide, Indol-Alkaloide, Chinolin-Alkaloide, Isochinolin-Alkaloide, Steroid-
Alkaloide, Purin-Alkaloide, Tropolon-Alkaloide
b) Einteilung nach dem Bio-Syntheseweg
Die meisten Alkaloide leiten sich von Aminosäuren ab, diese werden als echte
Alkaloide betrachtet. Dagegen sind Pseudoalkaloide solche, die sich in ihrem
Syntheseweg nicht von Aminosäuren ableiten. Das Stickstoffatom stammt etwa
von Ammoniak. Beispiele hierfür sind Coniin und Aconitin, letzteres ist ein Terpen-
oder Isoprenoid-Alkaloid.
Als Protoalkaloide werden Alkaloide bezeichnet, die sich von Aminosäuren
ableiten, deren Stickstoff jedoch nicht heterozyklisch gebunden vorliegt. Dies ist
bei Meskalin der Fall.
Vorkommen & Gewinnung:
Im Allgemeinen sind Alkaloide Naturstoffe, ferner können auch (teil-) synthetische
Verbindungen (z.B. Lysergid, Heroin) als Alkaloide betrachtet werden. In der
Mehrzahl handelt es sich um Derivate von Aminosäuren. Sie kommen in der Natur
zumeist in Pflanzen vor, werden aber auch von Tieren und Pilzen gebildet. Die
Gewinnung erfolgt häufig durch Extraktion, etwa von Pflanzenmaterial, und
anschließende Isolierung.
Wirkung & Verwendung:
Sehr viele dieser Alkaloide weisen starke, spezifische pharmakologische
Wirkungen auf und sind als Arzneistoffe, Toxine oder für die Forschung relevant.
Beispielsweise sind Morphin und andere Opioide bewährte Analgetika, Kokain ist
ein effektives Lokalanästhetikum und Scopolamin wird transdermal gegen Übelkeit
eingesetzt. Atropin ist ein Antidot (Gegenmittel) bei verschiedenen Vergiftungen.
Toxikologie:
Bei Überdosierung von Alkaloiden zeigen sich in der Regel charakteristische
Vergiftungsbilder, zahlreiche Vertreter sind stark giftig. Häufig finden sich Effekte
im zentralen und peripheren Nervensystem mit Krämpfen oder Lähmungen.
Zudem besitzen einige Alkaloide in entsprechender Dosierung psychotrope Effekte
und können als Rauschmittel (häufig mit Abhängigkeitspotential) missbraucht
werden, so beispielsweise Kokain, Scopolamin, Opioide wie Morphin und Heroin
sowie Nikotin und Coffein.
Zurück zum Thema.
Diese wichtige „schädliche Nebenwirkung“ bei einer Überdosierung –
z.B. bei Langzeit-Einnahme von Berberis-Wurzelrinden-Pulver in
höherer Dosierung wie u.a. bei einer chronischen Niereninsuffizienz
– muss unbedingt beachtet werden, ganz besonders vom
verordnenden Therapeuten (Arzt, Heilpraktiker)!
Berberitze: Eine Pflanzen-
Familie stellt sich vor
Gehen wir ganz langsam und Schritt-für-Schritt vor; d.h.
entsprechend der „Botanischen Systematik“, wenn man so will: dem
„Stammbaum der Pflanzen“:
Ausgangspunkt – wenn ich das so sagen kann & darf – ist in der
Zuordnung der „Gemeinen Berberitze“ (Berberis vulgaris L.) die
Zugehörigkeit zur Pflanzenklasse der Bedecktsamer (Magnoliopsida) –
oder Bedecktsamige, Decksamer, Angiospermen –.
Dabei handelt es sich um die höchstentwickelte Unterabteilung der
Samen-Pflanzen, die in mehr als 400 Familien und 1000 Gattungen
eingeteilt werden.
Die Bedecktsamer stellen ca. 2/3 aller heute existierenden
Pflanzenarten! Die Bedecktsamer werden nach der alten Systematik
(nach A.L. de Jussieu, 1748–1836) in 2 Klassen unterteilt; in die
a. Einkeimblättrigen Pflanzen (Monokotylen, Monokotyledonen, Liliatae,
Monocotyledoneae) und
b. Zweikeimblättrigen Pflanzen (Dikotylen, Dikotyledonen, Dicotyledoneae,
Magnoliatae).
In der Pflanzenhierarchie-Zuordnung nunmehr die Eingliederung in
die sogen. Pflanzen-Ordnungen.
Hier zählen die Berberitzen zur Ordnung der Hahnenfuß-artigen
Pflanzen (Hahnenfuß-Gewächse) (Ranunculares).
Die Ordnung umfasst sieben Familien:
1. Berberitzen-Gewächse (Berberidaceae)
2. Circaeasteraceae
3. Schönulmen-Gewächse (Eupteleaceae)
4. Fingerfruchtg-Gewächse (Lardizabalaceae)
5. Mondsamen-Gewächse (Menispermaceae)
6 Mohn-Gewächse (Papaveraceae) und
7. Hahnenfuß-Gewächse (Ranunculaceae).
Von der Ordnung nun die Einteilung & Zuordnung zur Pflanzen-
Familie
und hier zur
Familie
der Berberitzen-Gewächse
(Berberidaceae).
Die Familie der Berberitzen-Gewächse wird in zwei Unterfamilien
gegliedert und enthält 14 bis 17 Gattungen mit etwa 700 Arten.
Als vorletzter Schritt dann die Rubrizierung in die Pflanzen-Gattung.
Die Gewöhnliche Berberitze gehört zur Gattung der Berberitzen
(Berberis).
Da wir uns langsam der eigentlichen „Gewöhnlichen Berberitze“
nähern, muss ich hier etwas weiter ausholen:
Die Gattung Berberis besitzt ein disjunktes Areal. Die meisten Arten
sind im gemäßigten Ostasien und im Himalaya verbreitet. Auch in
den südamerikanischen Anden gibt es zahlreiche Arten. In Europa
sind nur zwei bis vier Arten heimisch.
In der Natur sind Berberitzen oft Pionierpflanzen.
Viele Arten bilden Naturhybriden. In der überaus artenreichen
Gattung Berberis sind 400 bis 600 Arten beschrieben (allein über 200
Arten in der chinesischen Flora).
Es ist zu unterscheiden zwischen:
a) Europäischen Arten
wie z.B. Gemeine/Echte Berberitze * Kretische Berberitze *
b) Außer-Europäische Arten
wie z.B. Knäuel-früchtige Berberitze – Amur-Berberitze – Asiatische
Berberitze – Schwarz-früchtige Berberitze – Kantige Berberitze – Schön-
blühende Berberitze – Kanadische Berberitze – Schneeige Berberitze –
Durchsichtige Berberitze – Netz-blättrige Berberitze – Silberne Berberitze –
Taiwan- & Koreanische Berberitze – Himalaya-Berberitze – Warzige
Berberitze u.v.a.m. V
c) Hybriden
(Zufalls-Kreuzungen, Pflanzen-Bastarde)
wie u.a. Scharlach-rote Berberitze, Lolog-Berberitze, Schmal-blättrige
Berberitze.
Bleibt zuletzt noch die Benennung der Art: also die Gemeine oder
Echte Berberitze (Berberis vulgaris L.).
Dazu dann später ein eigenes Kapitel.
Berberitze: Ein Pflanzen-
Portrait
Bei der bei uns als „Gemeine oder Echte Berberitze“ – lat.-
botanischer Doppelname „Berberis vulgaris L.“ – bezeichneten Pflanze
handelt es sich um einen immergrünen Dornenstrauch aus der
Familie der Berberitzen-Gewächse.
Die Berberitze ist ursprünglich beheimatet gewesen in Asien und im
Himalaya.
Die Pflanze ist bei uns auch mit Volksnamen wie Bubenstrauch,
Dreidorn, Essigscharf, Kuckucksbrot, Reselbeere, Spießdorn,
Spitzbeerli oder auch Zitzerlstrauch bekannt.
Mit am gebräuchlichsten ist aber der Name „Sauerdorn“.
Weitere – vielmals nur regional gebräuchliche – Namen sind:
Ruht Aegresch (Siebenbürgen, ruht im Sinne von rot), Brasselbeere oder
Baisselbeere (in Tirol und im Raum Salzburg) oder Basselbeere (Tirol und
Kärnten) , Berberissen (Weser) , Berbersbeere, Berbersbeerstrauch,
Berbis, Berberitzen (Mecklenburg, Schleswig-Holstein) , Breixelbeere,
Bromlbeer (Tirol bei Lienz) , Erbishöhler (Raum Memmingen/Bayern) ,
Erbsich, Erbsip, Erbsidel & Ersichdorn, Erbsippe (Bayern) , Erbshöfen
(Schwaben) , Gagelsdorf, Peysselbeerenstruk (Mecklenburg) , Prassel-
Beere (Tirol) , Salsendorn (Salsendorn) , Sauerach, Sauerdorn &
Saurach (Elsass) , Sauerauchdorn, Suerdurn (Mecklenburg) , Surach &
Surauch (Elsass) , Weinlägelein (Raum Ulm) , Weinschärlein (Bayern) ,
Weinschierling,
Weinschürling,
Weinzäpfel,
Wutscherling,
Zweckholz.
In einigen Gebieten der Schweiz ist sie bekannt als Bettlerkraut