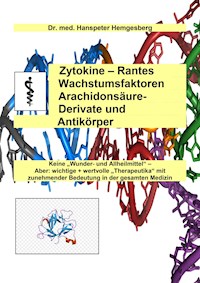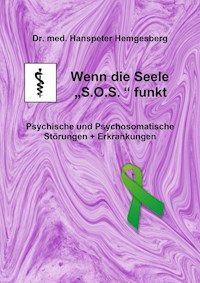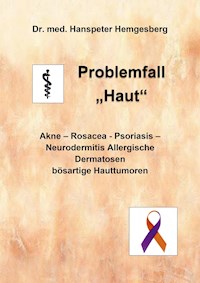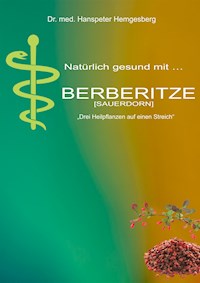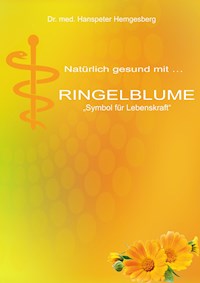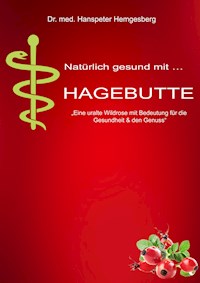
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zwar hat die Hagebutte (Rosa canina L.) in der Heilkunde heutzutage noch nicht den Stellenwert von z.B. Johanniskraut, Ringelblume, Arnika, Passionsblume, Hopfen, Holunder oder des Baldrian und anderer Vertreter aus der "Heilpflanzen-Hitliste" inne, sie ist aber auf dem besten Weg dahin. Die Hagebutte verfügt über ein breites Wirkungs-/Anwendungs-Spektrum: von verminderter Immunabwehr über Lungen- & Bronchial-Erkrankungen, bei Bluthochdruck, Nieren- & Harnblasen-Erkrankungen, Leber-Galle-Leiden bis hin zu Haut-Erkrankungen und Dekubitus u.a.m. Und: Die Hagebutte kann auch in der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Ferner ist die Hagebutte (mit allen Teilen) absolut nicht-toxisch (ungiftig)!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 39
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hagebutte
eine uralte
Wildrose für die
Gesundheit & den Genuss
Die Tatsache ist nicht zu leugnen: Immer öfters und immer mehr
Menschen
greifen
zur
gesundheitlichen
Verbesserung
zu
Heilpflanzen- & Heilkräuter-Arzneien. Das würde nicht sein, würden
diese Pflanzenwirkstoffe nicht hilfreich sein.
Viele – seit Urzeiten in der Erfahrung- und der Volksmedizin angewendete
– Heilpflanzen haben inzwischen auch in der Gegenwart einen festen
Platz in der Medizin gefunden, nicht nur in der biolog.-
naturheilkundlichen Medizin und in der Selbstbehandlung, sondern
auch zunehmend in der wissenschaftlichen (Schul-)Medizin.
Zwar hat die Hagebutte (Rosa canina L.) in der Heilkunde heutzutage
noch nicht den Stellenwert von z.B. Johanniskraut, Ringelblume,
Arnika, Passionsblume, Hopfen, Holunder oder des Baldrian und
anderer Vertreter aus der „Heilpflanzen-Hitliste“ inne, sie ist aber auf
dem besten Weg dahin.
Die Hagebutte verfügt über ein breites Wirkungs-/Anwendungs-
Spektrum: von verminderter Immunabwehr über Lungen- &
Bronchial-Erkrankungen, bei Bluthochdruck, Nieren- & Harnblasen-
Erkrankungen, Leber-Galle-Leiden bis hin zu Haut-Erkrankungen
und Dekubitus u.a.m.
Und: Die Hagebutte kann auch in der Schwangerschaft und Stillzeit
verwendet werden. Ferner ist die Hagebutte (mit allen Teilen) absolut
nicht-toxisch (ungiftig)!
Meiner Meinung nach also allerhöchste Zeit, sich mehr mit dieser
uralten Heilpflanze auseinanderzusetzen.
Hagebutte: „Heilpflanze des Jahres 2013“!
Dieses Buch Natürlich gesund mit
Hagebutte mit dem Untertitel „Eine uralte
Heilpflanze für die Gesundheit & den Genuss“ will Sie – als aktiven Menschen,
allgemein an der eigenen Gesundheit Interessierten und ganz besonders aber
auch alle biologisch-naturheilkundlich (insbesondere ganzheitlich) orientierte
Therapeuten – informieren und beraten.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine
Verbindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Natürlich gesund mit
Hagebutte
Verfasser:
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Wissenschaftliche Recherche
Rosemarie Hemgesberg
Redaktionelle Mitarbeit & Lektorat
© Copyright 2019
für das Buch Natürlich gesund mit
Hagebutte liegt ausschließlich bei
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg.
Nutzung – auch auszugs- und teilweise – in Wort, Schrift und allen elektronischen
(auch den zukünftigen) Kommunikationssystemen und in irgendeiner sonstigen
Form (Fotokopie, Mikrofilm und andere Dokumentations- & Archivierungs-
Verfahren) sowie die Weitergabe an Dritte und/oder die Vervielfältigung und
sonstige Verbreitung ist verboten und strafbewehrt!
Gerichtsstand: Jeweiliger Wohnort
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
© Copyright 2019
für die Gestaltung des Covers und das Layout liegt bei M.Schlosser
Drei Gedichte „Hagebutte“
Die Hagebuttenlaterne
Die winterharte Frucht erglüht zur Unzeit,
Apfel des Dorns, ein kleines Licht für kleine Leute,
das nur von ihnen will, dass sie den Docht
der Selbstachtung am Leben halten,
und es nicht nötig hat, mit Glanz zu blenden.
Doch manchmal, wenn dein Atem frostig pludert,
wird er zur schweifenden Gestalt Diogenes'
mit der Laterne, der nach seinem Mann sucht;
so spürst Du auf einmal hinter dieser Frucht,
die er in Augenhöhe hält, den Schätzblick
und schreckst zurück vor ihrem dürren Fleisch,
vor ihrem Stich (dass er dich prüfte und freigäb!)
ihrer angepickten Reife, die dich misst, dann weiterzieht.
Seamus Heaney
(13. April 1939 – 30 August 2013 – Irischer Dichter – ihm wurde 1995 der
Nobelpreis für Literatur verliehen)
Die Hagebutte
Eingezuckert vom ersten Reif,
zeigt sich die Hagebutte, etwas steif.
Die Kälte sitzt ihr in den Knochen
wie hat sie einmal gut gerochen?
Im Frühling beliebter Rosenduft
erfüllte um sie rum die Luft.
Menschen die vorübergingen
sogen den Duft in ihre Kiemen.
Schwärmen davon, mit Gebärden,
als würden sie bald König werden.
Ja, sie hat sich Allen gegeben,
in ihrem kurzen Rosenleben.
Sie wartet, bis sie Jemand pflückt,
Tee aufgießt und sie trinkt verzückt.
Inge Witt
(geb. 1952 – lebt im Chiemgau – Erzieherin / veröffentliche einige Bücher,
Gedichtbände – u.a. „Jetzt glaub‘ ich‘s auch! – und Hörbücher – dieses Gedicht
wurde geschrieben am 09.11.2012)
Die Heckenrose
Eine schlanke Heckenrose
schaukelt lustig in dem Wind;
freute sich, das fleckenlose,
rosig zarte Sonnenkind.
Hat geduftet und gesungen:
Blühe hier für jedermann,
alle, alle hübschen Jungen
lachen mich am Strauche an.
Eine dicke Hagebutte,
tiefgekränkt und voll Verdrieß,
war es, die aus roter Kutte
also sich vernehmen ließ:
„Wart ein Weilchen, meine Teure,
und dann bist du Spatzenspott.
Dick und voll Zitronensäure
wirst du bestenfalls Kompott!“
Herrmann Otto Rudolf Presber
(1868-1935 / deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor)
(Quelle: Die Deutsche Gedichtebibliothek)
Nebenbei:
Bereits der berühmte römische Dichter Ovid (Publius Ovidius Naso / 43
v.Chr. – 17 n.Chr.) hat ein Gedicht über Pflanzen geschrieben und
darinnen die Hagebutte bedacht „
wan hagebutten unde slên
“
(slên = Schwäche)
Hinweis
Die Erklärung zu allgemeinen medizinischen und besonders auch zu
biologisch-naturheilkundlichen Begriffen und Behandlungs-Verfahren
– gekennzeichnet mit einem ( ) – finden Sie im Glossar unter
Lexikon: „Begriffe verständlich gemacht!“
Ihr
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Kräuter & Pflanzen:
„Gestern & Heute“
Es ist weiß Gott keine „Errungenschaft“ der Jetzt-Zeit, sondern die
Nutzung von Pflanzen & Kräutern war schon immer – eigentlich
seitdem die Menschen [Homo sapiens] auf unserem Planeten in
Erscheinung getreten waren und sich ernähren mussten und für ihre
Gesundheit Sorge zu tragen hatten – eine sehr wichtige Quelle für die
Ernährung und das leibliche Wohlergehen (= Gesundheit &
Leistungsvermögen) somit die Sicherung ihrer „Art“.
Diese – als Wissen zu Anfang von Einzelpersonen – Kenntnisse um die
Bedeutung von Pflanzen & Kräutern wurde von Person zu Person
weitergegeben; in der Folge dann zu festem Wissen der Medizin der
Naturvölker, der Erfahrensheilkunde ( ) und der Volksmedizin ( ),
überall dort, wo die einzelnen Pflanzen & Kräuter heimisch waren.
Von der Volksmedizin gingen die Kenntnisse dann über in die
Medizin der Antike – die Medizin in Arabien, in Ägypten, Nordafrika,
Griechenland, im Römischen Reich – und dann in die Medizin im
Mittelalter und von dort in die naturheilkundliche Medizin der Neuzeit.
In der Neuzeit – insbesondere mit der zunehmenden Industrialisierung,
also in den sogen. ‚Industrie-Nationen‘ – wurde die Bedeutung und
somit die Anwendung von (Heil-)Pflanzen und von (Heil-)Kräutern
immer geringer; über eine lange Wegstrecke wurden Heilpflanzen
nur noch von Natur-Heilkundler zur Behandlung hergenommen.
Übrigens: auch die Anwendung von Pflanzen und Kräutern zur
Ernährung wurde mehr und mehr geringer; zuletzt findet sich diese
Anwendung nur noch bei Naturvölkern und außerdem oftmals in der
asiatischen & arabischen bzw. Nordafrikanischen Küche. In den
Industrienationen war dieser Zustand besonders gravierend, einmal
abgesehen von Kräutern wie Petersilie, Schnittlauch, Zwiebel,
Knoblauch und in geringerem Umfang noch Estragon, Basilikum und
einige wenige andere.
In den letzten Jahren – eigentlich seit 1-2 Jahrzehnten – ist es
erfreulicherweise in der Nutzung von Heil-Pflanzen & -Kräutern, das
gilt insbesondere für die Anwendung zu medizinischen Zwecken, zu
einer – aus meiner Sicht ‚erfreulichen‘ – „Trendwende“ gekommen.
Nicht einzig bei naturheilkundlichen Therapeuten, sondern für einige
Heilpflanzen auch in der wissenschaftlichen (Schul-)Medizin. So z.B.
Johanniskraut, Baldrian, Arnika, Ginkgo und Ginseng u.a.
Die Hagebutte (Rosa canina L.) – oder Hundsrose – galt zu frühen und
sehr frühen Epochen als wichtige Pflanze für Mensch & Vieh, damals
als „echte Wildpflanze“. Diesen hohen Stellenwert hat die Pflanze –
wie etliche andere auch – leider mit Beginn der Ära der chemisch-
synthetischen Wirkstoffe/Arzneimittel nach und nach und besonders
in den sogen. Industrienationen verloren.
Seit einiger Zeit ist aber auch in der gesundheitlichen Nutzung eine
Zunahme der Anwendung von Hagebutte – bei grippalen Infekten, als
mildes Laxans (Abführmittel), zur Beherrschung von Frühjahrsmüdigkeit, zur
Stärkung des Immun(abwehr)systems und Magen-Darm-Beschwerden
sowie bei „rheumatischen“ Beschwerden – sowohl der Früchte, der
Blüten als auch der Blätter und sogar in einigen Fällen wird die
Wurzel verwendet – in der naturheilkundlichen Medizin.
In der Schulmedizin findet die Hagebutte – soweit mir bekannt – keine
Anwendung.
Zuletzt noch:
Viele kennen die Hagebutte aus dem Kinderlied „Ein Männlein steht
im Walde“, auch wenn viele tatsächlich die Auflösung nicht kennen –
denn dort steht
„das Männlein dort auf einem Bein mit seinem roten Mäntelein und
seinem schwarzen Käppelein kann nur die Hagebutte sein“ –.
Für alle, die den Text nur noch vage in Erinnerung haben oder
diesen gar nicht mehr kennen, nachstehend der Liedtext. Er ist
verfasst vom berühmten deutschen Dichter August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben (1798-1874 / deutscher Hochschullehrer für
Germanistik / er ist auch Verfasser des „Lied der Deutschen“, dessen dritte
Strophe die „Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland“ ist).
Der Liedtext:
„Ein Männlein steht im Walde“
„Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm,
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald allein
Mit dem purpurroten Mäntelein.
Das Männlein steht im Walde auf einem Bein
Und hat auf seinem Haupte schwarz Käppelein klein,
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das da steht im Wald allein
Mit dem kleinen schwarzen Käppelein?
Das Männlein dort auf einem Bein
Mit seinem roten Mäntelein
Und seinem schwarzen Käppelein
Kann nur die Hagebutte sein...“
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1798-1874 / Hochschullehrer für Germanistik)
So wie viele Kinder die Hagebutte durch das Kinderlied kennen, so
kennen sie die Erwachsenen, besonders deren besonderen und
auffälligen roten Früchte.
Hagebutte: Ein „Pflanzen-
Stammbaum“
Die Vertreter der Spezies „Hagebutte“ (Rosa canina Linné) gehören zur
Pflanzen-Familie der ‚Rosengewächse‘.
Dröseln wir die botanische Ahnenreihe Schritt-für Schritt auf:
Die Familie der Rosengewächse (Rosaceae) umfasst ca. 3.000 Arten;
zum größten Teil findet man die Rosengewächse in den kalten und
gemäßigten Klimazonen der Erde. Bei den Rosengewächsen handelt
es sich um krautige Pflanzen oder um hölzerne Gewächse. Bei den
Rosaceae handelt es sich um eine vielgestaltige Pflanzenfamilie mit
vielmals großer wirtschaftlicher Bedeutung.
Sowohl die Kernobstgehölze Apfel und Birne, als auch verbreitete
Steinobst-Arten, wie Aprikose, Pfirsich, Süß- und Sauerkirsche,
Beeren-Obst, wie Erdbeere und Himbeere und viele Zier-Sträucher
und -Gehölze gehören ihr an.
Die Familie der Rosengewächse umfasst vier Unterfamilien:
Rosoideae, Maloideae, Prunoideae und Spiraeoideae.
Innerhalb der Unterfamilie lassen sich einige gemeinsame Merkmale
festlegen, die die zugehörigen Arten teilen. Die Hagebutten –
Hundsrosen-Arten – zählen allesamt zur Unterfamilie der Rosoideae.
Die Rosoideae sind meist oberständig, 1-samig und haben als
Früchte sogen. Nüsschen oder Rosenfrüchte.
Von der Zugehörigkeit zur Unterklasse weiter im Stammbaum als
nächste Stufe zur Pflanzen-Klasse bei den Rosengewächsen.
Hier gehören die Hundsrosen zur Klasse der Bedecksamer
(Magnoliopsida) – oder ‚Bedecktsamigen Pflanzen‘, auch Angiospermen
genannt; sie bilden die größte Klasse, mit ca. 226.000 Arten, der
Samenpflanzen –.
Die nächste Untergruppierung – oder, wenn wir im Jargon eines
Stammbaumes bleiben wollen, die nächste Generation – stellt in der
botanischen Systematik die Pflanzen-Gruppe dar. Bei den Rosen-
Gewächsen finden sich vier Pflanzengruppen:
Eudikotyledonen, Kern-Eudikotyledonen, Rosiden und Eurossiden I.
Die Eudikotyledonen umfassen einen Großteil der Bedecktsamer.
Sie gliedern sich in zwei Gruppen, die Asteriden und die Rosiden.
Die Hundsrosen zählen zur Pflanzen-Gruppe der Superrosiden.
Von den Pflanzen-Gruppen bzw. -Untergruppen zur letzten Stufe im
Stammbaum der Rosengewächse, der Pflanzen-Ordnung:
Hier gehören die Hagebutten zur Ordnung der Rosenartigen
Gewächse, der Rosales.
Damit können wir die Pflanzenfamilie der Rosengewächse verlassen
und uns zuwenden Y
Hagebutte: Ein Pflanzen-
Portrait
Die bei uns vielmals als Hunds- oder Heckenrose bezeichnete Rosa canina L. – Hagebutte – ist eine sehr alte Pflanze.
Um es vorweg zu sagen, bei der Hagebutte handelt es sich nicht nur
um eine einzige Pflanzen-Varietät, sondern vielmehr um zahlreiche
Pflanzen-Arten, oftmals sogen. Wildpflanzen.
Bleiben wir bei der bei uns heimischen Hagebutte:
Sprechen wir zunächst über die zahlreichen Namen, vielmals nur im
regionalen Gebrauch, für die Hagebutte. Die in Deutschland oftmals
gebrauchten Namen „Hecken- und Hundsrose“ habe ich ja bereits
mehrfach erwähnt. Diese beiden Namen sind – außer dem Namen
Hagebutte – die bekanntesten.
Weitere Namen für die Hagebutte sind – vielfach sogen. ‚Volkstümliche
Bezeichnungen‘ und oft nur gebraucht für die Bezeichnung der „Früchte“–:
Hagebutze Thurgau), Häbutje (Göttingen), Hombuezen, Haumbodden,
Hûmbodden (Gotha), Hombuden (Teplitz), Hânepötzen (Hannover).
Hawodele (rheinfränkisch). Häufig tritt der zweite Namensbestandteil
der Hagebutte auch alleine auf, so als Buddeln (Westfalen), Boddele
(Nahegebiet), Bottel (Niederrhein, Lothringen), Bötteln (Eifel), Butte (Baden), Buttle (Schweiz um Aargau ), Bottelter für den Strauch (Lothringen),
Butteltendôn (Bergisches Land), Butte(n)rösle (Elsaß), Hetscherln
(Bayern).
Das besonders in fränkischen Mundarten häufige Hiefe, Hiffe, Hüffe
gehört zu althochdeutsch huifo = Dornstrauch; Zusammensetzungen
sind: Hâhiefe (Niederhessen), Hiefeheck (Baden), Hainhiffe (Thüringen).
Drastische Benennungen, die darauf hinweisen, dass die mit den
Hagebutten verspeisten Fruchtkörner an der Ausgangspforte des
Darmes Jucken hervorrufen, sind: Arschkitzl (z.B. bayrisch-österreichisch,
fränkisch), Lochkitzle (Elsaß), Arschkratzelche (Nahegebiet), Arschkratzer
(Saarland), Kratzärschle, Krätz am Arsche (Lothringen).
Ein kleiner Schwenk in meine Kinder- & Schulzeit:
Wir Buben haben uns eine Gaudi daraus gemacht, die als
wirkungsvolles „Juckpulver“ beliebt-gefürchteten Hagenbutten – die
wir kurz zuvor aufgequetscht hatten – während des Schulunterrichts
den Mädels ins Kleid oder unter den Pullover vom Nacken her zu
stecken. Und wir haben uns diebisch gefreut, wenn die Mädels dann
ein heftiges Jucken geplagt hat und die Mädels nur schlecht an die
betroffenen Körperstellen während des Unterrichts herangekommen
waren.
Wir hatten seinerzeits natürlich nichts von „Allergien“ gewusst, die
die Haare der Hagebutten-Nüsschen auslösen können!
Weitere Namen sind: Hagrose, Wilde Rose, Hambutte, Frauenrose,
Bottel,
Dornapfel,
Butterfässlein,
Wildhips,
Weichhagen,
Schlafdorn, Mariendorn, Hainrose, Hainbutten, Heiderose &
Heideröslein,
Hundsdorn,
Judendorn,
Rosendorn
und
Rosenbeere,
Hagenbutten-Strauch,
Dornröschen,
Wiepken,
Butterfäßlein, und Feldrose.
Der Name Hagebutte stammt von den Worten Hag oder Hagen für
dichtes Gebüsch bzw. Dornenstrauch und Butzen für Klumpen,
Batzen. Je nach Landstrich nennt man die Früchte auch Hainbutte
oder Heinzerlein.
Ein im Mittelalter bei uns gebräuchlicher Name war „Hambutte“.
Wilde Rosen gibt es schon viel länger, als uns Menschen. Im Pariser
Rosenmuseum bezeugen Funde von versteinerten Pflanzenteilen,
dass Rosen schon vor 25 bis 30 Millionen Jahren existierten.
Ein noch lebendes imposantes Exemplar der Rosa canina wächst an
der Außenwand der Grabkapelle des Hildesheimer Doms. Er ist 13 m
hoch und wird bereits in einer Urkunde aus dem 11. Jahrhundert
erwähnt.
Mit botanischem Doppel-Namen heißt die Hagebutte Rosa canina L.
Das Wort Rosa ist der lateinische Name der Pflanze und canina
heißt so viel wie hundsgemein, was bedeutet, dass man die
Hagebutte überall finden kann.
Im anglo-amerikanischen Sprachraum nennt man die Hagebutte
„rose hip“ oder auch „wild hips“ und die Hagebutten-Früchte
„Rosehip fruits“ oder „Dog rose fruits“ und auch „Sweet briar fruits“.
Im Französischen heißt sie „églantier“ oder auch „cynorrhodon“, ihre
Früchte „fruits d’églantier“" .
Die Italiener bezeichnen sie mit „rosa canina silvestre“ und die
Früchte „frutti di rosa canina“.
Bei den spanisch sprechenden Völkern heißt sie „escaramujo” und
die Früchte “frutos de rosa mosqueta” .
Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden haben sie den Namen
„Rozenbottel“ und die Früchte „Rozenbottel vruchten“.
Wer nach Dänemark unterwegs ist, der hört dort den Namen „hyben“
und die Früchte „hyben frugter“.
In Schweden nennt man sie „nypon” und in Finnland „ruusunmarja” .
In Russland und allen russisch sprechenden Ländern nennt man sie
„шиповник“ (auszusprechen: shipovnik), die Früchte „Плоды шиповника“
(auszusprechen: Plody shipovnika).
Bei unseren Nachbarn im Osten, den Polen, werden sie genannt
„róży” , die Früchte „ Hagebutte-owoce” .
Machen wir noch einen Sprung nach Asien:
In Japan werden sie geheißen „Rōzuhippu“ und im Reich der Mitte,
in China, wird sie genannt „Méiguī guǒ“.
Zuletzt noch:
In allen arabisch parlierenden Ländern heißt sie „airtafae alwrk“.
Genug der Namen.
Wo kommt unsere Hagebutte eigentlich her?
Die Hagebutte(n) ist/sind in Europa, Westasien und in Nordafrika
ursprünglich beheimatet. Inzwischen haben sie sich aber auch als
sogen. „invasive Pflanzen“ ausgebreitet und sind dort ebenfalls
heimisch geworden in Süd-Amerika und auch in Ost-Europa und
dem asiatischen Teil Russlands, sowie in Nord-Asien und zuletzt
auch in Nord-Amerika.
Stammpflanzen unserer heutigen Hagebutten sind diverse Rosa-
Arten, außer der Hundsrose, Rosa canina L., insbesondere noch die
Alpen-Rose, Rosa pendulina L., (s. nächstes Kapitel).
Nun endlich zur Botanik der Pflanze „Hagebutte“:
Die Heckenrose ist ein bis zu 1,50 m hoch-wachsender – er kann aber
auch eine Wuchshöhe von bis zu 3 m und in vereinzelten Fällen sogar bis
zu 5 m erreichen – kräftiger Strauch aus der Familie der Rosen-
Gewächse.
Nur im 1. Wuchsjahr hat die Hagebutte aufrechte Zweige; in den
folgenden Jahren sind die Äste und Zweige gebogen und hängen
zumeist über. Äste und auch der Stamm haben rückwärts gebogene
Stacheln (Dornen). Die wechselständigen Blätter sind unpaarig
gefiedert, am Grund beiderseits geflügelt. Sie bestehen meist aus 5-
7 Fliederblättchen mit gesägtem (gezähntem) Rand. Die Blüten stehen
wechselständig, sind von blässlichen hell-rötlichen oder weißer
Farbe. Die Blüten sind ungefüllt, duftlos und sie stehen einzeln oder
in mehr-blütigen Doldenrispen. Sie besitzen einen etwa 2 cm langen
Stiel, 5 Blütenblätter und 5 Kelchblätter, die nach dem Verblühen
zurückgeschlagen sind.
Aus den Kelchblättern entwickelt sich die bei der Reife kräftig rote
Scheinfrucht, die eigentliche Hagebutte. Die Scheinfrüchte, also die
Hagebutten, sind 1-2 cm lang, 0,6-1,5 cm im Durchmesser messend,
rundlich bis eiförmig, glänzend rot oder bräunlich-rot, hart,
eingefallen und runzelig. Am oberen Frucht-Ende ist meistens eine
stumpf fünf-eckige Scheibe aus den Überbleibsel der 5 Kelchblätter
erkennbar. In der Mitte der Scheibe befindet sich ein ca. 1 mm
breites Loch, die Griffelröhre.
Im Innern enthält sie zahlreiche harte Früchte – die „Nüsschen“ –,
sowie zahlreiche, einen Juckreiz bei Berührung auslösende,
Härchen; diese sind hell und steif. Die Nüsschen sind bis 5 mm lang
und bis 3 mm dick, von gelb-brauner Farbe und von 3- bis mehr-
kantigem, abgeplattetem Aussehen.
Festzuhalten ist noch, dass von der Hagebutte zahlreiche Unterarten
und Varietäten vorkommen.
Blütezeit (bei uns in Mitteleuropa):
Monate Juni und Juli.
Fruchtreife:
ab Mitte September:
Geruch und Geschmack:
Die Rosen riechen gering „lieblich“ oder sind duftlos; das Frucht-
Fleisch schmeckt süß-säuerlich und es hat einen schwach
zusammenziehenden Charakter.
Die Nüsschen sind fast geruchlos – Hinweis: der Absud aus den
Nüsschen hingegen hat ein Tee-artiges Aroma –.
Die Wucherungen der Hundsrose, die sogen. Rosengallen oder
Rosenschwämme ( ), sind geruchlos.
Standorte:
Die Heckenrose gedeiht an sonnigen Waldrändern, auf sonnigen
Heide-Hängen, auf Schlägen (d.s. zusammenhängende Stücke Ackerland *
vielfach auch als „Windschutz“ genutzt), als Teil von Hecken und
Gebüschen und auch Gärten, hier besonders in Gärten von Bauern.
Die Hundsrose verlangt einen sehr guten, tief-gründigen Boden und
viel Sonne. Sie gedeiht zwar auch auf steinigem Grund, doch dort
sind die Früchte auffallend klein.
Was die Nutzung der Hagebutten-Pflanzenteile angeht, das kommt
später zur Sprache.
Weil immer wieder gefragt, will ich auch kurz auf diese Frage
eingehen:
Gibt es „Verwechslungs-Möglichkeiten“ der Hagebutten mit
anderen und evtl. sogar giftigen Wild-Beerenfrüchte?
Da kann ich mich sehr kurz fassen und alle zukünftigen und
derzeitigen Sammler von Hagebutten absolut beruhigen:
Ganz gleich, ob Hundsrose, Essigrose (Rosa gallica) – auch Gallica-
Rose – Apfelrose (Rosa villosa L.), Kartoffelrose (Rosa rugosa L.) – auch
Japan-Rose – oder bes. auch der Chinesischen Gold-Rose (Rosa
hugonis L.) (dazu später ein eigener Kapitel „Ein kleines Interludium“), Mini- oder
Schwarze Hagebutte (Rosa spinosissima) – oder Bibernell-Rose –, alle
Hagebutten-Arten können verwendet werden, keine ist giftig.
Im Aussehen ihrer Blüten und ihrer Früchte sind diese „Rosen-Arten“
grundverschieden. Zudem unterscheiden sich die verschiedenen
Früchte in Form, Größe und Färbung.
Die Kartoffelrose füllt schneller die Gläser, ist aber auch fader im
Geschmack als die Frucht der wilden Hundsrose.
Ein abschließendes Wort noch zur „Ernte“ der Pflanze – das ist ja
besonders wichtig für die Gewinnung der „heilkräftigen“ Pflanzenteile –:
Gesammelt werden in erster Linie die Hagebutten in den gemäßigten
Klimazonen – z.B. in Mitteleuropa – im Herbst in den Monaten
Oktober & November, nachdem sie einmal „durch den Reif (Frost)
gegangen sind und so die Hagebutten(früchte) erweicht wurden.
Gesammelt werden in erster Linie die (Schein-)Früchte (Fructus
Cynosbati) und zwar mit dem Samen (Fructus Cynosbati cum semine) oder
ohne Samen (Fructus Cynosbati sine semine); aber auch isoliert den
Samen (Semen Cynosbati) und ferner für die Tee-Gewinnung die Blätter
(Folium Cynosbati). Zuletzt werden nach wie vor gesammelt die
Rosengallen (oder Rosen-Schwämme).
Diese Kapitel will und werde ich beenden mit einem kleinen Gedicht
und einem Zitat.
Die Hundsrose
Die Ros’ ist ohn’ Warum
Sie blühet weil sie blühet
Sie acht nicht ihrer selbst,
fragt nicht ob man sie siehet
(Angelus Silesius – eigentlich Johann Scheffler)
1624-1677 – Deutscher Lyriker, Theologe und Arzt)
Rosa canina
„
Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut
gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich
(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Vicomte de Saint-Exupéry
1900-1944 / Zitat aus „Der kleine Prinz“ [„Le Petit Prince“])
Von der reinen Botanik zur Y
Hagebutte: „Inhalts-Stoffe“
Richtiger muss es heißen „Heil- und Inhalts-Stoffe“.
Zuvor muss noch einiges gesagt werden zur Gewinnung der Droge
( ) und auch zur weiteren Verarbeitung:
Die Hagebutten (= Früchte) werden zu Beginn der Reife in den
Monaten September bis November, wenn sie bereits rot gefärbt, aber
noch nicht fest sind, gesammelt. Vielerorts wird auch erst
gesammelt, wenn sie einmal durch den ‚Frost (Reif) erweicht wurden.
Nach dem sammeln werden sie von Stielen und Kelchresten befreit.
Dann werden sie der Länge nach aufgeschnitten, völlig entkernt (von
den Nüsschen) und dann werden sie anfangs an der Luft vorgetrocknet
und anschließend können sie bei mäßiger Wärme von maximal 75-
80°C z.B. zuhause im Backofen getrocknet werden. Industriell
geschieht dieser Vorgang natürlich in speziellen Trockenöfen.
Die Kerne der Hundsrose werden abgespült und so von den Härchen
befreit und danach ebenfalls getrocknet.
Zur Verwendung in der Erfahrungsmedizin ( ) und der Volksmedizin
( ) werden zur Blütezeit auch die Blütenblätter gesammelt. Auch die
an den Heckenrosen befindlichen Rosengallen/Rosenschwämme ( )
werden gesammelt.
Nunmehr zu den „Heil- & Inhaltsstoffen“:
D