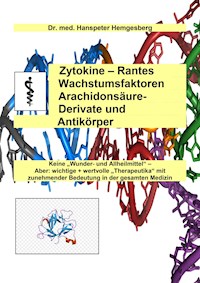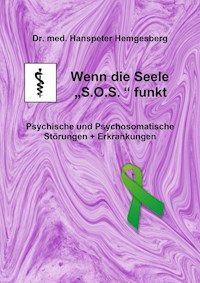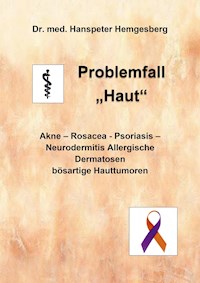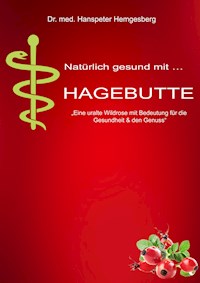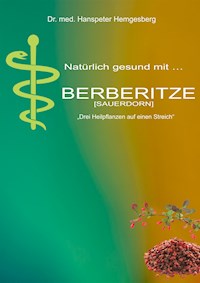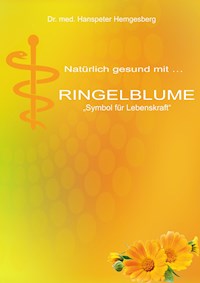
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Ringelblume – wegen ihrer leuchtend-gelben Blüten auch genannt "Goldblume" und mit lateinisch botanischem Doppelnamen "Calendula officinalis L." – zählt inzwischen (wieder) bei uns in Mitteleuropa nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch mit am meisten zu gesundheitlichen Zwecken angewendeten Heilpflanzen. Erfreulicherweise zeichnet sich seit rund eineinhalb Jahrzehnten ein Trend ab, hin in Richtung einer Anwendung von Heilpflanzen & Heilkräutern zur Stabilisierung der Gesundheit, zur Anwendung als – wie ich es nenne – "Basis-Therapeutika" bei den verschiedensten Befindlichkeitsstörungen und/oder leichtgradigen Erkrankungen und auch in Kombination mit schulmedizinischen chemisch-definierten Arzneimitteln bei manifesten Erkrankungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ringelblume
eine uralte
Heilpflanze, ein „Symbol
für Lebenskraft“
Die Ringelblume – wegen ihrer leuchtend-gelben Blüten auch genannt
„Goldblume“ und mit lateinisch botanischem Doppelnamen „Calendula
officinalis L.“ – zählt inzwischen (wieder) bei uns in Mitteleuropa nicht
nur zu den bekanntesten, sondern auch mit am meisten zu
gesundheitlichen Zwecken angewendeten Heilpflanzen.
Erfreulicherweise zeichnet sich seit rund eineinhalb Jahrzehnten ein
Trend ab, hin in Richtung einer Anwendung von Heilpflanzen &
Heilkräutern zur Stabilisierung der Gesundheit, zur Anwendung als –
wie ich es nenne – „Basis-Therapeutika“ bei den verschiedensten
Befindlichkeitsstörungen und/oder leichtgradigen Erkrankungen und
auch in Kombination mit schulmedizinischen chemisch-definierten
Arzneimitteln bei manifesten Erkrankungen.
Dieser Griff zu den „Wirkstoffen aus Mutter Natur“ würde sicherlich
nicht erfolgen, wenn diese natürlichen Heilmittel nicht wirksam und
hilfreich wären.
Wenngleich einige Heilpflanzen inzwischen so etwas wie einen
festen Platz & Stellenwert in der Medizin gefunden haben und nicht
nur in der naturheilkundlichen, sondern zunehmend auch in der
wissenschaftlichen (Schul-)Medizin, so reichen die Kenntnisse –
insbesondere, wenn es um Wirkungen & Anwendungsmöglichkeiten zur
Selbstbehandlung geht – vielmals nicht aus.
Ich halte es dafür für wichtig, richtig und angebracht, einer breiteren
Öffentlichkeit das Wissen über die „Kraft, die in Heilpflanzen steckt“,
näher zu bringen.
„Ringelblume – Heilpflanze des Jahres 2009“!
Dieses Buch Natürlich gesund mit
Ringelblume mit dem Untertitel „Symbol
für Lebenskraft“ will Sie – als aktiven Menschen, allgemein an der eigenen
Gesundheit Interessierten und ganz besonders aber auch alle biologisch-
naturheilkundlich (insbesondere ganzheitlich) orientierte Therapeuten – informieren
und beraten.
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Jedoch kann eine
Verbindlichkeit aus ihnen nicht hergeleitet werden.
Natürlich gesund mit
Ringelblume
Verfasser:
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Wissenschaftliche Recherche, Redaktionelle Mitarbeit & Lektorat
Rosemarie Hemgesberg
© Copyright 2019
für das Buch Natürlich gesund mit
Ringelblume liegt ausschließlich bei
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg.
Nutzung - auch auszugs- und teilweise - in Wort, Schrift und allen elektronischen
(auch den zukünftigen) Kommunikationssystemen und in irgendeiner sonstigen
Form (Fotokopie, Mikrofilm und andere Dokumentations- & Archivierungs-
Verfahren, auch zukünftigen) sowie die Weitergabe an Dritte und/oder die
Vervielfältigung und sonstige Verbreitung ist verboten und strafbewehrt!
Gerichtsstand: Jeweiliger Wohnort Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
© Copyright 2019
für die Gestaltung des Covers und das Layout liegt bei M.Schlosser
Ringelblume – in der Lyrik
Ringelblume
Wie leuchten Blütenkorb und Krone
der Ringelblume uns entgegen.
und hausgebräuchlich wär man ohne
die Pflanze dann und wann verlegen.
Sie färbt den Kuchen, gilbt die Torten,
ersetzt den Safran mühelos.
Man schätzt sie, kennt sie allerorten
und zieht sie meist im Garten groß.
Als Balsam wirkt sie, in Tinkturen,
in Form der Salbe mildert sie
die Folge von Verletzungsspuren.
Ein aeskulapisches Genie!
Die Blume klebt auch, soll man wissen,
sie stellt sich dauerhaft zur Schau.
Vom Ringelstrauß nicht hingerissen
ist ob der Haftkraft deine Frau.
(© Ingo Baumgartrner – 24.12.1944-5.8.2015 – Lehrer an Pflichtschulen im
Salzburger Land – hatte die größte Tiergeschichten-Sammling)
(entnommen „Gedichte-Sammlung.net)
Ringelblume
Jeden Tag, seit die Sonne für mich scheint,
jede Nacht, seit ich Sterne sehen kann.
Jede Minute, in der ich hab geweint,
jede Sekunde, in der ich wusste wann.
Meine Ringelblume, du bist da.
Keinen Tag ohne Gedanken an dich,
keine Nacht ohne mein Herz bei dir zu wissen.
Keine Minute warst du nicht da für mich,
keine Sekunde müsste ich dich missen.
Immer wenn ich eine sehe erinnere ich mich an den Satz:
Und wenn ich einmal sterbe, will ich eine Ringelblume werden.
Und in meinem Herzen ist dein Platz,
noch größer als er ist auf Erden.
(von Gebärdelied – entnommen keinVerlag.de)
Zu Letzt soll noch ein Gedicht des umstrittenen ‚Heide-Dichters‘
Hermann Löns (1866-1914 – deutscher Journalist & Dichter + Schriftsteller –
schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger,
Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos
geworden) zu Papier gebracht werden, ein traurig-melancholisches
zumal:
Totenblumen
Es blühten Tulpen und Narzissen,
sie blühten dir, sie blühten mir,
sie sind verwelkt, sie sind verdorret,
denn heute muss ich fort von dir.
Der blaue und der weiße Flieder,
der hat verloren seine Zier;
er wird uns niemals wieder blühen,
denn heute muss ich fort von dir.
Die roten und die weißen Rosen,
die blühen weder dir noch mir;
sie müssen ungepflückt verwelken,
denn heute muss ich fort von dir.
Die Astern und Reseden blühen,
was hilft es dir, was hilft es mir;
ein andrer wird sie beide brechen,
denn heute muss ich fort von dir.
Die allerletzten gelben Blumen,
die Ringelblumen, pflück ich mir;
sie blühen auf dem Grab der Liebe,
denn heute muss ich fort von dir.
Noch ein letztes Gedicht:
Calendula
Calendula, du Blumenschöne,
jetzt bist du wieder hell erblüht;
dein Sonnenantlitz sendet Töne
mir golden strahlend ins Gemüt.
Erfreutest mich schon nach dem Kriege,
als ich war Kind, im Trümmermeer
war mir dein Anblick Lebenswiege,
du wuchst, wo alles schien so leer.
Ich war noch klein, und deinen Namen,
den hab’ ich damals nicht gekannt
wohl sammelte ich deinen Samen,
hab’ dich „mein Sonnenkind“ genannt.
Das bist du mir bis heut’ geblieben.
Nun schau ich schon nostalgisch hin.
So vieles, was als Kind wir lieben,
erfreut im Alter noch den Sinn.
(Ingrid Herta Drewing – geb. 12.12.1943 – Lehrerin für Deutsch, Ethik, Erdkunde in
Mainz –)
(Quelle: e-Stories.de)
Hinweis
Die Erklärung zu allgemeinen medizinischen und besonders auch zu
biologisch-naturheilkundlichen Begriffen und Behandlungs-Verfahren
– gekennzeichnet mit einem ( ) – finden Sie im Glossar unter
Lexikon: „Begriffe verständlich gemacht!“
Ihr
Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
Kräuter & Pflanzen:
„Gestern & Heute“
Es ist weiß Gott keine „Errungenschaft“ der Gegenwart, sondern die
Nutzung von Pflanzen & Kräutern war schon immer – eigentlich
seitdem die Menschen [Homo sapiens] auf unserem Planeten in
Erscheinung getreten waren und sich ernähren mussten und besonders
auch für ihre Gesundheit Sorge zu tragen hatten – eine sehr wichtige
Quelle für die Ernährung und das leibliche Wohlergehen (= Gesundheit
& Leistungsvermögen) somit die Sicherung ihrer „Art“.
Diese – als Wissen der Heilkundigen der frühen „Medizin-Geschichte“–
Kenntnisse, insbesondere die heilkundlichen Wirkungen, um die
Bedeutung von Pflanzen & Kräutern wurde von Person zu Person
weitergegeben; in der Folge dann zu festem Wissen der Medizin der
Naturvölker, der Erfahrensheilkunde ( ) und der Volksmedizin ( ),
überall dort, wo die einzelnen Pflanzen & Kräuter heimisch waren.
Von der Volksmedizin gingen die Kenntnisse dann über in die
Medizin der Antike – die Medizin in Arabien, in Ägypten, Nordafrika,
Griechenland, im Römischen Reich – und dann in die Medizin im
Mittelalter und von dort in die naturheilkundliche Medizin der Neuzeit.
In der Neuzeit – insbesondere mit der zunehmenden Industrialisierung,
also in den sogen. ‚Industrie-Nationen‘ – wurde die Bedeutung und
somit die Anwendung von (Heil-)Pflanzen und von (Heil-)Kräutern
immer geringer und ganz besonders mit den Möglichkeiten der
Herstellung chemisch-synthetischer Arzneimittel.
Über eine lange Wegstrecke wurden Heilpflanzen nur noch von
Natur-Heilkundlern zur Behandlung hergenommen.
Übrigens:
Auch die Anwendung von Pflanzen und Kräutern zur Ernährung ging
immer mehr und weiter zurück; das ist sicherlich in hohem Maße
dem Umstand geschuldet, dass in unserer hektischen Zeit sich nur
noch wenige Menschen die Zeit nehmen & lassen, um mit
Heilpflanzen & Heilkräutern die Nahrungs-Zubereitung zu bereichern.
Was die Ringelblume(n) angeht, so wird deren Verwendung in der
Küche zumeist reduziert als schmückendes Beiwerk – als „Dekor“,
insbesondere in den „Sterne-Küchen“ – auf Salaten usw.
Dass es Gerichte, fest wie flüssig, mit Ringelblumen gibt, das dürfte
heutzutage weitgehend in Vergessenheit geraten sein.
In den letzten Jahren – eigentlich seit 1-2 Jahrzehnten – ist es
erfreulicherweise in der Nutzung von Heil-Pflanzen & -Kräutern, das
gilt insbesondere für die Anwendung zu medizinischen Zwecken, zu
einer – aus meiner Sicht ‚erfreulichen‘ – „Trendwende“ gekommen.
Nicht einzig bei naturheilkundlichen Therapeuten, sondern für einige
Heilpflanzen auch in der wissenschaftlichen (Schul-)Medizin. So z.B.
Johanniskraut, Baldrian, Arnika, Ginkgo und Ginseng, Weißdorn,
Hopfen u.a.
Die Ringelblume (Calendula officinalis L.) – oder Goldblume – galt zu frühen und sehr frühen Epochen als wichtige Pflanze für Mensch &
Vieh, damals als „echte Wildpflanze“.
Diesen hohen Stellenwert hat die Pflanze – wie etliche andere auch –
leider mit Beginn der Ära der chemisch-synthetischen Wirkstoffe/
Arzneimittel nach und nach und besonders in den sogen. Industrie-
Nationen verloren.
Seit einiger Zeit ist aber auch in der gesundheitlichen Nutzung eine
Zunahme der Anwendung von Ringelblume – bei Wunden, auch sogen.
‚offenen Beinen‘ & Wundheilungsstörungen, Blutergüssen, Quetschungen,
Muskelzerrungen, Geschwürsleiden u.a.m. – in der naturheilkundlichen
Medizin und zunehmend auch in der Schulmedizin zu verzeichnen.
In der Gesamtwirkung der Ringelblume wird sie völlig zu Recht
vielmals auch genannt „die kleine Schwester der Arnika“.
Zuletzt noch:
Der berühmte Komponist Franz Peter Schubert (1797-1828 – österr.
Komponist) als „Vertoner“ und der weltberühmte Dichter William
Shakespeare als „Verfasser“ (1564-1616 – englischer Dramatiker, Lyriker
und Schauspieler – seine Komödien & Tragödien zählen zu den bedeutendsten
Bühnenstücken der Weltliteratur) setzten der Ringelblume ein Denkmal in
der ersten Strophe ihres Gedichtes bzw. Liedes:
Ständchen
Und Phöbus, neu erweckt,
Tränkt seine Rosse mit dem Tau,
Der Blumenkelche deckt.
„Der Ringelblume Knospe schleußt
Die goldnen Äuglein auf,
Mit allem, was da reizend ist,
Du süße Maid, steh auf,
Steh auf, steh auf!
(aus William Shakespeares Theaterstück:
„The Tragedie of Cymbeline” oder „Cymbeline, King of Britain”)
[Imogen, die Tochter von König Cymbeline, heiratet heimlich und gegen den Willen
ihrer Stiefmutter den niedrig geborenen Posthumus. Vom Hof verbannt gelangt
dieser nach Rom, wettet auf die Untreue seiner Frau und strebt, nachdem er
getäuscht wurde, danach, Imogen ermorden zu lassen. In den Wirren militärischer
Konflikte zwischen Rom und Britannien trifft Imogen ihre verloren geglaubten
Brüder wieder, die böse Stiefmutter gesteht auf dem Sterbebett ihre Intrigen gegen
die Tochter des Königs, Posthumus vergibt seinem verräterischen Freund und
Imogen verzeiht ihrem Mann den Mordanschlag. Das Stück spielt in der Zeit der
römischen Antike, wurde vermutlich 1610 verfasst und erschien erstmals 1623]
Übrigens:
Einer der vielen Namen für die Ringelblume lautet irrigerweise
„Totenblume“.
Irrigerweise, weil der Name übernommen wurde – soweit mir bekannt
– aus Mexiko. Dort war der Glaube, dass die leuchtend organge-
gelben Totenblumen (Flor de Muertos) den Verstorbenen – die Farbe für
die Toten ist orange-gelb – am mexikanischen Tag der Toten, Día de
los Muertos am 01./02. November eines jeden Jahres, den Weg
weisen (an diesem Tag werden in Mexiko Städte, Dörfer und vor allem die
Friedhöfe in ein orange-gelbes Blumenmeer getaucht). Gemeint waren aber
die ebenfalls orange-gelb blühenden „Tagetes erecta“, auf Deutsch
„Studentenblumen“!
Übrigens: eine regionale Bezeichnung der Tagetes ist ebenfalls bei
uns „Totenblume“.
Wie es bei uns zu dieser Fehldeutung gekommen ist, ist nicht
eindeutig nachvollziehbar und nicht zweifelsfrei belegt.
Ringelblume: Pflanzen-
Stammbaum
Die Vertreter der Spezies „Ringelblume“ (Calendula officinalis Linné)
[Linné: Kürzel „L.“ – s. Lexikon ( )] gehören zur Pflanzen-Ordnung der
‚Asternartigen Pflanzen‘ (Asterales).
Dröseln wir die botanische Ahnenreihe Schritt-für Schritt auf:
Wie schon gesagt, die Ringelblume zählt zur Pflanzenfamilie der
Asternartigen (Asterales).
Sämtliche Asterales werden eingegliedert in die übergeordnete
Ordnung
der
„Bedecktsamer“
–
Bedecktsamigen
Pflanzen
(Magnolipsida) –. Diese ist eine der artenreichsten Ordnungen der
Bedecktsamigen Pflanzen. Fossilfunde sind bekannt seit dem
Oligozän, etwa 29 Millionen Jahre vor heute; es ist also eine noch
relativ junge Ordnung. Bei den Asterales bestehen 49 Unter-
Kategorien oder Familien.
Eine dieser Familien sind die „Korbblütler“ – Korbblüten-Gewächse
bzw. Astern-Gewächse oder auch Köpfchenblütler und mit Fachnamen
„Asteraceae“ [früherer Name: Compositae] –.
Außer den Ringelblumen gehören noch zu dieser Familie Pflanzen wie z.B.
Arnika, Artischocke, Gänseblümchen, Goldrute, Huflattich, Kamille,
Löwenzahn, Margerite, Mariendistel, Pestwurz, Schafgarbe, Sonnenblume ,
Roter Sonnenhut und auch Wermut.
Die Unter-Familie bilden die Asteroideae. Sie enthält ca. 1.135
Gattungen mir rund 16.200 Arten mit weltweiter Verbreitung.
Neben den Hagebutten gehören dieser Unterfamilien u.a. an: die
verschiedenen Arten der Schafgarbe, sowie der verschiedenen Arten des
Berufskrauts, der Katzenpfötchen und der Kamillen sowie die Arten des
Ruhrkrauts und der Pestwurz wie auch der Goldruten, Arnika
(Bergwohlverleih), Sonnenblume, Margeriten [ und auch der Huflattich.
Die nächste Stufe in der botanischen Systematik stellt der Tribus
(deutsch: „Stamm“ oder „Gattung“) dar. Hier wird die Ringelblume dem
Tribus Calendulae – der Gattung ‚Ringelblumen‘ – zugeordnet.
Die Gattung Calendulae wurde 1753 von Carl von Linné in seinem
Werk ‚Species Plantarum‘ (deutsche Übersetzung ‚Arten der Pflanzen‘) zum
ersten Mal veröffentlicht.
Es gibt etwa 11 Calendula-Arten:
Acker-Ringelblume ( Calendula arvensis (Vaill.) L.) // Calendula eckerleinii Ohle –
sie kommt in Marokko vor // Calendula lanzae Maire – sie kommt in
Marokko vor // Calendula maroccana (Ball) B.D.Jacks. – sie kommt in
Marokko vor // Calendula meuselii Ohle – sie kommt in Marokko vor //
Calendula pachysperma Zohary – sie kommt im Gebiet von Israel und
Jordanien vor // Calendula palaestina Boiss. – sie kommt in Syrien, im
Libanon und im Gebiet von Israel und Jordanien vor // Calendula stellata
Cav. – sie kommt in Sizilien, Tunesien, Algerien, Marokko und den Kanaren
vor // Calendula suffruticosa Vahl – sie kommt in Madeira, Portugal,
Spanien, Italien, Sizilien, Sardinien, Tunesien, Algerien und Marokko vor.
Es gibt von dieser Spezies etwa 13 Unterarten // Calendula tripterocarpa
Rupr. – sie kommt auf den Kanaren, in Nordafrika, Vorderasien und
Südeuropa vor // und [
Gewöhnliche Ringelblume ( Calendula officinalis L.).
Die nächste und letzte Stammbaum-Stufe stellen die Pflanzen-Arten
dar.
Es handelt sich dabei um die Art „Ringelblume“ oder mit
wissenschaftlich-botanischem Namen Calendula officinalis Linné.
Mit dieser Pflanzen wollen und werden wir uns nunmehr näher
befassen.
Ringelblume: Pflanzen-
Portrait
Die bei uns im allgemeinen Sprachgebrauch als Gemeine
Ringelblume bezeichnete Calendula officinalis L. – auch bekannt als
Ringelrose – ist eine sehr alte Wild-Pflanze.
Bevor wir uns mit der Pflanzen-Botanik auseinandersetzen, zuerst zu
den vielen – vielmals nur regional gebräuchlichen – Namen für die
Ringelblume. Das sind u.a.:
Butterblume – Dotterblume – Fallblume – Feminell – Garten-
Dotterblume – Gartenringelblume – Goldblume – Goldrose –
Holligold – Ingelblum – Liebesblume – Mariegold – Marienrose –
Monatsblume – Morgenröte – Regenblume – Rinderblume –
Ringelken – Ringeln – Ringelrose – Sonnenbraut – Sonnenwende
bzw. Sonnenwendblume – Stinkerli – Studentenblume – Totenblume
– Weckbröseln und Weckbröselchen – Weinblume – Wucherblume
– 6
Die Ringelblume war in alten Zeiten bekannt unter dem Namen
„Niewelkblume“ und sollte dafür sorgen, dass die Liebe unter den
Menschen immer neu erblühe, so wie die Blüten dieser Blume.
Übrigens:
Nach den Farben ihrer Blüten wird sie auch noch genannt
„Morgenrot“ und „Abendrot“.
In Frankreich heißt sie Fleur de tous les mois und Fleur des souci.
Der anglo-amerikanische Sprachraum kennt sie als Marigold und
Goldbloom ferner als Pot marigold, ruddles, common marigold,
garden marigold, English marigold, Scottish marigold.
Dort, wo holländisch/niederländisch gesprochen wird, heißt sie
goudsbloem.
In Italien nennt man sie einfach calendula.
In Spanien und allen spanisch sprechenden Ländern wird sie wie in
Italien ebenfalls caléndula genannt.
Dort, wo die portugiesische Sprache üblich ist, nennt man sie
malmequer.
Bei unseren dänischen Nachbarn heißt sie Marigold, in Schweden
kennt man sie ebenfalls unter diesem Namen. In Finnland heißt sie
Kehäkukka.
Auf kroatisch heißt sie neven.
Bei den Polen nennt ist sie bekannt als nogietek; und in Tschechien
měsíček; bei allen russisch sprechenden Nationen kennt man sie als
ноготки – in lateinischen Buchstaben: nogotki –.
Zuletzt noch ein Ausflug auf die arabische Halbinsel und in die Türkei
und nach Asien:
In der arabischen Sprache heißt sie f
ür uns lesbar und aussprechbar
aladhiriun naba'at und in der Türkei kadife çiçeği.
In Japan ist ihr Name マリーゴールド – für aus les- und sprechbar
als Marīgōrudo –.
In China heißt sie 万寿菊 – in lateinischen Buchstaben: Wànshòu jú –.
Der deutsche Name „Ringelblume“ hat zweifelsfrei unmittelbaren
Bezug auf die ‚inneren ringförmig gewundenen Früchte der
Pflanzen‘.
Eine andere Theorie für die Namensherkunft ist, dass sich die Strahl-
Blüten der Calendula-Arten mit dem Aufgehen der Sonne öffnen und
mit dem Untergehen schließen. Sie verfolgen also die Bewegung der
Sonne.
Der (lateinische) botanische Name „Calendula“ ist abgeleitet vom
lateinischen „calendae“, d.h. den ersten Tagen eines Monats; dies,
weil die Pflanzen während vieler Monate, lateinisch ‚calendis‘,
blühen.
Auch ist dieser Name ‚calendulae‘ verwandt mit dem uns
gebräuchlichen Namen ‚Kalender‘, denn die Ringelblume blüht ja den
„Kalender“ hindurch bis zu den ersten Frösten.
Übrigens:
Der französische Name „Fleur de tous moins“ – auf Deutsch in etwa zu
übersetzen mit ‚Blüte/Blume für alle Monate‘ – trägt dieser lateinischen
Herkunft Rechnung.
Kommen wir zur ursprünglichen Herkunft der Ringelblume(n):
Die genaue und ursprüngliche Herkunft der Ringelblume ist
unbekannt, sie wird jedoch im gesamten Mittelmeerraum – auf der
europäischen wie der nordafrikanischen Seite – vermutet.
Sie wird weit verbreitet kultiviert und kommt verwildert in ganz
Europa vor.
In Mitteleuropa ist sie eine Adventiv-Pflanze ( ), ebenso auf dem
gesamten Balkan, in Ost-Europa und Vorderasien und zuletzt auch in
Japan, China, Malaysia, Indonesien.
Die Ringelblume verwildert leicht.
Die Ringelblumen als Drogen (als Pflanze zur Verwendung als Arzneimittel)
kommen heute vielmals auch aus Ägypten, Ungarn und Polen.
Nun endlich zur Botanik der Pflanze „Ringelblume“:
Die Goldblume ist überwiegend einjährig, selten auch zweijährig. Der
Pflanzenstängel wird 60-70 cm hoch; er steht aufrecht, er ist verästelt
und filzig behaart. Er trägt wechselständig angeordnete fleischige
Blätter, die in den Stiel verlaufen. Die Blätter sind ebenfalls behaart;
sie sind breit-lanzettlich, ganzrandig und sitzend. Die leuchtend
gelben bis orange-gelben Blütenköpfe haben einen Durchmesser
von ca. 3-9 cm und sie stehen auf den Enden der Stängel. Die
zahlreichen Zungenblüten sind zuallermeist orange-gelb. Die Früchte
sind kahnförmig einwärts gekrümmt, die inneren sogar eingerollt und
haben einen kurz-stacheligen und quergestreiften Rücken.
Die Ringelblumen-Wurzeln sind spindelförmig, fast faserig verzweigt.
Hinweis:
Die Ringelblume gilt als „Regenanzeiger“: Ist sie morgens nach 7 Uhr
noch geschlossen, kommt noch am gleichen Tag Regen!
Geruch und Geschmack:
Charakteristisch, aromatisch und eigenartig süßlich-würzig, stark
duftend.
Blütezeit:
Von Juni bis Ende Oktober.
Standorte/Vorkommen:
Die ursprünglich aus Südeuropa stammende Pflanze ist bei uns
heimisch geworden. Sie gedeiht allerdings nur in geschützten Gärten
– abgesehen von Ringelblumen-Kulturen –.
Seit dem 12. Jahrhundert wird sie bei uns viel als Zier- und auch als
Heilpflanze angepflanzt; auch heute ist sie noch oft in sogen.
‚Bauerngärten‘ anzutreffen.
Wenngleich die Ringelblume besonders prächtig in guter Gartenerde
gedeiht, so findet sie sich aber auch mit mehr oder minder dürftigen
Böden ab.
Sie ist leicht zu kultivieren – und entfaltet sich sogar im Blumentopf.
An dieser Stelle wird es nun Zeit, über die Gewinnung (das Ernten) der
„heilkräftigen Pflanzenteile“ zur Drogengewinnung zu sprechen:
Die voll entfalteten Blütenköpfchen der Ringelblumen werden in den
Monaten Juni bis August ohne Stiel abgeschnitten; sie werden
hierzulande nur bei ‚strahlendem Sonnenschein-Wetter‘ – es sollte
schon einige Tage bereits Schönwetter geherrscht haben – ‚geerntet‘. Die
Blütenköpfe werden dann bei Temperaturen bis 35°C an schattigen,
gut belüfteten Plätzen getrocknet – in Ringelblumen-Kulturen erfolgt die
Trocknung in speziellen Trockenöfen –.
In der Volksheilkunde werden außer den Blüten/Blütenköpfen, Flores
calendulae, auch noch die Blätter, Folia calendulae, gesammelt.
Nach der Trocknung werden die gelben Randblüten abgezupft; sie
werden nun vorsichtig nachgetrocknet – die Nachtrocknung sollte rasch
erfolgen, es sollte keine künstliche Wärme verwendet werden –.
In der Volksmedizin werden die ganzen Blüten getrocknet und zur
Gänze verwendet, desgleichen die Blätter.
Zuvor soll aber noch ein kurzes Wort verloren werden – insbesondere,
auch weil ich immer wieder dazu und darüber gefragt wurde – über evtl.
bestehende „Verwechslungsmöglichkeiten der Ringelblume“ mit
anderen Pflanzen.
Ja, eine Verwechslungsmöglichkeit gibt es und zwar mit der unter
Naturschutz stehenden „Acker-Ringelblume“ (s. nächstes Kapitel:
„Zwischenspiel“).
Auch öfters gefragt:
Sind Ringelblumen giftig?
Da kann ich beruhigen. Ringelblumen sind absolut nicht-giftig!
Sie zählen zu den „ungiftigen, kinderfreundlichen Pflanzen in Garten
& Natur!“
Dazu zählen weitere Pflanzen im Garten wie u.a. Begonien, Dahlien,
Gänseblümchen, Herbstaster, Holunder, Petunien, Sonnenblumen,
Kapuzinerkresse, Kornblumen, Löwenzahn, Magnolien, Tränendes
Herz, Vergissmeinnicht.
Toxikologische Untersuchungen haben ergeben:
Ringelblumen und somit auch die Ringelblumen-Zubereitungen sind
bei fachgemäßer Dosierung nicht toxisch und weitgehend frei von
Nebenwirkungen wie Hautreizung und allergische Reaktionen.
Mit dem Ames-Test konnte keine mutagene Wirkung ( Mutagene sind
biologische, chemische oder physikalische Einflussfaktoren, die Veränderungen
des Erbguts [Mutationen, Chromosomenaberrationen] hervorrufen) festgestellt
werden.
Was die Inhaltsstoffe angeht, so besprechen wir dies an späterer
Stelle.
Abschließen will ich die Beschreibung der Botanik über die
Ringelblume mit einem Zitat aus dem „Botanischen Bilderbuch für
Jung und Alt“ aus dem Jahre 1897 von Franz Bleu:
„Der Ringelblume Knospe schließt die goldnen Äuglein auf; mit
allem, was da reizend ist, du süße Maid, steh auf!" singt der große
Dichter, der aller Geheimnisse des menschlichen Herzens wie der
Natur in gleichem Maße kundig war, und der sich sagte, dass junge
Damen zwischen 9 und 10 Uhr morgens eigentlich schon auf den
Beinen sein sollten. Denn erst um diese Zeit erwacht, wenigstens
gegen Ende des Sommers, die Ringelblume, und gegen 5 Uhr
nachmittags schließt sie das Blütenköpfchen schon wieder, und zwar
durch Aufrichten der randständigen Zungenblüten, die in dieser
Stellung das Mittelfeld mit den Röhrenblüten dachförmig decken.“
Ringelblume:
Zwischenspiel
Damit es nur ja nicht zu Verwechslungen beim Blüten- & Pflanzen-
Sammeln kommt, kommen kann, ein kleiner Seitenschwenk zur
Acker-Ringelblume
(Calendula arvensis L.).
Sie hat mit der Ringelblume (Calendula officinalis L.) einen gemeinsamen
Pflanzen-Stammbaum. Die Gemeinsamkeit reicht bis zur Pflanzen-
Gattung der Calendulae.
Dann aber trennen sich die Entwicklungswege.
Die Acker-Ringelblume ist eine eigenständige Art – ebenso wie es die
Ringelblume ihrerseits auch ist –.
Die Acker-Ringelblume wächst als einjährige krautige Pflanze und
erreicht Wuchshöhen von 5-30 Zentimetern. Die niederliegenden
oder bogig aufsteigenden, verzweigten Stängel sind bis zu den
Blütenkörben beblättert. Die unteren Laubblätter sind spatel-förmig,
kurz gestielt, ganzrandig oder entfernt stumpf gezähnt, die oberen
sind lanzettlich mit seicht herzförmigem, Stängel-umfassendem
Grund.
Die Körbchen weisen einen Durchmesser von meist 1-2 (selten bis zu
3,5) Zentimetern auf. Die weit glockige Hülle besteht aus grünen
Hüllblättern, die an der Spitze oft rötlich überlaufen und weißhäutig
berandet sind. Die Blüten sind meist zitronen-gelb, seltener gold-
gelb. Die Zungenblüten sind 7 bis 12 mm lang und meist weniger als
doppelt so lang wie die Hüllblätter. Die stark gekrümmten, am
Rücken dornigen Schließfrüchte sind innerhalb eines Korbes meist
von dreierlei Gestalt. Die äußeren, Hakenfrüchte genannten, enden
in einem zweischneidigen Schnabel und sind ungeflügelt und doppelt
so lang wie die Hülle, die mittleren, Kahnfrüchte genannten, sind
schwach kahnförmig, die inneren, Larvenfrüchte genannten, sind
ringförmig eingerollt und am Rücken quer gerieft.
Die Acker-Ringelblume blüht in Mitteleuropa zwischen April und
Oktober, im Mittelmeerraum meist von November bis Mai, selten
auch ganzjährig.
Vorkommen:
Die
Acker-Ringelblume
hat
ihr
Hauptverbreitungsgebiet
im
Mittelmeer-Gebiet einschließlich der Kanarischen Inseln und Madeira
und kommt dort weit verbreitet und häufig in allen floristischen
Territorien vor.
In Deutschland kommt die Acker-Ringelblume als Archäophyt (d.s.
hemerochore = veredelte/kultivierte Pflanzenarten, die vor 1492, als Christoph
Kolumbus Amerika erreichte, aber noch in im weiteren Sinne historischer Zeit,
durch direkten oder indirekten menschlichen Einfluss in ein neues Gebiet
eingeführt wurden und sich dort selbständig ohne fremde Hilfe fortgepflanzt
(etabliert) haben. Im Gegensatz dazu bezeichnet man Pflanzen, die nach 1492
eingeführt wurden, als Neophyten. Archäophyten gelten zwar nicht als einheimisch
(indigen), werden aber insbesondere im Naturschutz im Gegensatz zu Neophyten
als heimisch betrachtet) in Weinbaugebieten vor und tritt darüber hinaus
gelegentlich unbeständig auf.
Sie gilt in Mitteleuropa als Wärme-liebende Art und wächst in
Weinbergen, in Hackfrucht-Äckern, an Ackerrändern und Ruderal-
Flächen (d.i. eine zumeist brachliegende Rohbodenfläche) auf Nährstoff-
reichen, lockeren, kalkhaltigen, lehmigen Böden.
Sie gilt bundesweit als stark gefährdet, kommt aber regelmäßig nur
noch in Baden-Württemberg vor; in Nordrhein-Westfalen, in
Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen finden sich nur
noch geringe Bestände; vom Aussterben bedroht ist sie in
Rheinland-Pfalz; in Bayern ist sie vom Aussterben stark gefährdet
und sowohl in Sachsen – wohl auch in Sachsen-Anhalt und
Thüringen – und im Saarland gilt die Acker-Ringelblume sogar als
ausgestorben.
Die Acker-Ringelblume ist in Südafrika, Argentinien, Chile und
Uruguay, in Kalifornien selten, in Neuseeland lokal eingebürgert.
Das sollte genügen, um einer Verwechslungsgefahr vorzubeugen.
Nach der Botanik zu den Inhaltsstoffen in der Ringelblume.
Ringelblume: „Inhalts-
Stoffe“
Richtiger muss es heißen „Heil- und Inhalts-Stoffe“.
Die pflanzliche Droge ( ) „Calendula officinalis L.“ enthält in ihren
heilkräftigen Pflanzenteilen zahlreiche wichtige Inhaltsstoffe, die für
die Gesundheit und auch das Wohlbefinden bedeutend sind.
Festzuhalten ist, dass in der wissenschaftlichen Medizin arzneilich
verwendet nur die Ringelblumen-Blüten verwendet werden; in der
naturheilkundlichen Medizin hingegen zusätzlich gelegentlich auch
das Kraut, sprich die Blätter
Die wichtigsten Inhalts- & Wirkstoffe sind:
- ätherisches Öl ( ) [in den Zungenblüten + Blütenständen]
[es enthält zahlreiche Inhaltsstoffe, s.u.]
- Flavonoide ( )
- Triterpene ( ) bzw. Triterpen-Alkohole
- Sesquiterpene ( )
- Saponine ( ) und Saponiside
- Pflanzenschleim ( ) und sonstige Schleimstoffe ( )
- wasserlösliche Zuckerstoffe ( ) z.B. Polysaccharide
- Vitamine ( )
- Bitterstoffe ( )
- Glycoside ( )
- Sekundäre Pflanzenstoffe (SPS) ( )
- Pflanzen-Gummi ( )
- Harze ( )
- Antioxidantien ( )
- Mineralstoffe und Spurenelemente ( )
- Phenolische Säuren ( )
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren ( )
- Tannine ( )
- Phenolcarbonsäuren ( )
- Enzyme ( )
- Cumarine ( )
- Paraffin-Kohlenwasserstoffe ( )
- Albumin ( )
- Fruchtsäuren ( )
- weitere und sonstige Wirkstoffe
Nach aktuellen Untersuchungen enthält die Ringelblume außerdem
an weiteren wichtigen Inhalts- & Wirkstoffen:
- Salicylsäure
- Violaxanthin
Ich denke, nein, ich bin sicher:
Eine ganz schön lange Liste an Wirkstoffen in dieser Heilpflanze!
Jetzt etwas detailliertes, sprich: genauer.
01. Fruchtsäuren
In den Ringelblumen-Blütenköpfchen ist die Äpfelsäure enthalten. Sie ist
ein Zwischenprodukt im „Energie-Stoffwechsel“, dem „Zitronensäure-
Zyklus“. Äpfelsäure unterstützt die Wirkung der Antioxidantien ( ).
Die Fruchtsäuren in Pflanzen spielen eine bedeutende Rolle bei
Krankheiten der Nieren und Blase. Sie verhindern die Entstehung von
Nieren- und Blasensteinen und regulieren die Verdauung auf die natürliche
Weise. Die in den Früchten enthaltenen Enzyme (s.u.) & die Fruchtsäuren
(s.o.) bilden eine Schutzwirkung.
02. Salicylsäure
Salicylsäure (chem. Bezeichnung: 2.Hydroxy-Benzoesäure) gehört zur Klasse
der nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) und wirkt bei innerer
Anwendung analgetisch, antiphlogistisch und antipyretisch. [Anmerkung: bei
pflanzlicher Herkunft als Phytotherapeutikum und als Homöopathikum sind diese
Nebenwirkungen nur selten zu verzeichnen; vielmals treten sie überhaupt nicht
auf!]. In der Dermatologie wird Salicylsäure hingegen noch sehr häufig
eingesetzt. Bei externer Anwendung wirkt sie bakterizid und keratolytisch.
In niedrigen Konzentration (< 2%) wird die Substanz in Kosmetikprodukten
gegen Akne eingesetzt. In höheren Konzentrationen (> 5%) nutzt man die
keratolytische Wirkung zur Komedolyse bei Akne und zur Therapie von
Warzen (Verruca vulgaris). Die Auflösung der Hornschicht erfolgt über eine
Zerstörung der interzellulären Kohäsion im Stratum corneum. Durch die
lokale Reizung wird darüber hinaus wahrscheinlich eine Immunantwort