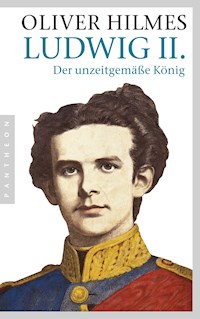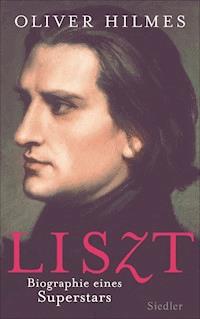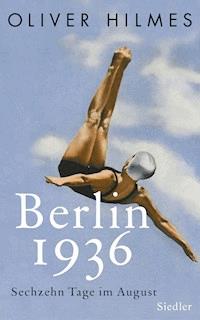
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Diktatur im Pausenmodus: Stadt und Spiele im Sommer 1936
Im Sommer 1936 steht Berlin ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Zehntausende strömen in die deutsche Hauptstadt, die die Nationalsozialisten in diesen sechzehn Tagen als weltoffene Metropole präsentieren wollen. Oliver Hilmes folgt prominenten und völlig unbekannten Personen, Deutschen und ausländischen Gästen durch die fiebrig-flirrende Zeit der Sommerspiele und verknüpft die Ereignisse dieser Tage kunstvoll zum Panorama einer Diktatur im Pausenmodus.
Die »Juden verboten«-Schilder sind plötzlich verschwunden, statt des »Horst-Wessel-Lieds« klingen Swing-Töne durch die Straßen. Berlin scheint für kurze Zeit eine ganz normale europäische Großstadt zu sein, doch im Hintergrund arbeitet das NS-Regime weiter daran, die Unterdrückung zu perfektionieren und das Land in den Krieg zu treiben.
In »Berlin 1936« erzählt Oliver Hilmes präzise, atmosphärisch dicht und mitreißend von Sportlern und Künstlern, Diplomaten und NS-Größen, Transvestiten und Prostituierten, Restaurantbesitzern und Nachtschwärmern, Berlinern und Touristen. Es sind Geschichten, die faszinieren und verstören, überraschen und bewegen. Es sind die Geschichten von Opfern und Tätern, Mitläufern und Zuschauern. Es ist die Geschichte eines einzigartigen Sommers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Im Sommer 1936 fiebert Berlin den Olympischen Spielen entgegen. Die Stadt wirkt plötzlich wieder wie eine weltoffene und pulsierende Metropole. Die »Juden verboten«-Schilder sind verschwunden, statt des »Horst-Wessel-Lieds« klingen Swing-Töne durch die Straßen. Die Nationalsozialisten inszenieren sich als friedliebende Gastgeber, zugleich arbeitet das Regime daran, die Unterdrückung zu perfektionieren und das Land in den Krieg zu treiben.
Ein Sommer der Widersprüche: Im Olympiastadion jubeln die Massen, und vor der Stadt entsteht das KZ Sachsenhausen. Die ausländischen Gäste werden vom Regime hofiert, die Berlinerinnen und Berliner erleben unerwartete Momente der Freiheit. In seinem Buch begleitet Oliver Hilmes prominente und unbekannte Personen, Sportler und Künstler, Restaurantbesitzer, Transvestiten und NS-Größen durch die sechzehn Tage der Sommerspiele und verknüpft die Ereignisse kunstvoll zum Porträt einer Stadt und ihrer Bewohner, die in diesen Tagen wild entschlossen sind, das Leben noch einmal voll auszukosten.
Zum Autor
Oliver Hilmes, geboren 1971, studierte Geschichte, Politik und Psychologie in Marburg, Paris und Potsdam. Er wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet seit 2002 für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen »Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel« (2004) und »Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima Wagner« (2007) wurden zu Bestsellern. Zuletzt erschienen von ihm »Liszt. Biographie eines Superstars« (2011) und »Ludwig II. Der unzeitgemäße König« (2013).
OLIVER HILMES
Berlin 1936
Sechzehn Tage im August
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 Siedler Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlag: Rothfos + Gabler, Hamburg Umschlagmotiv: Ullstein Bild/histopicsSatz: Ditta Ahmadi, BerlinISBN 978-3-641-15686-2V004www.siedler-verlag.de
Für meine Familie
INHALT
Samstag, 1. August 1936
Sonntag, 2. August 1936
Montag, 3. August 1936
Dienstag, 4. August 1936
Mittwoch, 5. August 1936
Donnerstag, 6. August 1936
Freitag, 7. August 1936
Samstag, 8. August 1936
Sonntag, 9. August 1936
Montag, 10. August 1936
Dienstag, 11. August 1936
Mittwoch, 12. August 1936
Donnerstag, 13. August 1936
Freitag, 14. August 1936
Samstag, 15. August 1936
Sonntag, 16. August 1936
Was wurde aus …?
Dank
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Berlin im Sommer 1936. Hunderttausende Schaulustige säumen täglich die Straßen und erwarten die Vorbeifahrt Adolf Hitlers.
© Emanuel Hübner, Münster
SAMSTAG, 1. AUGUST 1936
BERICHT DES REICHSWETTERDIENSTES FÜR BERLIN
Stark wolkig und zeitweise bedeckt mit Regenfällen.
Mäßige Südwest- bis Westwinde. Etwas kühler. 19 Grad.
In der Suite von Henri de Baillet-Latour klingelt leise das Telefon. »Exzellenz, es ist sieben Uhr dreißig«, meldet sich der Portier. »Bon«, antwortet der Graf, »ich bin schon wach.« Die Mitarbeiter des Hotel Adlon, wo Baillet-Latour residiert, behandeln ihren Gast mit vorzüglicher Hochachtung, denn Henri de Baillet-Latour ist so etwas wie ein Regierungschef. Allerdings beherrscht er kein Land, er steht keiner Republik vor und ist nicht der Regent einer Monarchie. Henri Comte de Baillet-Latour ist der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Wenn heute pünktlich um 17.14 Uhr im Berliner Olympiastadion die Olympische Flagge gehisst werden wird, übernimmt der sechzigjährige Belgier für sechzehn Tage gewissermaßen die Lufthoheit über die Berliner Sportstätten.
Bis dahin hat Baillet-Latour ein straffes Programm zu absolvieren: Er wird mit seinen Kollegen des Olympischen Komitees einen Gottesdienst besuchen, eine Ehrenformation der Wehrmacht abschreiten und schließlich in der Neuen Wache, dem Ehrenmal für die Gefallenen des Weltkriegs, einen Kranz niederlegen. Im Anschluss an die militärische Zeremonie wird Hermann Göring in seiner Funktion als Preußischer Ministerpräsident die Mitglieder des IOC willkommen heißen.
Mittlerweile ist es 8 Uhr, und auf dem Pariser Platz vor dem Hotel Adlon erklingt Marschmusik, die mehrfach von Weckrufen sowie dem Lied »Freut euch des Lebens« unterbrochen wird. Das »Große Wecken«, wie das Ritual heißt, ist eine der vielen Ehrerbietungen, die die Nationalsozialisten dem IOC entgegenbringen. Während Henri de Baillet-Latour am Fenster seiner Suite steht und das Treiben beobachtet, kann er sich wie ein Staatsoberhaupt fühlen, mit dem Adlon als Regierungssitz. Das IOC residiert in bester Nachbarschaft: Dem Hotel gegenüber liegt die französische Botschaft, zur linken Seite erstrahlt das Brandenburger Tor, und direkt neben Berlins berühmtestem Wahrzeichen befindet sich das Palais Blücher, das den Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Eigentlich sollte das weitläufige Gebäude die amerikanische Botschaft beherbergen, doch der Komplex ist 1931 ausgebrannt, und der Wiederaufbau zieht sich hin. Das Adlon wiederum grenzt zum Pariser Platz an die altehrwürdige Akademie der Künste und zur Wilhelmstraße an das Palais Strousberg, wo die englische Botschaft ansässig ist.
Henri de Baillet-Latour hat zwischenzeitlich das Frühstück beendet und macht sich bereit, das Adlon zu verlassen. Zur Feier des heutigen Tages kleidet sich der Comte besonders festlich und trägt graue Hosen, einen dunklen Cutaway, Schuhe mit Gamaschen, Zylinder sowie eine prächtige Amtskette. Als Joseph Goebbels ihn so sieht, schüttelt er innerlich den Kopf. In sein Tagebuch notiert er: »Die Olympianer sehen aus wie Direktoren von Flohzirkussen.«
Mit Pauline Strauss ist nicht gut Kirschen essen. Frau Pauline ist die Gattin des berühmten Komponisten Richard Strauss und bringt es fertig, wildfremden Menschen die schlimmsten Dinge ins Gesicht zu sagen. Doch auch Freunde und Bekannte sind vor ihrer legendären Taktlosigkeit nicht sicher. »Frau Strauss, die beim Tee noch, gegen ihre Gewohnheit, ganz liebenswürdig gewesen war, hatte jetzt wieder einen ihrer halbhysterischen Unartigkeits-Anfälle«, erinnert sich Harry Graf Kessler an eine Begegnung in einem Berliner Nobelrestaurant. Die Tische sind mit teurem Porzellan, edlem Silberbesteck und geschliffenen Gläsern bestückt, livrierte Kellner bewegen sich nahezu lautlos durch den Raum, und die Gäste unterhalten sich in gedecktem Ton. Nicht so Pauline Strauss. Als Kessler eine offensichtlich nicht sonderlich interessante Anekdote über einen berühmten Pariser Gastronom erzählt, fährt Frau Strauss lärmend dazwischen: »Der ist ja längst tot, längst tot, bis Sie die Geschichte zu End’ haben! Na ja, wenn Einer eine so fade Geschicht’ so langsam erzählt! Seht Euch lieber das Mastschwein da an …« Die Gäste sehen sie erstaunt an. »Na ja, das Mastschwein, den dicken Offizier da am Tisch«, erklärt Frau Strauss und zeigt mit dem Finger auf einen ziemlich korpulenten Leutnant an einem Nebentisch. »Na was denn? Ich will doch nur ein bisschen mit dem Mastschwein da kokettieren«, wiederholt sie und fixiert den Leutnant dabei unablässig, bis sie triumphierend ausruft: »Nun seht doch, jetzt wirft mir das Mastschwein ganz verliebte Blicke zu. I glaub wirklich, er kommt und setzt sich an unseren Tisch.« In der Runde herrscht Entsetzen, der ebenfalls anwesende Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal starrt verstört auf seinen Teller, und Richard Strauss wird abwechselnd weiß und rot. Doch Strauss schweigt zu dem skandalösen Auftritt seiner Gattin, wohl um noch Schlimmeres zu verhindern. Sie soll ihm einmal, als er ihr bei einer ähnlichen Szene Vorwürfe machte, vor allen Anwesenden laut zugerufen haben: »Noch ein Wort, Richard, und ich geh’ auf die Friedrichstrass’ und nehm mir den Ersten Besten.«
Kein Wunder, dass Pauline Strauss der Schrecken aller Hotelportiere, Kellner und Zimmermädchen ist. Gestern Vormittag sind die Eheleute Strauss in Begleitung ihrer Haushälterin Anna im Hotel Bristol eingetroffen. Das Bristol befindet sich nur einen Steinwurf vom berühmten Hotel Adlon entfernt auf Berlins Prachtboulevard Unter den Linden. Selbstverständlich bietet das Haus sämtliche modernen Annehmlichkeiten. So sind die geräumigen Zimmer und Suiten mit edlem Mobiliar eingerichtet und verfügen über eigene Badezimmer. Darüber hinaus besitzt das Hotel besonders schöne Gesellschaftsräume: Das Schreib- und Lesezimmer etwa ist im gotischen Stil gehalten, während der Teesalon mit schweren englischen Ledermöbeln ausgestattet ist.
Richard Strauss hat kaum Gelegenheit, den Komfort seiner Herberge zu genießen. Gestern war er mit Proben beschäftigt, heute Nachmittag steht die Uraufführung einer neuen Komposition auf dem Programm, und morgen Vormittag wird er Berlin schon wieder in Richtung Bayern verlassen. Als einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart ist Richard Strauss ohnehin eine vielbeschäftigte Person: Im März absolvierte er eine Konzerttournee durch Italien und Frankreich, die ihn bis nach Marseille führte, im April dirigierte er in Paris und Köln und im Juni in Zürich sowie erneut in Köln. Darüber hinaus findet der zweiundsiebzigjährige Strauss auch immer wieder Zeit, neue Werke zu schreiben. Das Stück, das in wenigen Stunden uraufgeführt werden wird, heißt Olympische Hymne und ist eine Auftragskomposition des Olympischen Komitees für die heutige Eröffnungsfeier der Spiele. Strauss behauptet von sich, alles in Töne setzen zu können. »Was ein richtiger Musiker sein will«, spottet er einmal, »der muss auch eine Speisenkarte vertonen können.« Komponieren ist für Strauss immer auch eine Frage des Fleißes und der Disziplin. Mit stoischer Ruhe sitzt er an seinem Schreibtisch und entwirft Werk um Werk. Theodor W. Adorno wird Jahre später das bitterböse Wort von der Komponiermaschine prägen: Strauss habe die Moderne verraten und sich dem breiten Publikum angebiedert – er sei ein Meister der Oberfläche, der komponiere, was sich für bare Münze verkaufen lässt.
Die Olympische Hymne für Chor und großes Sinfonieorchester gehört offensichtlich in die Kategorie Fleißarbeit, denn Strauss interessiert sich mitnichten für Sport. Skifahren sei eine Tätigkeit für norwegische Landbriefträger, lautet sein Urteil. Als er im Februar 1933 erfährt, dass sein Wohnort Garmisch zur Finanzierung der Olympischen Winterspiele eine Sonderabgabe plant, protestiert Strauss energisch. An den Gemeinderat schreibt er: »In der Annahme, dass die neue Bürgersteuer zur Deckung der Unkosten des Sportunfugs und der vollständig unnötigen Olympiapropaganda dient, erhebe ich dagegen Einspruch, ersuche, da ich keinerlei Sportanlage: Bobbahn, Skisprunghügel etc. benütze, auch auf die Triumphbögen am Bahnhof gerne verzichte, mich von der Steuer zu befreien und diejenigen damit zu belasten, die ein Interesse an Olympiaden und derartigen Schwindel haben. Mein Portemonnaie ist genügend belastet durch Staatssteuern für Faulenzerunterstützungen, soziale Fürsorge genannt und durch den in Garmisch besonders grassierenden Hausbettel.«
Dieser Protest hält Richard Strauss aber nicht davon ab, für die Komposition einer Hymne, mit der dieser »Sportunfug« gefeiert werden soll, ein Honorar von zehntausend Reichsmark zu verlangen – der Scheck heiligt die Mittel. Doch diese erhebliche Summe übersteigt bei weitem das Budget des Olympischen Komitees, sodass Strauss nach längeren Verhandlungen auf eine Vergütung ganz verzichtet. Es verwundert also kaum, dass er dieser Arbeit mit wenig Begeisterung nachgeht. »Ich vertreibe mir in der Adventslangeweile die Zeit damit, eine Olympiahymne für die Proleten zu componieren«, schreibt er im Dezember 1934 an Stefan Zweig, »ich der ausgesprochene Feind und Verächter des Sports. Ja: Müßiggang ist aller Laster Anfang.«
Die Textvorlage wurde mittels eines Preisausschreibens erkoren und stammt von dem arbeitslosen Schauspieler und Gelegenheitsdichter Robert Lubahn. Als Joseph Goebbels moniert, dass Lubahns Gedicht zu wenig dem Geist des »Dritten Reiches« entspräche, werden einige Textstellen verändert. Aus Lubahns Zeile »Friede soll der Kampfspruch sein« wird »Ehre soll der Kampfspruch sein«. Die Formulierung »Rechtsgewalt das Höchste sein« wird kurzerhand zu »Eidestreu das Höchste sein« verändert. Robert Lubahn muss sich wohl oder übel fügen, das Olympische Komitee als Auftraggeber der Hymne legt keinen Widerspruch ein – und Richard Strauss ist es vermutlich egal.
Unmittelbar nach der Fertigstellung des etwa vierminütigen Werkes im Dezember 1934 wendet sich Strauss an Hans Heinrich Lammers, den Leiter der Reichskanzlei, und bittet darum, Hitler die Hymne vorspielen zu dürfen, »denn ihm, dem Führer und Protektor der Olympiade soll sie doch in erster Linie gefallen«. Nach längerem Hin und Her – Hitlers Interesse an einem Treffen ist nicht so groß wie das von Strauss – verständigt man sich schließlich auf einen Termin Ende März 1935. Im Anschluss an das Privatkonzert, das in Hitlers Wohnung stattfindet, schenkt Strauss seinem »Führer« ein signiertes Autograph der Hymne, das dieser mit großem Dank annimmt.
Für Richard Strauss’ Anbiederung an das Regime gibt es ganz diesseitige Gründe. Seine neue Oper Die schweigsame Frau soll im Juni 1935 in Dresden uraufgeführt werden. Propagandaminister Joseph Goebbels ist gegen das Werk, denn das Libretto stammt von Stefan Zweig, der als Jude im »Dritten Reich« persona non grata ist. Doch Hitler erteilt der Oper eine Sondergenehmigung, für die Strauss sich offensichtlich mit der Olympischen Hymne bedanken will. Das Engagement des weltberühmten Komponisten für Nazideutschland gerät allerdings kurze Zeit später in eine schwere Krise, als die Gestapo einen Brief von Strauss an Stefan Zweig abfängt, worin er sich über seine Tätigkeit als Präsident der Reichsmusikkammer lustig macht. Mitte Juli 1935 muss Strauss von diesem Amt zurücktreten, und die Schweigsame Frau wird nach zwei weiteren Aufführungen abgesetzt. Für einen nicht so prominenten Künstler hätte dieser Zwischenfall leicht das Aus bedeuten können. Doch Richard Strauss ist zu bedeutend, als dass die Nationalsozialsten auf Dauer auf ihn verzichten wollten. Ein Jahr später – im Sommer 1936 – ist die Affäre vergessen, und Strauss darf seine Olympische Hymne persönlich aus der Taufe heben. Während die Eheleute Strauss gerade im sogenannten Terrassensaal des Bristol beim Frühstück sitzen und Pauline wie üblich die Bedienung kujoniert, denkt Richard daran, wie es wohl sein wird, heute Nachmittag vor mehr als hunderttausend Proleten zu dirigieren.
Wo sind wir eigentlich?«, fragt Max von Hoyos seinen Nachbarn Hannes Trautloft. Max ist soeben aufgewacht und hat keine Ahnung, wie lange er geschlafen hat. Er gähnt, reibt sich die Augen und reckt die Arme in die Höhe. »Noch immer auf der Elbe«, antwortet Hannes. Max scheint nicht sonderlich erstaunt zu sein. »Hab ich einen Hunger!«, ruft er und schwingt sich aus seiner Koje. Die beiden jungen Männer teilen sich eine Kabine auf dem Dampfer Usaramo und befinden sich auf dem Weg von Hamburg nach Spanien. Mit über achtzig weiteren Personen gehören sie zu einer Gruppe, die sich »Reisegesellschaft Union« nennt. Dieser Verein besteht nur aus Männern, die sich sonderbar verhalten und von den anderen Passagieren separieren. Spricht man sie auf den Zweck ihrer Reise an, erhält man keine Antwort. Die Herren scheinen keine wohlhabenden Kreuzfahrt-Touristen zu sein, denn dafür bewegen sie sich nicht elegant genug. Man könnte sie fast für Soldaten halten, dagegen spricht allerdings, dass sie in Zivil gekleidet sind. Auffällig ist auch, dass sie mit viel Gepäck reisen. Was in den zahlreichen großen Kisten sei, die in Hamburg an Bord gingen? Auch jetzt hüllt man sich in Schweigen. So viel steht fest: Mit der »Reisegesellschaft Union« stimmt etwas nicht.
Im Berliner Lustgarten beginnt um 12 Uhr eine Kundgebung der Hitlerjugend, bei der knapp neunundzwanzigtausend Jungen und Mädchen in Reih und Glied strammstehen. Vom Dach des Stadtschlosses hat man einen freien Blick auf das weitläufige Areal zwischen dem Alten Museum, dem Berliner Dom und dem Schloss. Einzelne Personen sind in der Menge nicht mehr auszumachen, was man sieht, ist die Masse Mensch. Wie so vieles in diesen Tagen ist auch dieser Aufmarsch eine machtvolle Demonstration, die sich an die Gäste aus dem Ausland richtet. Adolf Hitler kann sich auf seine Jugend verlassen, lautet die Botschaft, die man getrost auch als Warnung verstehen darf.
Wie bei einem geölten Räderwerk greifen die verschiedenen Programmpunkte nun ineinander. Die Begrüßung des Internationalen Olympischen Komitees wird pünktlich beendet, woraufhin die Ehrengäste nur wenige Meter vom Kuppelsaal des Alten Museums vor das Gebäude gehen müssen. Auf der Freitreppe, die vom Museum in den Lustgarten führt, ist eine Rednerbühne errichtet worden, von der nun nacheinander Reichsjugendführer Baldur von Schirach, Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, Reichserziehungsminister Bernhard Rust und zuletzt Joseph Goebbels zur Hitlerjugend sprechen. »Imposantes Schauspiel«, notiert der Propagandaminister in sein Tagebuch. »Was kann man da schon Rares sagen? Dann kommt die Flamme von Olympia. Ein ergreifender Augenblick. Es regnet leicht.«
Der olympische Fackellauf, der im Lustgarten ein vorläufiges Ende findet, ist nicht, wie man denken könnte, eine Tradition aus dem alten Griechenland, sondern die Erfindung eines Sportfunktionärs aus Würzburg. Der vierundfünfzigjährige Carl Diem ist als Generalsekretär des Organisationskomitees eine der zentralen Figuren der Olympischen Spiele in Berlin. Die gut dreitausend Kilometer lange Laufstrecke von Olympia über Athen, Delphi, Saloniki, Sofia, Belgrad, Budapest, Wien, Prag und Dresden nach Berlin schlage eine Brücke vom Altertum zur Neuzeit, behauptet der findige Diem. Dass bei den Olympischen Spielen der Antike gar keine Fackelläufe durchgeführt worden sind, tut für Diem nichts zur Sache, geht es ihm doch darum, den Berliner Spielen einen möglichst weihevollen Charakter zu verleihen. Joseph Goebbels, dessen Propagandaministerium für die Ausgestaltung der Jugendkundgebung am Lustgarten verantwortlich zeichnet, ist von der Idee sofort begeistert. Goebbels lässt den Fackelträger zunächst durch das Spalier der Hitlerjugend vor das Alte Museum laufen und dort einen Feueraltar entzünden. Anschließend läuft der junge Mann mit der Fackel vor das Stadtschloss, um dort auf dem »Fahnenaltar der Nationen« eine zweite Flamme zu entfachen.
Ein wahrer Fuhrpark von Limousinen steht nun bereit, um die Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees und die anderen Ehrengäste zum Reichskanzlerpalais in die Wilhelmstraße zu chauffieren. Dort ergreift Henri de Baillet-Latour das Wort, um sich bei Hitler für die deutsche Gastfreundschaft zu bedanken. Der Hausherr antwortet kurz und betont den völkerverbindenden Charakter der Spiele. Um 14 Uhr heißt es dann im Ablaufplan lapidar: »Imbiss«.
Zwischen 15 Uhr und 15.07 Uhr verlassen Hitlers Gäste die Reichskanzlei in Richtung Olympiastadion. Die Wagenkolonnen biegen von der Wilhelmstraße kommend in die »Via triumphalis« ein. So nennen die Organisatoren der Spiele die gut elf Kilometer lange Feststraße zwischen dem Lustgarten im Osten und dem Olympiastadion im Westen der Stadt. Im alten Rom diente die »Via triumphalis« dem feierlichen Einzug eines siegreichen Feldherrn, in Berlin gleitet Adolf Hitler auf ihr in einem offenen Mercedes zu den Spielen, die in einer Arena stattfinden, welche einem römischen Amphitheater nachempfunden ist. Panem et circenses.
Die gesamte Wegstrecke ist von überdimensionalen Hakenkreuz- und Olympiafahnen gesäumt und wird von vierzigtausend SA-Männern gesichert. Hinter dem Spalier stehen Hundertausende Schaulustige, die auf ein Ereignis warten, das im Ablaufplan für 15.18 Uhr vorgesehen ist: »Abfahrt des Führers zum Olympiastadion«.
Irgendwo in der Menge befindet sich auch ein fünfunddreißigjähriger Amerikaner namens Thomas Clayton Wolfe. Tom, wie der junge Mann von seinen Freunden genannt wird, stammt aus Asheville im Bundesstaat North Carolina und ist erst vor kurzem in Berlin eingetroffen. Mit einer Körpergröße von knapp zwei Metern und einem Gewicht von etwa hundertzwanzig Kilogramm ist Tom ein respektabler Hüne und wahrlich nicht zu übersehen. Man könnte ihn für einen Kugelstoßer halten, doch weit gefehlt. Tom ist Schriftsteller – ein ziemlich berühmter sogar –, dessen Erstlingswerk Look Homeward, Angel in einer deutschen Übersetzung 1932 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Ernst Rowohlt – Toms Verleger – war mit der Veröffentlichung von Schau heimwärts, Engel ein beachtlicher Coup gelungen: Die Kritiker äußerten sich enthusiastisch über den Autor aus der Neuen Welt, und innerhalb weniger Jahre gehen gut zehntausend Exemplare des Buches über die Ladentische.
Ende 1926 war Tom das erste Mal nach Deutschland gereist, hatte zwei Wochen in Stuttgart und München verbracht und ist seither nahezu jedes Jahr für einige Zeit zurückgekehrt. 1935 kam er erstmals auch nach Berlin, wo ihn ein Gefühl ergreift, wie er seinem Notizbuch anvertraut, »das ich in meinem Leben wohl nicht mehr oft haben werde. Es war die Gewissheit, zum ersten Mal eine der wirklich bedeutenden Metropolen dieser Welt zu betreten.« Die folgenden Wochen in der deutschen Reichshauptstadt erlebte Wolfe als einen einzigartigen Rausch: »Ein wilder, fantastischer, unglaublicher Wirbel von Partys, Teegesellschaften, Dinners, nächtlichen Saufgelagen, Zeitungsinterviews, Radioprojekten, Foto-Sitzungen und so weiter.« Es ist sprichwörtlich Liebe auf den ersten Blick, die Wolfe für Berlin empfindet. Dass Berlin aber auch das Epizentrum einer brutalen Dikatur ist, die politische Gegner verfolgt, einsperrt oder ermordet, scheint Tom nicht zu interessieren. Noch nicht. Einstweilen preist der Amerikaner die Deutschen als das »sauberste, freundlichste, warmherzigste und ehrlichste Volk, das ich in Europa kennengelernt habe«.
Als Wolfe die Stadt an der Spree Mitte Juni 1935 verlässt, ist er sich ganz sicher, bei nächster Gelegenheit zurückkehren zu wollen. Dieser Anlass bietet sich jetzt – im August 1936. In der Zwischenzeit ist nämlich Wolfes Roman Von Zeit und Strom bei Rowohlt erschienen, den es nun zu bewerben gilt. Dass zeitgleich die Olympischen Spiele in Berlin stattfinden, ist für den sportbegeisterten Amerikaner ein weiterer guter Grund, die Schiffspassage über den Atlantik anzutreten.
Tom wohnt – wie schon im vergangenen Jahr – im Hotel am Zoo, das zwar nicht zu den Häusern »allerersten Ranges« gehört, dafür aber andere Vorzüge aufweist. Das Hotel am Zoo ist gemütlich. Wolfe liebt es gemütlich, nicht etepetete, wie das Adlon, das Bristol oder das Eden. Ganz besonders schätzt er aber die Lage des Hotels auf dem Kurfürstendamm. Was soll er auch am Brandenburger Tor, wo das Adlon liegt? Der Kurfürstendamm, das ist Berlin. Tom empfindet es jedes Mal als magischen Moment, wenn er sein Hotel verlässt, nach links schaut und die goldene Turmuhr der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erblickt. Dann ergreift ihn dieser besondere Berlin-Zauber, dann spürt er, dass er dieser Stadt erlegen ist. Auf dem Kurfürstendamm reihen sich Cafés, Restaurants und Bars aneinander, mehr noch, Tom erlebt den Kurfürstendamm als ein einziges Kaffeehaus. »Unter den Bäumen des Kurfürstendamms flanierten die Leute, die Terrassen der Cafés waren dicht besetzt, und die Luft dieser goldfunkelnden Tage schien wie Musik zu schwingen.« Thomas Wolfe möchte keinesfalls irgendwo anders in Berlin leben. Nur hier.
Doch jetzt steht Tom wie so viele andere auf der »Via triumphalis« und wartet. »Langsam näherte sich der blitzende Wagen des Führers«, erinnert er sich, »kerzengerade, ohne eine Bewegung und ohne ein Lächeln stand er darin, ein kleiner, dunkler Mann mit einem Operettenbärtchen, den Arm mit der nach außen gekehrten Handfläche erhoben, nicht zum üblichen Nazigruß, sondern hoch aufgereckt mit der segnenden Gebärde eines Buddha oder eines Messias.«
Punkt 13 Uhr öffnen sich die Tore des Olympiastadions. Die rund hunderttausend Zuschauer aus aller Welt sind angehalten, bis spätestens 15.30 Uhr ihre Plätze einzunehmen. Der 246 Meter lange Zeppelin »Hindenburg«, eines der größten jemals gebauten Luftfahrzeuge, kreist derweil über dem Stadion, und unten in der Arena unterhält das Olympische Symphonie-Orchester mit einem Festkonzert. Auf dem Programm steht neben Franz Liszts Bravourstück Les Préludes das im »Dritten Reich« unvermeidliche Meistersinger-Vorspiel von Richard Wagner. Die große Uhr am Turm des Marathontors zeigt 15.53 Uhr an, als dort in luftiger Höhe positionierte Trompeten und Posaunen plötzlich Fanfaren anstimmen. Sieben Minuten später – pünktlich um 16 Uhr – betritt Adolf Hitler in Begleitung des Internationalen und Nationalen Olympischen Komitees das Stadion über die große Treppe am Marathontor. Die Fanfaren verklingen, und das Orchester intoniert nun Wagners Huldigungsmarsch. Dass der Marsch, den Wagner einst zu Ehren König Ludwigs II. schrieb, zu den schwächsten Werken des Komponisten zählt und von peinlicher Dürftigkeit ist, nehmen die Organisatoren stillschweigend in Kauf. In diesem Fall ist der Titel wichtiger als die Musik: Es geht um die Huldigung Adolf Hitlers, der soeben wie ein römischer Imperator durch das Stadion zu seiner Ehrenloge schreitet. Unterwegs muss der »Führer« kurz anhalten, da sich ihm Carl Diems fünfjährige Tochter Gudrun mit einem Blumenbouquet in den Weg stellt. »Heil, mein Führer« soll die Kleine gesagt haben. Der Herr Papa tut ebenso freudig-überrascht wie Hitler und will von dieser Einlage im Vorfeld nichts gewusst haben.
Als Hitler seine Loge betritt, wird die von den Nationalsozialisten eingeführte Doppelhymne gespielt, die aus der jeweils ersten Strophe des Deutschland- und des Horst-Wessel-Lieds besteht. An den Masten des Stadions fahren nun die Flaggen der an den Spielen beteiligten Nationen in die Höhe, und der Klang der Olympiaglocke weht über das Maifeld in das Stadion. Dann beginnt der Einmarsch der Mannschaften – Griechenland an erster, Deutschland an letzter Stelle. Während die Engländer vom Publikum vergleichsweise kühl begrüßt werden (Goebbels notiert in sein Tagebuch: »Etwas peinlich«), lösen die Franzosen wahre Beifallsstürme aus, weil sie mit erhobenem rechten Arm salutieren. Dabei handele es sich aber nicht um den »salut hitlérien«, erklären Vertreter der Grande Nation später, sondern um den olympischen Gruß, was allerdings kaum zu unterscheiden ist. Die Menschen im Stadion glauben jedenfalls, die Franzosen zeigten den »Hitlergruß«.
Zu Hitlers Rechten hat Henri de Baillet-Latour Platz genommen, zu seiner Linken sitzt ein älterer Herr, den Joseph Goebbels ebenfalls leicht für den Direktor eines Flohzirkus halten könnte: Theodor Lewald, Präsident des Organisationskomitees. Der fünfundsiebzigjährige Jurist und Sportfunktionär ist neben seinem Generalsekretär Carl Diem die treibende Kraft hinter den Spielen der XI. Olympiade. Ohne die Herren Lewald und Diem gäbe es die Berliner Spiele nicht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Exzellenz, wie Lewald respektvoll genannt wird, sich von den Nationalsozialisten benutzen lässt. Denn: Dr. Theodor Lewald ist nach den Vorstellungen der Nazis »Halbjude«. In der Inszenierung der Olympischen Spiele hat er sich nun selbst die Rolle eines »Alibijuden« zugewiesen: Er fungiert als Aushängeschild, um der Weltöffentlichkeit zu beweisen, dass das Regime keinerlei Einfluss auf die Spiele nehme. In Wahrheit sind Lewalds Tage bereits gezählt. Doch bis zu seinem erzwungenen Rücktritt, der längst beschlossene Sache ist, darf die Exzellenz weiterhin ihre Aufgaben erfüllen.
Um kurz nach 17 Uhr tritt Lewald an das Mikrofon und hält eine gut fünfzehnminütige Ansprache. Er wird sich gut überlegt haben, wie er seine Rede beginnt. Lewald könnte sie mit »Sehr geehrter Herr Reichskanzler« eröffnen, was protokollarisch korrekt wäre. Er könnte Henri de Baillet-Latour und die anderen wichtigen olympischen Würdenträger begrüßen, er könnte die anwesenden Botschafter willkommen heißen, kurzum: Er könnte den Einstieg in seinen Text so gestalten, wie es diplomatische Gepflogenheiten nahelegen. Doch Theodor Lewald entscheidet sich für eine wesentlich kürzere Anrede: »Mein Führer!« Mehr nicht.
Nach dieser Huldigung ergreift Hitler das Wort. Der Diktator wurde von Baillet-Latour im Vorfeld ermahnt, dass er die Spiele nur mit einem einzigen Satz zu eröffnen habe. Woraufhin Hitler geantwortet haben soll: »Herr Graf, ich werde mich bemühen, den Satz auswendig zu lernen.« Leichter gesagt als getan. Anstatt der offiziellen Version (»Ich verkünde die Eröffnung der Spiele von Berlin zur Feier der XI. Olympiade neuer Zeitrechnung«) benutzt Hitler eine Formulierung, die seine österreichische Herkunft grammatikalisch entlarvt: »Ich erkläre die Spiele von Berlin zur Feier der XI. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.« Es bleiben die einzigen Worte, die er in diesen Tagen in der Öffentlichkeit sprechen wird.
Die olympische Flagge wird nun gehisst, die Artillerie schießt Salut, und etwa zwanzigtausend Friedenstauben steigen in den Himmel über Berlin. Richard Strauss sitzt währenddessen auf einem Stuhl neben dem Orchester, schlägt die Beine übereinander und macht einen gelangweilten Eindruck. Irgendjemand flüstert ihm zu, dass es gleich losgeht. Strauss erhebt sich daraufhin, steigt auf sein Dirigentenpodest und gibt den auf dem Marathontor positionierten Bläsern um 17.16 Uhr ihren Einsatz. Ein kurzes Fanfarenmotiv hallt durch das Stadion, dann setzt das volle Orchester ein. Das Olympische Symphonie-Orchester besteht aus dem Berliner Philharmonischen Orchester und dem Landesorchester Berlin, der Chor wurde aus verschiedenen Ensembles zusammengewürfelt und zählt dreitausend Sängerinnen und Sänger. Joseph Goebbels ist von der Olympischen Hymne begeistert. »Sie ist wirklich wunderbar«, hatte er bereits nach einer Probe gejubelt. »Komponieren kann der Junge.« Aber auch Adolf Hitler ist mit Strauss zufrieden. Er wünsche den Komponisten im Anschluss kurz zu sehen, befielt er einem Adjutanten. Pauline Strauss vermerkt in ihrem Tagebuch daraufhin einen »Händedruck von Hitler«.
Den Zuschauern wird keine Pause gegönnt. Noch während Strauss von seinem Podest herabsteigt, trifft der Fackelläufer, der das olympische Feuer auf der letzten Strecke vom Lustgarten zum Stadion trägt, am Osttor der Arena ein, läuft über die Aschenbahn zum Westtor und entzündet dort die große Flammenschale. Voller Symbolkraft ist auch der nächste Programmpunkt. Spyridon Louis, der Sieger im Marathonlauf der Olympischen Spiele von 1896 in Athen, überreicht Hitler einen Ölzweig aus Olympia. Am Ende der Zeremonie erfolgt der olympische Eid. Stellvertretend für alle Sportler spricht der deutsche Gewichtheber Rudolf Ismayr die Eidesformel und greift dabei anstatt zur olympischen Flagge lieber zur Hakenkreuzfahne. Henri de Baillet-Latour ist entsetzt ob dieser Verletzung des olympischen Protokolls, doch was kann er in dieser Situation schon machen?
Damit ist die Eröffnungsfeier fast beendet. Bevor Adolf Hitler um 18.16 Uhr das Stadion verlässt, erklingt als letzter Programmpunkt das Halleluja aus Georg Friedrich Händels Oratorium Der Messias. Während der Chor die Worte »und er regiert auf immer und ewig, Herr der Herrn, der Welten Gott. Halleluja!« singt, tippt Józef Lipski, der polnische Botschafter in Berlin, Henri de Baillet-Latour vorsichtig auf die Schulter. »Wir müssen auf der Hut sein vor einem Volk, das so zu organisieren versteht«, flüstert Lipski dem Grafen zu. »Eine Mobilmachung in diesem Land wird genauso reibungslos funktionieren.«
Beunruhigendes hat auch der österreichische Gesandte in Berlin, Stephan Tauschitz, von der Eröffnungsfeier zu berichten. An den Staatssekretär des Äußeren in Wien schreibt er: »Wie mir ein in Berlin lebender ehemaliger österreichischer Offizier, der […] im Stadion mitten unter die Gäste aus Österreich zu sitzen kam, erzählt, habe er in Deutschland selten so fanatisierte Leute gesehen, wie er dies unter den Österreichern beobachten konnte, denn die ›Heil Hitler!‹, ›Sieg heil!‹-Rufe der Österreicher und insbesondere der Österreicherinnen beim Erscheinen des Deutschen Reichskanzlers waren nicht mehr Rufe, sondern eine Aufeinanderfolge von heiseren Schreien, die nicht mehr gesteigert werden konnten. […] Ein älterer Besucher aus Wien, der unweit vom Gewährsmann saß, klagte, dass er Hitler leider nicht sehen konnte, denn als er eintrat, brach ihm ein Tränenstrom aus den Augen.«
TAGESMELDUNG DER STAATSPOLIZEISTELLE BERLIN: »Der Schneider Walter Harf, 3. 12. 90 geboren, Lützowstraße 45 wohnhaft, soll anlässlich der Olympiade-Eröffnungsfeier zu seiner Ehefrau geäußert haben: ›Jetzt müssen sie auf den Führer genau so ein Attentat verüben, wie auf den König von England.‹ Die Festnahme des Harf wurde angeordnet, falls sich zuverlässige Zeugen für die Beschuldigung finden.«
Das Quartier Latin ist der Treffpunkt der Schönen und Reichen. Leon Henri Dajou ist immer zur Stelle, um seine eleganten Gäste in Empfang zu nehmen.
© aus: Die Dame. Illustrierte Mode-Zeitschrift, Heft 16/1936, Seite 38, Humboldt-Universitätsbibliothek zu Berlin, Historische Sammlungen, AZ 81377
SONNTAG, 2. AUGUST 1936
BERICHT DES REICHSWETTERDIENSTES FÜR BERLIN
Überwiegend bewölkt, zeitweilig leichte Regenfälle, Temperaturen wenig verändert, schwache Luftbewegung. 19 Grad.
Toni Kellner ist eine misstrauische Frau. Wenn sie ihre kleine Einzimmerwohnung im Tegeler Weg 9 in Charlottenburg betritt, schließt sie sofort die Türe hinter sich ab und legt zur Sicherheit noch eine Kette vor. Johanna Christen wohnt seit April in der Wohnung gegenüber, gesehen hat sie ihre Nachbarin in all den Monaten jedoch so gut wie nie. Nur einmal hört sie Geräusche im Treppenhaus und lugt heimlich durch den Türspion. Sie erblickt eine üppige Frau in einem langen Mantel, die einen altmodischen Hut trägt. Schon wenige Sekunden später verschwindet die Fremde wieder hinter ihrer fest verschlossenen Tür.
Toni Kellner bekommt nur selten Besuch. Ab und zu schaut ihre dreißigjährige ledige Tochter Käthe vorbei, die Toni als herzliche, aber pedantische Person beschreibt. So pflege sie etwa ihre kleinen Rituale, gibt Fräulein Käthe später zu Protokoll: Wenn sie beispielsweise am frühen Morgen aufsteht, reißt sie als Erstes den Kalender auf ihrem Waschtisch ab. Eine andere gelegentliche Besucherin heißt Anna Schmidt und ist die Witwe eines früheren Arbeitskollegen von Toni Kellner. Die Schmidt berichtet, dass Toni Kellner mit ihren wenigen Bekannten ein Geheimzeichen verabredet habe und nur die Wohnungstüre öffne, wenn der Besucher dreimal mit der Messingklappe des Briefkastenschlitzes klopfe. Doch warum ist Toni Kellner so ängstlich? Wovor fürchtet sie sich?
Toni Kellner ist ein Transvestit. Im Juni 1873 als Emil Kellner geboren, fühlt er beziehungsweise sie sich schon früh im falschen Körper gefangen. Emil wird Polizeibeamter, heiratet aus purer Verzweiflung und trägt, wenn seine Frau nicht zu Hause ist, deren Kleidung. Die Ehe scheitert, und Emil quittiert den Polizeidienst. Von einer großen Last befreit, beantragt er einen sogenannten Transvestitenschein, der ihm das Tragen von Frauenkleidung gestattet, und erhält vom preußischen Justizministerium einen geschlechtsneutralen Vornamen. Aus Emil wird Toni Kellner, aus dem Polizeibeamten wird eine Frau mit Geheimnis. Sie lässt sich nun ihre eigenen Kostüme schneidern und arbeitet fortan als Privatdetektivin. In der Szene kennt man sie als »die große Polly«. Es sind vermutlich Tonis schönste Jahre. Im Berlin der Weimarer Republik floriert eine reiche Subkultur mit eigenen Bars, Lokalen und Treffpunkten für all jene, die jenseits der Norm leben und lieben möchten. Doch mit Hitlers Machtübernahme ändert sich das. Fortan stehen Transvestiten wie Toni unter dem Generalverdacht der Homosexualität. 1935 verschärfen die Nazis den berüchtigten Paragrafen 175 des Reichsstrafgesetzbuches und richten die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung ein. Transvestiten gelten nun den nationalsozialistischen Sittenwächtern als Perverse. Nur wer seine Heterosexualität nachweisen kann, wird der Transvestitenschein aus der Weimarer Zeit verlängert. Kein Wunder, dass Toni Kellner Angst hat – Angst vor den Nachbarn, vor den Hitlerjungen, die auf der Straße spielen, oder vor den SA-Männern, die regelmäßig über den Tegeler Weg marschieren.
Seit geraumer Zeit schon fühlt sich Toni Kellner unwohl. Das Herz. Und Asthma – jedenfalls vermutet sie das, denn zu einem Arzt traut sie sich nicht. An ihrem letzten Lebenstag trägt Toni ein Damenhemd, Schlüpfer und rote, bis an die Knie reichende Damenschnürstiefel, als ihr plötzlich schlecht wird und sie rücklings auf ihr Bett fällt. Aus ihrem Mund tritt Blut hervor, eine Schlagader ist geplatzt. Niemand vermisst sie. Erst vierzehn Tage später fühlen sich Nachbarn von dem Gestank, der aus Tonis Wohnung kommt, gestört. Die Polizei kann sich zunächst keinen Zutritt verschaffen, denn wie immer hat Toni Kellner die Wohnungstüre mehrfach verschlossen. Als die herbeigerufene Feuerwehr über das Küchenfenster die Wohnung betritt, zeigt der Kalender auf Tonis Waschtisch Sonntag, den 2. August 1936.
TAGESMELDUNG DER STAATSPOLIZEISTELLE BERLIN: »Auf Anordnung des Herrn SS. Gruppenführers Heydrich soll der Olympische Polizei-Befehlsstab ab heute seine Tagesmeldungen in 4facher Ausfertigung zum Dauerdienst der Geheimen Staatspolizei, welcher die Verteilung vornehmen sollte, einreichen. Es wurde festgestellt, dass Hptm. Göres vom Kommando der Schutzpolizei die fraglichen Tagesmeldungen zusammenstellt. Dieser lehnte die Einreichung der Tagesmeldungen in 4facher Ausfertigung ab mit der Begründung, dass es technisch nicht möglich sei. Aus diesem Grunde kann eine Verteilung der Tagesmeldungen, wie angeordnet, nicht ausgeführt werden.«
Joseph Goebbels erfährt ausgerechnet durch seinen Intimfeind Alfred Rosenberg von einer Affäre seiner Frau. »In der Nacht hat Magda zugestanden, daß Sache Lüdecke stimmt«, notiert Goebbels in sein Tagebuch. »Ich bin darüber sehr deprimiert. Sie hat mir permanent die Unwahrheit gesagt. Großer Vertrauensschwund. Es ist alles so schrecklich. Man kommt im Leben nie ohne Kompromisse aus. Das ist das Furchtbare!« Der Seitensprung von Magda liegt zwar schon drei Jahre zurück, doch die Angelegenheit ist für Goebbels aus politischen Gründen ausgesprochen unangenehm. Seine Frau hätte mit Kurt Georg Lüdecke kaum einen peinlicheren Partner für ihr amouröses Abenteuer auswählen können. Lüdecke ist eine windige Figur aus den Anfangstagen der NSDAP. Eine Mischung aus Dandy, Gigolo und Hochstapler, benutzt Adolf Hitler Lüdecke mehrfach für delikate Sondermissionen. In den Vereinigten Staaten, wo Lüdecke einige Jahre lebt, bemüht er sich bei Henry Ford um Geld für die damals klamme Nazipartei, in Rom spricht er bei Benito Mussolini vor. Immer wieder gerät er mit dem Gesetz in Konflikt, wenn er reichen Damen den Hof macht und sie anschließend erpresst. Nach Hitlers Machtübernahme will Lüdecke ein Stück vom Kuchen abbekommen, wird aber stattdessen inhaftiert. Ein Mann wie er hat viele Feinde. 1934 setzt Lüdecke sich schließlich in die USA ab, wo er mit der Niederschrift eines Enthüllungsbuches über Hitler beginnt. Joseph Goebbels ist nervös: Nicht auszudenken, wenn dieser »Felix Krull« nun auch seine Affäre mit Frau Magda publik macht.
Erna und Willi Rakel sind einfache Leute: Sie verdient ihr Geld als Arbeiterin, Gatte Willi ist Glasbläser. Die Rakels leben in Köpenick, Wendenschloßstraße 212, einfaches Wohnhaus, sechzehn Mietparteien, beengte Verhältnisse, dunkler Hinterhof. Die Toiletten befinden sich jeweils auf halber Treppe. Erna und Willi müssen sie sich mit der Familie Mehl (er Rohrleger, sie Hausfrau), der Schneiderin Rabe und der Witwe Lehmann teilen. Hier in der Wendenschloßstraße ist Berlin denkbar unspektakulär und der Kurfürstendamm mit seinen schicken Cafés, Bars und Geschäften weit weg. In Köpenick geht es deutlich bodenständiger zu: Luise Burtchen betreibt in der Wendenschloßstraße 202 ihre kleine Wäscherei, im Nachbarhaus befindet sich die Auslieferung der Linoleum Werke AG, und in der Nummer 218 ist die Nitritfabrik AG ansässig. Nach der Arbeit treffen sich die Männer auf ein Bier in Bernhard Woickes Kneipe.
Von der gestrigen Eröffnung der Olympischen Spiele hat man in der Wendenschloßstraße nicht viel mitbekommen, hierher verirren sich keine Touristen. Erna interessiert sich ohnehin nicht für Sport, sie hat ganz andere Probleme. Seit geraumer Zeit fühlt sie sich nicht wohl. Körperlich ist bei der Fünfundzwanzigjährigen alles in Ordnung, nein, seelisch geht es ihr nicht gut. Sie trägt ein Geheimnis mit sich herum. Es muss ein dunkles Geheimnis sein, denn sie wagt sich niemandem anzuvertrauen. Mit Willi kann sie darüber nicht sprechen, vielleicht ist Willi aber auch ein Teil des Problems – wir wissen es nicht.
Sicher ist, dass Erna heute gegen Mittag den S-Bahnhof Neukölln betritt. Der Halt in Neukölln ist Teil der Ringbahnstrecke, die einmal ganz um Berlin führt. Am zweiten Tag der Olympischen Spiele ist hier erwartungsgemäß besonders viel los, zahlreiche Fahrgäste befinden sich auf dem Weg zu den Wettkämpfen. Die Menschen lachen und sind fröhlicher Stimmung. Erna bahnt sich ihren Weg durch die Wartenden und stellt sich in die erste Reihe. Sie befindet sich nun etwa einen halben Meter von den Gleisen entfernt. Von der Lautsprecheransage bekommt Erna nur Wortfetzen mit: »Achtung … Einfahrt Ringbahn … bitte zurücktreten!« Als der S-Bahnzug um 12.34 Uhr nur noch wenige Meter von ihr entfernt ist, macht Erna Rakel einen Schritt nach vorne.
Um 15 Uhr beginnt im Olympiastadion der Speerwurf der Frauen. Vierzehn Athletinnen treten an, darunter mit Ottilie »Tilly« Fleischer, Luise Krüger und Lydia Eberhardt drei deutsche Sportlerinnen. Als Favoritinnen gelten Luise Krüger und die Österreicherin Herma Bauma. Bereits im zweiten Durchgang wirft Tilly Fleischer den Speer auf 44,69 Meter und übertrifft den Olympiarekord von Los Angeles um genau einen Zentimeter. Nach drei weiteren Versuchen erreicht Fleischer 45,18 Meter und stellt damit einen neuen olympischen Rekord auf. Tilly Fleischer, die Tochter eines Metzgers aus Frankfurt am Main, gewinnt so die erste Goldmedaille für die deutsche Olympiamannschaft. Den zweiten Platz belegt Luise Krüger, die Bronzemedaille geht an die Polin Maria Kwaśniewska.
Adolf Hitler bittet die drei Sportlerinnen nach der Siegerehrung zum Fototermin in seine Loge, sehr zum Ärger des Internationalen Olympischen Komitees, das die Gastgeberrolle für sich beansprucht. Doch Hitler weiß um die Macht der Bilder. »Fast hätte ich vor dem Führer geweint«, wird Tilly Fleischer in einer Zeitung zitiert. Die deutsche Presse schlachtet die Gratulationscour des Diktators weidlich aus, und es entstehen mehrere Fotos, die Hitler, Hermann Göring und Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten neben der vierundzwanzigjährigen Tilly zeigen. Tränen sind bei ihr auf diesen Fotos nicht zu erkennen, doch sieht man die kleine, etwa fünfzig Zentimeter große Eiche, die jede Gewinnerin und jeder Gewinner einer Goldmedaille zusätzlich erhält. In ihrem Fotoalbum kommentiert Tilly trocken: »Adolf + ich mit Eiche«.
Hubertus Georg Werner Harald von Meyerinck entstammt einer alten preußischen Offiziers- und Beamtenfamilie und sollte eigentlich die Militärlaufbahn einschlagen oder zumindest Geistlicher werden, doch ihn zieht es schon früh zum Theater und zum Film. Sein Spitzname Hupsi hätte einer Karriere als Offizier oder Pfarrer vermutlich auch im Weg gestanden, in der Schauspielerei ist Hupsi 1936 jedoch eine Marke. Mit öligem Pomadenhaar, Monokel und Menjou-Bärtchen verkörpert er vornehmlich aalglatte Bösewichte, skurrile Großbürger, vertrottelte Adelige oder galante Exzentriker. Hupsi kann schnarren wie ein preußischer Spieß und näseln wie ein arroganter Fatzke. Das kommt gut an beim Publikum. Etwa zehn Filme dreht Hubert von Meyerinck im Jahr, Ende Mai feierte sein neuester Streifen im Primus-Palast an der Potsdamer Straße Premiere. In der Komödie Befehl ist Befehl spielt Hupsi den Rittmeister von Schlackberg – einen windigen Hochstapler, der auf das schnelle Geld aus ist.
Als Filmstar ist Hubert von Meyerinck ein fester Bestandteil des Berliner Nachtlebens. Er besucht gerne das Restaurant Schlichter oder – soll es einmal besonders vornehm zugehen – das Horcher, man sieht ihn aber auch bei Aenne Maenz, bei Mampe, in der Taverne, in der Ciro-Bar und bei Sherbini. Am liebsten verbringt Hupsi seine Nächte jedoch im Quartier Latin. Man könnte es fast seine Stammkneipe nennen, verböte sich die Bezeichnung »Kneipe« nicht im Zusammenhang mit diesem Nobeletablissement. Das Quartier Latin an der Kreuzung Nürnberger Ecke Kurfürstenstraße ist der eleganteste und teuerste Club der Reichshauptstadt. Wer hier verkehrt, benötigt als Herr einen Smoking, als Dame ein Abendkleid und als Gast viel Geld. Auf die Einhaltung dieses Dresscodes wird streng geachtet, Ausnahmen werden grundsätzlich nicht gemacht, auch nicht bei prominenten Zeitgenossen. Braunhemden und andere Uniformträger sucht man im Quartier Latin vergebens. Hier, so scheint es, ist die Zeit im Jahre 1926 oder vielleicht 1928 stehen geblieben, doch der Eindruck täuscht. Das Lokal ist keineswegs ein Überbleibsel der Goldenen Zwanziger: Erst Ende September 1931 ist es eröffnet worden und wird seine kurze Glanzzeit während des »Dritten Reiches« erleben.
Das Quartier Latin besteht aus einem winzigen Entree mit Garderobe sowie zwei ineinander übergehenden Räumen. Im ersten Teil befindet sich die Bar mit einigen Cocktailtischen samt den dazugehörigen Hockern, im zweiten Raum gibt es den Restaurantbereich, die Tanzfläche sowie ein Podium für die Kapelle. Selbstverständlich wird im Quartier Latin ausschließlich Livemusik gespielt.
Sobald Hubert von Meyerinck oder ein anderer bekannter Gast die Bar betritt, ist Leon Henri Dajou sofort zur Stelle. Er bildet das Empfangskomitee, hilft einer Filmdiva aus ihrem Pelzmantel, führt eine Gruppe von Wirtschaftsbossen an ihre Tische und nimmt erste Wünsche entgegen. Nicht zuletzt ist Leon Henri Dajou der Besitzer des Quartier Latin. Als Chef ist er allgegenwärtig, mit einem schnellen Blick und wenigen Anweisungen steuert er die zahlreichen Mitarbeiter.
Hupsi nennt Dajou einen Freund, doch eigentlich weiß er nicht viel über ihn. Dajou soll aus Rumänien stammen, heißt es, andere behaupten, er sei aus Algerien oder Marokko nach Deutschland gekommen und habe im Hotel Adlon als Eintänzer gearbeitet. Hedda Adlon, die Gattin des Hoteldirektors, soll sich in den Gigolo verguckt und ihn ausgehalten haben. Das Geld für die Eröffnung der Bar stamme ebenfalls von Frau Adlon, munkelt man, doch nichts Genaues weiß man nicht.
Auch wenn Dajous Herkunft im Dunklen liegt, offensichtlich ist, dass seine Geschäfte glänzend laufen. Er kann sich eine teure Wohnung auf dem Kurfürstendamm sowie einen edlen Cadillac leisten. Er genießt es, seine Nobelkarosse durch die Straßen zu steuern und direkt vor dem Quartier Latin abzustellen. Leon Henri Dajou hat auch eine Freundin: Charlotte Schmidtke, Ende zwanzig, gutaussehend, blond, Typ Mannequin. Fräulein Schmidtke arbeitet nicht, bewohnt dafür aber eine luxuriös eingerichtete Fünf-Zimmer-Wohnung in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms. Das nötige Kleingeld für diesen Lebenswandel stammt von Dajou, hört man, doch Genaues weiß man wieder nicht. Wann immer Hubert von Meyerinck seinem Freund Dajou eine private Frage stellt, lacht dieser. Dajou lacht Hupsi nicht aus, er lacht auch nicht über ihn, er lacht die Frage einfach weg. »Ach, Hupsi …«, sagt er dann – und schenkt ein Glas Champagner nach.
Die Besucher des Quartier Latin sind so schillernd, wie der Patron undurchsichtig ist. An einem Tisch sitzt die große Pola Negri, die soeben ihren neuesten Film Moskau – Shanghai