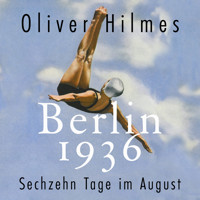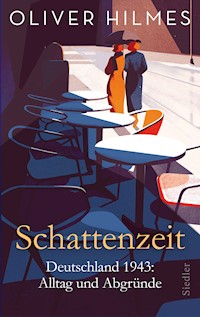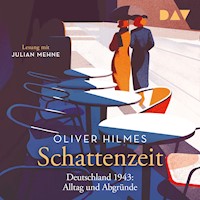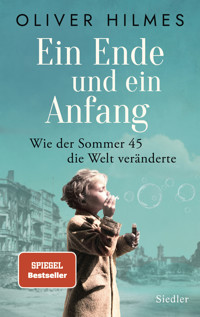
20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Porträt des Sommers 1945, wie man es noch nie gelesen hat - ein packend erzähltes Geschichtspanorama
In diesem Sommer ist nichts mehr, wie es war: In den vier Monaten von Mai bis September 1945 bricht die alte Welt zusammen, und eine neue tut sich auf. Das verbrecherische »Dritte Reich« ist am Ende, und eine Zeit der Freiheit, aber auch neuer Konflikte, nimmt ihren Anfang.
Wie erleben die Menschen diesen Sommer – Sieger wie Besiegte, Opfer wie Täter, Prominente wie Unbekannte? Die »Großen Drei« bestimmen auf der Potsdamer Konferenz den Gang der Geschichte, und die Berliner Hausfrau Else Tietze bangt um das Leben ihres Sohnes. Der US-Soldat Klaus Mann spürt Nazi-Verbrecher auf, und in Berlin plant Billy Wilder eine Komödie über das Leben in den Ruinen. Cafés und Restaurants öffnen ihre Türen, und der Rotarmist Wassili Petrowitsch wird von deutschen Kindern um Brot angebettelt. In vielen Geschichten und Szenen, die von Berlin nach Tokio führen, von München nach Paris oder von Bayreuth nach Moskau, fängt Oliver Hilmes die einzigartige Atmosphäre dieser Zeit der Extreme ein: das große Glück und die Hoffnung der Befreiten, das Elend und die Trauer, die Ängste der Besiegten und die neue Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
In diesem Sommer ist nichts mehr, wie es war: In den vier Monaten von Mai bis September 1945 bricht die alte Welt zusammen, und eine neue tut sich auf. Das verbrecherische »Dritte Reich« ist am Ende, und eine Zeit der Freiheit, aber auch neuer Konflikte, nimmt ihren Anfang.
Wie erleben die Menschen diesen Sommer – Sieger wie Besiegte, Opfer wie Täter, Prominente wie Unbekannte? Die »Großen Drei« bestimmen auf der Potsdamer Konferenz den Gang der Geschichte, und die Berliner Hausfrau Else Tietze bangt um das Leben ihres Sohnes. Der US-Soldat Klaus Mann spürt Nazi-Verbrecher auf, und in Berlin plant Billy Wilder eine Komödie über das Leben in den Ruinen. Cafés und Restaurants öffnen ihre Türen, und der Rotarmist Wassili Petrowitsch wird von deutschen Kindern um Brot angebettelt. In vielen Geschichten und Szenen, die von Berlin nach Tokio führen, von München nach Paris oder von Bayreuth nach Moskau, fängt Oliver Hilmes die einzigartige Atmosphäre dieser Zeit der Extreme ein: das große Glück und die Hoffnung der Befreiten, das Elend und die Trauer, die Ängste der Besiegten und die neue Freiheit.
Oliver Hilmes, 1971 geboren, wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel (2004) und Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima Wagner (2007) wurden zu großen Verkaufserfolgen. 2011 folgte Liszt. Biographie eines Superstars, danach Ludwig II. Der unzeitgemäße König (2013) sowie Berlin 1936. Sechzehn Tage im August (2016), das in viele Sprachen übersetzt und zum gefeierten Bestseller wurde. Zuletzt erschienen Das Verschwinden des Dr. Mühe. Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 30er Jahre (2019) und Schattenzeit. Deutschland 1943: Alltag und Abgründe (2023).
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
OLIVER HILMES
Ein Ende
und ein Anfang
Wie der Sommer 45 die Welt veränderte
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Ludger Ikas, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31808-6V002
www.siedler-verlag.de
Dass diese Bestie endlich daliegt, gut;
aber was hat sie angerichtet.
Alfred Döblin, Mai 1945
Inhalt
Am Abgrund
Freunde und Feinde
Gewinner und Verlierer
Die Bombe
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
bpk / Herbert Hensky
Das »Dritte Reich« endet vielerorts in Schutt und Asche. An der Potsdamer Brücke in Berlin haben Unbekannte eine Büste Adolf Hitlers gefunden.
Am Abgrund
Als Harry am späten Vormittag des 7. Mai 1945 durch die Flure seines neuen Zuhauses geht, beschleicht ihn das Gefühl, auf hoher See zu sein. Der Fußboden knarrt unter seinen Schritten und scheint in Bewegung zu geraten wie das Deck eines wogenden Schiffs. Halbtonnenschwere Kronleuchter schwanken plötzlich, und die Kristallgläser auf den Tischen klirren gegeneinander. Immer wieder bewegen sich auch die schweren Vorhänge wie von Geisterhand, während aus den alten Mauern ein geheimnisvolles Ächzen dringt. Man könnte meinen, dass Harry sich das alles nur einbildet, dass er vielleicht überspannt ist oder einfach nur zu viel Fantasie besitzt. Doch seine Wahrnehmungen sind echt: Das neue Domizil ist eine Bruchbude und bedarf dringend der Renovierung. Die Rede ist vom Weißen Haus in Washington.
Harry S. Truman hatte bei der Präsidentschaftswahl im November 1944 für die Demokratische Partei als Vizepräsident an der Seite des Amtsinhabers Franklin D. Roosevelt kandidiert. Für Roosevelt war es tatsächlich schon die vierte Kandidatur, und auch diesmal gewann er die Abstimmung. Als er jedoch wenige Monate später – am 12. April 1945 – überraschend starb, musste Truman selbst das Amt übernehmen. »Das Weiße Haus sah von außen prächtig aus«, wird sich Trumans einundzwanzig Jahre alte Tochter Margaret erinnern. »Aber die Privaträume waren damals alles andere als komfortabel. Es war nicht anders, als wenn man in eine möblierte Wohnung einzog, in der seit zwanzig oder dreißig Jahren keine neuen Möbel oder Geräte gekauft worden waren. Die Einrichtung sah aus, als käme sie aus einer drittklassigen Pension. Einiges davon war buchstäblich morsch.« Roosevelts Witwe Eleanor versicherte den neuen Bewohnern, dass der alte Kasten viel besser aussehen werde, sobald frische Farbe an den Wänden sei.
Margaret wählt schließlich Wedgwood-Blau für ihr Wohn- und Rosa für ihr Schlafzimmer. Trumans Frau Bess bevorzugt Blau für ihr Schlafzimmer und Grau für ihr Wohnzimmer, während das Schlafzimmer ihres Gatten cremefarben ausgemalt wird. Der Präsident und die First Lady schlafen offensichtlich getrennt. Das ovale Arbeitszimmer des Präsidenten erhält derweil einen Anstrich in gebrochenem Weiß. Am 7. Mai sind die Arbeiten beendet, und die Trumans beziehen noch am gleichen Tag ihre Wohnung im Weißen Haus.
Während die Möbelpacker Hunderte Umzugskisten in das Gebäude schleppen und Margaret Trumans Konzertflügel an einem Kran baumelnd in den ersten Stock gehievt wird, erfährt der Präsident von General Dwight D. Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa, dass Generaloberst Alfred Jodl wenige Stunden zuvor in Eisenhowers Hauptquartier im französischen Reims die deutsche Kapitulation erklärt hat. Da die Wehrmachtsführung laut Jodl aber etwas Zeit benötigte, um den Befehl zur Aufgabe bis in die untersten Gliederungen durchzureichen, einigte man sich darauf, die Kapitulation erst am nächsten Tag in Kraft zu setzen. Mit der Gewissheit, dass der Zweite Weltkrieg in Europa nach fünf Jahren, acht Monaten und sieben Tagen beendet ist, verbringt Harry S. Truman die erste Nacht im Weißen Haus.
Am nächsten Morgen werden bereits für neun Uhr eine Pressekonferenz sowie eine Radioansprache angekündigt. Der Präsident habe der Nation etwas Wichtiges mitzuteilen. Entsprechend groß ist das Gedränge, als Pressesprecher Jonathan W. Daniels die Reporter gegen 8.35 Uhr ins Oval Office führt. Anwesend sind auch Bess und Margaret Truman, das Kabinett, hohe amerikanische und britische Militärs sowie hochrangige Mitglieder des Kongresses. Sie alle sitzen auf Stühlen rund um den Schreibtisch des Präsidenten. Die Journalisten müssen derweil stehen, wobei es inzwischen so voll ist, dass man wohl in Ohnmacht fallen könnte und trotzdem aufrecht stehen bliebe.
Historical / Corbis Historical via Getty Images
Präsident Harry S. Truman bereitet sich auf seine Rundfunkansprache vor, in der er nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa verkündet. »Eine feierliche und glorreiche Stunde ist angebrochen.«
Truman lässt die Anwesenden zu Beginn wissen, dass er eine Erklärung verlesen werde, die noch bis neun Uhr streng vertraulich sei. Die Nachricht sei aber so kurz, dass die Vertreter der Presse danach genug Zeit hätten, ihre Meldungen zu schreiben. Die Reporter lachen. Truman scherzt, dass dies ein ganz besonderer Tag sei, denn er habe zudem Geburtstag. Er wird einundsechzig Jahre alt. »Happy Birthday, Mister President!«, ruft jemand im Saal. Dann ist es neun Uhr, und Truman beginnt mit seiner Ansprache: »Eine feierliche und glorreiche Stunde ist angebrochen. Ich wünschte nur, Präsident Franklin D. Roosevelt hätte diesen Tag erlebt. Von General Eisenhower ist die Meldung eingegangen, dass sich die deutschen Streitkräfte den vereinten Nationen ergeben haben. Über ganz Europa wehen die Banner der Freiheit.« Truman weist darauf hin, dass der Zweite Weltkrieg noch nicht überall zu Ende sei, da Japan und die USA noch immer in einen schrecklichen Krieg im Pazifik verwickelt seien. Er warnt die Japaner, dass die gesamte amerikanische Militärmaschinerie nun gegen sie gerichtet sein werde. Man habe erst die Hälfte des Kriegs hinter sich. Nach wenigen Minuten ist die Pressekonferenz beendet.
Während Harry S. Truman nun weitere Glückwünsche entgegennimmt, unzählige Hände schüttelt, eine üppige Geburtstagstorte in appetitliche Stücke schneidet, diese an seine engsten Mitarbeiter verteilt und irgendwann zu seiner Arbeit zurückkehrt, beginnen sich in New York bereits zahllose Menschen am Times Square zu versammeln, und Zehntausende marschieren in den nächsten Stunden die Fifth Avenue hinunter, während Konfetti auf sie herabregnet. Alles in allem sind gut 500.000 Menschen auf den Beinen. Es ist die mit Abstand größte Feier zum »Victory Day« in den USA. Doch schon am Abend kehrt die Stadt zu ihrer üblichen Betriebsamkeit zurück. »Die Nachricht hatte gestern Abend kaum Auswirkungen auf die Theaterkassen«, weiß die New York Times am nächsten Tag zu berichten. »Die Ticketverkäufer sagten, dass sie einige Stornierungen von Reservierungen zu verzeichnen hatten, aber diese Plätze wurden sogleich von eifrigen Käufern ergattert.«
Wie lange hat Alfred Döblin auf diesen Tag gewartet! Und wie oft hat er sich das Ereignis in Gedanken ausgemalt? Dass die Erde sich öffnet, ein gigantischer Schlund entsteht und Adolf Hitler geradewegs zur Hölle fährt! Zwanzig Mal? Dreißig Mal? Oder noch häufiger? Döblin weiß es nicht. »Dass diese Bestie endlich daliegt, gut«, schreibt er Anfang Mai Freunden, »aber was hat sie angerichtet.« Rund sechzig Millionen Menschen sind gestorben, Soldaten wie Zivilisten. Neun Millionen Männer, Frauen und Kinder sind in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden, darunter sechs Millionen Juden. Weite Teile des europäischen Kontinents sind verwüstet, Deutschlands Städte gleichen Ruinenlandschaften.
In Los Angeles, wohin der Schriftsteller fünf Jahre zuvor emigriert war, notiert er: »Vielleicht ist in einigen Monaten das Exil zu Ende, – und was kommt nachher? Das Leben eine Serie von Abenteuern.«
Gut eine Woche nach Adolf Hitlers Selbstmord im Bunker der Reichskanzlei schwirren abenteuerliche Gerüchte durch Berlin. »Hitler sei in Japan, Spanien, sei in der Nähe von Hamburg gefallen, habe sich erschossen, sei im Kampf um die Reichskanzlei gefallen«, grübelt Else Tietze in ihrem Tagebuch. Eigentlich heißt sie Elisabeth Anna Henriette, doch solange sie denken kann, nennen sie alle nur Else. Sie weiß nicht recht, was sie von dem Gerede halten soll. »Wenn Gott ihn einen Soldatentod hätte sterben lassen, hätte er es sehr gut mit ihm gemacht. Dass der Mann Gutes wollte, glaube ich noch immer, aber er muss zuletzt wohl wahnsinnig gewesen sein.« Eine echte Nationalsozialistin sei sie ja nie gewesen, beteuert Frau Tietze, doch die Russen seien nun mal die Feinde. Wenn sie aber jetzt durch die Straßen der Reichshauptstadt geht, kommen ihr immer mehr Zweifel an Hitler. »Man hat fast das Gefühl, dass Hitler den Feinden nur ein ganz zerstörtes Berlin hinterlassen wollte und an die armen, unglücklichen Menschen gar nicht gedacht hat.«
Else Tietze ist Anfang siebzig und lebt in einer stattlichen Wohnung in der Holsteinischen Straße unweit des Stubenrauchplatzes im Berliner Bezirk Steglitz. Ihr Mann Richard war zuletzt pensionierter Oberst und ist vor drei Jahren gestorben. Die Leute aus ihrem Haus, das den Krieg wundersamerweise ohne größere Schäden überstanden hat, sprechen Else mit »Frau Oberst« an, worüber sie sich immer besonders freut. Ihr Richard sei eine Respektsperson gewesen, denkt sie dann, vor dem hatte man Achtung, die jetzt auch ein wenig auf sie abzufärben scheint.
Die Tietzes haben drei Kinder – Traute, Hildegard und Richard Junior –, von denen Else seit mehreren Wochen ohne Nachricht ist. Als die Rote Armee in Berlin einmarschierte, flohen Traute und ihr Mann Hans Hals über Kopf nach Süddeutschland, denn sie hatten gehört, Stalins Soldaten würden mit SS-Männern wie Hans oftmals kurzen Prozess machen. Elses Sohn Richard ist wie sein Vater zum Militär gegangen und soll zuletzt in Potsdam gekämpft haben – auch von ihm fehlt seither jede Spur. Einzig ihre Tochter Hildegard weiß Else in Sicherheit. Sie hat einen Klavierbauer geheiratet, mit dem sie bereits 1933 in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist.
»Die Sehnsucht und Sorge ist manchmal gar zu groß«, klagt Else in diesen Tagen mehr als einmal. Es nagt an ihr, nicht zu wissen, wie es den Kindern geht. Obwohl sie über ihre Gefühle nie groß gesprochen oder gar geschrieben hat, führt sie seit ein paar Wochen ein Tagebuch. Es ist ihr »Journal intime«, dem sie ihre quälenden Ängste und Sorgen ebenso anvertraut wie ihre leisen Hoffnungen. Sollten Traute und Richard noch am Leben sein, will sie ihnen irgendwann die Kladde übergeben. Bis dahin notiert Else, so gut es geht, ihre täglichen Erlebnisse. Am 8. Mai schreibt sie: »Die Kinder spielen hier schon wieder vergnügt auf der Straße, und auf meinem Weg heute, der mich an vielen Russenwagen vorbeiführte, sah ich, wie ein Russe einem Jungen eine dicke Scheibe Brot abschnitt, die der strahlend nahm. Übrigens haben sie eine Unmenge meist sehr gut aussehender Pferde, keine kleinen Russenpferde, sondern schöne, große; sicher lauter geraubte und eroberte deutsche.«
Der 8. Mai 1945 ist ein arbeitsreicher Tag im Buckingham Palace. Um elf Uhr findet wie üblich die Wachablösung statt, eine Zeremonie, die während des gesamten Krieges fortgesetzt worden war. Zeitgleich hält König Georg VI. im Ballsaal eine Investitur ab, bei der er mehr als zweihundertsiebzig Orden, darunter die »Distinguished Service Medal« und die »Military Medal«, an verdiente Soldaten verleiht. Gegen Mittag trifft Premierminister Winston Churchill zum Lunch mit dem König ein. Als ihn die Menschenmenge, die sich bereits vor dem Palast versammelt hat, erkennt, muss die Polizei einschreiten. Der siebzigjährige Churchill ist der Mann der Stunde, gilt er doch als treibende Kraft hinter dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Nun, da der lang ersehnte Frieden da ist, will das britische Volk diesen mit seinem Premier feiern. Nach dem Mittagessen kehrt Churchill in seinen Amtssitz in Downing Street 10 zurück, um sich in einer Radioansprache an das Volk zu wenden. »Wir können uns eine kurze Zeit der Freude gönnen«, mahnt er darin, »aber wir sollten nicht einen Augenblick lang die Mühen und Anstrengungen vergessen, die vor uns liegen. Japan mit all seinem Verrat und seiner Gier ist noch nicht besiegt. Die Verletzungen, die es Großbritannien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zugefügt hat, und seine abscheulichen Grausamkeiten verlangen nach Gerechtigkeit und Vergeltung.«
Vor dem Buckingham Palace ist die Menschenmenge mittlerweile auf rund hunderttausend Personen angewachsen. Zunächst sind es nur einzelne Stimmen, doch dann werden es immer mehr: Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge – sie alle skandieren »We want the King!«. Dann öffnet sich die Tür, und König Georg VI., Königin Elisabeth, Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Margaret treten zum ersten Mal an diesem Tag auf den Balkon des Palastes. Der König erscheint in der Uniform eines Admirals der Flotte, und Prinzessin Elisabeth trägt die khakifarbene Uniform des »Auxiliary Territorial Service« – der Frauenabteilung des britischen Heeres –, dem sie im selben Jahr beigetreten ist. Königin Elisabeth und Prinzessin Margaret sind beide in Blau gekleidet.
Winston Churchill begibt sich derweil von Downing Street zum nahen Richmond House, dem Sitz des Department of Health. Vom Balkon des Gebäudes hält er nun eine weitere Rede. »Meine lieben Freunde, dies ist eure Stunde«, ruft er der Menge zu. »Dies ist nicht der Sieg einer Partei oder einer Klasse. Es ist ein Sieg der großen britischen Nation als Ganzes. (…) Nun sind wir aus einem tödlichen Kampf hervorgegangen – ein schrecklicher Feind wurde zu Boden geworfen und wartet auf unser Urteil und unsere Gnade.«
Der Jubel kennt hier wie überhaupt in der ganzen Stadt keine Grenzen mehr. Am späteren Nachmittag empfängt der König Churchill mit den Mitgliedern des Kriegskabinetts zu einer offiziellen Audienz im Buckingham Palace. Um 17.30 Uhr begibt sich die königliche Familie dann erneut auf den Balkon, um sich der Menge zu zeigen – dieses Mal zusammen mit dem Premierminister.
Zeitgleich in Paris: Während Truman zum amerikanischen und Churchill zum britischen Volk sprechen, wendet sich Charles de Gaulle, der Chef der provisorischen Regierung der Französischen Republik, an seine Landsleute. »Der Krieg ist gewonnen!«, erklärt er am 8. Mai um fünfzehn Uhr mit bebender Stimme im Radio. »Hier ist der Sieg! Es ist der Sieg der vereinten Nationen und es ist der Sieg Frankreichs!« Dann lässt sich der General von seinem Pathos mitreißen: »Ehre sei dir! Ehre für immer unseren Armeen und ihren Anführern! Ehre für unser Volk, das durch schreckliche Prüfungen nicht geschwächt oder gebeugt werden konnte! Ehre den vereinten Nationen, die ihr Blut mit unserem Blut, ihre Schmerzen mit unseren Schmerzen, ihre Hoffnung mit unserer Hoffnung vermischt haben und die heute mit uns triumphieren. Ah! Vive la France!«
Charles de Gaulle wollte ursprünglich bereits am 7. Mai als Erster den Sieg verkünden, was aber eine heftige Auseinandersetzung zwischen Washington, London und Paris zur Folge hatte. In Downing Street war man entsetzt über den Coup; man rate dem General dringend, auf sein Vorhaben zu verzichten, kabelten die britischen Diplomaten. Doch der vierundfünfzigjährige de Gaulle gilt als völlig unberechenbar. »Sollte er aber nicht bereit sein, diesen Rat anzunehmen«, so das ernüchternde Fazit, »könne kein weiterer Druck auf ihn ausgeübt werden.« In letzter Minute sagte de Gaulle seinen Plan ab.
Aufseiten des Generals ist eine gehörige Portion gekränkter Eitelkeit im Spiel. Zwar haben Stalin, Churchill und Roosevelt die von ihm angeführte provisorische Regierung im Oktober 1944 offiziell anerkannt, doch de Gaulles Anwesenheit bei den großen Kriegskonferenzen von Teheran und Jalta war unerwünscht gewesen. Die Alliierten behandeln die Grande Nation offensichtlich als Siegermacht zweiter Klasse, was sich nicht gut mit dem Selbstverständnis des Generals verträgt. Das Misstrauen ist auf allen Seiten groß. Schon für den verstorbenen Franklin D. Roosevelt war de Gaulle ein Möchtegern-Napoleon gewesen, der den Krieg als Sprungbrett zur Diktatur nutzen wollte. Und Winston Churchill ließ bereits im Mai 1943 seine Minister wissen: »Er hasst England und hat überall eine Spur von Anglophobie hinterlassen. Er hat nie selbst gekämpft, seit er Frankreich verlassen hat, und er hat sich bemüht, seine Frau vorher in Sicherheit zu bringen.« Der britische Premierminister beschreibt den französischen General als »eitel und sogar bösartig« und verdächtigt ihn faschistischer Tendenzen. Mehr als einmal flüchtet sich Churchill in den Sarkasmus. »Jeder hat sein Kreuz zu tragen, meines ist das lothringische«, soll er einmal gesagt haben, eine Anspielung darauf, dass de Gaulle das sogenannte Lothringer Kreuz – ein Kreuz mit zwei gleich langen Querbalken – als Symbol für das von ihm 1940 gegründete Komitee »France libre« (»Freies Frankreich«) eingeführt hatte. Und Stalin? Der General handele, als ob er das Oberhaupt eines großen Staates sei, während er in Wirklichkeit über geringe Macht verfüge, lästert der Sowjetführer. Auch diese beiden dürften also wohl keine Freunde werden.
Im Anschluss an seine Radioansprache begibt sich de Gaulle zum Arc de Triomphe, um am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz niederzulegen. Als er die Gedenkstätte verlassen will, drängt die Menge zu ihm nach vorne und zertrampelt dabei die Grünanlage. Doch davon abgesehen verläuft der »Victory Day« an der Seine friedlich. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn glänzt Paris wieder als »cité lumière«, als Stadt des Lichts. Die Denkmäler sind beleuchtet, und die Opéra erstrahlt in Blau, Weiß und Rot – den Farben der Trikolore. »Jeder schien überall zu sein«, erinnert sich ein Zeitzeuge. »Jeeps, Lastwagen, sowohl zivile als auch militärische, waren voll mit Menschen, ob Zivilisten oder Militärs. Ich glaube, in keinem Jeep saßen weniger als zwanzig Personen und in den Lastwagen so viele, wie sie fassen konnten, und mehr. Von den Fahrzeugen wehten Fahnen, es wurde gehupt, und alles erweckte den Eindruck einer riesigen informellen Feuerwehrparade.«
Stundenlang kreisen Flugzeuge über der Innenstadt und werfen Konfetti und Luftschlangen ab. Die Menschen halten den Atem an, als ein amerikanischer »Mitchell«-Bomber das Kunststück vollbringt, unter dem Eiffelturm durchzufliegen. Und immer wieder wird die »Marseillaise« angestimmt: »Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé!«
Was für ein Tag! Am späten Abend lässt Winston Churchill ihn noch einmal Revue passieren, wobei ihm die Auseinandersetzung mit General de Gaulle keine Ruhe lässt. Er greift zu Papier und Stift und notiert ein Telegramm, das er um 23.55 Uhr an Duff Cooper, den britischen Botschafter in Paris, schicken und als persönlich und streng geheim kennzeichnen lässt: »Wir müssen den Besuch des Generals hier später besprechen. Es könnte durchaus sein, dass ich ihn eines Tages auf einer Reise nach Frankreich in aller Ruhe aufsuche, obwohl ich vorher wissen müsste, dass er mir nicht die Tür vor der Nase zuschlägt, vergittert und verriegelt.«
Die Mitarbeiter des Berliner Hauptamts für Statistik haben am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Stadt 245.300 Gebäude gezählt, wovon 27.679 total zerstört sind, was wiederum 11,3 Prozent entspricht. 8,2 Prozent der Gebäude sind schwer beschädigt, und 9,3 Prozent sind wiederherstellbar. Die überwiegende Zahl von 171.965 Gebäuden (70,1 Prozent) ist nur leicht beschädigt und gilt als bewohnbar.
Die nackten Zahlen sind das eine, das andere ist der desaströse Eindruck, den die zerstörte Stadt auf die Menschen macht. Selbst Fachleute zeigen sich angesichts der Trümmerberge entmutigt. Als man den berühmten Architekten Hans Scharoun in diesem Frühjahr fragt, wie lange es dauern werde, bis Berlin trümmerfrei sei, nimmt er zunächst einen tiefen Zug an seiner Zigarre. »Etwa fünfzig Jahre«, sagt er nachdenklich, während er den Rauch nach oben bläst. »Und dann kann der Aufbau beginnen.«
An jenem 8. Mai, als die Welt das Ende der »Bestie« und den Untergang ihres Schreckensreiches feiert, überqueren zwei junge Männer in einem Jeep der US-Army von Innsbruck kommend bei Berchtesgaden die deutsche Grenze. Am Steuer sitzt Sergeant Grayson B. Tewksbury, der als Fotograf für die amerikanische Soldatenzeitung The Stars and Stripes tätig ist. Als Tewksbury kurze Zeit später irgendwo in Bayern anhält und die beiden Männer mit einem großen Satz aus dem Jeep springen, ist das insbesondere für den Beifahrer ein bewegender Moment. Im März 1933 hatte er Deutschland verlassen müssen, um seiner Verhaftung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Jetzt – zwölf Jahre später – betritt Klaus Mann als amerikanischer Staatsbürger wieder deutschen Boden.
Der achtunddreißig Jahre alte Sohn von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann soll im Auftrag der US-Army für die Stars and Stripes aus dem befreiten Deutschland und seinen Nachbarländern berichten. Bei nahezu allen Aufenthalten in den kommenden Wochen wird Mann Gespräche mit Einheimischen führen, prominente Zeitgenossen interviewen und über diese Begegnungen Reiseberichte für sein Blatt verfassen.
Bevor Klaus Mann mit seiner Arbeit als Sonderberichterstatter beginnt, begibt er sich am Tag nach seiner Ankunft zunächst auf eine ganz persönliche Spurensuche. Ihn zieht es nach München. In seiner Geburtsstadt bewohnte die Familie Mann in der Poschingerstraße im vornehmen Stadtteil Bogenhausen eine stattliche Villa, die von Klaus und seinen Geschwistern liebevoll »Poschi« genannt wurde. Auf der Fahrt über die Reichsautobahn malen Klaus und sein Freund Grayson sich aus, wie es wohl sein wird, wenn sie an der »Poschi« läuten und ein feister Nazi-Bonze ihnen die Türe öffnet. »Wollen Herr Obersturmführer bitte zur Kenntnis nehmen, dass diese Villa rechtmäßiges Eigentum meines Vaters ist!«, würde Klaus Mann den neuen Bewohner anblaffen. »Herr Obersturmführer haben das Haus sogleich zu räumen. Ich gebe Herrn Obersturmführer zweieinhalb Minuten …« Die beiden Männer sind schon ganz aufgekratzt, doch in München eingetroffen, trübt sich die heitere Stimmung bald ein. Zu trostlos ist der Anblick der zerstörten Stadt. »München ist nicht mehr da«, wird Klaus Mann kurze Zeit später seinem Vater Thomas in Los Angeles berichten. »Das ganze Zentrum, vom Hauptbahnhof bis zum Odeonsplatz, besteht nur noch aus Trümmern.«
Als der Jeep, von der Föhringer Allee kommend, in die Poschingerstraße einbiegt, atmet Klaus zunächst auf: Das Elternhaus steht noch. Aber das dreigeschossige Anwesen scheint unbewohnt, der Eingang ist verbarrikadiert. Weit und breit kein Nazi-Bonze. Irgendwie verschafft Klaus sich Zugang zum Gebäude – und kommt aus dem Staunen nicht heraus. Man hat überall neue Wände eingezogen und aus den einst so repräsentativen Räumen mehrere kleine Zimmerchen gemacht. Nirgendwo findet Klaus ein intaktes Möbelstück, nur Trümmer. Vom verwilderten Garten aus entdeckt er plötzlich eine junge Frau, die sich auf dem kleinen Balkon im zweiten Stock, auf den einst sein Zimmer ging, provisorisch eingerichtet hat. Klaus spricht sie an, gibt seine wahre Identität aber nicht preis. Die neue Bewohnerin mustert ihn misstrauisch, vielleicht wundert sie sich darüber, dass ein amerikanischer Soldat – ein GI – so gut Deutsch spricht. Sie sei eine Ausgebombte, erklärt sie schließlich, und habe ihre gesamte Familie einschließlich des Bräutigams im Krieg verloren. Ob sie denn wisse, wem die Villa gehöre, fragt Klaus. Dazu könne sie nichts sagen, erwidert die Frau in breitestem Bairisch. Sie habe gehört, dass das Haus für die Organisation »Lebensborn« genutzt worden sei. Klaus schaut sie fragend an. Lebensborn? Er hat davon noch nie gehört. »Stramme Burschen von der SS waren hier einquartiert«, erläutert die Unbekannte, »sehr feine Leute wirklich: die reinsten Bullen. No, und als Bullen oder Hengste sind s’ dann auch benützt worden, zwegen der Rasse, verstehen S’.«
Etwa neuntausend Kilometer Luftlinie von München entfernt liegt Pacific Palisades. Dieses wunderschöne Fleckchen Erde – ruhig, mit mildem Klima und immergrüner Vegetation – ist ein vornehmer Stadtteil von Los Angeles und geprägt durch ein Labyrinth kleiner, verwinkelter und kurvenreicher Straßen. Am dortigen San Remo Drive Nummer 1550 sind seit gut vier Jahren Klaus Manns Eltern Thomas und Katia ansässig. Sie hatten Deutschland nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen müssen und waren über Zwischenstationen in der Schweiz und Südfrankreich in die Vereinigten Staaten gelangt.
Thomas Mann erlebt den 8. Mai als ermüdenden Tag. Ist er es gewohnt, am Morgen genüsslich zu speisen (»Zum Frühstück Thee, 2 Eier ohne das Weiße des einen und Toast mit Honig«), anschließend zu baden und daraufhin nicht selten einen Spaziergang durch die benachbarten Straßen zu unternehmen, muss er heute auf nüchternen Magen das Haus verlassen. Die Feierlichkeiten zum »Victory Day« sind an der amerikanischen Ostküste bereits im vollen Gange, als Frau Katia ihren Gatten zum Arzt nach Beverly Hills fährt, wo sich der Schriftsteller einer gründlichen Untersuchung zu fügen hat. Seit dem Vorjahr klagt er über Gewichtsverlust sowie über wiederkehrenden nächtlichen Reizhusten samt chronischer Katarrhe – Leiden, für die bislang keine Ursache gefunden werden konnte. Nun soll eine Röntgenuntersuchung Klarheit bringen. Die Ärzte lassen ihn ein Kontrastmittel trinken und beginnen dann mit der Prozedur. Nach einer Mittagspause, die Mann zwar daheim verbringen, in der er allerdings immer noch nichts zu sich nehmen darf, werden am Nachmittag weitere Röntgenbilder angefertigt. »Im Auto etwas Wermut und Cigarette«, notiert er nach Abschluss der Behandlung. »Zu Hause Suppe, Kotelets und Kaffee.« Einen Grund für Thomas Manns Leiden findet man nicht.
Am Abend nehmen Thomas und Katia Mann vor dem Radioapparat Platz und hören die Aufzeichnung von Präsident Trumans Rede. Obwohl Thomas Mann nicht zuletzt wegen der ihn erschöpfenden medizinischen Untersuchungen keinesfalls nach Überschwang zumute ist, öffnet er zur Feier des Tages eine Flasche Champagner. In sein Tagebuch notiert er: »Die Russen suchen weiter vergebens nach Hitlers Leichnam.«
»Alle miteinander sind stolz darauf, was sie in fünf Kriegsjahren geleistet haben«, ätzt der Schriftsteller Erich Kästner am 8. Mai. Die Werke des Sechsundvierzigjährigen galten unter den Nationalsozialisten als »entartet« und waren im Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz verbrannt worden. »Gegen Dekadenz und moralischen Verfall!«, schrie damals ein Student, als er Kästners Roman Fabian in die Flammen warf. Propagandaminister Joseph Goebbels verachtete Autoren wie Kästner, die er als Repräsentanten einer »Asphaltliteratur« betrachtete. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Kästner trotz eines offiziellen Publikationsverbotes gut im Geschäft war und unter Verwendung von Pseudonymen das eine oder andere Drehbuch für die nationalsozialistische Filmindustrie verfassen konnte.
Zum Feiern ist er am heutigen Tag der Kapitulation gleichwohl nicht aufgelegt. Kästner glaubt, bei den Siegern des Weltkriegs Selbstgerechtigkeit zu wittern, wenn er den Vorwurf hört, die Deutschen hätten sich nicht selbst vom Nazitum befreien können. »Wer hat denn, als längst der Henker bei uns öffentlich umging, mit Hitler paktiert?«, fragt er in seinen Aufzeichnungen. »Das waren nicht wir. Wer hat denn Konkordate abgeschlossen? Handelsverträge unterzeichnet? Diplomaten zur Gratulationscour und Athleten zur Olympiade nach Berlin geschickt? Wer hat denn den Verbrechern die Hand gedrückt statt den Opfern? Wir nicht, meine Herren Pharisäer!«
Erich Kästner schreibt sich regelrecht in Rage. Für ihn ist klar, dass die Alliierten ihre Mitschuld am Nationalsozialismus ignorieren: »Die Sieger, die uns auf die Anklagebank verweisen, müssen sich neben uns setzen. Es ist noch Platz.«
Die Russen sind da! Gegen einundzwanzig Uhr hört man plötzlich sich nähernden Motorenlärm. Davon aufgeschreckt, stehen die Menschen hinter ihren Fensterscheiben und blicken ängstlich nach draußen. Man sieht Panzer und Lastwagen der Roten Armee vorbeifahren, rote Fahnen und bengalische Feuer. Obwohl die Soldaten auf den Fahrzeugen Gewehre in ihren Händen halten, haben sie nichts Gefährliches an sich. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder treten nun auf die Straßen und jubeln ihnen zu, und die Soldaten winken zurück. Die Russen sind da! Es ist dieser kurze Satz, der sich am Abend des 8. Mai wie ein Lauffeuer durch das KZ Theresienstadt verbreitet. Die alte nordböhmische Festungsanlage, nordwestlich von Prag an der Mündung der Eger in die Elbe gelegen, war von den Nazis nach 1941 zu einem Konzentrationslager ausgebaut worden. Insgesamt mehr als einhundertvierzigtausend Menschen – darunter etwa fünfzehntausend Kinder – waren hier seitdem unter unmenschlichen Bedingungen interniert gewesen.
Auch Margot Bendheim ist von den Ereignissen völlig überwältigt. Die dreiundzwanzigjährige Berlinerin befindet sich seit dem Vorjahr im Lager, wo sie dem elf Jahre älteren Adolf Friedländer, den sie bereits seit Berliner Tagen flüchtig kannte, wiederbegegnet ist. Seit Kurzem sind die beiden ein Paar. Margot und Adolf sind ganz allein auf der Welt. Seine Mutter Fanny wurde im Dezember 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet, Margots Mutter Auguste und ihr Bruder Ralph folgten einen Monat später. Adolfs Schwester Ilse soll es über Italien in die Vereinigten Staaten geschafft haben; ob sie noch lebt, weiß er nicht.
Margot und Adolf gehen an jenem Dienstagabend, als die Rote Armee Theresienstadt erreicht, zur Lagerpforte. Das Tor ist weit geöffnet, und die gefürchteten Wachen sind verschwunden. Die beiden könnten hindurchtreten, doch sie stehen minutenlag wie angewurzelt davor. Ist es ein Traum? Kann es wirklich sein? Dann machen sie vorsichtig ein paar Schritte nach vorne und befinden sich plötzlich auf der Straße nach Prag. »Neben mir steht Adolf«, erinnert sich Margot. »Wir sehen uns an. Wir erleben die Befreiung zusammen. Ein Moment, den wir nie vergessen werden.«
Wird der Sieg über Nazi-Deutschland in London, Paris und New York bereits seit vierundzwanzig Stunden ausgelassen gefeiert, herrscht in Moskau eine merkwürdige Stille. Das Leben geht seinen gewohnten Gang, könnte man denken, und als ob es das zu beweisen gelte, sendet der Moskauer Rundfunk am Nachmittag ein Märchen. Stalin aber hat entschieden, die in Reims unterzeichnete Kapitulationserklärung nur als ein »vorläufiges Protokoll« zu betrachten. Dieses Dokument, fordert er, müsse durch einen »Akt der allgemeinen bedingungslosen Kapitulation« ersetzt werden, der im Hauptquartier von Marschall Georgi Schukow in Berlin ausgearbeitet und unterzeichnet werden solle. Stalin begründet dies mit der Befürchtung, die Kapitulation könnte von den Wehrmachtsverbänden im Osten nicht befolgt werden, doch das ist wohl nur vorgeschoben. In Wahrheit geht es ihm um etwas anderes: Prestige. Die einzige »echte« Kapitulation sollte nur gegenüber einem sowjetischen Befehlshaber erfolgen, schließlich hatte die Rote Armee die Hauptlast des Krieges getragen. Damit ist der ursprüngliche Plan, das Kriegsende gleichzeitig in Washington, London und Moskau zu verkünden, vom Tisch. Stalin will seinen eigenen »Victory Day« am 9. Mai. Er wird ihn bekommen.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai findet am Sitz des Oberkommandierenden der Roten Armee in Deutschland, Marschall Schukow, die von Stalin verlangte Unterzeichnung einer weiteren Kapitulationserklärung statt. In einem Gebäude, das bis vor Kurzem der Wehrmacht als Pionierschule diente und in der Militäringenieure ausgebildet wurden, wird der Krieg ein zweites Mal beerdigt. Anwesend sind neben Schukow der britische Luftmarschall Arthur Tedder, der US-General Carl Spaatz sowie seitens der Franzosen General Jean de Lattre de Tassigny. Die deutsche Delegation besteht aus Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg für die Marine und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff für die Luftwaffe.
Über hundert Journalisten und Fotoreporter warten gespannt, als Schukow um kurz nach Mitternacht die deutschen Militärs in den Saal befiehlt. Die Delegation tritt ein, Keitel hebt seinen Marschallstab zum Gruß und setzt sich dann hin. Schukow fragt ihn, ob er die Kapitulationsurkunde gelesen habe, was Keitel bejaht. Dann beordert der sowjetische Marschall die Deutschen zu sich. »Mit einem unguten Blick auf das Präsidium erhob sich Keitel rasch von seinem Platz«, erinnert sich Schukow, »dann senkte er die Augen, nahm langsam seinen Marschallstab vom Tisch und kam mit unsicheren Schritten auf unseren Tisch zu. Sein Monokel fiel herunter und baumelte an der Kordel, das Gesicht bedeckte sich mit roten Flecken.« Keitel unterschreibt nun im Blitzlichtgewitter der Reporter die Kapitulationsurkunde in fünffacher Ausfertigung, danach folgen von Friedeburg und Stumpff. Im Anschluss daran setzen Schukow und die Vertreter der Alliierten ihre Unterschriften unter die Dokumente, und die Zeremonie ist beendet. Als Keitel bemerkt, dass sein Adjutant währenddessen in Tränen ausgebrochen ist, zischt er ihn laut vernehmlich an: »Lassen Sie das. Nach dem Krieg können Sie ein Vermögen verdienen, wenn Sie ein Buch verfassen: ›Mit Keitel im russischen Kriegsgefangenenlager‹.« Es ist 0.43 Uhr.
»Und plötzlich weicht die gestaute Spannung aus dem Saal«, erinnert sich ein Zeuge. »Ein allgemeiner Seufzer der Erleichterung und Erschöpfung bricht sich Bahn. Die Kapitulation ist besiegelt, der Krieg ist zu Ende.« Nachdem Keitel, von Friedeburg und Stumpff den Saal verlassen haben, lässt Georgi Schukow ein reichhaltiges Essen auftragen sowie Wodka und Champagner servieren. Die deutsche Delegation wird derweil in einem benachbarten Gebäude nicht weniger opulent mit kalten und warmen Speisen verköstigt. »Zum Schluss gab es noch gefrorene frische Erdbeeren, die ich zum ersten Mal in meinem Leben vorgesetzt erhalten hatte«, lobt Wilhelm Keitel die Verpflegung. »Offenbar hat ein Berliner Schlemmer-Restaurant diese Nachttafel geliefert, denn auch die Weine waren deutschen Ursprungs.«
Etwa zu dieser Zeit tritt Juri Borissowitsch Lewitan, der leitende Sprecher von Radio Moskau, vor das Mikrofon, um zu verkünden, was der Rest der Welt längst weiß. Innerhalb weniger Minuten füllt sich nun das Zentrum Moskaus mit Menschen, viele noch im Nachthemd, die jubelnd »Sieg! Sieg!« rufen. Etliche weinen, andere beten. Am Abend wird eine Salve von tausend Kanonenschüssen abgefeuert, ehe sich Stalin persönlich an sein Volk wendet: »Vor drei Jahren verkündete Hitler vor aller Welt, dass die Zerstückelung der Sowjetunion, die Losreißung des Kaukasus, der Ukraine, Belorusslands, der baltischen Länder und anderer Sowjetgebiete zu seiner Aufgabe gehört. Er erklärte unumwunden: ›Wir werden Russland vernichten, dass es sich niemals mehr erheben kann.‹ Das war vor drei Jahren. Die wahnwitzigen Ideen Hitlers sollten jedoch nicht in Erfüllung gehen – im Verlaufe des Krieges sind sie wie Spreu im Winde verweht. Was in Wirklichkeit herauskam, ist das gerade Gegenteil dessen, wovon die Hitler-Leute faselten. Deutschland ist aufs Haupt geschlagen. Die deutschen Truppen kapitulieren. Die Sowjetunion feiert den Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten.« In Europa beginne nun eine Zeit der friedlichen Entwicklung, fährt Stalin fort. »Ruhm und Ehre unserem großen Volke, dem Siegervolk!« Die westlichen Alliierten erwähnt er mit keinem Wort.
Irgendwann an jenem 9. Mai, als in Moskau der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert wird, greift Swetlana zum Telefon und ruft ihren Vater an. Während sie die Nummer wählt, denkt die Neunzehnjährige an ihre letzte Begegnung mit ihm zurück. Die war im Vorjahr, als Swetlana ihm eröffnete, ihren Freund Grigori heiraten zu wollen. »Hol dich der Teufel, mach, was du willst«, erwiderte der Alte damals und erklärte, seinen Schwiegersohn niemals treffen zu wollen. Auch als sie wenig später schwanger wurde, reagierte der Herr Papa nicht gerade überschwänglich. »Du hast frische Luft nötig«, sagte er einsilbig und schickte sie auf seine Datscha. Swetlana fürchtet sich nun verständlicherweise ein wenig vor dem Gespräch mit ihrem alten Herrn, der so schrecklich herrisch und rücksichtslos sein kann.
»Papa, ich gratuliere dir zum Sieg!«, sagt Swetlana, als ihr Vater den Hörer abnimmt.
»Ja, der Sieg«, antwortet er nachdenklich. »Danke, ich beglückwünsche dich. Wie fühlst du dich?«
Swetlana stammelt ein paar Worte, dann bricht sie in Tränen aus. Wie so viele andere ist sie von den Ereignissen völlig überwältigt.
Am Abend erwarten Swetlana und Grigori zahlreiche Freunde zum Feiern in ihrer Wohnung. Der Wodka fließt in Strömen, und trotz des großen Gedränges finden die Gäste noch irgendwo Platz zum Tanzen.
Ihren Vater hat Swetlana nicht eingeladen. Mit Josef Stalin im Raum hätten die Anwesenden bestimmt nicht so viel Spaß.