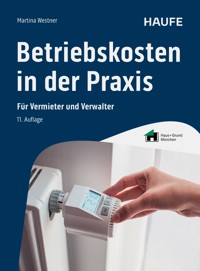
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch von Martina Westner bietet Ihnen eine ausführliche Anleitung für die rechtlich korrekte Betriebskostenabrechnung. Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung erläutert es die wichtigsten Fragen zur Vertragsgestaltung, zum Verteilerschlüssel und Fristen. Ebenso geht es auf die durch das Bürokratieentlastungsgesetz eingeführten Neuerungen zur Belegeinsicht ein. Darüber hinaus finden Sie zahlreiche Beispiele, Checklisten und Musterschreiben, die Ihnen in der täglichen Praxis im Umgang mit Mietern helfen. Inhalte: - Tipps zur richtigen Vertragsgestaltung - Übersicht der Betriebskosten - Ausführliche Erläuterung der einzelnen Positionen - Aufteilung des CO2 Preises zwischen Vermieter und Mieter - Ermittlung der richtigen Wohnfläche Neu in der 11. Auflage: - Bürokratieentlastungsgesetz - Einführung neuer Betriebskosten - Aktuelle BGH-Urteile
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumEinleitungFAQ: Die häufigsten Fragen zum Thema Betriebskosten1 Betriebskosten1.1 Definition der Betriebskosten in der Betriebskostenverordnung (BetrKV)1.2 Zuordnung zum Eigentümer1.3 Durch das Eigentum oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Objekts verursachte Kosten1.4 Laufende Entstehung1.5 Eigenleistungen des Vermieters1.6 Verwaltungskosten1.7 Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten2 Betriebskostenpositionen2.1 Umlagefähige öffentliche Lasten des Grundstücks2.2 Kosten der Wasserversorgung2.3 Kosten der Entwässerung2.4 Kosten der Heizung2.4.1 Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage2.4.2 Kosten des Betriebs einer zentralen Brennstoffversorgungsanlage2.4.3 Kosten der gewerblichen Lieferung von Wärme/Wärmecontracting2.4.4 Kosten der Wartung von Etagenheizung und Gaseinzelfeuerstätten2.5 Kosten der Warmwasserversorgung2.6 Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen2.7 Kosten des Betriebs des Personen- und Lastenaufzugs2.8 Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung2.9 Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung2.10 Kosten der Gartenpflege2.11 Kosten der Beleuchtung2.12 Kosten der Schornsteinreinigung2.13 Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung2.14 Kosten für den Hauswart2.15 Telekommunikation2.15.1 Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage2.15.2 Kosten des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteileranlage2.15.3 Kosten des Betriebs der mittels Glasfaser mit einem öffentlichen Netz verbundenen Verteileranlage2.16 Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege2.17 Sonstige Betriebskosten2.18 ABC der sonstigen Betriebskosten2.19 Nicht umlagefähige Betriebskosten2.20 Rauchwarnmelder3 Vertragliche Grundlagen für die Umlage der Betriebskosten3.1 Mietvertrag und Betriebskosten3.1.1 Gestaltung der Mietstruktur3.1.2 Betriebskostenvereinbarung3.1.3 Bestimmtheits- und Transparenzgebot3.1.4 Fälle aus der Rechtsprechung3.2 Änderung der Mietstruktur3.2.1 Heizkostenverordnung3.2.2 Was gilt bei gewerblichen Mietverhältnissen?3.2.3 Was gilt bei Wohnraummietverhältnissen?3.2.4 Änderung der Mietstruktur durch schlüssiges Verhalten3.2.5 Umstellung von Eigenversorgung auf Wärmelieferung (Contracting) bei Wärme oder Warmwasser3.3 Einführung neuer Betriebskosten3.3.1 Vereinbarung3.3.2 Mehrbelastungsabrede3.3.3 Modernisierungsmaßnahme4 Betriebskostenvorauszahlung4.1 Vereinbarung einer Betriebskostenvorauszahlung4.2 Angemessenheit der Vorauszahlung4.3 Fälligkeit der Vorauszahlungen4.4 Anpassung von Vorauszahlungen4.5 Geltendmachung rückwirkender Erhöhungen4.6 Berücksichtigung der Mehrwertsteuer4.7 Besonderheiten beim Einfamilienhaus5 Betriebskostenpauschale5.1 Anpassung bei gewerblichen Mietverhältnissen5.2 Anpassung bei Wohnraummietverhältnissen5.2.1 Erhöhung der Betriebskostenpauschale (§ 560 Abs. 1, 2 BGB)5.2.2 Ermäßigung der Betriebskostenpauschale6 Abrechnung6.1 Form6.2 Inhalt6.2.1 Aufstellung der Gesamtkosten6.2.2 Angabe und Erläuterung des Verteilerschlüssels6.2.3 Abzug der Vorauszahlungen6.2.4 Berücksichtigung der Mietminderung bei der Abrechnung6.3 Fälligkeit des Abrechnungssaldos6.4 Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen7 Verteilerschlüssel7.1 Gesetzliche Regelung7.2 Die wichtigsten Umlageschlüssel im Einzelnen7.2.1 Wohnfläche7.2.2 Kostenverteilung bei Wohnungseigentum7.2.3 Personenzahl7.2.4 Miet- oder Wohneinheiten7.2.5 Verbrauchs- und Verursachungserfassung7.2.6 Kombinierter Personen-/Flächenschlüssel7.2.7 Personenmonate/Personentage7.3 Vorwegabzug7.4 Leerstand7.5 Verteilerschlüssel bei den einzelnen Betriebskostenarten7.5.1 Grundsteuer7.5.2 Wasser und Abwasser7.5.3 Exkurs Kaltwasserzähler7.5.4 Lift7.5.5 Weitere Betriebskosten7.6 Änderung des Umlageschlüssels8 Wohn- und Nutzfläche8.1 Anwendungsbereich8.2 Einzelheiten8.2.1 Grundfläche8.2.2 Ermittlung der Grundfläche8.2.3 Wie werden die Grundflächen bei der Wohnfläche angerechnet?8.3 Vereinbarungen von Flächenangaben im Mietvertrag8.4 Rechtsfolgen falscher Flächenangaben im Mietvertrag8.5 WoFlV im Vergleich mit II. BV und DIN 2839 Abrechnungsfrist und Ausschlussfrist9.1 Abrechnungspflicht9.2 Abrechnungszeitraum9.2.1 Wenn Verbrauchs- und Abrechnungszeitraum auseinanderfallen (Leistungs- und Abflussprinzip)9.2.2 Besonderheiten bei Wohnungseigentum9.3 Berechnung der Abrechnungs- und Ausschlussfrist9.4 Rückforderungsansprüche des Mieters bei fehlender Abrechnung10 Einwendungen des Mieters10.1 Einwendungsfrist und Ausschlussfrist10.2 Einsichtsrecht des Mieters10.2.1 Anspruch und Umfang der Einsichtnahme10.2.2 Ort der Einsichtnahme10.3 Fotokopien10.4 Wenn der Vermieter keine Einsicht gewährt11 Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten11.1 Pflicht zur Verbrauchserfassung11.2 Duldungspflicht des Nutzers11.3 Umlage der Kosten11.4 Verbrauchserfassung11.4.1 Messgeräte11.4.2 Pflicht zur Fernablesung11.5 Bei Mieterwechsel: Zwischenablesung11.5.1 Wenn keine Zwischenablesung möglich ist11.5.2 Kosten der Zwischenablesung11.6 Einzelfragen zur Heizkostenabrechnung11.7 Aufteilung des CO2-Preises12 Gebot der Wirtschaftlichkeit12.1 Welche Betriebskosten kann der Vermieter an den Mieter weitergeben?12.2 In welcher Höhe darf der Vermieter Betriebskosten in Rechnung stellen?12.2.1 Angemessenheit der Höhe12.2.2 Beispiel: Hausmeister/Hauswart12.2.3 Beweis- und Darlegungslast12.2.4 Wirtschaftlichkeitsgebot gilt auch für Verbrauchserfassungsgeräte12.3 Rechtsfolgen bei einem Verstoß13 Parteiwechsel13.1 Vermieterwechsel13.1.1 Vermieterwechsel durch Zwangsvollstreckung13.1.2 Insolvenzverfahren13.2 Mieterwechsel14 Verjährung und Verwirkung von Ansprüchen14.1 Verjährung der Ansprüche des Vermieters14.2 Verjährung der Ansprüche des Mieters14.3 Berechnung der Verjährungsfrist14.4 Unterbrechung bzw. Hemmung der Verjährung14.4.1 Neubeginn der Verjährung14.4.2 Hemmung der Verjährung14.4.3 Beispiele/Verjährungstabelle14.5 Verwirkung14.6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht15 Betriebskostenabrechnung bei preisgebundenen Wohnungen15.1 Der Vermieter ist zur Betriebskostenabrechnung verpflichtet15.2 Einzelheiten der Abrechnung16 Datenschutz17 MusterabrechnungAbkürzungs- und LiteraturverzeichnisDie AutorinIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-19119-4
Bestell-Nr. 06258-0011
ePub:
ISBN 978-3-648-19120-0
Bestell-Nr. 06258-0105
ePDF:
ISBN 978-3-648-19121-7
Bestell-Nr. 06258-0155
Martina Westner
Betriebskosten in der Praxis
11. aktualisierte Auflage, November 2025
© 2025 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © djedzura, iStock
Produktmanagement: Jasmin Jallad
Lektorat: Cornelia Rüping
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Einleitung
Die Betriebskostenabrechnung gibt in der Praxis oft Anlass zu Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter. Stetig steigende Betriebskosten sowie Neuerungen, die ebenfalls zu höheren Kosten führen, zum Beispiel Vorgaben nach der Heizkostenverordnung (Einbau von funkablesbaren Erfassungsgeräten, Informationspflichten), rücken sowohl die Erstellung als auch die Überprüfung der Betriebskostenabrechnung in den Fokus der Vertragsparteien. Für Vermieter gilt es daher nicht nur, neue Urteile zu berücksichtigen, sondern auch schon bei der Vertragsgestaltung die richtigen Vereinbarungen zu treffen, um später bei der Abrechnung keine bösen Überraschungen zu erleben. Inzwischen gehört dieses Thema zu den Schwerpunkten der Beratung durch örtliche Haus- und Grundbesitzervereine.
In diesem Ratgeber wird daher die »richtige« Vertragsgestaltung bei Abschluss des Mietvertrags ausführlich erörtert. Denn damit werden die entscheidenden Weichen für die künftige Abrechnung der Betriebskosten gestellt. Der Gesetzgeber gestattet die Abrechnung der Betriebskosten nur, wenn dies mietvertraglich eindeutig festgelegt wurde.
Die BetriebskostenabrechnungBetriebskostenabrechnung muss rechtzeitig gefertigt und ordnungsgemäß sein, damit der Vermieter eine Nachforderung geltend machen kann. Dieses Buch befasst sich sehr ausführlich mit der richtigen Erstellung der Abrechnung, da sich in der Praxis gezeigt hat, dass viele Abrechnungen fehlerhaft sind.
Der Bundesgerichtshof hat in aktuellen Urteilen die Anforderungen an eine formell ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung noch einmal reduziert. Beispielsweise gilt der fehlende Vorwegabzug bei den Gesamtkosten nur noch als materieller Fehler. Außerdem hat der BGH seine bisherige 10 %-Rechtsprechung bei einer Differenz zwischen vereinbarter und tatsächlicher Wohnfläche aufgegeben. Maßgeblich ist nun nur noch die tatsächliche Wohnfläche.
In Zeiten steigender Energie- und Betriebskosten ist auch die Anpassung der Vorauszahlungen ein wichtiges Thema. Welche Verteilerschlüssel bei der Abrechnung zugrunde zu legen sind und wie zum Beispiel die richtige Wohnfläche ermittelt wird, wird ebenfalls detailliert erörtert.
Ausführlich behandelt werden darüber hinaus die Fragen, die sich rund um das Thema Betriebskosten ergeben, Hilfestellung geben zahlreiche Musterbriefe, Tipps und Beispiele.
In einem eigenen Kapitel werden die Neuerungen erläutert, die durch die Novelle der Heizkostenverordnung zum 1.12.2021 in Kraft getreten sind (unter anderem die Pflicht zur Fernablesbarkeit der Verbrauchserfassungsgeräte). Außerdem wird die zum 1.1.2023 in Kraft getretene Aufteilung des CO2-Preises zwischen Vermieter und Mieter ausführlich erklärt. Die Neuerungen bei der Belegeinsicht, die durch das Bürokratieentlastungsgesetz eingeführt wurden, werden ebenfalls erläutert.
Das vorliegende Fachbuch soll Vermieter dabei unterstützen, einfach und schnell korrekte Betriebskostenabrechnungen zu erstellen. Zudem informiert es über die richtige Vorgehensweise, falls Mieter Einwendungen erheben.
München, im Oktober 2025
Martina Westner
FAQ: Die häufigsten Fragen zum Thema Betriebskosten
Die mietrechtliche Beratungspraxis zeigt, dass es nicht nur im Rahmen von Abrechnungen über die Betriebskosten zahlreiche Fragen und Probleme zu klären gilt. In diesem Buch werden daher die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit Betriebskosten beantwortet. Es werden zum Beispiel die Voraussetzungen für die richtigen vertraglichen Grundlagen, Anpassungen sowie die Umlage neu entstandener Betriebskosten anschaulich und praxisrelevant erörtert. Welche Kosten auf Mieter umgelegt werden können, wird ebenfalls ausführlich dargestellt. Schwerpunktmäßig werden zudem die Voraussetzungen für die Erstellung einer rechtswirksamen Betriebskostenabrechnung sowie die verschiedenen Verteilerschlüssel behandelt.
Welche Kosten gelten als Betriebskosten?
Die Betriebskostenverordnung enthält eine Aufzählung umlagefähiger Positionen, die ein Vermieter/Verpächter im Rahmen eines Miet- oder Pachtverhältnisses an seinen Vertragspartner weitergeben kann. Darüber hinaus können vertraglich noch weitere, in der Betriebskostenverordnung nicht genannte Kosten, als umlagefähig vereinbart werden.
Wie muss eine wirksame Umlagevereinbarung vertraglich gestaltet werden?
Der Gesetzgeber hat in § 556 BGB die Rechtsgrundlage für mögliche Vertragsgestaltungen geschaffen. Danach kann für die Betriebskosten eine Vorauszahlung/Abschlagszahlung oder Pauschale, die neben der Miete geschuldet ist, vereinbart werden.
Welcher Unterschied besteht zwischen einer Vorauszahlung/Abschlagszahlung und einer Pauschale?
Eine Vorauszahlung/Abschlagszahlung berechtigt den Vermieter einerseits, verpflichtet ihn jedoch andererseits auch, einmal jährlich eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen. Wurde dagegen eine Pauschale vereinbart, ist eine Abrechnung nicht möglich und kann vom Mieter auch nicht gefordert werden.
Wie kann eine Vorauszahlung und eine Pauschale angepasst werden?
Sowohl für die Anpassung der Vorauszahlung als auch für die Pauschale gibt es gesetzliche Grundlagen, die in § 560 BGB festgelegt sind.
Können während des Mietverhältnisses neu entstehende Betriebskosten weitergegeben werden?
Wird zum Beispiel ein Aufzug eingebaut oder ein Hausmeister angestellt, so entstehen neue Kosten. Je nach vertraglicher Regelung oder wenn eine Modernisierungsmaßnahme durchgeführt wurde, kann eine Umlage erfolgen.
Wie kann die Betriebskostenabrechnung rechtssicher gestaltet werden?
Die Abrechnung hat sowohl formale als auch materielle Voraussetzungen, die unbedingt beachtet werden sollten. Bei Verstößen kann dies zur Unwirksamkeit der Abrechnung führen, mit der Folge, dass der Vermieter eine Nachzahlung nicht fordern kann. Korrekturmöglichkeiten bestehen nur in engen Grenzen.
Welche Verteilerschlüssel gibt es?
Die am häufigsten verwendeten Umlageschlüssel sind das Verhältnis der Wohn- bzw. Nutzflächen und der Mieteigentumsanteil.
Welche Fristen sind seitens des Vermieters zu beachten?
Die wichtigste Frist ist die sogenannte Abrechnungsfrist. Diese beträgt zwölf Monate. Daneben sieht das Gesetz auch Fristen bei der Anpassung der Pauschale vor.
Welche Fristen sind seitens des Mieters zu beachten?
Die wichtigste Frist ist die sogenannte Einwendungsfrist. Diese beträgt ebenfalls zwölf Monate und beginnt mit Erhalt der Abrechnung zu laufen.
Wann verjähren Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit einer Abrechnung ergeben?
Aus einer Abrechnung ergibt sich entweder eine Forderung auf Nachzahlung oder einer Gutschrift. Diese Ansprüche unterliegen der Verjährung. Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
Was ist bei einem Vermieter- bzw. Mieterwechsel zu beachten?
Wechseln die Parteien eines Mietverhältnisses, so bleibt das Mietverhältnis grundsätzlich bestehen. Die vertraglichen Vereinbarungen gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger über.
1 Betriebskosten
1.1 Definition der Betriebskosten in der Betriebskostenverordnung (BetrKV)
Nach Definition des § 556 Abs. 1 BGB bzw. § 1 Abs. 1 BetrKV Betriebskosten, Definitionsind BetriebskostenBetriebskosten solche Kosten, »die dem Eigentümer oder dem Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, der Anlagen, der Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen«. Diese Definition gilt unmittelbar für preisgebundenen wie für preisfreien Wohnraum.
1.2 Zuordnung zum Eigentümer
Betriebskosten sind nur solche Kosten, die dem Eigentümer zugeordnet werden. Abzugrenzen hiervon sind ferner die Kosten, die dem Mieter entstehen, weil er selbst Vertragspartner eines Leistungserbringers ist, zum Beispiel für den in der Wohnung verbrauchten Strom oder für das Gas seiner Gastherme.
1.3 Durch das Eigentum oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Objekts verursachte Kosten
Als Betriebskosten gelten nur diejenigen Kosten, die objektbezogen sind. Eine FremdenverkehrsabgabeFremdenverkehrsabgabe knüpft beispielsweise nicht an das Eigentum am Grundstück an und ist deshalb nicht umlagefähig. Kosten, die durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Mietobjekts entstehen, zum Beispiel für das Entfernen von GraffitiGraffiti oder übermäßiger Verschmutzung des Treppenhauses, können in der Regel nicht angesetzt werden.
1.4 Laufende Entstehung
Wesentliches Merkmal der Betriebskosten ist die laufende EntstehungBetriebskosten, laufende Entstehung. Die Kosten brauchen weder in derselben Höhe noch in denselben Zeitabständen, etwa jährlich, anzufallen. Auch Kosten, die turnusmäßig alle drei bis fünf Jahre entstehen, gehören zu den Betriebskosten (zum Beispiel Überprüfung des Aufzugs durch den TÜV, Eichung der Kaltwasserzähler, Reinigung des Heizöltanks.1 Bei einem Turnus von über sieben Jahren beginnt der kritische Grenzbereich. Kosten, die nur alle zehn oder zwölf Jahre anfallen (zum Beispiel Dichtigkeitsprüfung der Gasleitungen), sind dementsprechend nicht umlagefähig. Einmalige oder in nicht voraussehbaren Zeitabständen entstehende Kosten fallen nicht unter den Begriff der Betriebskosten (zum Beispiel Kosten der Zwischenablesung oder Kosten der Entrümpelung wegen Dachgeschossausbaus).
Hinsichtlich der Kosten für eine Öltankreinigung, die zumeist alle sieben Jahre durchgeführt wird, hat der BGH entschieden, dass diese in einem Betrag in dem Abrechnungsjahr umgelegt werden dürfen, in dem sie angefallen sind.2 Der Vermieter ist auch nicht verpflichtet, die Kosten auf sieben Jahre aufzuteilen.
1 BGH, 11.11.2009, VIII ZR 221/08, WuM 2010, 33
2 BGH, 11.11.2009, VIII ZR 221/08, WuM 2010, 33
1.5 Eigenleistungen des Vermieters
Der Vermieter kann EigenleistungenEigenleistung für einzelne Betriebskostenarten, die er selbst erbringt, als BetriebskostenBetriebskostenBetriebskosten, Eigenleistung ansetzen. In der Regel sind das in kleinen Mietshäusern Hausmeisterdienste, Gartenarbeiten oder Winterdienst, die der Vermieter persönlich erbringt. § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrKV ermöglicht die Einbeziehung von Sach- und Arbeitsleistungen. Die Eigenleistung kann der Vermieter mit dem Betrag ansetzen, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten entstehen könnte. Eigenleistungen können vom Vermieter höchstpersönlich oder durch unselbstständige Dritte erbracht werden. Überträgt der Vermieter Arbeiten einem Angehörigen, kann er auch hierfür die Kosten als Eigenleistung umlegen. In der Regel kann dem Umfang nach nur ein nachweisbarer Aufwand berücksichtigt werden. Der Vermieter kann zum Nachweis der Kosten das Angebot einer Fremdfirma mit detailliertem Leistungsverzeichnis vorlegen.3 Für alle Arten von Eigenleistungen kann der Vermieter allerdings keine Umsatzsteuer geltend machen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 BetrKV).
3 BGH, 14.11.2012, VIII ZR 41/12, WuM 2013, 44
1.6 Verwaltungskosten
Nicht zu den Betriebskosten gehören VerwaltungskostenVerwaltungskosten, das heißt die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrKV). Die Kosten für die Erstellung der Betriebskostenabrechnung können ebenfalls nicht angesetzt werden, auch nicht über eine zusätzliche Pauschale.4 Ausnahmen bilden nur die Kosten, die für die Berechnung und Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten, für die verbrauchsabhängig ermittelten Kaltwasserkosten sowie die Kosten der Müllbeseitigung bei vorhandenen Müllmengenerfassungsanlagen entstehen.
4 BGH, 19.12.2018, VIII ZR 254/17, NZM 2019, 253
1.7 Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten
Kosten für die Instandhaltung oder Instandsetzung, die während der Nutzungsdauer zur ErhaltungInstandhaltungs- und Instandsetzungskosten des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrKV), sind keine Betriebskosten. Auch InstandhaltungsrücklagenInstandhaltungsrücklage sind nicht umlagefähig. Lediglich Instandhaltungskosten in Form von Wartungskosten sind in den ausdrücklich zugelassenen Fällen als Betriebskosten umlagefähig, zum Beispiel für Heizungs- oder Liftwartung. Enthalten Betriebskostenarten Instandhaltungskosten, beispielsweise beim Vollwartungsvertrag für den Aufzug, muss ein Vorwegabzug erfolgen (siehe Kapitel 7.3).
Wichtig
Zu beachten ist, dass im Rahmen eines Gewerberaummietvertrags Verwaltungs- und Instandhaltungskosten auf den Mieter umgelegt werden können, was einer vertraglichen Vereinbarung bedarf, die auch formularmäßig möglich ist.
2 Betriebskostenpositionen
Nach § 556 Abs. 1 BGB können die Parteien vereinbaren, dass »der Mieter die Betriebskosten trägt«. Betriebskosten nach § 556 Abs. 1 BGB sind die in § 2 BetrKV genannten Kostenpositionen.
§ 2 BetrKV enthält die Aufstellung der einzelnen Betriebskosten einschließlich der Heiz- und Warmwasserkosten. Die Betriebskostenverordnung ist am 1.1.2004 in Kraft getreten. Sie hat die umlagefähigen Betriebskosten gegenüber dem bisherigen Betriebskostenkatalog der Anlage 3 zu § 27 II. BV5 um einige Positionen erweitert. Für Mietverträge, die vor dem 1.1.2004 abgeschlossen wurden und für die der Mieter Betriebskosten gemäß Anlage 3 zu § 27 II. BV trägt, bleibt es bei der Altregelung.
Der BetriebskostenkatalogBetriebskostenkatalog umfasst folgende Positionen:
Grundsteuer,
Wasser,
Abwasser,
Entwässerung,
Heizung,
Warmwasser,
Aufzug,
Straßenreinigung,
Müllbeseitigung,
Gebäudereinigung/Ungezieferbeseitigung,
Gartenpflege,
Beleuchtung,
Kaminkehrer,
Sach- und Haftpflichtversicherung,
Hausmeister,
Antenne/Breitband/Glasfaser-Verteilanlage
Einrichtung der Wäschepflege,
sonstige Betriebskosten.
Im Folgenden werden die einzelnen Betriebskostenarten aus dem Katalog des § 2 BetrKV erläutert.
5 Gültig bis 31.12.2003
2.1 Umlagefähige öffentliche Lasten des Grundstücks
Nach § 2 Nr. 1 BetrKV gehört zu »den laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks namentlich die Grundsteuer«.
Es zählen also dazu: die Grundsteuer, RealkirchensteuernRealkirchensteuer, Deichabgaben6Deichabgabesowie Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden7Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden, nicht jedoch die Personen- oder RealsteuernRealsteuer des Vermieters und auch nicht die HypothekengewinnabgabeHypothekengewinnabgabe (diese wird nicht mehr erhoben) oder Anliegerbeiträge aus Erschließungs- oder Anschlussmaßnahmen8. Manche Gemeinden gehen dazu über, die StraßenausbaubeiträgeStraßenausbaubeiträge nicht mehr vorzufinanzieren, und erheben im Vorweg regelmäßig Beiträge von den Grundstückseigentümern. Diese Beiträge sind nicht als Betriebskosten umlagefähig, da der Grundstückseigentümer zum einen eine Gegenleistung für diese Abgabe erhält und es zum anderen an dem Merkmal des laufenden Entstehens der Kosten fehlt.9
Die GrunderwerbssteuerGrunderwerbssteuer ist gleichfalls nicht umlegbar, sie gehört zu den anschaffungsnahen Nebenkosten des Grundstückserwerbs und fällt ohnehin nicht laufend an. Auch die OrtskirchensteuerOrtskirchensteuer fällt nicht unter § 2 Nr. 1 BetrKV, da es sich um eine Personensteuer handelt, die von der Konfession des Vermieters abhängt.10
Eine FremdenverkehrsabgabeFremdenverkehrsabgabe stellt keine umlagefähige laufende öffentliche Last des Grundstücks dar, weil sie nicht an das Eigentum am Grundstück geknüpft ist, sondern – personenbezogen – an die jährlichen Einnahmen des Vermieters im Erhebungsgebiet.11 Gleichfalls nicht unter § 2 Nr. 1 BetrKV fallen die Kosten der Feuerstättenschau, weil diese nicht – wie die Grundsteuer – unmittelbar auf dem Grundstück lasten, sondern sich die Kosten erst mit ihrer Durchführung konkretisieren.12 Die Kosten können aber unter § 2 Nr. 9 BetrKV Kosten der Schornsteinfegerreinigung umgelegt werden.13
Der Vermieter ist grundsätzlich berechtigt, die GrundsteuerGrundsteuer in voller Höhe an die Mieter weiterzugeben. Handelt es sich um eine Eigentumswohnung, wird die Grundsteuer von der Kommune direkt für die jeweilige Wohnung erhoben, es muss nicht erst durch Addition eine Gesamtsumme gebildet werden. Auch ohne Verteilerschlüssel darf die Grundsteuer in voller Höhe »direkt« in der Abrechnung ausgewiesen werden.14 Der BGH hat die direkte Umlage mit Urteil vom 17.4.2013 nochmals bestätigt.15
Ferner zählen GrundsteuernachforderungenGrundsteuer, Nachforderung der Stadt/Gemeinde für zurückliegende Jahre zu den umlagefähigen Betriebskosten, obwohl es sich insofern nicht um eine laufende, sondern um eine einmalige Zahlung handelt.16 Der Vermieter kann die Nachzahlung von rückwirkend neu festgesetzten Grundsteuern auch bei zwischenzeitlicher Beendigung des Mietverhältnisses vom ehemaligen Mieter verlangen. Eine verspätete Abrechnung der Betriebskostenvorauszahlungen hat der Vermieter nicht zu vertreten, da diese nicht in seinen Einflussbereich fällt.17
Da der Vermieter bei gemischt genutzten Objekten einen einheitlichen Grundsteuerbescheid erhält, wurde viel diskutiert, ob ein Vorwegabzug für den gewerblich genutzten Anteil vorzunehmen ist.
Ein VorwegabzugGrundsteuer, Vorwegabzug ist dann erforderlich, wenn durch die gewerbliche Nutzung erhebliche Mehrkosten pro Quadratmeter entstehen. Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine ertragsunabhängige Objektsteuer. Die in einem Abrechnungsjahr erhobene Grundsteuer hängt grundsätzlich nicht von den in diesem Jahr erzielten Erträgen und deren Verteilung auf die Nutzung zu gewerblichen Zwecken einerseits und zu Wohnzwecken anderseits ab. Vielmehr wird die Grundsteuer anhand des Einheitswerts, des Grundsteuermessbetrags und des für die Gemeinde geltenden Hebesatzes ermittelt. Der Vermieter muss daher weder auf Basis des Einheitswertbescheids noch anhand der konkreten Einnahmen im Abrechnungsjahr ermitteln, welche Erträge auf die gewerbliche Nutzung und welche auf die Wohnnutzung entfallen, und keinen Vorwegabzug vornehmen.18
6 AG Winsen, 23.10.2013, 16 C 808/13, ZMR 2014, 217
7 LG Hamburg, 20.4.2000, 307 S 14/00
8 AG Greiz, 30.7.1998, 1 C 259/98 und 13.7.1998, 4 C 247/98, WuM 1999, 133 für kommunale Straßenausbaubeiträge
9 Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizkostenrecht, Rn. A 42
10 LG Landau, 3.7.2012, 1 S 30/12, WuM 2012, 469
11 OLG Schleswig, 14.3.2012, 4 U 134/11, ZMR 2012, 866
12 AG Soest, 6.2.2013, 12 C 280/12, DWW 2013, 340
13 Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizkostenrecht, Rn. A 176
14 BGH, 13.9.2011, VIII ZR 45/11, NZM 2012, 96
15 BGH, 17.4.2013, VIII ZR 252/12, WuM 2013, 358
16 OLG Frankfurt/Main, 7.4.1983, 1 U 213/82, ZMR 1983, 374
17 LG Rostock, 27.2.2009, 1 S 200/08, ZMR 2009, 924
18 BGH, 10.5.2017, VIII ZR 79/16, NZM 2017, 520
19 AG Hannover, 28.2.2017, 516 C 7749/16, ZMR 2017, 403
20 LG Hanau, 30.12.2020, 2 S 123/19, ZMR 2021, 887
21 LG Berlin, 13.1.2009, 65 S 458/07, GE 2009, 383; siehe auch BGH, 12.3.2008, VIII ZR 188/07, NZM 2000,444
22 AG Neuss, 1.6.1988, 30 C 518/87, DWW 1988, 284; AG Bremerhaven, 1.10.1986, 53 C 512/87, DWW 1987, 19
23 Nach § 60 Nr. 14 MessEG kann ein Verstoß mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 EUR geahndet werden.
24 BGH, 17.11.2010, VIII ZR 112/10, WuM 2011, 21
25 AG Berlin-Köpenick, 27.3.2012, 7 C 398/11, GE 2012, 759; Lammel, WuM 2015, 531; Ruff, WuM 2016, 255
26 BGH, 11.11.2009, VIII ZR 221/08, WuM 2010, 33
27 BGH, 12.3.2008, VIII ZR 188/07, WuM 2008, 288
28 BGH, 12.3.2008, VIII ZR 188/07, NZM 2008, 444
29 A. A. LG Berlin, 17.9.2010, 63 S 54/10, GE 2010, 1742
30 BGH, 14.2.2012, VIII ZR 207/11, WuM 2012, 405
31 BGH, 6.10.2009, VIII ZR 183/09, GE 2010, 1615
32 BGH, 6.10.2009, VIII ZR 183/09, GE 2010, 1615
33 LG Duisburg, 22.2.2006, 13 T 9/06, WuM 2006, 199; nur 10 % LG Kassel, 13.9.2002, 1 S 195/02, WuM 2006, 273
34 Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizungsrecht, Rn. A 74
35 AG Steinfurt, 8.7.2004, 4 C 59/04, WuM 2004, 567
36 AG Friedberg, 14.3.1985, C 5/84, WuM 1985, 369
37 AG Lörrach, 31.1.1995, 2 C 343/04, WuM 1995, 593
38 AG Regensburg, 11.8.1993, 9 C 2418/93, WuM 1995, 319
39 AG Friedberg, 18.3.1998, C 1626/96-17, WuM 2000, 381
40 AG Dresden, 16.2.2002, 143 C 3528/00, NZM 2001, 708
41 BGH, 11.11.2009, VIII ZR 221/08, WuM 2010, 33 zur Öltankreinigung
42 AG Wesel, 20.6.1990, 26 C 115/90, WuM 1990, 443; AG Ulm, 19.5.2000, 2 C 537/00, ZMR 2001, 550
2.3 Kosten der Entwässerung
Nach § 2 Nr. 3 gehören hierzu »die Gebühren der Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nichtöffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe«.
Darunter fallen sämtliche Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung durch eine öffentliche EntwässerungseinrichtungKosten der EntwässerungEntwässerung (Kanal-Kanalgebühren oder SielgebührenSielgebühren), unabhängig davon, ob sie für Schmutz- oder Regenwasser erhoben werden.43
In vielen Gemeinden werden die Entsorgungskosten für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers separat berechnet. Die Kosten des SchmutzwassersKosten des Schmutzwassers werden in der Regel nach der Menge des bezogenen Frischwassers berechnet. Die Gebühr für das NiederschlagswasserNiederschlagswasser wird nach der Größe der versiegelten Flächen berechnet (OberflächenwasserOberflächenwasser).
Enthält der Mietvertrag anstelle des Begriffs »Entwässerung« den Begriff »AbwasserAbwasser«, ist streitig, ob darunter auch das in das Kanalsystem abfließende Regenwasser gemeint ist. Der Mieter hat dann beide Gebühren zu zahlen, wenn die Gemeinde ihre Gebührenstruktur dahingehend verändert hat, dass anstelle einer Abwassergebühr nunmehr eine Gebühr für Schmutzwasser und eine Gebühr für Niederschlagswasser zu zahlen ist.44
Wenn das Gebäude nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist, sind bei einer hauseigenen Abwasseranlage wie SammelgrubeSammelgrube, SickergrubeSickergrube oder biologische KläranlageBiologische Kläranlage die Entleerungskosten, das heißt für die Abfuhr des gesammelten Schmutzwassers oder Klärschlamms, Reinigungskosten und Kosten der Wartung der Anlage, ansatzfähig.45
Ist eine EntwässerungspumpeEntwässerungspumpe im Einsatz, sind die Kosten für Strom, Reinigung, Prüfen und Abschmieren umlegbar.
Nicht zu den Betriebskosten gehören die Instandhaltungskosten an hauseigenen Entwässerungsanlagen oder Kosten für die Beseitigung von RohrverstopfungenRohrverstopfung oder vorbeugende Rohrreinigungen. Bei derartigen Maßnahmen handelt es sich um Instandhaltungsarbeiten.46
Es stellt keinen formellen Fehler dar, wenn der Vermieter die Kosten für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser zusammenfasst und einheitlich nach dem Flächenmaßstab abrechnet, obwohl nach den mietvertraglichen Vereinbarungen eine verbrauchsabhängige Abrechnung erfolgen soll. Möglicherweise kann der Mieter den Abrechnungsbetrag analog § 12 HeizKV um 15 % wegen unterbliebener Verbrauchserfassung kürzen.47
Die Kosten für die Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen sind nicht umlagefähig, weil es sich nicht um eine bloße Bestandsaufnahme handelt, sondern um die Feststellung von Undichtigkeiten, deren Beseitigung zu den Instandsetzungskosten zählt. Außerdem ist der Prüfturnus mit 20 Jahren wohl nicht mehr als laufend anzusehen.48
Gießwasserabzug
Der Vermieter ist aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots verpflichtet, bei den Wasserwerken einen GießwasserabzugGießwasserabzug zu erwirken (das heißt für Wasser, das nicht in die Kanalisation eingeleitet wird) und für die Erfassung Zwischenzähler an allgemein zugänglichen Wasserhähnen außerhalb des Hauses zu installieren.49 Versäumt er diesen Antrag, muss er wegen Verstoßes gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot die Entwässerungskosten entsprechend reduzieren.50
43 OLG Düsseldorf, 3.2.2000, 10 U 197/98, WuM 2000, 591
44 LG Hannover, 7.1.2004, 12 S 53/03, NZM 2004, 343; AG Tempelhof-Kreuzberg, 11.2.2008, 11 C 254/07, GE 2008, 1063
45 AG Bergisch Gladbach, 4.4.1984, 23 C 2/84, WuM 1985, 369; Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizkostenrecht, Rn. A 84; so auch AG Greiz, 25.6.1998, 1 C 115/98, WuM 1999, 65
46 AG Augsburg, 11.1.2012, 21 C 4988/11, WuM 2012, 201
47 BGH, 13.3.2012, VIII ZR 218/11, ZMR 2012, 615
48 Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizkostenrecht, Rn. A 87
49 AG Brandenburg, 8.11.2010, 34 C 16/10, GE 2010, 1751
50 AG Schöneberg, 9.9.1998, 6 C 421/97, GE 1998, 1343
2.4 Kosten der Heizung
2.4.1 Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage
Nach § 2 Nr. 4a BetrKV zählen zu den HeizungskostenKosten der Heizung die Kosten »des Betriebs der zentralen Heizanlage einschließlich Abgasanlage; hierzu gehören die Kosten des zur Wärmeerzeugung verbrauchten Stroms und der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung«.
Kosten des verbrauchten Stroms
Die Kosten des verbrauchten Stroms zum Betrieb von Wärmepumpen zählen seit 1.10.2024 zu den Kosten des Betriebs einer zentralen Heizungsanlage. Diese Stromkosten sind allerdings nicht mit denjenigen des Allgemeinstroms zu verwechseln. Für die Ermittlung des Stromverbrauchs ist ein Zähler zu installieren.
Brennstoffe
Die Kosten der verbrauchten BrennstoffeKosten der Heizung, Brennstoffe umfassen die Kosten für Heizöl, Gas, Holz, Holzpellets, Kohle und andere Brennstoffe sowie Brennstoffzusätze und Anfeuerungsmaterial. Kosten für das Trockenheizen eines Neubaus können nicht angesetzt werden, da sie nicht laufend, sondern einmalig entstehen. Wird mit Heizöl geheizt, sind der Anfangs- und der Endbestand des Heizöls im Tank zu ermitteln. Die Differenz ist der verbrauchte Brennstoff. Entscheidend ist also nicht der Zeitpunkt der Brennstoffrechnung, sondern der Zeitraum, in dem der Brennstoff verbraucht wurde. Resultiert der Endbestand aus mehreren Lieferungen mit unterschiedlichen Ölpreisen, sind zunächst die älteren Ölmengen mit den zugehörigen Preisen zu verrechnen.51 Fehlt in der Heizkostenabrechnung die Angabe des Anfangs- und Endbestands, ist die Abrechnung dennoch formell wirksam, da die Nennung der Brennstoffmenge und der darauf entfallenden Kosten ausreicht.52
Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit hat der Vermieter das günstigste Brennstoffangebot zu wählen. Er muss den Öltank aber nicht ständig nachfüllen. Zwar steht ihm eine gewisse Dispositionsfreiheit zu, die üblichen Kosten dürfen aber nicht um mehr als 20 % überschritten werden.53 Das LG Berlin54 sieht das Wirtschaftlichkeitsgebot noch als erfüllt an, wenn das Heizöl 6 % über dem optimalen Einkaufspreis liegt.
Der Vermieter darf auch nur die tatsächlich entstandenen Kosten ansetzen. Mengenrabatte sowie Preisnachlässe sind zugunsten des Mieters zu berücksichtigen. Er muss auf jeden Fall die Position »BrennstoffkostenBrennstoffkosten« erläutern, um dem Mieter die Möglichkeit der Prüfung zu geben, ob Investitionskosten des Heizungsbetreibers in der Position enthalten sind.55
Eine ordnungsgemäße Abrechnung über Brennstoffkosten erfordert nur die summenmäßige Angabe der Verbrauchswerte und der dafür angefallenen Kosten. Eine vollständige Überprüfbarkeit durch die Benennung des Anfangs- und des Endbestands des Heizöls gehört zur inhaltlichen Richtigkeit der Abrechnung und bleibt einer Belegeinsicht – wenn vom Mieter gewünscht – vorbehalten.56
LieferkostenKosten der Heizung, Lieferkosten sind die Beträge, die der Brennstofflieferant dem Vermieter in Rechnung stellt, nicht aber dafür aufgewendete Eigenleistungen.
Ob die üblichen Trinkgelder angesetzt werden dürfen, ist strittig. Der Vermieter wird Kosten dieser Art in aller Regel nicht belegen können.
Werden mehrere Wohngebäude von Beginn des Mietverhältnisses an durch eine Gemeinschaftsheizung versorgt, darf der Vermieter diese Gebäude zu einer AbrechnungseinheitAbrechnungseinheit zusammenfassen, auch ohne mietvertragliche Vereinbarung.57 Materielle Fehler der Betriebskostenabrechnung bezüglich der Aufteilung der Heiz- und Warmwasserkosten berühren die Wirksamkeit der Abrechnung nicht.
Es kommt nicht darauf an, ob die gemeinsame Heizungsanlage bereits bei Abschluss des Mietvertrags bestand, denn dem Vermieter ist es nicht verwehrt, eine Abrechnungseinheit im Lauf des Mietverhältnisses zu bilden.58 Außerdem ist die Bildung einer Wirtschaftseinheit, zu der die durch eine gemeinsame Heizungsanlage versorgten Gebäude zusammengefasst werden, ohne weiteres zulässig.59 Hat der Vermieter in der Abrechnung bei der Bezeichnung der WirtschaftseinheitWirtschaftseinheit die Hausnummern einiger Gebäude vergessen, berührt dies nicht die formelle Wirksamkeit der Abrechnung.60
Die Kosten für Frischwasser und Entwässerung dürfen im Rahmen der Heizkostenabrechnung abgerechnet werden.61
Betriebsstrom
Zu den Kosten des BetriebsstromsKosten der Heizung, BetriebsstromBetriebsstrom gehören sämtliche Stromkosten, die für das Betreiben der Heizungsanlage anfallen, zum Beispiel der Strom für Pumpen, Brenner, elektrisch arbeitende Wärmefühler, elektrische Wärmepumpen, die Beleuchtung des Heizraums sowie für Strom, der im Rahmen der Überwachung, Pflege und Reinigung der Anlage verbraucht wird. Gemäß § 7 HeizKV müssen die Kosten des Betriebs einer zentralen Heizungsanlage teilweise verbrauchsabhängig verteilt werden. Dazu gehören gemäß § 7 Abs. 2 HeizKV unter anderem die Kosten des Betriebsstroms. Es ist nicht zulässig, die für die Heizanlage aufgewendeten Stromkosten als Teil des Allgemeinstroms abzurechnen.62
Wird der Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler, sondern über den allgemeinen Stromzähler erfasst, muss geschätzt werden, welcher Anteil an dem Allgemeinstrom hierauf entfällt. Der BGH63 hat in diesem Fall die Schätzung der umlagefähigen Stromkosten für zulässig erachtet. Bestreitet der Mieter den vom Vermieter angesetzten Betrag, so muss der Vermieter die Grundlagen seiner Schätzung darlegen. Gibt es keinen Zwischenzähler, werden die Stromkosten entweder prozentual ermittelt oder sie dürfen nach dem Anschlusswert der betroffenen Geräte errechnet werden. Die Stromkosten dürfen mit etwa 3 % bis 6 % der gesamten Brennstoffkosten veranschlagt werden.64
Der StromverbrauchKosten der Heizung, Stromverbrauch kann nach der folgenden Formel65 errechnet werden.
Anschlusswert der elektrischen Geräte der Heizanlage in kW/h
x
24 h
x
Anzahl der Heiztage
x
Strompreis
Betriebsstrom der Heizanlage
Nach dem BGH66 ist es unschädlich, wenn in der Heizkostenabrechnung keine Kosten des Betriebsstroms aufgeführt werden. Dies führt weder zu einer Unwirksamkeit der Abrechnung aus formellen noch aus inhaltlichen Gründen.
Bedienung, Überwachung, Pflege
Zu den Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage gehören die Sach- und Personalkosten einschließlich der Sozialbeiträge, die dem Eigentümer laufend entstehen, insbesondere beim arbeitsintensiven Betrieb einer Kokszentralheizung. Bei vollautomatischen Öl- oder Gasheizungen werden Bedienungskosten meistens nicht anerkannt. Es sei denn, es handelt sich um eine größere Anlage. Bei halbautomatischen Anlagen ohne Thermostat und/oder Zeitregelung muss die Heizung jeweils auf die wechselnden Außentemperaturen oder die Nachtabsenkung eingestellt werden, sodass hier eine gewisse Bedienung notwendig ist.
Zu den Kosten der regelmäßigen Prüfung der BetriebsbereitschaftKosten der Heizung, Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft zählen die Kosten für einen WartungsdienstKosten der Heizung, Wartungsdienst (nicht Reparaturen). Eine Heizungswartung beinhaltet zum Beispiel das Überprüfen und Einstellen der Feuerungseinrichtungen, das Reinigen und Einstellen des Brenners einschließlich Austausch verschleißanfälliger Kleinteile wie Dichtungen, Filter und Zerstäuberdüsen, das Überprüfen der zentralen regeltechnischen Einrichtungen, Probeläufe, Messungen der Abgaswerte und der Abgastemperaturen, Kontrolle und Nachfüllen des Wasserstands67 sowie den Austausch des Elektrodensatzes bei der Gastherme.68 Die Wartungskosten für eine thermische Solaranlage sind umlagefähig (Überprüfung der Sauberkeit und Reinigung der Kollektoren, Überprüfung auf Undichtigkeit, Kontrolle des Frost- und Korrosionsschutzes der Solarflüssigkeit, Entlüftung des Solarkreises, Einstellen des Volumenstroms und der Druckverhältnisse, Einstellen der Umwälzpumpe).69 Ebenfalls umlagefähig sind die Kosten der Anfahrt.70
Prüfung der Gasleitungen
Die Kosten für die Überprüfung der GasleitungKosten der Heizung, GasleitungGasleitung, die vom Gastank zum Heizbrenner führen, sind umlagefähig. Etwas anderes gilt für die Überprüfung von Gasleitungen, die Etagenheizungen oder Einzelöfen in den Wohnungen versorgen. Für Gasleitungen sind nach der Empfehlung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) e. V. folgende Prüfungen vorzunehmen:
Jährlich eine einfache SichtkontrolleGasleitung, Sichtkontrolle (durch Hausmeister oder Vermieter selbst): Das AG Köln bestätigte dafür entstehende Kosten von 21,24 EUR als angemessen.71
Alle zwei Jahre qualifizierte Sichtkontrolle mit Gasspürgerät und detailliertem Protokoll.
Alle zwölf Jahre Prüfung auf Druck und Dichtigkeit: Die von einem Fachmann durchzuführende Kontrolle ist gemäß § 2 Nr. 4d BetrKV umlagefähig.72 Allerdings muss für die Ansetzbarkeit der Kosten nach der Funktion der Gasleitungen differenziert werden. Versorgen die Gasleitungen in den Wohnungen Gasheizgeräte und Gasherde zugleich, dient die DichtigkeitsprüfungGasleitung, Dichtigkeitsprüfung der Betriebssicherheit im Sinne des § 2 Nr. 4d BetrKV, sodass ihre Kosten ohne weiteres angesetzt werden dürfen.73 Versorgen die Gasleitungen allein Gasherde, setzt die Umlage dieser sonstigen Kosten eine entsprechende mietvertragliche Vereinbarung voraus. Eine häufigere Dichtigkeitsprüfung, zum Beispiel alle ein bis zwei Jahre, verstößt hingegen gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit.74
Reinigung der Anlage
Zu den Kosten der Reinigung der AnlageKosten der Heizung, Reinigung der Anlage gehört die Reinigung des Heizkessels durch Entfernung von Verbrennungsrückständen und Wasserablagerungen, insbesondere das Auswechseln kleinerer Teile, der Austausch eines Filtersatzes, das Zerlegen und der anschließende Zusammenbau des Ölbrenners sowie notwendige Dichtungen.
Öltankreinigung
Die wiederkehrenden Kosten der Reinigung des ÖltanksÖltank sind umlagefähige Betriebskosten. Bei den Tankreinigungskosten handelt es sich nicht um Instandhaltungskosten, denn die Tankreinigung dient nicht der Vorbeugung oder Beseitigung von Mängeln an der Heizanlage, sondern vielmehr der Aufrechterhaltung ihrer Funktionsfähigkeit. Betriebskosten, die nicht jährlich, sondern in größeren zeitlichen Abständen wiederkehren, etwa für die Öltankreinigung, können grundsätzlich in dem Abrechnungszeitraum umgelegt werden, in dem sie entstehen. Der Vermieter ist auch nicht verpflichtet, die jeweils nur im Abstand von mehreren Jahren anfallenden Tankreinigungskosten auf mehrere Abrechnungsjahre aufzuteilen. Sie dürfen vielmehr grundsätzlich komplett in dem Abrechnungszeitraum umgelegt werden, in dem sie entstehen.75
Die Kosten der Beschichtung oder des Anstrichs des Öltanks sind dagegen nicht umlagefähige Instandhaltungskosten.76
Bei den Kosten für die Spülung einer Fußbodenheizung handelt es sich ebenfalls um nicht umlegbare Betriebskosten, sondern um Kosten, die in den Bereich der Instandhaltung fallen.77
Die Reinigung des Betriebsraums wird nur bei der Beheizung mit Kohle erforderlich sein. Bei der Beheizung mit Holzpellets oder Holzhackschnitzeln dagegen erfolgt die Versorgung des Brenners automatisch, sodass kein nennenswerter Reinigungsaufwand erforderlich sein dürfte. Zu dem umlagefähigen Aufwand gehören Reinigungszeit und Reinigungsmaterial.
Abgasanlage
AbgasanlageHierzu gehört vor allem der Schornstein einschließlich der Verbindungsstücke zur Heizanlage (zum Beispiel Rauch- und Abgasrohre); weiterhin zählen dazu Drosselvorrichtungen (Drosselklappen oder Schieber), Zugbegrenzer, Nebenlufteinrichtungen, Absperrvorrichtungen, Abgasventilatoren sowie andere Bestandteile der Verbindung zwischen Heizungsanlage und Schornstein.
Kaminkehrer/Schornsteinfeger
Die Kosten für Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, auch soweit sie vom SchornsteinfegerKaminkehrerSchornsteinfeger durchgeführt werden, sind umlagefähig. Bei Zentralheizungen besteht die gesetzliche Verpflichtung zur jährlichen Überprüfung der Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger.
Wenn die Prüfung ergibt, dass die Heizanlage den Anforderungen nicht genügt, muss der Gebäudeeigentümer innerhalb von sechs Wochen eine Wiederholungsmessung durchführen lassen. Die Kosten dafür können nur dann nicht umgelegt werden, wenn der Eigentümer die Wiederholungsmessung zu vertreten hat. Dies kann dann der Fall sein, wenn er zur Wartung verpflichtet war und diese trotzdem nicht hat ordnungsgemäß ausführen lassen.
Zu den umlagefähigen Schornsteinfegerkosten gehören gleichfalls die Kosten für eine Luftvolumenstrommessung, die alle zwei Jahre vom Kaminkehrer durchgeführt wird. Es handelt sich dabei um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung. Dabei werden die Lüfter der Zwangsentlüftung in den Wohnungen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Da diese Zwangsentlüftungen nur in Dunkelbädern oder Küchen ohne Fenster installiert sind, also nicht in allen Wohnungen, werden diese Kosten nur den betroffenen Wohnungen zugeordnet.
Feuerstättenschau/Feuerstättenbescheid
Seit dem 1.1.2013 ist der Schornsteinfeger dazu verpflichtet, für jedes Gebäude eine FeuerstättenschauFeuerstättenschau durchzuführen, über die dann ein Feuerstättenbescheid ausgestellt wird. Die Feuerstättenschau muss innerhalb von sieben Jahren zweimal stattfinden, wobei zwischen den beiden Terminen mindestens drei Jahre liegen müssen. Die Begutachtung aller Feuerungsanlagen dient dem vorbeugenden Brandschutz. Nach erfolgter Feuerstättenschau stellt der Kaminkehrer den Feuerstättenbescheid aus. Dieser gibt Auskunft darüber, welche Reinigungs-, Überprüfungs- und Messarbeiten an den Feuerungsanlagen in welchen Zeiträumen durchzuführen sind. Die dafür entstehenden Kosten dürfen als Kosten für die Prüfung der Betriebssicherheit gemäß § 2 Nr. 4a BetrKV umgelegt werden.78 Das AG Soest79 hat die Kosten für den FeuerstättenbescheidFeuerstättenbescheid als umlagefähige Betriebskosten eingestuft, allerdings fälschlicherweise als laufende öffentliche Lasten des Grundstücks.
Anmietung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung
Unter Ausstattung zur VerbrauchserfassungKosten der Heizung, Ausstattung zur VerbrauchserfassungAusstattung zur VerbrauchserfassungVerbrauchserfassung, Ausstattung sind WärmezählerWärmezähler und HeizkostenverteilerHeizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip und elektronische Heizkostenverteiler zu verstehen. Wenn diese Geräte gemietet oder geleast werden, gehören die Miet- oder LeasingkostenVerbrauchserfassung, Leasingkosten zu den Betriebskosten. Hinsichtlich der Mietkosten ist zu beachten, dass diese nur dann umgelegt werden können, wenn der Vermieter das BeteiligungsverfahrenBeteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 HeizKV durchgeführt hat. Der Vermieter muss den Nutzern unter Angabe der dadurch verursachten Mehrkosten mitteilen, dass er die Geräte zur Verbrauchserfassung mieten will. Wenn die Mehrheit der Nutzer binnen Monatsfrist widerspricht, ist die Umlage der Anmiet- oder Leasingkosten unzulässig. Infolge der unterbliebenen Mitteilung dürfen die betroffenen Mieter nicht mit Mietkosten belastet werden. Wenn sich der Vermieter für den Kauf der Geräte entscheidet, kann er eine Mieterhöhung wegen Modernisierung gemäß § 559 BGB geltend machen.
Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Eichkosten sowie der Kosten für Berechnung und Aufteilung
Diese Position umfasst die Kosten der Wärmemessdienstfirmen für die übliche Miete der Erfassungsgeräte, das Ablesen der Geräte sowie den Austausch von Messflüssigkeiten und Batterien. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gilt auch für die Kosten der Messgeräte zur Verbrauchserfassung. Überhöht sind die Kosten der Beschaffung bzw. Anmietung, Abrechnung und Ablesung der Erfassungsgeräte jedenfalls dann, wenn sie mehr als die Hälfte der Heiz- und Warmwasserkosten betragen.80 Belaufen sich die Kosten des Wärmemessdienstes auf etwa die Hälfte der Energiekosten der Abrechnungsperiode, so ist die Heizkostenabrechnung fehlerhaft, solange der Vermieter nicht nachweist, dass am Markt keine günstigere Wärmedienstleistung zu erlangen ist, wonach die Grenze bereits bei 25 % zu ziehen ist.81 Das AG Regensburg82 zieht die Grenze bei 15 %: Demnach liegt ein Verstoß gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit bereits dann vor, wenn die Kosten der Abrechnung und Verbrauchserfassung der Heiz- und Warmwasserversorgung mehr als 15 % der Brennstoffkosten ausmachen. Diese Kosten sind aus der Heizkostenabrechnung herauszunehmen.
Seit Inkrafttreten der Betriebskostenverordnung am 1.1.2004 sind auch die Kosten der Eichung von VerbrauchserfassungsgerätenVerbrauchserfassung, Eichung der Geräte umlagefähig. Eichpflichtig sind Wärmezähler (bzw. WarmwasserzählerWarmwasserzähler), das heißt Messgeräte, die den Wärmeverbrauch in physikalischen Einheiten angeben. Heizkostenverteiler, die nach dem Verdunstungsprinzip funktionieren, sind keine Messgeräte, da sie nicht die verbrauchte Wärmemenge messen, sondern nur einen Verhältniswert anzeigen. Heizkostenverteiler sind deshalb nicht eichpflichtig. Kaltwasserzähler, Warmwasserzähler und Wärmezähler müssen alle sechs Jahre geeicht werden. Die Kosten des Austauschs von Erfassungsgeräten infolge der gesetzlich vorgeschriebenen Eichung können im Rahmen der Heizkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden.
Auch wenn diese Eichkosten nur in längeren zeitlichen Abständen anfallen (aperiodische KostenAperiodische Kosten), können die Austauschkosten anlässlich einer gesetzlich vorgeschriebenen Eichung umgelegt werden. Der Vermieter kann die Eichkosten grundsätzlich in dem Abrechnungszeitraum umlegen, in dem sie entstehen.83 Alternativ können die Kosten gemäß § 7 Abs. 2 HeizKV auf mehrere Jahre aufgeteilt werden.84 Eine Kostenumlage scheidet allerdings aus, wenn der Austausch infolge eines Defekts erforderlich wird, da es sich in diesem Fall um nicht umlagefähige Instandhaltungskosten handelt.
Zu den Betriebskosten des Wärmezählers gehören auch die Kosten für deren Wartung und die Kosten für die Erneuerung der zu ihrem Betrieb benötigten Batterien.85
Kosten der Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen
Mit der Heizkostennovelle vom 1.12.2021 sind an die Stelle der Kosten für die VerbrauchsanalyseVerbrauchsanalyse die Kosten für die Abrechnungs- und VerbrauchsinformationenAbrechnungs- und Verbrauchsinformationen gemäß § 6a HeizKV getreten. Dabei handelt es sich einerseits um die hierauf entfallenden Kosten des Messdienstleisters. Zugleich sind diejenigen Kosten erfasst, die der Gebäudeeigentümer aufwendet, um den Nutzern die Informationen nach § 6a HeizKV mitzuteilen oder zur Verfügung zu stellen. Diese Kosten sind umlagefähig.
Solarheizung/Wärmepumpe
Trägt eine SolaranlageSolaranlage oder eine WärmepumpeWärmepumpe zur Heizung oder zur Erwärmung des Warmwassers bei, darf der Vermieter keinen fiktiven Preis für ersparte Heizkosten, etwa je kWh, in der Heizkostenabrechnung ansetzen.86 In der Heiz- und Betriebskostenabrechnung dürfen grundsätzlich nur tatsächlich entstandene Kosten umgelegt werden (§ 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 HeizKV, § 2 Nr. 4a, 5a, 6a BetrKV). Es dürfen ausschließlich die Kosten der tatsächlich verbrauchten Brennstoffe wie Kohle, Koks, Heizöl, Gas oder Holzpellets angesetzt werden. Würde der Vermieter die eingesparten Brennstoffkosten umlegen, wäre dies unzulässig. Eine Vereinbarung, die den Mieter zur Zahlung eines »Solarpreises« verpflichtet, wäre gemäß § 556 Abs. 4 BGB unwirksam.
Wenn allerdings aufgrund zu geringer Sonneneinstrahlung eine Zusatzheizung benötigt wird, sind die dafür aufgewendeten Brennstoffkosten anzusetzen. Abgesehen davon kann der Vermieter zumindest die Kosten für den Betriebsstrom der Solaranlage, Einstellungskosten sowie Reinigungs- und Wartungskosten als Heiznebenkosten umlegen.
Wird das Objekt dagegen überwiegend oder monovalent mit Wärme oder Warmwasser aus einer Solaranlage, Wärmepumpe oder Ähnlichem versorgt, gelten die Regelungen der HeizKV nicht (§ 11 Abs. 1 Nr. 3). In diesem Ausnahmefall ist eine verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserabrechnung nicht zwingend vorgeschrieben. Eine überwiegende Versorgung liegt vor, wenn über 50 % des Gebäudes durch eine Anlage wie Wärmepumpe, Solaranlage oder Ähnliches versorgt wird.
Auch wenn die Wärmepumpe die Wärmeversorgung zu 100 % übernimmt, wird empfohlen, eine verbrauchsbasierte Abrechnung zu erstellen. Denn eine Wärmepumpe benötigt Strom oder auch konventionelle Brennstoffe, um dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Energie zu entnehmen und diese in Energie umzuwandeln. Sogar besonders effiziente Wärmepumpen benötigen rund 25 % elektrische Antriebsenergie, um 100 % Heizwärme zu erzeugen. Es muss auf jeden Fall ein Stromzähler vor der Wärmepumpe installiert werden, um den Energieverbrauch der Anlage zu erfassen, denn nur tatsächlich entstandene Kosten dürfen auf die Verbraucher umgelegt werden.
Die Investitionskosten für die Solaranlage können nicht angesetzt werden. Der Vermieter kann für den Einbau einer Solaranlage eine Mieterhöhung wegen Modernisierung gemäß § 559 BGB vornehmen, da Primärenergie eingespart wird.87
Kraft-Wärme-Kopplung
Stammt die Wärme aus Anlagen der Kraft-Wärme-KopplungAnlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, kann es Schwierigkeiten bereiten zu ermitteln, welche Kosten auf die Stromerzeugung entfallen. Hierzu gibt es seit November 2012 die Richtlinie VDI 2077/3.1. Allerdings ist sie nicht verbindlich und schließt andere Berechnungsmethoden nicht aus.
Sonstige Kosten
Tankhaftpflichtversicherung
Die Kosten einer TankhaftpflichtversicherungTankhaftpflichtversicherung gehören nicht zu den unmittelbaren Heizkosten nach § 7 Abs. 2 HeizKV, sondern sie sind gemäß § 2 Nr. 13 BetrKV bei der Position »Sach- und Haftpflichtversicherung« in die Betriebskostenrechnung einzustellen.88
Energieausweis
Der Vermieter ist nach § 16 Abs. 2 Satz 2 EnEV 2009 verpflichtet, für das Gebäude einen EnergieausweisEnergieausweis erstellen zu lassen. Seit dem 1.5.2014 muss der Vermieter einem Mietinteressenten den Energieausweis vorlegen. Bei Abschluss des Mietvertrags muss dem Mieter eine Kopie ausgehändigt werden. Bei den Kosten für die Erstellung des Energieausweises (Verbrauchsausweis etwa 50 EUR, Bedarfsausweis etwa 500 EUR) handelt es sich um nicht umlagefähige Verwaltungskosten, weil sie nicht laufend entstehen.89
Korrosionsschutz
Anodenschutzanlagen dienen dem Korrosionsschutz des Öltanks, die damit verbundenen Kosten sind als vorbeugende Erhaltungskosten nicht umlagefähig.90
Feuerlöscherwartung
Die Kosten für die Wartung von FeuerlöschernFeuerlöscher sind selbst dann kein umlagefähiger Aufwand, wenn sie zum Heizraum gehören. Bei entsprechender mietvertraglicher Vereinbarung fallen sie unter »sonstige Betriebskosten« gemäß § 2 Nr. 17 BetrKV.
Zwischenablesung/Nutzerwechsel
Beim Mieterwechsel fallen Kosten der ZwischenablesungZwischenablesung an, auch NutzerwechselgebührNutzerwechselgebühr genannt. Liegt eine mietvertragliche Vereinbarung vor, übernimmt der Mieter die Kosten. Fehlt diese Vereinbarung, hat der Vermieter die Kosten zu tragen. Es handelt sich schon begrifflich nicht um Betriebskosten, da diese nicht laufend entstehen.91
2.4.2 Kosten des Betriebs einer zentralen Brennstoffversorgungsanlage
§ 2 Nr. 4b BetrKV: die Kosten »des Betriebs einer zentralen Brennstoffversorgungsanlage; hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums«.
Dabei handelt es sich vorrangig um zentrale Öllagertanks (gilt auch für Gasversorgungsleitungen), von denen aus Versorgungsleitungen zu den in den Wohnungen befindlichen Einzelheizungen der Mieter (Etagenheizungen) führen. Eine Hausanlage, die an das öffentliche oder städtische Gasleitungsnetz angeschlossen ist, fällt nicht unter diese Vorschrift.
Zu diesen Kosten gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums.
2.4.3 Kosten der gewerblichen Lieferung von Wärme/Wärmecontracting
§ 2 Nr. 4c BetrKV: die Kosten »der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne von Nummer 4a; hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a«.





























