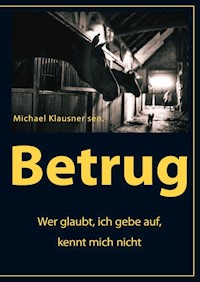
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Bankgarantie über 920.000.000,- Millionen US Dollar mit dem Namen des Mahatma Gandhi darauf, eine geplante Bargeldübergabe am Züricher Flughafen, Stimmen betrügerischer Banker auf meiner Mailbox, Lügen, groteske Erinnerungslücken und vor all dem die Augen verschließende Staatsanwälte und Generaldirektoren – in was ich mit dem Notverkauf meines Pferdegestüts zur Jahrtausendwende hineingeriet, glaubte mir lange Zeit niemand. Doch lest einmal. Hier steht die ganze Geschichte. Und irgendwo, gut versteckt, der Ordner mit allen Beweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Klausner sen.
Betrug
Wer glaubt, ich gebe auf,
kennt mich nicht
Impressum
Michael Klausner sen.
Wasserburger Straße 50
Logoix/139893
83395 Freilassing
Email: [email protected]
© 2023 Michael Klausner sen.
© Umschlagfoto: NinaLohmeyer/Pixabay
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
„Lassen Sie sie rein. Dann ist sie angehängt.“
Bankdirektor R. empfahl mir dies im bäuerlichen Jargon und stürzte mein Leben mit seinen Worten in den Abgrund.
„Angehängt“ wie die verkaufte Kuh am Strick sei diejunge Frau Y., lasse ich sie bereits vor Vertragsunterzeichnung und Zahlung des Preises mein zum Verkauf stehendes Pferdegestüt beziehen, erläuterte R. das Vorgehen. Wischte meine Zweifel beiseite. Bläute mir vielmehr ein, dass ich sie endlich zu zahlen habe: meine Schulden bei seiner Bank.
Wie ein dummer, unter Druck gesetzter Junge hörte ich auf den Bankdirektor und ließ Y. am 13. Jänner 2000 mein Gestüt beziehen. Ohne einen Schilling bezahlt zu haben, lebte die junge Frau nun auf jenem von mir mit größter Leidenschaft hergerichteten, gleichsam wie aus der Fernsehserie „Dallas“ entsprungenen Anwesen. Umspannt vom blütenweißen Zaun, funkelte ein Swimmingpool in der Mitte des fünfunddreißigmal vierzig Meter großen Vierkanthofes. Achtundzwanzig Pferdeboxen, zwei Hektar Koppeln – ich war gezwungen, diesen Schatz zu verkaufen.
Immerhin war Y. nun „angehängt“. Der Kaufpreis würde sicher bald fließen. Dachte ich. Doch alles war Betrug. Wurde derart schlimm, dass wohl die meisten Menschen sich selbst „angehängt“ hätten: an den nächsten Baum.
„Man gönnt sich ja sonst nix“.
Nur Wochen zuvor hatte dieser Aufkleber auf meinem Ferrari noch die Autofahrer hinter mir angegrinst. Goldene Zeiten. Endlich. War das erste Vierteljahrhundert meines Lebens doch oft bitterhart gewesen. Drei Wochen nach meiner Geburt am 17. September 1962 verunglückte mein Vater tödlich. Eben geboren, schon Halbwaise, hielt meine Mutter mich uneheliches Kind im tief katholischen Mariazell auf dem Arm und die abwertenden, ach-so-frommen-Blicke der Dorfbewohner nicht aus. Meine Mutter zog mit mir nach Salzburg. Kellnerte und arbeitete als Wirtschafterin bei jenem Mann, den ich bald „Vater“ nennen würde.
Im Weltkrieg hatte es „Vater“ erwischt. Eine Granate, eine Bombe, eine Ladung Munition, was auch immer. Gehen konnte er kaum noch. Dafür liefen seine Geschäfte umso besser: Gasthäuser, ein Schmuckladen, weitere Immobilien und Ländereien – alles war gut verpachtet. „Vater“ war reich. Und ich mit fünfeinhalb Jahren Vollwaise.
Mama starb 1968. „Vater“ konnte nicht mein Vater sein, sich nicht um mich kümmern. Zu sehr hatte der Weltkrieg ihn zum Invaliden gemacht. „Michael“, sah er mich vor der Beerdigung meiner Mutter an. „Deine Großeltern in Mariazell, bei denen wirst du leben.“
Großvater war ein Traum. Großmutter eine Großmutter. Nicht weniger und nicht mehr. Mit ihr kam ich aus. Opa allerdings ist für mich heute – viele Jahre nach seinem Tod – noch immer jener erste Freund und mir Mut machende „Großvater“, wie S.T.S ihn in ihrem gleichnamigen Lied besingen:
„Großvota, kannst du net obakumman
auf an schn’n Kaffee?Großvota, i mecht da sofül sog’n, wos I erst jetzt versteh’!Großvota, du worst mei erster Freind, und des vergi’ i nie, Großvota. Du worst ka Übermensch, host a nie so tan,G’rod desweg’n wor da irgendwie a KroftUnd durch die Ort, wie du dei Leb’n g’lebt host,Hob i a Ahnung ‘kriagt, wia ma’s vielleicht schofft.“
Wie gut hätte es getan, „Großvota“ wäre während der schrecklichen Ereignisse um mein Pferdegestüt manchmal „obakumman auf an schn’n Kaffee“. Opa starb 1987 mit neunzig. Wer weiß, wie heute alles wäre, hätte er mir damals nicht beigebracht, „wia ma’s vielleicht schofft.“
Auf dass ich es packte, während der Wochen im Kinder-heim. Als ich mal nicht bei den Großeltern sein konnte. Als Jüngster am Ende des langen Tisches saß. Herüberschaute zu den älteren Kindern auf der anderen Seite. Wo die Küchenfrau den Suppentopf abstellte. Alle Einlagen rausgelöffelt wurden, bevor der Topf mit dem wässrigen Etwas und das Grinsen der Älteren mich erreichte. Da lernt man kämpfen.
Den Kontakt zu „Vater“ brach ich nicht ab. Salzburg war meine Heimat. Das fühlte ich. Saß als Junge – ohne erwachsene Begleitung – im Zug. In meinen Händen einen kleinen Christbaum haltend. „Vater“, übergab ich ihn stolz. „Frohe Weihnachten!“
Kinderarzt wäre ich gern geworden. Mir gefiel der Gedanke, kleinen Menschen zu helfen. „Unmöglich“, stellte Oma allerdings klar. Ein Studium sei nicht zu finanzieren. Dabei hätte der Staat, wie ich später erfuhr, mir Vollwaisen ein solches ermöglicht. Oma in ihrem dörflichen Mariazell – sie konnte das nicht wissen.
Dann eben Holz: Ich wurde Tischler. Absolvierte eine Lehre in Mariazell. Wusste während meiner dreijährigen Ausbildung genau, was ich wollte und setzte es nach deren Abschluss geradewegs um: freitags bestand ich die Prüfung, feierte abends im Wirtshaus, nahm am Samstag einen Zug nach Salzburg und rief Montagmorgen von dort aus in meinem Lehrbetrieb an. „Tut mir leid“, schlug ich ihren Wunsch, mich als Gesellen zu übernehmen, in aller Deutlichkeit aus. „Ich komme nicht mehr. Ich bleibe in Salzburg. Hier gehöre ich hin.“
Neben dem Militärdienst ging ich „Vater“ bei seinen Verpachtungen und Reparaturen zur Hand. Holte, kaum zweiundzwanzig, meine Freundin aus Mariazell an die Salzach, heiratete sie 1985. Ein Jahr zuvor war uns ein Bub geboren worden, unserer Tochter kam 1985 zu Welt.
„Vater“ verfolgte meine Lebensplanung genau. Offen-bar imponierte ihm, wie gekonnt ich mich um seine Verpachtungen, wie liebevoll um meine Familie kümmerte. Sechsundzwanzig war ich, als er mich zu sich rief. „Alt bin ich und krank“, sah „Vater“ mich an. „Michael, du bist ein guter Junge. Ich habe beschlossen, mein Vermögen in deine Hände zu geben.“
Dieser wunderbare alte Mann adoptierte mich. Endlich hatte ich wieder einen richtigen Vater. Darf die Anführungszeichen beim Schreiben des Wortes weg-lassen. Dann der Schlaganfall. Weitere Krankheiten überkamen ihn. 1992 starb der zweite Vater meines Lebens.
Ich war reich. Eine gesunde Familie. Ein Ferrari in der Garage. Was willst’e mehr? „Man gönnt sich ja sonst nix!“
Die Immobilien hielt ich in Stand. Zog die Pacht ein, wie es mein Vater getan hatte und erfüllte mir den größten Wunsch.
Ein Pferdegestüt. 1992 erwarb ich das Anwesen und baute es zu jenem Schmuckstück um, das mein Alptraum werden würde: der abgerissene Zaun, ein Swimmingpool voller Schutt, überall Betrug, Gerichtsverhandlungen, menschliche und finanzielle Abgründe.
Wie aus dem Nichts standen sie 1993 plötzlich vor mir: zwei außereheliche Kinder meines Salzburger Vaters. Forderten ihr Erbe ein. „Einstecken“ hatte ich die Summe nicht. Bot den beiden Immobilien an. Sie lehnten ab. Geld wollten sie. 17.000.000,- österreichische Schilling (ATS), etwa 1,2 Millionen Euro, kostete mich der losbrechende Erbschaftsstreit. Ein verflixt kurzer Reichtum war es, den ich damals genoss.
Den Ferrari meldete ich ab. Stand alsbald Direktor R. aus der dörflichen Niederlassung einer mächtigen Bank gegenüber. „Eigentlich lächerlich“, schmunzelte ich, „dass Leiter von derart mickrigen Filialen sich Direktor nennen dürfen.“
„Herr Bankdirektor“, sagte ich dennoch frei heraus, was ich brauchte. „Einen Kredit. 17.000.000,- ATS.“
Ich bekam das Geld. Doch es schien mir wie ein Pakt mit dem Teufel. Mein gesamtes Hab und Gut galt es, der Bank als Pfand zu überlassen. Alle Pacht ging fortan auf einem Zessionskonto ein. Der Zahlungsstrom floss an mir vorbei. Ich saß auf dem Trockenen. War nahezu pleite. Brauchte ich Geld, musste ich R. anrufen.
„Wir haben ihm ab und zu Geld gegeben“, sollte Direktor R. später während einer Verhandlung seine Bank preisen, damit Klausner, „die Gasrechnung bezahlen kann, damit der Strom nicht abgedreht wird, ...“
(Hauptverhandlung des 6. März 2013, 10.05 Uhr, Landgericht Steyr, Zeuge R., Seite 26)
Welch Großmut.
Eben noch der Ferrari, nun knickte ich vor der Stromrechnung ein. Unbedingt und am besten gestern würde ich Teile meiner Besitztümer zu Geld machen müssen. „Das Gestüt“, schmerzte mich der Gedanke, mein mit Herzblut saniertes und vom weißen Zaun umgebendes Anwesen mit den Pferdeboxen, dem glitzernden Pool und dem beeindruckenden Vierkanthof zum Verkauf anzubieten. Ich entschied mich trotzdem dafür. „Der Erlös müsste reichen, meine Schulden und die Bank von den Hacken zu haben“, mutmaßte ich, gab Annoncen auf und wartete auf Käufer.
Anfang Dezember 1999 rief ein Herr S. an. Wollte unbedingt und gemeinsam mit einer Frau Y. das Gestüt besichtigen. Sie kamen und es begann, was mich erst Ruhe finden lässt, wenn all der Betrug, die Lügen, Verbrechen und gefälschten Bankgarantien von damals bestraft, aufgeklärt und gesühnt sind. Chronologisch erzähle und zitiere ich auf den folgenden Seiten, was wie ein Krimi klingt – doch aber meine wahre Geschichte ist.
7. Dezember 1999
„Geld spielt keine Rolle”, schwärmt die junge Frau Y. während des Besichtigungstermins. Ihre ältere Schwester C. werde mein Gestüt kaufen. Eine Reithalle bauen, eine Pferdeklinik …
Dieser Reichtum kam mir mehr als gelegen. Machte Bankdirektor R. doch zunehmend Druck wegen meines Kredits. 15 Millionen ATS, mehr als eine Million Euro, nannte ich als Verkaufspreis. Legte ich meine auf dem Zessionskonto eingehende Pacht obenauf, würde ich R. und seine Bank zufriedenstellen können.
15 Millionen seien kein Problem, willigte Y. ein. Sie und ihre Begleiter, die Herren S. und v.N., wünschten, umgehend einen Kaufvertrag aufsetzen zu lassen. Ich jubilierte innerlich. Bald würde ich wieder ohne die Fesseln der Bank leben können.
9. Dezember 1999
Wir treffen uns in der Kanzlei meines Rechtsanwalts. Die junge Frau Y. erscheint in Begleitung dreier Herren, darunter Herr S. Mein Steuerberater ist anwesend, zudem mein Anwalt Dr. Pf. Die Stimmung – anders lässt es sich nicht sagen – ist einwandfrei. Erneutes Schwärmen von der Reithalle, dem ganzen großen Vorhaben mit meinem Gestüt. Bald, ganz bald, werde ihre Schwester aus Amerika zurückkommen und den Kaufpreis zahlen, bestätigt Y.: „Setzen Sie bitte schnell den Vertrag auf.“
Ich atme auf. Ahne nicht, dass ich zur Marionette in einem heimtückischen Spiel werde.
10. Dezember 1999
Am Tag nach dem Treffen in der Kanzlei setzen mein Rechtsanwalt Dr. Pf. sowie mein Steuerberater den Kauf-vertrag auf und faxen diesen an den offenbar für die Koordination des Immobilienerwerbs zuständigen Herrn S. Anschließend bittet mein Anwalt Herrn Bankdirektor R. um Freistellung des Grundstückes. Dieser stimmt kurzerhand zu. Alles läuft wie geschmiert.
15. Dezember 1999
Y. reist mit dem Ziel in die Niederlanden, alles für ihren Umzug nach Österreich vorzubereiten. Mitte Januar soll es soweit sein. Dann werde sie das Gestüt beziehen, sagt Y. mir am Telefon und bittet mich um Rat hinsichtlich des Transports ihrer elf Pferde. Ich kenne mich aus und vermittle Y. eine entsprechende Transportfirma.
21. Dezember 1999
Bankdirektor R. schickt die Löschungsbewilligung an die Kanzlei meines Anwalts Dr. Pf.. Mein Gestüt steht frei zum Verkauf. Das alles fühlt sich wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an. In wenigen Tagen werde ich ins nächste Jahr rutschen. Das neue Millennium. Feuerwerk. Der Kaufvertrag. Der Ärger mit der Bank bleibt im alten Jahrtausend zurück. So stelle ich mir das vor.
2. Januar 2000





























