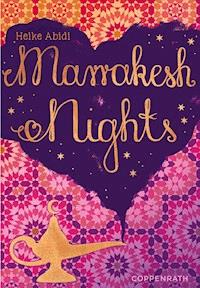9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Victoria stürzt bei einem Leichtathletikturnier und wird zur Routineuntersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort bekommt sie eine schreckliche Diagnose, mit der sie niemals gerechnet hätte. Ein Gehirntumor. Dieser ist zwar operabel – allerdings mit hohem Risiko. Sie entscheidet sich für den lebensgefährlichen Eingriff. Bis zum OP-Termin bleibt nur eine Woche, um alles zu erledigen, was ihr noch wichtig ist. Mit ihrem besten Freund Theo geht sie auf einen aufregenden Roadtrip und hakt die wichtigen Punkte auf ihrer Bucket List ab. Darauf steht unter anderem: den schönsten Kuss aller Zeiten zu erleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Victorias Welt bricht zusammen, als sie eine schreckliche Diagnose bekommt: Sie hat einen Hirntumor. Dieser ist zwar operabel – allerdings mit hohem Risiko. Victoria entscheidet sich für die lebensgefährliche OP. Und dafür, vorher noch etwas zu erleben. Mit ihrem besten Freund Theo begibt sie sich auf einen Roadtrip. Das Ziel ist klar: der schönste Kuss aller Zeiten vom heißesten Mann der Welt in der aufregendsten Stadt. Auf ihrer Reise lernt Victoria einiges über sich selbst und auch, dass sie diesen Kuss vielleicht von jemand ganz anderem bekommen möchte, als sie bisher dachte …
Eine emotionale Achterbahnfahrt – auf der Suche nach dem, was wirklich zählt
Kapitel 1Ein falscher Schritt
»Das ist Victoria Sander, achtzehn Jahre. Zustand nach Sturz bei Sportveranstaltung. Verdacht auf Fraktur des Unterschenkels und Gehirnerschütterung.«
»Okay, wir betten sie um. Auf drei …«
Ganz schön schräg, hier zu liegen und mit anzuhören, wie der Sanitäter und die Ärztin über mich reden, als wäre ich gar nicht da oder könnte sie nicht verstehen.
Hey, ich kann selbst von der Trage auf die Pritsche klettern, will ich rufen, aber außer einem leisen Stöhnen kommt nichts über meine Lippen.
Sie zerren an mir herum, ich lasse es über mich ergehen. Dann liege ich auf einer Pritsche, die auch nicht viel bequemer ist als die Trage aus dem Rettungswagen, aber wenigstens halbwegs nach Krankenhausbett aussieht. Die Kabine ist winzig und trist, nur ein Vorhang trennt sie vom nächsten Notaufnahmebett.
Die Ärztin hat freundliche Augen und kalte Hände. Sie fühlt meinen Puls und leuchtet mir in die Augen.
»Pupillen rund, mittelweit, isokor und lichtreaktiv, Herzschlag leicht erhöht. Sieht schon mal nicht nach einer Gehirnerschütterung aus. Haben Sie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel?«
»Ähm – nein«, erwidere ich. Ich weiß bloß nicht, was mit mir los ist.
»Wir machen zur Sicherheit ein Blutbild, EKG, EEG, Röntgen.« Ihre Stimme klingt müde. Als hätte sie schon eine 24-Stunden-Schicht hinter sich. Dafür ist sie eigentlich ein bisschen zu alt. Machen das sonst nicht nur Anfänger? Aber vielleicht ist es auch der Dienst in der Notaufnahme selbst, der ihr vorzeitig graue Strähnen verpasst hat.
Eine Krankenschwester legt mir eine Blutdruckmanschette an und setzt eine Art Wäscheklammer auf meinen linken Zeigefinger. Nach all den vielen Folgen von Grey’s Anatomy, die ich gesuchtet habe, weiß ich, dass damit die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen wird. Fast so, als wäre ich schwer krank.
Entspannt euch, möchte ich sie beruhigen, ich bin doch bloß über meine eigenen Füße gestolpert! Tut fast gar nicht mehr weh.
Die Blutdruckmanschette pumpt sich auf und quetscht mir fast den Arm ab. Nicht gerade angenehm.
Ich schließe die Augen und atme tief durch. Versuche zu vergessen, dass ich hier in der Notaufnahme des städtischen Krankenhauses liege, obwohl ich jetzt eigentlich auf einem Siegerpodest stehen sollte. Aber es gelingt mir nicht. Statt nach frisch gemähtem Gras, Sportlerschweiß und Grillwürstchen riecht es hier nach Desinfektionsmitteln und Krankheit.
»Achtung, jetzt kommt ein kleiner Pikser.«
Ich lasse die Augen geschlossen. Mir wurde schon oft Blut abgenommen, das macht mir nichts aus – doch zusehen will ich nicht, wie sich das Röhrchen langsam füllt. Ich finde das gruselig.
Dann werde ich verkabelt, von Kopf bis Fuß. Mein Shirt ist bis zum Hals hochgeschoben, ich fühle mich schutzlos und friere. Geräte brummen und piepsen, ein Ausdruck kommt ratternd aus einem kleinen Drucker. Er dokumentiert, dass mein Herz tut, was es am besten kann: Es schlägt.
Die Elektroden werden wieder entfernt, und die Krankenschwester zieht mein Shirt herunter. Es klebt jetzt ein bisschen an den Stellen, auf die zuvor das Gel aufgetragen worden ist.
»Alles okay?«, flüstere ich. Das Sprechen strengt mich unglaublich an, ich fühle mich, als wäre ich hundert Jahre alt.
»Dazu kann ich nichts sagen, das müssen Sie die Ärztin fragen«, erwidert sie. Man merkt ihr an, dass sie gewohnt ist, schnell zu sein. Ihre Handbewegungen sind routiniert, kraftsparend. Sie hat keine Zeit zu verlieren.
Aber was ist mit mir? Wie lange soll ich hier noch herumliegen?
Noch so eine Frage, die mir wohl vorerst niemand beantworten kann, denn auf einmal bin ich allein. Jenseits des Vorhangs sind aufgeregte Stimmen zu hören. Klingt ganz danach, als käme gerade ein Verkehrsunfallopfer herein. Logisch, dass das dringend ist. Aber könnte man mich bitte vorher noch schnell entlassen?
Wobei – die eigentliche Frage lautet ja, wie ich hier überhaupt landen konnte. In all den Jahren hatte ich noch nie eine ernsthafte Sportverletzung. Und jetzt das! Ausgerechnet beim Hochsprung ist es passiert, meiner Lieblingsdisziplin. Ich verstehe echt nicht, was da vorhin mit mir los war. Den Flop habe ich tausendfach trainiert, ich beherrsche ihn im Schlaf. Anlauf, beschleunigen, Kurve, abspringen, Latte überqueren, Landung.
Genau das liebe ich an diesem Sport: keine neuen Taktiken, keine Gegner, keine Fouls, keine Mitspieler. Nur ich selbst und der ewig gleiche Bewegungsablauf, den ich über die Jahre immer weiter perfektioniert habe.
Wenn es drauf ankommt, so wie bei einem Turnier, kann ich ihn jederzeit abrufen und Höchstleistungen erbringen. Heute wollte ich meinen persönlichen Rekord brechen. Aber das Einzige, was ich mir womöglich gebrochen habe, ist mein Bein. Es tut nun doch wieder ganz schön weh. Warum kümmert sich keiner darum?
Abrupt wird der Vorhang zur Seite gezogen, und ein Pfleger kommt herein. Er macht sich an den Rädern meines Bettes zu schaffen, offenbar, um die Bremsen zu entriegeln, dann schiebt er mich raus aus dem Kabuff.
»Wohin bringen Sie mich?«, will ich wissen. Eine legitime Frage, schließlich bin ich kein Gegenstand, auch wenn er mich so behandelt.
»Röntgen«, lautet die knappe Antwort.
Okay, vielleicht bin nicht ich der Gegenstand, sondern er? Ich beschließe, ihn insgeheim Robby, der Roboter zu nennen. Das hat er jetzt davon.
Unterwegs zum Fahrstuhl kommen wir an einem Wartebereich vorbei, der voll besetzt ist. Mindestens zwanzig Augenpaare sind auf mich gerichtet, als wären ihre Besitzer Zoobesucher und ich ein skurriles exotisches Äffchen.
Das muss ich mir nicht geben. Ich drehe meinen Kopf zur Seite und ignoriere die Gaffer. Sollen sie doch glotzen.
Vor der Radiologie stellt mich Robby einfach im Flur ab und macht sich wortlos davon. Ich schaue mich um und stelle fest, dass ich nicht die Einzige bin, der es so ergeht. Vor meinem stehen zwei weitere Betten. In einem liegt ein Mann, der aussieht wie eine Mumie, in dem anderen ein kleines Mädchen, das wimmernd einen Teddy umklammert und von seinem Vater getröstet wird. Die sind mit Sicherheit noch vor mir dran. Das kann also dauern …
Die Blutdruckmanschette pumpt sich mal wieder auf. Das tut sie alle fünfzehn Minuten, dieses ist das dritte Mal. Mindestens so nervig wie Kirchturmglocken, wenn man sie nicht gewohnt ist. Irgendwann hört man sie dann nicht mehr. Immerhin gibt mir das Blutdruckgerät ein gewisses Zeitgefühl. Ohne sein Armquetschmanöver hätte ich nicht sagen können, ob ich schon fünf Stunden hier liege oder erst zehn Minuten.
Endlich bin ich dran. Eine Radiologieassistentin schiebt mich in einen dunklen Raum und hängt mir eine Bleischürze um. »Damit sind Ihre Geschlechtsorgane geschützt, die sehr sensibel auf Strahlung reagieren«, erklärt sie, bevor sie mein linkes Bein vorsichtig in die richtige Position rückt. Anschließend verschwindet sie in einer Kabine und ruft: »Bitte nicht bewegen!« Dann ist es auch schon vorbei, und ich werde wieder im Flur geparkt.
Die Bleischürze hat mich an ein Thema erinnert, das ich lieber vergessen würde. Aber es bringt wohl leider nichts, weiterhin den Kopf in den Sand zu stecken. Ich war leichtsinnig, und jetzt muss ich mich den Tatsachen stellen. Verdammt! Was hab ich mir da nur eingebrockt?
Die morgendliche Übelkeit hätte mir längst zu denken geben sollen. Nein, eigentlich hätte ich gleich wissen müssen, was los ist, als ich neulich nach einer durchfeierten Nacht bei Lennox aufgewacht bin. Keine Ahnung, was genau in diesem Bett passiert ist, jedenfalls führte es dazu, dass mir beim Aufstehen schwindelig wurde, ich das Frühstück nicht bei mir behalten konnte – und das seitdem an fast jedem Morgen. Außerdem kommt hinzu, dass ich vorhin so übel gestürzt bin.
Da muss man ja nur zwei und zwei zusammenzählen …
Und ich weiß doch noch nicht einmal, ob ich überhaupt jemals Kinder will. Wenn ich als Mutter so viel Talent habe wie meine, sollte ich es wohl lieber bleiben lassen. Grundsätzlich. Und im Moment passt mir eine Schwangerschaft erst recht nicht in den Kram! Ich bin gerade mal achtzehn und habe noch ein Jahr bis zum Abi vor mir. Ich will leben, Party machen, Hochsprung-Rekorde feiern – keine Windeln wechseln. Und selbst wenn ich das wollte, wäre Lennox der denkbar schlechteste Partner! Ich meine, er ist witzig und cool, aber definitiv kein Typ, der gern Verantwortung übernimmt. Nicht mal für sich selbst.
Wenn ich mich doch nur genauer an diese verdammte Nacht erinnern könnte …
Ein Teil von mir hofft, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass Lennox viel zu viel intus hatte, um mich zu schwängern. Dass wir beide einfach eingepennt sind und nebeneinander unseren Rausch ausgeschlafen haben.
Aber das ist wohl ein Wunschtraum. Wer glaubt schon heute noch an die unbefleckte Empfängnis? Ich bin weder die Jungfrau Maria noch Jane the Virgin …
Die Sache mit dem Schwindel und der Übelkeit habe ich lange genug ignoriert, aber das geht jetzt wohl nicht mehr. Als ich vorhin beim Leichtathletikturnier gestürzt bin, wusste ich gleich, dass die Stunde der Wahrheit gekommen ist.
Das muss Schwangerschaftsdemenz sein. Auf eine Gehirnerschütterung kann ich es nicht schieben, die wäre schließlich höchstens die Folge, nicht die Ursache meines Sturzes gewesen. Können Hormone ein solches Blackout verursachen? Denn Tatsache ist, dass ich meine Schrittfolge vergessen habe. Einfach so, aus dem Nichts heraus. Etwas, was einem schon vor Jahren in Fleisch und Blut übergegangen ist, vergisst man doch nicht! Trotzdem ist genau das passiert. Von wegen: Anlauf, beschleunigen, Kurve, abspringen, Latte überqueren, Landung. Stattdessen bin ich beim Absprung über meine eigenen Füße gestolpert. Ich wusste nicht mehr, was ich als Nächstes tun musste. Da hat mein Körper wohl selbst entschieden, dass ich den Boden küssen sollte … Hoffentlich ist mein Bein nicht gebrochen! In zwei Wochen findet bereits der nächste Wettkampf statt, und bis dahin will ich fit sein. Solange ich noch keinen dicken Bauch habe, werde ich springen, so viel steht fest.
Die Blutdruckmanschette pumpt wieder. Ist das jetzt das vierte oder das fünfte Mal? Ich habe den Überblick verloren. Spielt ja auch eh keine Rolle, solange ich hier blöd im Gang rumstehe …
Ich bin richtig froh, als Robby endlich auftaucht. Er würdigt mich keines Blickes, aber das bin ich ja schon gewohnt. Diesmal schiebt er mich einhändig wie diese obercoolen Väter, die den Kinderbuggy mit links lenken und mit rechts telefonieren. Das tut Robby jetzt auch. Offenbar verabredet er sich gerade zu einem Feierabendbier – echt, ist es schon so spät? – und teilt seinem Kumpel mit, dass er vorher noch eine Fuhre habe.
Mir wird klar, dass er damit wohl mich meint. Innerhalb von wenigen Stunden wurde ich heute von Startnummer sieben und Hochsprung-Favoritin zum Notfall Victoria Sander, achtzehn Jahre, mit Verdacht auf Unterschenkelfraktur, und schließlich zur Fuhre. Herzlichen Glückwunsch, Victoria! Wenn das kein neuer Rekord ist.
Robby parkt mich in meiner Kabine und verdünnisiert sich prompt. Jetzt liege ich wieder hier und warte. Und grübele. Über meinen verkorksten Sprung, die Nacht mit Lennox, meine Zukunft als ledige Mutter ohne jegliches Talent für diese gewaltige Aufgabe …
Irgendwann kommt die Ärztin wieder.
»Ihre Werte sind bestens, Frau Sander«, verkündet sie mit einem müden Lächeln und streicht sich die vorzeitig ergraute Strähne hinters Ohr. »Und Ihr Bein ist auch nicht gebrochen, nur verstaucht. Das schmerzt zwar, verheilt aber von selbst.«
»Ich kann also nach Hause gehen?« Wird auch höchste Zeit.
»Im Grunde spricht nichts dagegen«, sagt die Ärztin, während ich mich aufrichte und die Beine aus dem Bett schwinge. Nichts wie weg von hier.
Es ist, als wären meine Füße eingeschlafen. Ich spüre den Boden unter ihnen nicht und wanke. In letzter Sekunde fängt mich die Ärztin auf, bevor ich umfalle wie ein Sack Mehl.
Hey, was ist denn das schon wieder?
Sie hilft mir zurück auf die Pritsche. Ihr Blick ist besorgt.
»Das gefällt mir gar nicht«, verkündet sie.
Ja, glaubt sie vielleicht, mir gefiele das?
»Mir … mir ist …« Verflixt, wie heißt dieses dämliche Wort noch gleich? »Mir ist schwindelig«, stoße ich schließlich hervor.
»Wir machen ein Schädel-CT. Jetzt sofort.«
Okay, schon verstanden. Ich werde noch nicht entlassen. Aber hey, ist das mit dem CT nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, es ist Samstagabend, und mir sind eben bloß die Füße eingeschlafen. Und dann ist mir das blöde Wort nicht eingefallen. Kann doch mal passieren, oder? Jetzt tut sie so, als ginge es um Leben und Tod!
Diesmal ruft sie keinen Robby, sondern bringt mich selbst zur Radiologie. Wieder vorbei an dem überfüllten Wartebereich, rein in den Fahrstuhl und dann durch das Flure-Labyrinth. Ich fühle mich wie eine Hochstaplerin, die jeden Moment entlarvt werden könnte. Hey, ich hab doch nichts – außer vermutlich einem Mini-Alien in meinem Bauch! Am Eingang müssen wir kurz warten, aber wenigstens sind diesmal keine Patienten vor mir dran. Doktor Beck – ich nehme gerade zum ersten Mal ihr Namensschild wahr – erklärt mir, was auf mich zukommt. Dass es sich bei einem CT um ein hochgenaues Röntgenbild handelt.
»Ich will einfach ausschließen, dass Sie einen Schädelbruch oder eine Gehirnblutung haben.«
Na toll. Und das nach sieben bis elf Blutdruckmessungen, mit anderen Worten rund zweieinhalb Stunden nach meiner Einlieferung? Wenn ich wirklich eine Gehirnblutung habe, bin ich in Kürze tot.
Da fällt mir noch etwas ein: »Ist das nicht gefährlich? Schon wieder Röntgenstrahlen – schützt die Bleischürze wirklich ganz sicher? Ich meine, falls ich schwanger wäre …«
Doktor Beck lächelt schmal. »Sind Sie nicht. Das hat die routinemäßige Blutuntersuchung ergeben.«
Aha. Nett, dass man das so nebenbei erfährt.
Ich bin wahnsinnig erleichtert, denn Lennox wäre echt der mieseste Vater geworden, den ein Kind nur haben könnte. Ungefähr eine Million Mal mieser als meiner, und der gewinnt nicht gerade den Preis als bester Daddy des Jahres. Höchstens als knuffigster und verpeiltester …
Dann bin ich dran. Die Radiologieassistentin nickt mir zu, sie erkennt mich wieder. Erleichtert stelle ich fest, dass es sich bei dem CT-Gerät eher um einen Ring handelt als um eine Röhre. Da hab ich wohl bei den Krankenhausserien nicht richtig aufgepasst.
Die beiden Frauen verlassen den Raum, und ich darf mich nicht bewegen. Augen zu und durch.
Heute hätte ich einen neuen Rekord aufstellen können. Einen Meter dreiundachtzig habe ich angepeilt. Eins einundachtzig habe ich dieses Jahr schon geschafft.
Meine Trainerin wird nicht begeistert sein von meinem dummen Unfall. Sie wird es darauf schieben, dass ich in letzter Zeit so oft ausgegangen bin. Aber hey, tanzen ist schließlich auch Training, oder?
Schneller als erwartet ist die Untersuchung vorbei. Mein Bett wird zurück in die Notaufnahme geschoben. In der Kabine nebenan stöhnt jemand. Ich versuche wegzuhören.
Doktor Beck setzt sich seitlich auf die Bettkante und nimmt meine Hand. Hey, was wird das denn jetzt?
Bevor sie mir sagt, was los ist, fragt sie nach meinen Angehörigen.
»Ich bin allein hier, das ist völlig okay«, erkläre ich. Und das stimmt auch. Ich bin es gewohnt, mich selbst um meine Angelegenheiten zu kümmern. Alles, was mich jetzt interessiert, ist ihre Diagnose.
»Auf den Bildern ist etwas zu sehen, was uns beunruhigt.«
Spuck’s schon aus – ein Schädelbruch? Ein Aneurysma? Ein Blutgerinnsel?
Ich wage kaum zu atmen. Warum spricht sie nicht weiter? Und warum macht sie so ein Gesicht? Das Warten ist grauenhaft.
»Nun – es gibt in Ihrem Gehirn eine Raumforderung. Wir müssen das weiter abklären.«
Eine waaaas?
Doktor Becks Worte erreichen meine Ohren, aber nicht meinen Verstand. Hat sie gerade Raumforderung im Gehirn gesagt? Aber zu wem? Außer mir ist doch gar niemand hier! Und überhaupt: Was in aller Welt soll das bedeuten? Ich kann mich nicht erinnern, dass der Begriff Raumforderung in Grey’s Anatomy jemals vorgekommen wäre. Doch er klingt definitiv nicht gut!
Kapitel 2Kontakte sind noch lange keine Freunde
Durch meinen Kopf schwirren tausend Gedanken, doch keiner lässt sich so richtig fassen, also sage ich gar nichts und starre Doktor Beck einfach nur an.
Ich sollte jetzt kluge Fragen stellen. Aber alles, was mir einfällt, ist: Was für ein Ding? Und: Hurra, nicht schwanger!
Doktor Beck lässt mir Zeit, wieder einigermaßen zu mir zu kommen. »Ich verstehe gut, dass man so eine Diagnose erst einmal verdauen muss. Schließlich erfährt man nicht jeden Tag, dass man einen Tumor hat.«
Okay. Damit ist es amtlich. Nun weiß ich, was sie so beschönigend als Raumforderung umschrieben hat.
Vermutlich sollte ich jetzt heulend zusammenbrechen. Ein Nervenzusammenbruch wäre sicher nicht übertrieben. Doch ich nicke nur und mache »Hm«. Sie hat recht. So was erfährt man nicht alle Tage. Ich kriege einfach keine angemessene Reaktion zustande. Immerhin ist es mein erster Hirntumor!
»Hatten Sie denn vor dem Unfall schon irgendwelche Symptome?«, will sie wissen. »Zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, epileptische Anfälle …«
»Epileptische Anfälle nicht, aber mir ist öfter mal übel. Daher dachte ich ja, ich wäre schwanger.« Meine Stimme klingt seltsam monoton. Ausführlich beschreibe ich Doktor Beck meinen Sturz beim Hochsprung, der, wie mir jetzt ganz klar ist, kein normaler Unfall war. Ich bin nicht einfach nur gestolpert, sondern habe für einen Moment den tausendfach trainierten Bewegungsablauf vergessen.
Als ich das der Ärztin erzähle, macht sie sich sofort Notizen. »Koordinationsprobleme sind ein typisches Symptom. Waren Sie in letzter Zeit auch vergesslich, oder hatten Sie mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen?«
»Ja.« Das alles ist der Fall. Ich habe sogar regelrechte Erinnerungslücken! Und das nicht erst seit der Nacht mit Lennox …
Doktor Beck scheint zu spüren, dass mir gerade nicht nach Reden zumute ist, daher bestreitet sie den Rest unseres Gesprächs mehr oder weniger im Alleingang. Ich erfahre, dass ich für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben muss. Noch ist nämlich unklar, ob der Tumor gut- oder bösartig ist und wie man ihn am besten behandelt. Das müssen Fachärzte beurteilen. Onkologen. Klingt niedlich, der Begriff. Nach nettem Onkel. Heißt aber nichts anderes als Krebsspezialist. Und solche Spezialisten haben natürlich am Samstagabend frei – da schieben nur übernächtigte Untergebene wie Doktor Beck Dienst.
»Ist gut«, höre ich mich sagen. »Kein Problem.«
Ernsthaft? Habe ich gerade »Kein Problem« gesagt? Im Zusammenhang mit einem Hirntumor? Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Das ist ja, als würde ich den apokalyptischen Reitern einen schönen Tag und viel Erfolg bei ihrer Mission wünschen. Sind es eigentlich drei, vier oder sieben apokalyptische Reiter? Ich sollte das googeln …
»Okay. Dann veranlasse ich jetzt mal Ihre stationäre Aufnahme«, unterbricht Doktor Beck meinen Gedankenstrudel, bevor er gänzlich ins Absurde abdriftet. »Ich schau dann später wieder bei Ihnen rein.« Sie nickt mir noch einmal aufmunternd zu, bevor sie mit wehendem Arztkittel verschwindet.
Ich bleibe allein in meiner Notaufnahmekabine zurück und fühle mich wie eine Schauspielerin bei Probeaufnahmen für die Rolle des Mädchens mit dem Gehirntumor. Und ich spiele sie so miserabel, dass man mich unmöglich dafür casten kann!
Schon klar, das hier ist weder ein Spielfilm noch eine Serie. Aber die Wahrheit kommt mir einfach noch unwahrscheinlicher vor als das, was meine Fantasie mir vorgaukelt. Oder stecke ich womöglich in einem Albtraum fest?
Wieder werde ich von einem Pfleger abgeholt, aber diesmal ist es nicht Robby, sondern ein netter Kerl mit grauen Locken und lustigen Grübchen. Er bringt mich auf eine Station im dritten Stock, wo ich offiziell als Patientin aufgenommen werde. Es fühlt sich so an, als wäre ich wie durch ein Wunder nun doch in die nächste Castingrunde gekommen. Trotz absoluter Talentlosigkeit.
Herzlichen Glückwunsch, Victoria!
Ich werde in ein Zimmer mit hellgrünen Wänden und einem beige gesprenkelten Gummiboden geschoben. Hey, ich bekomme sogar den Fensterplatz – Jackpot!
»Aber ich habe gar keine Zusatzversicherung für ein Einzelzimmer«, sage ich, als die Stationsschwester mit einer Teekanne hereinkommt. Dem Duft nach zu urteilen, ist es Pfefferminztee, bestimmt lauwarm und ungesüßt.
»Oh, das ist kein Einzelzimmer«, erklärt sie freundlich, »es sieht nur vorübergehend danach aus. Der Platz neben der Tür wird sicher bald wieder besetzt. Die Patientin, die bisher dort lag, ist heute früh … gegangen.«
Ihr kurzes Zögern sagt mir, dass meine Beinahe-Zimmergenossin nicht einfach nur entlassen wurde, sondern vermutlich in einem Kühlfach im Keller liegt. Mich überläuft eine Gänsehaut. Bisher waren Krankenhäuser für mich immer Orte, an denen man entweder geboren oder geheilt wird. Dass die meisten Menschen in einem Zimmer wie diesem ihren letzten Atemzug tun, habe ich nicht bedacht. Jetzt lässt sich der Gedanke nicht mehr verdrängen.
Ich will hier nicht sterben! Ich will erst noch meinen Hochsprungrekord brechen, mit Joshua ausgehen, mich unsterblich verlieben, um die Welt reisen, an den olympischen Spielen teilnehmen …
Bevor ich in Tränen des Selbstmitleids ausbreche, reißt die Krankenschwester einen der eingebauten Wandschränke auf. Ich sehe, dass ihr Kittel mit der Aufschrift »Schwester Sonja« bestickt ist – wie praktisch, dass hier alle sozusagen beschildert sind, da weiß man immer, mit wem man es zu tun hat. »Da können Sie Ihre Klamotten einräumen«, erklärt sie.
Welche Klamotten? Ich habe nichts dabei, was ich irgendwo hinräumen könnte, nur meine Sporttasche.
»Man hat mich direkt vom Leichtathletikturnier aus hergebracht«, erkläre ich. »Das ist jetzt blöd.«
»Kriegen wir hin«, beruhigt mich Schwester Sonja.
Fürs Erste bringt sie mir ein paar verwaschene Handtücher, außerdem eins dieser Krankenhaushemden, die hinten offen sind, und eine Wegwerfunterhose. Damit ich mich wenigstens frischmachen kann. Weil ich noch ziemlich wackelig auf den Beinen bin und das verstauchte Bein echt wehtut, wenn ich es belaste, begleitet sie mich ins Bad, wäscht mich und zieht mich um, als wäre ich ein hilfloses Kleinkind. Ich lasse es über mich ergehen.
»Ein Handy haben Sie doch sicher dabei«, sagt die Schwester, bevor sie geht. »Rufen Sie jemanden an, der Ihnen ein paar Sachen bringt. Sie wissen schon – Zahnbürste, Handtücher, Unterwäsche, Schlafanzüge, Hausschuhe und einen Bademantel. Die Standardausstattung eben.«
Einen Bademantel? So ein Teil besitze ich nicht mal. Ein Jogginganzug wird es wohl auch tun …
»Okay«, erwidere ich, »wird erledigt.« Fragt sich nur, von wem.
Als ich wieder allein bin, gehe ich meine Handykontakte durch. Sehr viele Nummern habe ich nicht gespeichert. Welche davon soll ich wählen?
Unter ICE wie In Case of Emergency habe ich meinen Vater eingetragen. Irgendwo habe ich nämlich mal gelesen, dass diese Abkürzung international gebräuchlich ist. So wissen Notärzte oder Rettungssanitäter immer sofort, welche Angehörigen sie als Erstes informieren sollen, wenn man zum Beispiel nach einem Autounfall nicht ansprechbar ist.
Diese ICE-Nummer wäre normalerweise meine erste Wahl. Aber Paps kann mir diesmal nicht helfen, er kommt erst in ein paar Tagen zurück. Zurzeit ist er in Helsinki auf einem Kongress und spricht dort mit anderen Wissenschaftlern über irgendwelche Fossilien – sein absolutes Spezialgebiet und Lieblingsthema.
Ich könnte ihn natürlich trotzdem anrufen, und in den meisten Familien wäre das vielleicht die normale Reaktion. Aber bei uns laufen die Dinge nun mal etwas anders. Ich meine, Paps und ich sind durchaus ein super Team! Im Alltag kommen wir wunderbar miteinander zurecht, und er gibt mir jede Menge Freiheiten, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß, aber emotional leben wir definitiv auf verschiedenen Umlaufbahnen. Vermutlich könnte er mehr mit mir anfangen, wenn ich keine achtzehnjährige Schülerin, sondern ein versteinerter Urzeitfisch wäre.
Mit anderen Worten: Er scheidet schon mal aus. Ich werde ihn keinesfalls auf seinem Kongress stören. Mein Tumor läuft ja nicht weg. Es reicht, wenn ich ihm nach seiner Rückkehr davon erzähle.
Und meine Mutter kommt noch viel weniger infrage. Weil ich sie nicht in meiner Nähe haben will. Aus Gründen. Sie hat sich nämlich schon vor vielen Jahren aus dem Staub gemacht. Ihr war das Leben mit einem verschrobenen Wissenschaftler nicht glamourös genug. Und das Leben als Mutter einer schlaksigen Zehnjährigen hat sie bei der Gelegenheit dann auch gleich hinter sich gelassen …
Ich werde ihr nie verzeihen, dass sie einfach so weggegangen ist. Wie konnte sie das nur übers Herz bringen? Was ist sie bloß für eine Rabenmutter! Sie ist definitiv die Letzte, die ich jetzt um Hilfe bitten würde.
Wie gut, dass ich volljährig bin und keinen Elternteil informieren muss. Ich stehe das allein durch. Die Frage ist bloß, wen ich wegen der Klamotten anrufen soll. Ich klicke mich weiter durch meine Kontakte.
Lennox? Auf keinen Fall! Er eignet sich eher zum Feiern, nicht zum Helfen. Und überhaupt – ich weiß nicht mal, was ich zu ihm sagen würde. »Hey, ich bin zwar nicht von dir schwanger, was obercool ist, aber ich habe einen Hirntumor, der mich gerade ziemlich aus der Bahn wirft, würdest du mir bitte ein Krankenhaustäschchen packen? Hier spricht übrigens Victoria. Du weißt schon, Victoria Sander, wir haben neulich eine Nacht miteinander verbracht …« Ich wette, er würde das Ganze für einen Scherz halten und lachend auflegen.
Aber wer sonst?
Meine Trainerin? Es würde mich nicht wundern, wenn Coach Meinert sich schon längst nach meinem Befinden erkundigt hätte. Schließlich bin ich eins ihrer größten Talente. Unsere Beziehung ist jedoch rein auf den Sport beschränkt. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie verheiratet ist und Kinder hat – nur, dass sie wegen einer Knieverletzung die olympischen Spiele in Peking knapp verpasst hat und dieser Chance noch immer hinterhertrauert. Ich zögere kurz. Dann entscheide ich, dass auch Clarissa Meinert nicht die Richtige ist. Die Vorstellung, wie sie in meinem Zimmer steht und meine Sachen zusammensucht, ist mir irgendwie unangenehm.
Ich scrolle weiter. Janine, Cassy, Alex, Sarah, Lexie – die Mädels aus dem Club. Absurder Gedanke, sie um einen derart persönlichen Gefallen zu bitten. Sie sind wie Lennox, nur in hautengen Minikleidern. Wir trinken zusammen Cocktails und gehen tanzen, oberflächlicher geht’s wirklich kaum.
Bleibt noch Joshua. Der attraktive, von allen angehimmelte Joshua, der in der Schule monatelang so getan hat, als wäre ich für ihn unsichtbar, und sich gerade erst letzte Woche dazu herabgelassen hat, mich anzusprechen. Und nicht nur das: sich mit mir zu verabreden. Für nächsten Samstag!
Ja, wenn wir schon zusammen wären, dann wäre es natürlich keine Frage, wen ich um Hilfe bitten würde. Aber vor dem ersten Date? Nein, das geht gar nicht! Wenn Joshua mich so sieht, ist es zwischen uns aus, bevor es überhaupt angefangen hat. Gibt es etwas Abturnenderes als ein Krankenhaushemdchen? Auch wenn es rückenfrei ist …
Die Tür geht auf, und Doktor Beck kommt herein. Sie trägt jetzt Jeans und eine geblümte Bluse statt des weißen Kittels.
»Ich wollte noch mal rasch nach Ihnen sehen, bevor ich nach Hause gehe.«
Ich nicke. Das ist nett von ihr. Aber hilft es mir? Wohl eher ihrem Gewissen. Sie hat mir die Diagnose an den Kopf geknallt und will sichergehen, dass ich nicht zusammenbreche.
»Morgen werden sich die Kollegen um Sie kümmern. Es werden weitere Tests gemacht. Dann können die Spezialisten mit Ihnen besprechen, wie therapeutisch weiter vorgegangen wird.«
Sie wirft mit Fachbegriffen wie Lumbalpunktion, Biopsie und MRT um sich. Jetzt fühle ich mich, als hätte ich das Casting wie durch ein Wunder doch bestanden und eine Rolle in einer Krankenhausserie ergattert. Oder noch besser: in Wunder dauern etwas länger, meiner absoluten Lieblingsserie mit Marek Carter als Engel in Menschengestalt, der mich selbstverständlich retten würde. Mit einer beiläufigen, zärtlichen Berührung und einem seiner berühmten magischen Blicke aus diesen unfassbar blauen Augen …
Was gäbe ich darum, jetzt vor dem Fernseher lungern und Marek Carter anschmachten zu können. Natürlich säße ich auf der Couch statt im Klinikbett und hätte eine große Tüte Chips auf dem Schoß. Und ich würde definitiv kein Krankenhaushemd tragen!
Okay, Marek Carter ist nicht in Sicht, weder auf dem Bildschirm noch leibhaftig als rettender Engel. Also spiele ich die vernünftige Patientin und danke Doktor Beck für ihre Informationen. Dann wünsche ich ihr noch einen schönen Feierabend.
»Alles Gute für Sie«, erwidert sie.
Eine seltsam nichtssagende Formulierung. Was sie damit wohl meint? Dass mir langes Leid erspart bleibt? Dass ich meine Restlaufzeit einigermaßen angenehm verbringe? Dass mir die Spezialisten morgen verkünden, dass alles bloß ein riesengroßer Irrtum war? »Sie sind lediglich ein bisschen dehydriert und unterzuckert, Frau Sander. Davon und von Ihrer Verstauchung abgesehen, sind Sie kerngesund.«
Man wird ja noch träumen dürfen.
Mein Blick fällt auf das Handy in meiner Hand. Was wollte ich noch gleich damit?
Ach ja. Jemanden anrufen, der mir meine Sachen bringt. Das müsste schon ein guter Freund sein – leider habe ich allerhöchstens Kontakte, keine Freunde. Denn Freunde muss man nah an sich heranlassen, und das liegt mir einfach nicht. Mein emotionaler Panzer schützt mich vor Enttäuschungen. Aber in Situationen wie dieser nützt mir der ganze Schutz nichts. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Nur wen? Einer nach dem anderen ist ausgeschieden. Die einen kennen mich als Victoria, die Sportskanone, die anderen als Victoria, das Partygirl. Doch wer von ihnen kennt mich wirklich? Vermutlich nicht mal ich selbst …
Ein letztes Mal gehe ich alle Namen durch. Dann halte ich inne. Bei T wie Theo.
Ja, Theo ist der Einzige, der eventuell infrage kommen könnte. Theo, der Nerd. Mein karohemdtragender, schwarzweißfilmliebender, logikrätselbegeisterter Mathe-Nachhilfelehrer. Und, wie mir gerade klar wird, vielleicht so was wie mein einziger Freund.
Kapitel 3Der Nerd und ich
Weil Theo und ich uns bisher immer per WhatsApp verabredet haben, wähle ich auch heute diesen Weg. Doch statt »Hilfe, kein Plan von Vektorrechnung und übermorgen Klausur, du musst mich retten!« schreibe ich ihm diesmal eine Liste der Sachen, die er für mich einpacken soll, und dazu eine Erklärung, wo er sie findet.
Drei Sekunden später klingelt mein Handy. »Was ist passiert, warum bist du im Krankenhaus?«, will Theo wissen.
Mir wird ganz warm ums Herz. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn sich jemand um einen sorgt, ohne dafür bezahlt zu werden. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, Paps auf seinem Fossilien-Kongress zu stören? Ach, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll! Vermutlich kann ich nicht einmal mehr klar denken – schließlich ist dieses Raumforderungsdingens in meinem Kopf …
»Victoria? Bist du noch dran? Alles okay bei dir?«, hakt Theo nach. Ups, ich habe total vergessen, dass er noch auf meine Antwort wartet.
»Ja, alles okay. Das heißt – nein, eigentlich nicht so richtig.«
Ich sehe Theos gerunzelte Stirn geradezu vor mir. Mit so einer sich selbst widersprechenden Antwort kann ein Logiker wie er nichts anfangen.
Wie erklärt man jemandem schonend, dass man einen Gehirntumor hat? Am besten geradeheraus, entscheide ich. Mich hat ja schließlich auch keiner geschont, und immerhin bin ich betroffen, im Gegensatz zu Theo.
Ich sage also meinen Text auf und muss fast darüber lachen, weil er so absurd klingt.
»Du machst Witze. Sehr schlechte Witze übrigens!«, erwidert Theo. Er glaubt mir nicht. Kein Wunder.
Also erzähle ich ihm alles – von meinem vermurksten Hochsprungversuch, dem Sturz, dem Krankenwagen, den Untersuchungen und schließlich dem Verstörenden, was das CT gezeigt hat.
Es kommt mir vor, als würde ich von jemand anderem reden statt von mir. »Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass so etwas passiert, ist extrem gering, aber nicht gleich null«, schließe ich meinen Bericht mit einem Argument aus der Mathematik, und das scheint ihn zu überzeugen.
»Was für ein Mist«, bringt Theo die Sache auf den Punkt. Er wirkt schockiert. So kenne ich ihn überhaupt nicht.
»Immerhin besteht noch eine winzige Chance, dass sich die Ärzte geirrt haben. Doch selbst wenn die nächsten Untersuchungen das zeigen sollten, ändert es nichts daran, dass ich über Nacht hierbleiben muss und dafür Waschutensilien und Klamotten brauche.«
Theo fragt nach dem Haustürschlüssel. Ich verrate ihm, unter welchem Blumentopf der Ersatzschlüssel versteckt ist.
»Das ist kein Versteck, sondern eher eine Einladung an sämtliche Einbrecher. Man könnte ebenso gut eine Einzugsermächtigung fürs Girokonto unter den Blumentopf legen«, kommentiert er. Ich muss darüber lachen, auch wenn mir klar ist, dass er das keineswegs als Scherz gemeint hat. Theo macht selten Scherze.
Bevor ich auflege, beschwöre ich ihn, niemandem etwas von der Diagnose zu sagen. Er verspricht es.
Anschließend wird mir klar, dass diese Bitte total überflüssig war. Wir haben eh keine gemeinsamen Freunde. Genau genommen haben wir beide überhaupt keine echten Freunde. Falls sich jemand nach meinem Befinden erkundigen will, wird er eher jemanden aus dem Leichtathletikteam fragen als Theo. Dass er mir Mathe-Nachhilfe gibt, weiß vermutlich kaum jemand.
Das Ganze ergab sich auch rein zufällig. Ich stand am Schwarzen Brett und hoffte, wie jeden Morgen, auf den Vertretungsplan. Vielleicht fiel ja Mathe aus? Oder wurde für alle Zeiten abgeschafft … Okay, das würde nicht passieren, so viel war mir auch klar, aber mir blieb wohl nichts anderes übrig, als an Wunder zu glauben. Denn mehr als null Punkte in Mathe zu bekommen, war ohne Zauberei fast undenkbar.
Während ich noch dastand und den Vertretungsplan anstierte, als könnte ich mit purer Willenskraft die Ankündigungen verändern (selbstverständlich fiel Mathe nicht aus), stellte sich Theo neben mich und pinnte seinen Aushang fest.
»Mathe-Nachhilfe von Oberstufenschüler mit Mathe-Leistungskurs. Misserfolge sind inakzeptabel. Melde dich unter folgender Handynummer …«
Spontan zog ich mein Handy hervor und schickte ihm eine Nachricht: »Hoffnungslose Mathe-Loserin nimmt die Herausforderung an. Ablehnung ist inakzeptabel. Melde dich einfach, indem du dich umdrehst.«
Ich fand mich ziemlich schlagfertig und witzig. Theo fuhr herum und runzelte nur die Stirn. »Stehst du schon die ganze Zeit hier? Warum sagst du denn nichts? Die SMS hättest du dir sparen können.«
Okay. Ein Nerd. Eindeutig. Und humorlos dazu.
Zum Glück fiel mir gleich eine halbwegs vernünftige Erklärung für mein unvernünftiges Verhalten ein. »So kannst du meine Nummer speichern und ich deine«, sagte ich schnell.
Wir verabredeten uns für den nächsten Nachmittag bei Theo zu Hause. Sein Zimmer strahlt ungefähr so viel Gemütlichkeit aus wie ein Labor. Alles ist weiß und ordentlich und klinisch sauber. Und natürlich gibt es jede Menge Technik: Computer, Drucker, mehrere riesige Bildschirme und allerhand Gerätschaften, von denen vermutlich nur er selbst weiß, wozu man sie braucht.
Meine Hoffnung sank augenblicklich, als ich das Zimmer sah. Dieser Typ würde mir nie helfen können, unsere Gehirne funktionierten einfach zu unterschiedlich.
Doch dann überraschte er mich, indem er mir das Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung mit so einfachen Worten nahebrachte, dass es mir in diesem Augenblick total einleuchtend und logisch erschien.
Okay, das war bloß eine thematische Einführung, später wurde es dann wesentlich komplizierter. Aber Theo hat ein Supertalent, das leider nicht alle Lehrer besitzen: Er kann unfassbar gut erklären.
In der nächsten Mathearbeit schaffte ich unglaubliche sieben Punkte, was einer Drei minus entspricht. Ich wäre Theo in der Pause am liebsten um den Hals gefallen, doch ich konnte ihn nirgendwo finden. Später stellte sich heraus, dass er die Pause in der Bibliothek verbracht hatte, um etwas über die Mathematik des Mittelalters zu lesen. Und als ich ihn das nächste Mal sah, hatte ich meine Euphorie so weit im Griff, dass ich von körperlichen Dankesbekundungen absah. Theo ist kein Typ für spontane Umarmungen, schätze ich.
Von da an trafen wir uns einmal in der Woche, vor Klausuren bei Bedarf noch öfter (und der Bedarf war immer gegeben). Meine Noten liegen inzwischen stabil zwischen befriedigend und ausreichend, nicht mehr zwischen knapp mangelhaft und ungenügend. Für uns beide eine Riesenleistung!
Meine Mathelehrerin verbuchte meine Fortschritte als eigenen Erfolg. »Dafür bin ich Pädagogin geworden«, erklärte sie mir zufrieden. »Nicht um die guten Schüler sehr gut zu machen, sondern um den hoffnungslosen Fällen eine Perspektive zu geben.«
Ich ließ sie in dem Glauben. Obwohl ich ungern als hoffnungsloser Fall bezeichnet werde. Aber sie meinte es ja irgendwie gut.
Meinen Mitschülern waren meine Noten herzlich egal. Daher sah ich auch keinen Anlass, ihnen die Hintergründe meiner plötzlichen Verbesserung darzulegen. Am Ende wären sie alle zu Theo gerannt, und er hätte womöglich keine Zeit mehr für mich gehabt? Kam ja gar nicht infrage!
Ich schließe die Augen. Was für ein Tag. Urplötzlich fühle ich mich hundemüde. Doch gerade, als ich einnicken will, gibt es Abendessen. Zwei Scheiben Graubrot mit Butter, Scheiblettenkäse und Leberwurst, dazu eine Essiggurke und noch mehr lauwarmen Pfefferminztee.
Verrückterweise spüre ich bei diesem wenig verlockenden Anblick, wie hungrig ich bin. Kein Wunder, bis auf eine Banane zum Frühstück habe ich noch nichts gegessen. Ich verputze alles bis auf den letzten Krümel und nehme dankbar das Angebot von Schwester Sonja an, mir noch einen übrig gebliebenen Joghurt zu bringen.
Würde man mich hinterher nach der Geschmacksrichtung fragen, könnte ich nur raten. Ich habe diese Mahlzeit nicht genossen, sondern lediglich zu mir genommen. Aus purem Trotz. Oder nennen wir es Selbsterhaltungstrieb. Wer isst und verdaut, lebt noch. Diesem blöden Tumor werde ich es zeigen. Und wenn ich bergeweise Graubrot essen muss!
Nachdem Schwester Sonja abgeräumt und angekündigt hat, dass demnächst die Nachtschwester übernimmt, ist meine Müdigkeit von vorhin verflogen. Ich schalte den Fernseher ein, doch es laufen überall nur Krimis, Nachrichten oder Talentshows. Langweilig.
Als Hintergrundberieselung lasse ich ein Darts-Turnier laufen, auch wenn ich mich für diesen Sport nicht sonderlich interessiere und noch nicht einmal die Regeln beherrsche. Dennoch fühle ich mich mit den Teilnehmern, die alle ungefähr so untrainiert aussehen wie Paps, irgendwie verbunden. Sie leben für ihren Sport und haben garantiert seit Jahren unzählige Stunden damit verbracht, ein und denselben Bewegungsablauf immer weiter zu perfektionieren. Genau wie ich.
Ob ich wohl jemals wieder einen Flop zustande bringe? Unvorstellbar, dass es das mit meiner Hochsprungkarriere gewesen sein könnte.
Spontan schnappe ich mir mein Handy und schreibe Coach Meinert eine kurze Nachricht. Den Tumor erwähne ich darin nicht, sondern nur, dass ich zur Beobachtung im Krankenhaus bin und vermutlich für die nächsten Wochen nicht zum Training kommen kann.