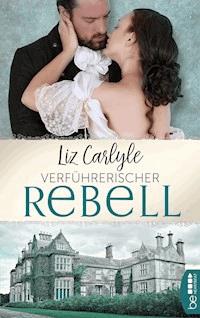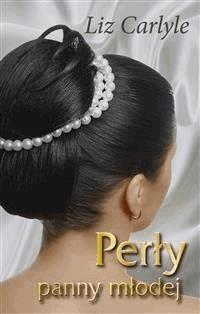4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neville Family
- Sprache: Deutsch
Ein verführerisches Spiel
Als der skrupellose Comte de Valigny die Hand seiner Tochter Camille als Einsatz in einem Kartenspiel anbietet, ist selbst der mit allen Wassern gewaschene Lebemann Kieran Rothewell erschüttert. Wie kann der Comte nur so herzlos sein? Kieran setzt alles daran, das Spiel - und damit die Lady - zu gewinnen, um sie vor ihrem Vater und den anderen Lüstlingen am Tisch zu bewahren. Doch bei Camilles attraktivem Anblick hat auch Kieran bald nur noch eines im Sinn: sie zu verführen ...
Weitere historische Liebesromane aus der Neville-Family-Reihe als eBook bei beHEARTBEAT: "Entflammt von deiner Liebe" und "Verloren in deiner Sehnsucht".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Verloren in deiner Sehnsucht
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Ein verführerisches Spiel
Als der skrupellose Comte de Valigny die Hand seiner Tochter Camille als Einsatz in einem Kartenspiel anbietet, ist selbst der mit allen Wassern gewaschene Lebemann Kieran Rothewell erschüttert. Wie kann der Comte nur so herzlos sein? Kieran setzt alles daran, das Spiel – und damit die Lady – zu gewinnen, um sie vor ihrem Vater und den anderen Lüstlingen am Tisch zu bewahren. Doch bei Camilles verführerischem Anblick hat auch Kieran bald nur noch eines im Sinn: sie zu verführen …
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck – auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
BEZWUNGENVON DEINERLEIDENSCHAFT
Aus dem amerikanischen Englisch vonSusanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Susan Woodhouse Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Never romance a Rake«
Originalverlag: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhild Gerlich
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © hotdamnstock; © thinkstock: NataliiaKucherenko | yurok; © iStock: LordRunar
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5781-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Phil und Roscoe,das Dynamic Duo
Prolog
Auf den Zuckerrohrfeldern
Die Sonne über den Westindischen Inseln brannte auf die stillen und grünen Felder herunter und trocknete den Boden aus. Säulendekorierte weiße Plantagenhäuser leuchteten in der flirrenden Hitze und schmückten die üppige Landschaft wie verstreute schimmernde Perlen. Die breiten Korridore der eleganten Häuser waren in Dunkelheit gehüllt. Die Lamellen der Fensterjalousien standen weit offen, um den kaum spürbaren Luftzug hereinzulassen, während Sklavenkinder die Ventilatoren antrieben, die wie riesige Raubvogelschwingen unter den hohen Decken hingen.
Es war ein blühendes Land; ein fast magischer Ort, wo das Geld buchstäblich aus der Erde wuchs, Tropfen um glänzenden Tropfen von den knirschenden Walzen der Zuckermühlen ausgepresst und gewonnen mit dem Schweiß der Männer – und der Frauen –, die das Zuckerrohr bearbeiteten. Das Land der Zuckerbarone und reichen Reeder. Ein kolonialer Außenposten, so weit abgelegen, dass das Auge des Königs nicht bis dorthin reichte – und oftmals taten es auch seine Gesetze nicht.
Neben den englischen Ladys, die in der Hitze ermattet auf ihren Diwanen ruhten, und den Sklaven, die sich in ihrem Elend quälten, existierte aber noch eine dritte Art von Menschen in diesem entfernten Paradies. Seemänner, die sich nach ihrem Zuhause zurücksehnten, das die meisten von ihnen jedoch niemals wiedersehen würden. Ehemals angestellte Dienstboten, die jetzt zu Sklaven der Umstände geworden waren. Hafendirnen, Straßenkehrer und Waisen – stumm und unsichtbar.
In dieser Welt aus Hitze und Gleichgültigkeit flohen zwei Jungen durch die dichten Reihen aus hohem, grünem Zuckerrohr, dessen rasiermesserscharfe Blätter ihnen die Arme und Gesichter zerschnitten. Sie atmeten in keuchenden Stößen. Sie verschwendeten keinen Gedanken an das wogende Band der saphirblauen See unter ihnen oder an das heruntergekommene Haus auf dem Hügel hinter ihnen. Sie hatten nie einen Diwan gesehen, geschweige denn auf einem gelegen.
»Da lang!« Der größere Junge knuffte den kleineren hart in die linke Schulter. »Zum Sumpf. Dort kriegt er uns nicht.«
Sie rannten am Saum des Zuckerrohrfeldes entlang; blasse dünne Arme holten weit aus. Der kleinere Junge tauchte unter dem niedrigen Ast eines Baums hindurch, hetzte weiter. Der Schmerz in seiner Brust stach wie ein Messer. Sein Puls raste. Die Angst trieb ihn weiter. Er konnte schon das brackige Wasser riechen. Nur noch ein paar Meter. Ihre nackten Füße wirbelten Staub auf, als sie am Feldrand entlangrannten. Fast. Fast. Fast in Sicherheit.
Ein betrunkenes Brüllen durchdrang die glühende Hitze. Ihr Onkel brach aus dem Zuckerrohr hervor, wo er gelauert hatte – wie ein Ungeheuer in den Mangroven. Versperrte den Weg zum Sumpf. Die Jungen blieben stehen. Traten zurück, drehten sich halb um. Ein dürrer Schwarzer tauchte aus dem Zuckerrohr auf, blockierte den Weg hinter ihnen. Sein Gesicht war ausdruckslos, aber in seinen Augen lag Mitleid.
Die Jungen drehten sich um, schmale Schultern senkten sich ergeben.
»Aye, jetzt hab ich euch, ihr kleinen Scheißkerle, eh?« Der Onkel kam auf sie zu, seine Schritte waren bemerkenswert fest für einen Mann, der von Rum und Grausamkeit vergiftet war.
Der kleinere Junge wimmerte, der größere nicht.
Der Onkel blieb stehen, seine Schweinsäuglein verengten sich zu glitzernden schwarzen Schlitzen, während eine Reitpeitsche fast fröhlich an seinem Handgelenk baumelte. »Bring mir den Kleinen, Odysseus«, sagte er. Spucke tropfte von seiner Lippe. »Ich werde es diesem Bettelpack austreiben, frech zu mir zu sein.«
Der Schwarze kam heran, packte den kleineren Jungen, zögerte dann.
Wie ein Blitz traf den Schwarzen die Peitsche des Onkels ins Gesicht, Blut lief ihm über seine ebenholzfarbene Wange. »Bei Gott, du wirst diesem kleinen Lumpen das Hemd ausziehen und ihn festhalten, Odysseus, oder du wirst vierzig Hiebe bekommen – und eine Woche im Loch, um deinen Ungehorsam zu büßen.«
Odysseus stieß den Jungen vorwärts.
Der größere Junge trat näher. »Er war nicht frech, Sir«, piepste er. »E-er war es nicht. Er hat kein Wort gesagt. E-er ist doch erst acht, Sir. Bitte.«
Der Onkel grinste und beugte sich hinunter. »Immer der helfende Gute, du kleiner Scheißer, eh?«, fragte er. »Aye, wenn du so verdammt mutig bist, kannst du die Prügel statt seiner kriegen. Zieh ihm das Hemd aus, Odysseus.«
Der ältere Junge wich ein kleines Stück zurück, als der Sklave ihn am Arm packte. »S-Sir«, stotterte der Junge. Seine Augen waren weit aufgerissen. »Ich – ich hab nur versucht, es zu erklären – n-niemand war frech. W-wir haben kein Wort gesagt, Sir. Es war nur der Pfau. Er hat gekreischt, Sir, erinnern Sie sich?«
Aber Odysseus hatte schon begonnen, dem Jungen das schmutzige Leinenhemd über den Kopf zu zerren, ungeachtet der Gegenwehr. Der kleinere Junge presste beide Fäuste vor den Mund, krümmte sich zusammen und begann, lautlos zu schluchzen.
In Odysseus’ braunen Augen standen Tränen, als er das zerschlissene Hemd in den Staub des Zuckerrohrfeldes warf und die Arme des älteren Jungen nach vorn vor dessen Brust zog und sie dort festhielt. Die schmalen Schulterblätter des Jungen stachen hervor wie die Flügel eines Reihers.
»Ihr kleinen Scheißkerle werdet jenen Tag noch bereuen.« Der Onkel zog die Peitsche durch seine Faust, als würde er es genießen. »Aye, jenen Tag, an dem ihr von diesem Schiff gekommen seid, um mir das Leben zur Hölle zu machen.«
Der ältere Junge schaute sich zu ihm um. »Bitte, Sir«, flehte er. »Schicken Sie uns doch einfach zurück. Wir werden gehen. Das werden wir.«
Der Onkel lachte und holte mit der Peitsche aus. Odysseus wandte sein blutendes Gesicht ab.
Als die Schläge begannen, gnadenlos und gleichmäßig, presste der kleinere Junge ganz fest die Augen zusammen. Er hörte nicht die Schreie seines Bruders. Das Knarzen des Leders. Und während er das alles aus seiner Wahrnehmung ausblendete, brannte die Sonne vom Himmel, erhob sich ein leichter Wind, und die reichen Leute in ihren Plantagenhäusern genossen ihre Ventilatoren und schickten ihre Sklaven nach mehr Limonade. Auf diesen Inseln war Gott zu Hause, und alles war so, wie es sein sollte.
Als der kleinere Junge die Augen wieder öffnete, hatte Odysseus sich seinen Bruder vorsichtig über eine Schulter gelegt und war auf dem Weg zum Haus. Der Staub des Zuckerrohrfeldes wirbelte um seine schwarzen Füße. Der kleinere Junge warf einen letzten Blick auf den Onkel.
Die Augen glasig vom Alkohol und vor Befriedigung, zog der Onkel seinen Flachmann aus dem Gehrock, prostete dem Jungen damit zu und blinzelte ihn an. »Aye, das nächste Mal bist du dran, du kleine Rotznase«, versprach er. »Das nächste Mal wird Odysseus dich vom Feld tragen.«
Der kleinere Junge drehte sich um und rannte.
Kapitel 1
In welchem Rothewell dem Gevatter Tod begegnet
Der Oktober ist ein abscheulicher Monat, dachte Baron Rothewell, als er aus dem Fenster seiner Kutsche starrte, an dem die Regentropfen herunterliefen. John Keats war entweder ein poetischer Lügner oder ein romantischer Narr gewesen. Im trüben Marylebone war der Herbst nicht die Zeit des sanften Nebels und der reichen Ernte. Es war vielmehr die Zeit des Trübsinns und des Verfalls. Kahle Bäume säumten die Plätze, und das Laub, das farbenfroh herumwirbeln sollte, lag stattdessen auf den Straßen und türmte sich in nassen braunen Haufen an den schmiedeeisernen Zäunen. London – wie wenig davon je lebendig gewesen war – war im Sterben begriffen.
Während seine Kutsche unermüdlich durch Pfützen und Schlimmeres rollte, zog Rothewell am Stumpen einer Zigarre und starrte fast blicklos auf die Bürgersteige, die an ihm vorbeizogen. Zu dieser Tageszeit waren sie leer – bis auf einen Angestellten oder Dienstboten, der hin und wieder mit einem schwarzen Regenschirm vorbeihastete. Der Baron sah niemanden, den er kannte. Aber schließlich kannte er in dieser Stadt auch so gut wie niemanden.
An der Ecke Cavendish Square und Harley Street klopfte er mit dem goldenen Knauf seines Spazierstockes an das Dach seiner Reisekutsche, um dem Kutscher anzuzeigen, dass er anhalten sollte. Die beiden Lakaien, die hinten auf der Kutsche postiert waren, sprangen herbei, um die Treppe herauszuklappen. Rothewell war dafür berüchtigt, sehr ungeduldig zu sein.
Er stieg aus, und die Falten seines dunklen Umhangs umwehten ihn elegant, als er sich zu seinem Kutscher umwandte. »Fahren Sie zum Berkeley Square zurück.« Im Nieselregen klang sein Befehl fast wie das tiefe Grummeln eines Donners. »Ich werde zu Fuß nach Hause gehen, wenn meine Angelegenheiten hier erledigt sind.«
Niemand hielt sich damit auf, ihm davon abzuraten, im Nieselregen herumzulaufen. Und schon gar nicht wagte jemand zu fragen, was den Baron den weiten Weg vom Hafenviertel hierher hatte unternehmen lassen, in die weniger vertrauten Straßen von Marylebone. Rothewell war Privatier und überdies kein besonders gut gelaunter.
Er zertrat seinen Zigarrenstumpen nachdrücklich mit dem Absatz und schickte die Kutsche mit einer Handbewegung davon. Respektvoll tippte der Kutscher mit der Peitsche an seine Hutkrempe, bevor er anfuhr.
Der Baron verharrte auf dem Bürgersteig, bis die Kutsche um die letzte Ecke des Karrees gebogen und in der Tiefe der Holles Street verschwunden war. Er fragte sich, ob er sich zum Narren machte. Vielleicht hatte seine Gemütsverfassung ihn dieses Mal so aus dem Lot gebracht, überlegte er und begann, entschlossenen Schrittes die Harley Street hinaufzugehen. Vielleicht war das alles. Seine Stimmung. Und eine weitere Nacht ohne Schlaf.
Er war in den graurosafarbenen Stunden kurz vor der Morgendämmerung aus dem Satyr’s Club heimgekommen. Dann, nach einem Bad und einem den Magen zum Revoltieren bringenden Blick auf das Frühstück, war er geradewegs in das Hafenviertel gefahren, zum Kontor der Reederei, die seiner Familie gehörte, um sich davon zu überzeugen, dass während der Abwesenheit seiner Schwester alles seinen Gang ging. Aber nach einem Ausflug zu Neville Shipping war Rothewell stets nervös und gereizt – weil, das gab er offen zu, er mit diesem verdammten Geschäft nichts zu tun haben wollte. Er würde heilfroh sein, wenn Xanthia von ihrer Reise mit ihrem frisch angetrauten Ehemann zurückkehren würde, damit diese Last wieder von seinen Schultern genommen und zurück auf ihre gelegt würde, wohin sie schließlich gehörte.
Aber schlechte Laune konnte nicht im Entferntesten für seine momentanen Probleme verantwortlich sein, und tief in seinem harten schwarzen Inneren wusste Rothewell das. Er verlangsamte seinen Schritt, um die Messingschilder zu lesen, die sich an den Türen der eleganten Häuser befanden, die die Harley Street säumten. Und von diesen Schildern gab es einige: Hislop. Steinberg. Devaine. Manning. Hoffenberger. Die Namen verrieten ihm nichts über die Menschen hinter den Türen – nichts über deren Charakter, deren Sorgfalt oder, was noch mehr zählte, über deren schonungslose Ehrlichkeit.
Rothewell erreichte schon bald die Ecke der Devonshire Street und stellte fest, dass sein Erkundungsgang zu Ende war. Er schaute über die Schulter zurück auf die Straße, die er gerade entlanggegangen war. Verdammt, er ging mit der Sache um, als würde er nach einem Gemüsehändler suchen. Aber in diesem Fall konnte man die Ware kaum durch ein Fenster in Augenschein nehmen. Zudem wollte er im Grunde genommen niemanden um Rat bitten – oder dessen prüfende Fragen anhören, die folgen würden.
Stattdessen versicherte er sich einfach selbst, dass Kurpfuscher und Medizinmänner im Allgemeinen keine Praxen in Marylebone hatten. Denn auch wenn der Baron erst seit einigen Monaten in London weilte, wusste er bereits, dass sich die Harley Street allmählich zum Territorium von Hippokrates’ Elite entwickelte.
Bei diesem Gedanken machte er kehrt und stieg die breite Marmortreppe des letzten Hauses mit einem Messingschild hinauf, an dem er vorbeigekommen war. Wenn der eine Arzt so gut war wie der andere, könnte es ebenso gut dieser sein – an diesem Punkt seiner Überlegungen beugte sich Rothewell vor, um durch den Nieselregen auf das Schild zu schauen – ah ja: James G. Redding, M.D. – Hier würde er richtig sein.
Ein in Grau gekleidetes Hausmädchen mit rundlichem Gesicht öffnete Rothewell die Tür, kaum dass er den Türklopfer losgelassen hatte. Ihr Blick glitt an ihm hinauf – weit hinauf –, während sie seine Erscheinung abschätzte. Fast sofort riss sie die Tür weit auf und knickste tief. Sie beeilte sich, ihm den nassen Hut und den Umhang abzunehmen.
Rothewell reichte ihr seine Karte. »Ich möchte Dr. Redding konsultieren«, sagte er, als würde er solche Anliegen täglich vorbringen.
Offensichtlich konnte das Mädchen lesen. Es schaute auf die Karte und knickste wieder, den Blick gesenkt. »Erwartet der Doktor Sie, Mylord?«
»Nein, das tut er nicht«, bellte er. »Aber es handelt sich um eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit.«
»S-Sie würden es nicht vorziehen, dass er Sie zu Hause besucht?«, wagte sie sich weiter vor.
Rothewell bedachte das Mädchen mit seinem finstersten Blick. »Unter gar keinen Umständen«, schnauzte er. »Ist das klar?«
»Ja, Mylord.« Das Mädchen war blass geworden und holte tief Luft.
Mein Gott, warum hatte er sie so angeschnauzt? Es wurde im Allgemeinen erwartet, dass die Ärzte ihre Patienten zu Hause aufsuchten, nicht die Patienten die Ärzte. Aber sein verdammenswerter Stolz würde das niemals zulassen.
Das Mädchen ergriff wieder das Wort. »Ich fürchte, Mylord, dass der Doktor noch nicht von seinen Nachmittagsvisiten zurückgekehrt ist«, erklärte sie freundlich. »Er könnte noch einige Zeit fort sein.«
Damit hatte Rothewell nicht gerechnet. Er war ein Mann, der es gewohnt war zu bekommen, was er wollte – und das schnell. Seine Frustration war ihm offensichtlich anzusehen.
»Wenn Sie zu warten wünschen, Mylord – darf ich Ihnen einen Tee bringen?«, bot das Mädchen an.
Aus einem Impuls heraus griff Rothewell sich seinen Hut von dem Tischchen, auf dem das Mädchen ihn abgelegt hatte. Er hatte hier nichts verloren. »Danke, nein«, lehnte er angespannt ab. »Ich muss gehen.«
»Darf ich dem Doktor eine Nachricht überbringen?« Die Miene des Hausmädchens zeigte Widerstreben, als es ihm seinen Umhang reichte. »Vielleicht könnten Sie morgen wiederkommen?«
Rothewell empfand den fast überwältigenden Drang, diesen Ort zu verlassen und vor seinen eigenen närrischen Ängsten und Gedanken zu fliehen. »Nicht morgen. An einem anderen Tag – vielleicht.«
Er verließ das Haus in so großer Hast, dass er den hochgewachsenen Mann übersah, der die Treppe heraufkam, und diesen fast umrannte.
»Guten Tag«, grüßte der Mann und lüftete den Hut, während er geschickt zur Seite auswich. »Ich bin Dr. Redding. Kann ich irgendwie behilflich sein?«
»Eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit, hm?«, sagte Dr. Redding zehn Minuten später. »Ich frage mich, Mylord, warum Sie es so lange haben laufen lassen, wenn Sie es doch für so dringend halten.«
Der Arzt war ein dunkelhaariger dürrer Mann mit einer Hakennase und tief liegenden Augen. Der Gevatter Tod, der seine Kapuze abgestreift hatte.
»Falls es gekommen und wieder gegangen wäre, Sir, wäre es jetzt nicht dringend, nicht wahr?«, widersprach Rothewell. »Und ich dachte, das würde es. Wieder weggehen, meine ich. Diese Art von Dingen tut das immer, wissen Sie.«
»Hm«, sagte der Arzt und zog Rothewells untere Augenlider herunter. »Von welcher Art von Dingen sprechen Sie, Mylord?«
Rothewell brummte unwillig. »Verdauungsstörungen«, sagte er schließlich. »Unpässlichkeit. Sie wissen schon, was ich meine.«
Der Blick des Arztes wurde seltsam ausdruckslos. »Nun, bei Ihnen geht es um ein wenig mehr als um eine gestörte Verdauung, Mylord«, konstatierte er und betrachtete wieder Rothewells linkes Auge. »Und Ihre Farbe ist besorgniserregend.«
Wieder stieß Rothewell ein missmutiges Brummen aus. »Ich bin vor Kurzem von den Westindischen Inseln gekommen«, erklärte er dann. »Ich habe zu viel Sonne abbekommen, würde ich meinen. Mehr ist es nicht.«
Der Doktor lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Mehr als das ist es nicht?«, wiederholte er und sah ungeduldig aus. »Das denke ich nicht, Sir. Ich rede von Ihren Augen, nicht von Ihrer Haut. Dort scheint eine Spur von Gelbfärbung vorzuliegen. Dies sind ernste Symptome, und das wissen Sie. Ansonsten wäre ein Mann Ihrer Sorte niemals hierhergekommen.«
»Von meiner Sorte …?«
Der Arzt ignorierte ihn und fuhr stattdessen mit seinen Fingerspitzen über Rothewells Kinn und dann über beide Seiten seines Halses. »Sagen Sie, Mylord, haben Sie an Malaria gelitten?«
Rothewell lachte. »Das war einer der Flüche der Tropen, von denen ich verschont geblieben bin.«
»Sie sind starker Trinker?«
Rothewell grinste grimmig. »Einige behaupten das.«
»Und Sie rauchen«, stellte der Arzt fest. »Ich kann es riechen.«
»Ist das ein Problem?«
»Übermäßiger Genuss jeder Art ist ein Problem.«
Rothewell knurrte unwillig. Ein moralisierender Pessimist. Genau das, was er brauchte.
Mit raschen, ungeduldigen Bewegungen zog der Arzt einen Vorhang neben der Tür zur Seite, was dessen Metallringe disharmonisch klirren ließ. »Wenn ich Sie bitten darf, Mylord – treten Sie hinter den Vorhang, und legen Sie Ihren Rock, Ihre Weste und Ihr Hemd ab. Und dann legen Sie sich bitte dort auf die Liege.«
Rothewell begann, seine Seidenweste aufzuknöpfen, wobei er im Stillen den Arzt, den nagenden Schmerz in seinem Magen und sich selbst verfluchte. Das Leben in London brachte ihn um. Der Müßiggang war wie ein Gift, das in seine Adern einsickerte. Er konnte es fühlen, brachte jedoch nicht genügend Selbstachtung auf, es abzuschütteln.
Bis heute konnte er an einer Hand die wenigen Male abzählen, die er sich krank genug gefühlt hatte, um einen Arzt aufzusuchen. Ärzte bewirkten sehr viel mehr Schlimmeres, als sie Gutes bewirkten, das glaubte er. Außerdem hatte Rothewell immer eine Rossnatur gehabt. Er hatte niemandes Rat gebraucht, weder medizinisch noch anderweitig.
Hinter dem Vorhang hörte er, dass der Arzt die Tür öffnete und das Zimmer verließ. Resigniert hängte Rothewell das letzte seiner Kleidungsstücke auf einen der Messinghaken, die offensichtlich für diesen Zweck gedacht waren, und sah sich dann in dem Raum um. Er war aufwendig möbliert; schwere Samtportieren schmückten die Fenster, und der Boden war aus cremeweißem Marmor. Ein wuchtiger, auf Hochglanz polierter Schreibtisch besetzte das eine Ende des Zimmers, und in der Mitte stand ein großer Tisch neben einer ledergepolsterten Liege. Dr. Reddings Patienten, so schien es, lebten demzufolge lange genug, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Das ist doch immerhin schon etwas, dachte Rothewell.
Auf dem Tisch stand ein Zinntablett, auf dem diverse medizinische Instrumente lagen. Rothewell trat näher, und ein unbehagliches Frösteln begann ihn zu überlaufen. Ein Skalpell und zwei Lanzetten funkelten ihn böse an. Dann gab es Scheren und Pinzetten und Nadeln – zusammen mit anderen Werkzeugen, die er nicht kannte. Das Frösteln verstärkte sich.
Großer Gott, er hätte niemals hierherkommen sollen. Die Medizin trennte doch nur ein Schritt von der Hexerei. Er sollte nach Hause gehen und entweder aus eigener Kraft gesund werden oder wie ein Mann sterben.
Aber heute Morgen … dieser verdammte Morgen war das Schlimmste überhaupt gewesen. Er konnte noch immer das Brennen von Eisen und Säure in seiner Kehle spüren, während die Krämpfe seine Rippen zerbrochen hatten.
O verdammt! Er könnte ebenso gut bleiben und sich anhören, was der grimmig dreinschauende Dr. Redding zu sagen hatte. Dann schob er den Gedanken an diesen Morgen beiseite und nahm eines der Furcht erregend aussehenden Instrumente in die Hand, um es eingehender zu betrachten. Vielleicht war es ein mittelalterliches Folterinstrument?
»Eine Trepanationsklammer«, ertönte eine Stimme hinter ihm.
Rothewell zuckte zusammen, und das Instrument fiel klirrend auf das Tablett. Er wandte sich um und sah Dr. Redding neben dem Vorhang stehen.
»Aber wenn es Ihnen ein Trost ist, Mylord«, sagte der Arzt, »dann bezweifle ich sehr, dass wir es für notwendig halten werden, Ihnen einen Loch in den Schädel zu bohren.«
Der Nieselregen hatte endlich aufgehört, als die glänzende schwarze Barouche ihre dritte und letzte Runde durch den Hyde Park fuhr. Der Serpentinenteich hatte sich wie ein Ding aus der Artuslegende aus den Nebelfetzen erhoben, und die mutigeren Seelen der beau monde dadurch verlockt, doch noch einen Ausritt oder eine Ausfahrt zu wagen. Und obwohl der Höhepunkt der Saison bereits einige Wochen zurücklag, erregte der Gentleman, der die Peitsche so elegant handhabte, mühelos die Aufmerksamkeit aller, denn er war sowohl gut aussehend als auch gut bekannt – wenn auch nicht besonders geschätzt. Leider, und das trotz seiner Schönheit, belegte ihn die Gesellschaft oft mit der kältesten aller englischen beschönigenden Umschreibungen – mit dem diffusen Makel, für not quite nice gehalten zu werden.
Obwohl er sein bestes Alter bereits überschritten hatte und stets am Rande des Bankrotts lebte, war der Comte de Valigny mit unverkennbar kontinentaler Eleganz gekleidet, und seine untadelige Garderobe wurde noch durch die Art von Hochnäsigkeit betont, die nur ein Franzose mit solcher Selbstverständlichkeit an den Tag legen konnte. Die atemberaubende Schönheit, die stocksteif neben ihm saß, wurde von den Passanten im Allgemeinen für seine neueste Geliebte gehalten, denn Valigny war dafür bekannt, dass er die Frauen mit geradezu raubtierhafter Gefräßigkeit konsumierte.
Der Nachmittag war inzwischen jedoch weit vorangeschritten, und da es Oktober und zudem nasskalt war, waren im Park nur wenige Menschen anzutreffen. Lediglich zwei schneidige junge Gecken zu Pferde und einige missbilligend dreinschauende Witwen in einem Landauer gönnten der Frau an Valignys Seite mehr als einen flüchtigen Blick. Und das war, nach seinem Dafürhalten, eine verdammte Schande. Fast sehnsüchtig schaute er über die Schulter auf die jungen Gentlemen.
»Mon Dieu, Camille!«, beklagte er sich, während er einen verbitterten Blick auf das Gesicht seiner Begleiterin warf. »Halt das Kinn höher! Und schau selbstbewusster! Wer gönnt denn schon einer Frau, die einen nicht einmal ansieht, einen zweiten Blick, eh? Du bist schließlich nicht auf dem Weg zur Guillotine!«
»Bin ich das nicht?«, erwiderte seine Begleiterin und sah ihn hochmütig an. »Ich beginne, mich genau das zu fragen. Wie lange bin ich jetzt hier? Sechs Wochen, n’est-ce pas? Sechs Wochen mit diesem ewigen Nebel und dieser maßlosen Aufgeblasenheit. Vielleicht würde ich das Beil des Scharfrichters willkommen heißen?«
Valignys Miene spannte sich an. »Ça alors!«, fauchte er, zügelte seine Grauen und lenkte die Kutsche an die Seite. »Du bist die Natter, die ich an meinem Busen nähre! Vielleicht, meine feine Dame, ziehst du es vor, abzusteigen und zu Fuß nach Hause zu gehen?«
Die junge Frau wandte das Gesicht ihm zu und legte die Hand, die in eleganten Handschuhen steckte, auf ihre Brust. »Quoi? Und meine kostbare Tugend dadurch zu beflecken, dass ich ohne Begleitung durch Mayfair spaziere wie eine Dirne?«, fragte sie spöttisch. »Aber warten Sie! Ich vergaß! Für eine Dirne hält man mich ja bereits.«
»Zum Teufel mit dir, Camille!« Der Comte ließ die Peitsche knallen, und die Pferde fielen in einen schnellen Trab. »Du bist eine undankbare kleine Xanthippe.«
Sie straffte die Schultern und verzichtete darauf, sich am Wagenkasten festzuhalten. »Nicht wahr, das bin ich.« Sie sagte es ebenso zu sich wie zu ihm. »Ich wünschte bei Gott, es wäre Frühling! Vielleicht könnte – könnte – Ihr dummer Plan dann Erfolg haben.«
Der Comte lachte laut. »Oh, mon chou! Ich fürchte doch sehr, dass es im Frühling bereits zu spät für dich sein wird.«
Sie sah ihn verächtlich an. »Oui, das ist wahr«, gab sie zu. »Und auch zu spät für Sie, mon Père!«
Pamela, Lady Sharpe, stand am Fenster ihres privaten Wohnzimmers, eine Hand auf die Rückenlehne eines wuchtigen Stuhles gestützt, und schaute, wie die Welt von Mayfair an ihr vorbeizog, als ein hochgewachsener Mann in dunklem Mantel mit energischen Schritten die Straße herunterkam. Zuerst beachtete sie ihn kaum, denn der Regen hatte aufgehört, und etwas, was tatsächlich so etwas wie ein Sonnenstrahl sein konnte, fiel schräg über die Dächer der Hanover Street. Lady Sharpe widerstand dem Wunsch, vor Freude darüber in die Hände zu klatschen.
Morgen vielleicht, würden dann Besucher kommen? Ja, gewiss doch. Und es ging ihr wieder gut genug, um sie zu empfangen: Genau genommen brannte sie darauf, sich mit ihren Erfolgen zu brüsten. Diese Woche war ereignisreich gewesen – aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, schon das ganze Jahr war für Lady Sharpe ereignisreich verlaufen. Sie hatte die dreifache Leistung vollbracht, in dieser Saison ihre geliebte Cousine Xanthia mit einem schockierend großen Erfolg in die Gesellschaft einzuführen und sogleich danach ihre Tochter Louise mit dem Erben eines Earls zu verheiraten.
Und schließlich, als ihr großes Finale, hatte Lady Sharpe nach zwei Jahrzehnten Ehe mit einem liebenswerten und verständnisvollen Ehemann endlich das getan, was niemand für möglich gehalten hatte: Sie hatte Sharpe einen Erben geboren. Einen reizenden Jungen mit blauen Augen, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war, einschließlich des kahlen Schädels.
»Mylady?« Die Zofe der Countess tauchte neben ihr auf. »Vielleicht sollten Sie sich wieder hinlegen?«
Genau in diesem Moment ging auf der Straße der Mann direkt unter Lady Sharpes Fenster vorbei.
»Oh! Oh!«, rief sie und zeigte hinaus. »Sehen Sie! Anne, halten Sie ihn auf! Laufen Sie hinunter! Holen Sie ihn sofort herauf.«
»Ma’am?« Anne zog die Stirn kraus.
»Rothewell!« Lady Sharpe gestikulierte wild. »Ich habe ihm erst gestern eine Nachricht geschickt. Ich muss ihn wirklich sehen! Oh, laufen Sie sofort hinunter.«
Anne verlor ein wenig von ihrer Farbe, aber sie ging hinunter – und wies den zweiten Lakai an, Lord Rothewell auf der Hanover Street hinterherzulaufen. Der Lakai zögerte einen Moment – der Ruf des Barons war dem Personal nicht unbekannt –, dann tat er schließlich, was ihm aufgetragen worden war, und erledigte seine Aufgabe ohne den Verlust irgendwelcher Körperteile. Lord Rothewell hatte offensichtlich bereits sein tägliches Maß an Nasen gebrochen, denn er folgte dem Lakai fast höflich die Treppe hinauf.
Die Countess empfing Rothewell in ihrem privaten Wohnzimmer; sie war noch in ihren Morgenmantel gekleidet und trug ihre Schlafhaube, die Füße hatte sie auf dem Gichtschemel ihres Mannes gelagert.
»Kieran, mein Lieber!«, begrüßte sie den Baron und bot ihm die Wange zum Kuss. »Du wirst mir verzeihen, dass ich mich nicht erhebe.«
»Ja, natürlich.« Rothewell nahm auf dem Stuhl Platz, auf den sie gedeutet hatte. »Wobei ich mir nicht denken kann, Pamela, dass du bereits jemanden empfangen solltest.«
Lady Sharpe lachte leicht. »Genau deswegen bist du mein Lieblingscousin, lieber Junge!«, entgegnete sie. »Wegen deiner schonungslosen Ehrlichkeit.«
Schonungslose Ehrlichkeit. Rothewell fragte sich, ob diese Worte dazu bestimmt waren, ihn heute zu verfolgen.
Aber Lady Sharpes Augen funkelten. »Sag es, mein Lieber! Warum hast du mich ignoriert?«
»Dich ignoriert?«
»Ich habe dir doch gestern eine dringende Nachricht gesandt«, hielt sie ihm vor. »Man könnte meinen, ich wäre nach diesen paar Wochen der Einschränkung ganz und gar vergessen.«
»Ah«, sagte er ruhig. »Aber ich bin seit gestern kaum zu Hause gewesen, Pamela.«
»Es war in der Tat ein Schock, dich am helllichten Tag zu sehen.« Sie krauste die Nase. »Ich verabscheue die Art von Gesellschaft, in der du dich bewegst – und die Tageszeit, zu der du das tust. Aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Willst du mich gar nicht beglückwünschen?«
Rothewell beugte sich auf seinem Stuhl ein wenig vor, die Hände auf den Knien. »Doch, das will ich, und mein Dankgebet füge ich sogleich hinzu«, erwiderte er. »Es war eine verdammt gefährliche Sache für dich, das durchzustehen, Pamela.«
Lady Sharpes fein gezeichnete Augenbrauen hoben sich. »Nun, wie seltsam, das zu sagen. Was meinst du damit?«
Rothewell zwang sich, sich wieder entspannt zurückzulehnen. »Nichts, Pamela«, sagte er schlicht. »Ich hoffe nur, dass du es nicht noch einmal versuchen wirst.«
»In meinem Alter?« Lady Sharpe lächelte ironisch. »Das halte ich für höchst unwahrscheinlich.«
»Dies hat Sharpe ein Jahr seines Lebens gekostet.«
»Das weiß ich, und das tut mir sehr leid.« Lady Sharpe spielte mit einem Band an ihrem Taschentuch. »Aber Sharpe braucht einen Erben, Kieran.«
»Er braucht seine Frau – lebendig, vorzugsweise.«
»Oh, das verstehst du nicht! Obwohl du es natürlich verstehen solltest – und das besser als die meisten anderen. Du weißt, was ich meine.«
Er wusste es. Aber ein Erbe? Der Gedanke war ihm immer lächerlich vorgekommen. »Was wird letztendlich aus meinem Titel werden, Pamela?«, fragte er schließlich.
»Was meinst du? Wenn du tot bist?« Lady Sharpe wedelte abweisend mit ihrem Taschentuch. »Einer von diesen abscheulichen Neville-Cousins in Yorkshire wird alles erben. Aber das kümmert dich ja nicht.«
»Nicht sehr, würde ich meinen«, murmelte er.
Lady Sharpe musterte ihn fragend. »Du solltest dich beschäftigen, Kieran.« Ihre Stimme klang untypisch scharf. »Du weißt, was ich meine.«
Rothewell tat, als würde er sie nicht verstehen. Er legte die Hände auf die Oberschenkel, als wollte er aufstehen. »Nun, altes Mädchen, ich muss weiter. Du brauchst deine Ruhe.«
»Unsinn!«, sagte Lady Sharpe und machte ihm ein Zeichen, sich wieder zu setzen. »Wenn jemand Ruhe braucht, Sir, dann sind Sie das. Es ist lange her, dass ich dich so abgespannt gesehen habe.« Sie wandte sich an ihre Zofe. »Anne, gehen Sie und sagen Sie Thornton, dass sie Viscount Longvale seinem Cousin vorstellen soll.«
Das Kind? Lieber Gott, nicht das. »Wirklich, Pamela«, sagte Rothewell. »Das ist nicht nötig.«
»O doch. Das ist es.« Ein rätselhaftes Lächeln lag um ihre Lippen. »Ich bestehe darauf.«
Rothewell vermied es strikt, Kindern zu begegnen. Er fühlte sich dann immer, als würde eine überschwängliche Reaktion von ihm erwartet. Er war nicht überschwänglich. Er war nicht einmal besonders freundlich. Und Kinder wünschten stets, auf den Knien geschaukelt zu werden, oder sie zogen einem die Uhr aus der Westentasche.
Aber Lord Longvale, wie sich zeigte, war fähig, nichts davon zu tun. Er war ein käsiges, weißrosa Bündel mit zwei unmöglich kleinen Fäusten und einer gespitzten Rosenknospe von einem Mund und viel zu klein, um irgendjemandem Ungemach zu bereiten. Mehr noch, dieses Kind war Pamelas Kind. Und Pamela war jemand, für den Rothewell eine seltene Zuneigung hegte. Deshalb stählte er sich, zwang sich zu einem Lächeln und beugte sich ziemlich zaghaft über das Bündel, das ihm die Amme zu seiner Inspektion hinhielt.
Seltsamerweise stockte ihm der Atem. Das Kind war so perfekt und so ruhig, dass es aus Madame Tussauds Wachs hätte gemacht sein können. Seine Haut war so zart, dass sie fast durchsichtig schien, und seine runden Wangen leuchteten in einem unglaublichen Rot.
Eine bemerkenswerte Stille senkte sich über das Zimmer, dass Rothewell sich fürchtete auszuatmen. Er konnte sich nicht erinnern, einem neugeborenen Kind jemals so nahe gewesen zu sein.
Plötzlich öffneten sich zwei blaue Augen. Das Kind presste seine Fäuste noch fester zusammen, verzog das Gesicht und begann, mit gesunder Begeisterung zu schreien. Der seltsame Moment zerplatzte, Rothewell zog sich zurück.
»Ich fürchte, Lord Longvale hat wenig Interesse daran, meine Bekanntschaft zu machen«, sagte er über den Lärm.
»Unsinn!«, sagte Ihre Ladyschaft. »Ich bin sicher, er spielt sich nur auf. Hast du je eine so kräftige Lunge gehört?«
Das hatte Rothewell nicht. Trotz seiner Windeln strampelte das Kind mit seinen stämmigen Beinen und stieß unermüdlich mit seinen kleinen Fäusten in der Luft herum, während es weinte. Rothewell war verblüfft über die pure Gewalt des Willens, die von dem kleinen Geschöpf ausging. Ja, das Kind war in der Tat sehr real – und sehr lebendig. Und es war auch ein Kämpfer, so wie es aussah. Rothewell ertappte sich dabei, dass er den plötzlichen und unwahrscheinlichen Drang zu lächeln unterdrückte.
Vielleicht war in London doch noch nicht alles tot oder dem Verfall anheimgegeben. Dieser kleine Racker war kostbar und neu und ganz offensichtlich erfüllt von Versprechen. Er würde die Hoffnungen und die Träume seiner Eltern mit sich in die Zukunft tragen. Vielleicht war der Kreis von Leben, Tod und Wiederauferstehung wahrlich ewiglich. Rothewell wusste nicht, ob dieser Gedanke ihn tröstete oder ärgerte.
Lady Sharpe hatte ihre Arme ausgebreitet, um das Kind zu nehmen. »Lassen Sie mich ihn einen Augenblick beruhigen, Thornton«, sagte sie und legte das Bündel an ihre Schulter. »Und danach, denke ich, wird es das Beste sein, ihn wieder nach oben zu bringen. Ich glaube, wir machen Lord Rothewell unerklärlich nervös.«
Rothewell nahm nicht auf seinem Stuhl Platz, sondern ging zu einem der Fenster, die auf die Hanover Street hinausgingen. Er fühlte sich seltsam angerührt. Er war sich nur vage bewusst, dass das Weinen des Kindes leiser wurde und schließlich aufhörte. Plötzlich war es ganz still im Zimmer.
Den Arm durchgestreckt und am Holzladen abgestützt, stand Rothewell da und starrte blicklos hinaus in die sich herabsenkende Dämmerung und fragte sich, was das Kind an sich hatte, das ihn so sehr berührte, als er Pamela wieder sprechen hörte.
»Kieran?« Ihre Stimme klang scharf. »Mein lieber Junge – geht es dir wirklich gut?«
Gefangen in seinen Grübeleien, fuhr Rothewell herum und sah sie an. Seine Cousine war allein im Zimmer. Das Kind und die Amme waren verschwunden.
Lady Sharpe legte den Kopf schief wie ein neugieriger Vogel. »Du hast nicht ein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe.«
»Entschuldige, Pamela«, sagte er. »Meine Gedanken waren woanders.«
»Ich sagte, dass ich dich um einen Gefallen bitten muss«, erinnerte sie ihn. »Kann ich auf dich zählen?«
Rothewell brachte ein Lächeln zustande. »Das bezweifle ich«, sagte er aufrichtig. »Die Frauen bedauern es normalerweise, wenn sie das tun.«
Sie beugte sich vor und klopfte auf den Stuhl neben sich. »Komm und setz dich zu mir«, bat sie ihn. »Und sei ernst. Es ist wichtig.«
Widerstrebend folgte Rothewell ihrer Aufforderung. Ihm missfiel die leichte Anspannung, die er in der Stimme seiner Cousine wahrnahm.
»Kieran«, begann sie, »hast du eigentlich noch Kontakt zu Christine?«
Diese Frage überraschte Rothewell. Christine Ambrose war Pamelas Schwägerin, aber die zwei waren so verschieden wie Feuer und Wasser. Und Pamela spionierte niemals jemandem hinterher.
»Ich sehe Mrs. Ambrose, wann immer es uns beiden passt«, wich er aus. »Warum? Hat Sharpe einige neu entdeckte Einwände?«
»Himmel, nein!« Lady Sharpe hob beschwichtigend die Hand. »Sharpe weiß, dass er seine Halbschwester nicht gängeln kann, und er versucht es auch gar nicht. Aber ihr zwei – nun, du meinst es doch nicht ernst mit ihr, Kieran, oder? Christine ist keine Frau, die man zu … nun, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll.«
Rothewell fühlte, wie seine Miene sich verfinsterte. Er diskutierte sein Privatleben nicht – selbst Xanthia hatte es nicht gewagt, ihm solche Fragen zu stellen. Über Christine wurde recht schnell geurteilt, das wusste er. Aber daraus machte er sich verdammt noch mal nichts.
»Ich fürchte, meine Beziehung zu Mrs. Ambrose ist eine private Angelegenheit, Pamela«, sagte er kalt. »Aber zwischen uns wird es nichts von Dauer geben, falls es das ist, was dir Sorge macht.«
Nichts von Dauer. Nein, es gab keine Zukunft für ihn mit Christine – nicht dass er solche Dummheit jemals in Erwägung gezogen hätte.
Aber Lady Sharpes Miene hatte sich bereits aufgehellt. »Nein, das dachte ich auch nicht«, sagte sie, als wollte sie sich es selbst versichern. »Sie ist natürlich ganz hübsch, aber Christine ist …«
»Pamela«, schnitt er ihr das Wort ab, »du betrittst gefährlichen Boden. Nun – du wolltest mich um einen Gefallen bitten? Bitte, tue das.«
»Ja, natürlich.« Pamela strich die Falten ihres Morgenrockes glatt. »Donnerstag ist die Taufe, Kieran. Und ich möchte … ja, ich habe es mir genau überlegt, und ich möchte, dass du einer von Longvales Paten wirst.«
Rothewell konnte sie nur anstarren.
»Oh, ich denke auch daran, Xanthia zu bitten«, fügte sie rasch hinzu. »Du bist mein nächster Verwandter, außer Mamma, weißt du. Ich war so glücklich, als du nach all diesen langen Jahren, die du auf Barbados warst, zurückkamst. Oh, wirst du es tun, mein Lieber? Bitte sag, dass du es tun wirst.«
Rothewell war von seinem Stuhl aufgesprungen und zu seinem vorherigen Aussichtspunkt am Fenster zurückgekehrt. Er schwieg sehr lange. »Nein«, sagte er schließlich mit ruhiger Stimme. »Nein, Pamela. Es tut mir leid. Das kommt absolut nicht infrage.«
Hinter sich hörte er das Rascheln von Stoff, als seine Cousine aufstand. Einen Augenblick später hatte sie ihm leicht die Hand auf die Schulter gelegt. »Oh Kieran! Ich weiß, was du denkst.«
»Nein.« Seine Stimme klang rau. »Nein, das weißt du nicht, glaube mir.«
»Du glaubst, dass du kein guter Pate sein wirst«, sprach Lady Sharpe weiter. »Aber ich bin davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Genau genommen weiß ich, dass es nicht so ist. Du bist ein brillanter und entschlossener Mensch, Kieran. Du bist ehrlich und geradeheraus mit deiner Meinung. Du bist …«
»Nein.« Er schlug mit dem Handballen gegen das Holz, als könnte der Schmerz ihn klarer denken lassen. »Gott verdammt, hast du mir nicht zugehört, Pamela? Nein. Das ist ganz unmöglich.«
Lady Sharpe war zurückgewichen, sie wirkte verletzt.
Rothewell drehte sich ganz ihr zu und fuhr sich mit einer Hand durch das Haar. »Ich bitte um Entschuldigung«, stieß er hervor. »Meine Worte waren …«
»Unerheblich, wirklich«, unterbrach sie. »Du hast viel Güte in dir, Kieran. Ich weiß, dass sie da ist.«
»Bitte langweile uns beide nicht mit einer Aufzählung meiner Tugenden, Pamela«, sagte er und mäßigte seinen Ton. »Es würde ohnehin nur eine kurze Liste werden. Ich danke dir für das Kompliment, das du mir gemacht hast, aber du musst jemand anderen bitten.«
»Aber … aber wir möchten, dass du sein Pate wirst«, sagte sie. »Sharpe und ich haben ausführlich darüber gesprochen. Wir sind ganz und gar überzeugt, dass du die richtige Person für eine so große Verantwortung bist. Mehr als jeder andere weißt du darum, wie wichtig es ist, dass ein Kind anständig groß wird – oder sollte ich sagen, du kennst den Schaden, der jemandem zugefügt wird, der nicht anständig groß wird.«
»Rede keinen Unsinn, Pamela«, sagte er grob.
»Darüber hinaus«, fuhr sie freundlich fort, »sind Sharpe und ich nicht mehr so jung, wie wir es einmal waren. Was, wenn wir sterben?«
Er ließ die Hand sinken.
Was, wenn sie sterben? Er würde ihnen von verdammt wenig Nutzen sein.
»Xanthia wird sich um das Kind kümmern, sollte etwas Unvorhergesehenes geschehen«, brachte er fertig zu sagen. »Sie und Nash würden den Jungen großziehen wie ihr eigenes Kind, wenn du das möchtest. Du weißt, dass sie es tun würden.«
»Aber, Kieran, die Aufgabe als Patenonkel ist mehr als …«
»Bitte frage mich nicht noch einmal, Pamela«, unterbrach er sie. »Ich kann nicht. Und Gott weiß, mein Charakter ist zu befleckt, auch wenn du das nicht glaubst.«
»Aber ich glaube nicht, dass du verstehst …«
»Nein, meine Liebe.« Mit überraschender Sanftheit legte Rothewell ihre Hand auf seinen Unterarm und führte sie zu ihrem Stuhl. »Du bist es, die nicht versteht. Jetzt musst du dich hinsetzen, Pamela, und deine Füße hochlegen. Du musst. Und ich muss gehen.«
Als sie den Stuhl erreichten, stützte sich Lady Sharpe mit einer Hand auf dessen Lehne und setzte sich langsam. »Wann kommen Nash und Xanthia zurück?«, fragte sie. »Ich denke, sie wird einverstanden sein, Patin zu werden.«
»Morgen«, sagte er und tätschelte ihr sanft die Schulter. »Bitte Nash, sie zu dir zu begleiten. Er wird sich geehrt fühlen. Schließlich ist er sich noch nicht sicher, ob wir ihn mögen.«
»Tun wir das?« Lady Sharpe schaute auf.
Rothewell dachte darüber nach. »Nun, ausreichend, würde ich meinen«, erwiderte er schließlich. »Wir müssen Xanthias Urteil vertrauen. Und jetzt, da ich darüber nachdenke, bin ich verdammt froh, ihn in der Familie zu haben.«
»Bist du das?« Die Countess blinzelte. »Warum?«
Rothewell brachte ein Lächeln zustande. »Aus keinem besonderen Grund, Pamela. Und jetzt gestatte mir, mich zu verabschieden.«
Seine Cousine stieß einen bedauernden Seufzer aus. »Nun, ich hatte gehofft, du würdest wenigstens zum Abendessen bleiben«, sagte sie und begann wieder, die Falten ihres Morgenrockes glatt zu streichen. »Schließlich hast du jetzt niemanden zu Hause, mit dem du essen kannst.«
Rothewell beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Wange. »Ich bin ein eigenbrötlerisches Ungeheuer«, versicherte er ihr. »Ich werde schon zurechtkommen.«
Die Countess legte den Kopf in den Nacken, um zu ihm hochzuschauen. Sie hatte die Lippen fest aufeinandergepresst. »Aber du und Xanthia habt dreißig Jahre lang Seite an Seite gelebt«, beharrte sie. »Es ist nur natürlich, dass du dich einsam fühlen könntest, Kieran.«
»Gelebt, das ist richtig, aber nicht gearbeitet«, entgegnete er, wobei er zur Tür starrte, seinem Fluchtpunkt. »Xanthia war der Protegé unseres Bruders Luke, nicht ich. Sie waren die Erbsen in der Schote, Pamela. Ich war nur … die Hülse, die übrig bleibt.«
Und dann, ehe Pamela ihre Bitte an ihn noch einmal wiederholen würde, verließ Rothewell das Zimmer.
Kapitel 2
In dem der Comte de Valigny einen Kartenspielabend ausrichtet
Die dünnen Finger Comte de Valignys bewegten sich wie kleine weiße Aale, als er geschickt die Karten mischte. Aus müden Augen beobachteten seine Gäste, wie er die Karten ausgab. Bei jeder seiner Bewegungen funkelte der blutrote Rubin, in dem sich das Licht der Lampe brach, an seiner Hand auf.
In dieser Nacht saßen sie zu fünft am Tisch im Salon des Comte, und jeder der Männer lebte ausschweifender als der andere. Valignys Spiel war Vingt-et-un mit einem Mindesteinsatz von fünfzig Pfund, und nach den langen Stunden, die inzwischen vergangen waren, roch es im Zimmer nach Zigarrenrauch und Schweiß. Unvermutet stand Lord Rothewell auf und öffnete eines der Schiebefenster.
»Merci, mon ami.« Valigny warf einen abschätzenden Blick in Rothewells Richtung, als er die letzte Karte über den vergoldeten Holztisch schob. »Das Spiel wird ernst, nicht wahr?«
Zwei der Gentlemen am Tisch sahen in der Tat verzweifelt aus. Valigny selbst hätte es auch sein sollen, aber in all den Monaten, in denen Lord Rothewell dem Comte beim Kartenspiel gegenübergesessen hatte, war dem Mann nicht einmal ein Zaudern anzusehen gewesen – nicht einmal dann, wenn es hätte sein müssen. Valigny spielte mit Leidenschaft, verlor oft und stellte seine Schuldscheine fast ebenso unbekümmert aus, wie er die Karten ausgab. Aber seine Gewinne, wenn es sich so fügte, waren legendär. Er war der geborene Spieler.
»Bonne chance, Messieurs.« Erste Karten wurden ausgegeben und die Einsätze platziert, jeder in der Runde entschied sich, eine weitere Karte zu nehmen. Der Comte lächelte noch immer, während er mit einem Finger auf die offen vor ihm liegende Karte trommelte – die Pik-Dame.
»Ich bin draußen.« Sir Ralph Henries spie diese Worte aus und starrte aus zusammengekniffenen Augen auf die schwarze Dame. »Das ist das zweite Mal in Folge, dass Valigny diese Karte hat! Haben Sie überhaupt gründlich gemischt, Calvert? Haben Sie das?«
»Sie haben mir doch dabei zugesehen«, entgegnete Calvert. »Guter Gott, worüber beklagen Sie sich eigentlich? Ich stehe schon so gut wie mit einem Bein im Schuldturm. Geben Sie ihm noch eine Karte, Valigny. Vielleicht hält ihn das davon ab, die ganze Nacht zu jammern.«
Sir Ralph schaute auf, sein Blick war wirr. »Ich jammere nicht«, stieß er hervor. »Aber warten Sie – was ist aus den Mädchen geworden? Hübsche kleine Dinger, nicht wahr? Mir gefiel die eine mit der … mit der – wie haben Sie das genannt? Dieses schwarze Lederding und die – nein, warten Sie –, bringe ich jetzt was durcheinander, Vallie?«
»Das liegt schon ein paar Nächte zurück, mon ami.« Valigny tätschelte Sir Ralph beruhigend die Hand. »Heute Abend spielen wir Karten, hm? Decken Sie Ihre Karten auf, Ralph, oder gehen Sie nach Hause.«
Nach einem flüchtigen Blick auf seine Karten wandte sich Rothewell auf seinem Stuhl halb um und ließ den Blick durch die Tiefe des Zimmers schweifen. Er war sich nicht ganz sicher, warum er Valigny nachgegeben und sich heute Abend hatte hierherlocken lassen. Die Clique des Comte bestand aus lasterhaften Rüpeln, sogar nach Rothewells Maßstäben. Aber seit Kurzem stellte er fest, dass er sich in immer schlechtere Gesellschaft begab, und fast schien es, als suchte er geradezu nach dem seelenverderbenden Morast am Boden der Gesellschaft.
Dieser Einschätzung folgend, war er über Valigny gestolpert – er war zu betrunken gewesen, um sich genau erinnern zu können, wo. Aber der Comte war die Sorte von Mann, der man üblicherweise nur in einer Spielhölle in Soho begegnete, denn Valigny gehörte keinem der besseren Clubs Londons an. Und auch keinem der weniger besseren, um genau zu sein. War Rothewell in der Gesellschaft so gut wie unbekannt, so wurde Valigny völlig ignoriert, denn da gab es einen lange Zeit zurückliegenden Skandal – eine kompromittierte Countess und ein anschließendes Pistolenduell. So oder ähnlich hatte es Christine Ambrose ihm erzählt. Rothewell war das völlig egal.
»Noch eine, Mylord?« Der Comte zog mit dem Daumen eine Karte vom Talon, wobei ihm seine dandyhafte Spitzenmanschette über die Hand fiel und sie zur Hälfte bedeckte. Rothewell nickte. Valigny schob ihm die Karte über die polierte Tischplatte zu.
Irgendwo in der Tiefe des Hauses erklang der Glockenschlag einer Uhr. Eine Stunde nach Mitternacht. Das Spiel ging weiter, wurde riskanter. Mr. Calvert, der Anständigste unter ihnen, geriet bald an den Rand des Bankrotts – der Lohn der Tugend, dachte Rothewell zynisch. Valigny erreichte zweimal nacheinander die Punktzahl von einundzwanzig, davon einmal mit seiner Pik-Dame, und fuhr damit fort, alles wieder zu verspielen.
Einer seiner Lakaien servierte mehr Brandy und brachte eine weitere Kiste mit den dunklen, bitteren Zigarren, die der Comte bevorzugte. Ein zweiter Lakai trug ein Tablett mit Sandwiches herein. Calvert stand auf, um in den Nachttopf,
der hinter der Tür des Sideboards verwahrt wurde, zu urinieren – oder vielleicht auch, um sich zu übergeben. Alles war bequem zur Hand. Gott behüte, dass irgendetwas das Spiel Valignys unterbrach.
Lord Enders war ein Spieler ohne Moral und Skrupel, wenn denn je einer gelebt hatte. Er wusste genau, wie er gegen den Comte sticheln konnte, und setzte ihn unter Druck. Rothewell hatte inzwischen sechstausend Pfund verloren – ein Almosen im Vergleich zu den Verlusten Valignys und Calverts. Aber er war noch nüchtern genug, um das verdammt ärgerlich zu finden. Er winkte einem der Lakaien, ihm Brandy nachzuschenken.
Das nächste Spiel spielten sie zu zweit, Rothewell und Valigny, der seine Einsätze machte, als wäre sein Blatt die Vollkommenheit selbst. Rothewell bog die Ecken seiner Karten hoch. Die Herz-Zwei und der Karo-König. Dazu die Kreuz-Vier. Vielleicht hatte er sein Glück überbeansprucht.
»Sie sind unschlüssig, mon ami?«, forderte Valigny ihn heraus. »Kommen Sie, seien Sie mutig! Es ist doch nur Geld.«
»Worte eines Mannes, der sich nie seinen Lebensunterhalt selbst verdienen musste«, entgegnete Rothewell grimmig. Er goss die Hälfte seines Brandys hinunter und fragte sich, ob er Valigny vielleicht eine Lektion erteilen sollte.
»Vielleicht sind Rothewells Taschen nicht so tief, wie man sagt?«, bemerkte Enders in einem Ton, der sarkastisch hätte sein können – oder auch nicht.
Der Comte lächelte Rothewell an. »Vielleicht sollten Sie Ihren Einsatz als Verlust abschreiben, Mylord?«, bemerkte er. »Wenn Sie dazu bereit sind, könnten wir allerdings auch um etwas spielen, das interessanter ist als Geld.«
Rothewells Nackenhaare stellten sich auf. »Das bezweifle ich«, erwiderte er. »Woran denken Sie?«
Der Comte hob eine Schulter, ganz ein Bild der Lässigkeit. »Vielleicht um einen gemeinsamen Abend?«
»Sie sind nicht mein Typ, Valigny«, lehnte Rothewell ab und schob einen Stapel Banknoten über den Tisch.
»Oh, Sie haben mich missverstanden, mon ami.« Valignys Fingerspitzen hielten Rothewells Hand auf, seine kunstvoll gewirkte weiße Spitzenmanschette berührte Rothewells noch immer gebräunte Haut. »Behalten Sie Ihr Geld, und decken Sie Ihr Blatt auf. Falls Sie verlieren, bitte ich nur um eine einfache Sache.«
Rothewell hob die Hand des Comte zu Seite. »Und was wäre das?«
Der Comte zog eine Augenbraue hoch. »Nur eine geringe Gefälligkeit, das versichere ich Ihnen.«
»Reden Sie schon, Valigny. Sie verzögern das Spiel.«
»Ich wünsche einen Abend – nur einen – mit der reizenden Mrs. Ambrose.«
Rothewell war verärgert, aber nicht überrascht. »Sie interpretieren mein Arrangement mit Mrs. Ambrose falsch«, erklärte er finster. »Sie steht nicht in meiner Obhut.«
»Non?« Der Comte sah aufrichtig verwirrt aus.
»Nein.« Rothewell schob sein Geld in die Tischmitte. »Sie kann mit ihrer Gunst bedenken, wen immer sie sich aussucht.«
»Was sie sehr oft tut«, bemerkte Enders genüsslich.
»Ah, aber was für eine Gunst! Das kann man sich nur vorstellen!« Valigny legte die Fingerspitzen auf seinen Mund, um sie zu küssen. »Lassen Sie uns auf jeden Fall um Geld spielen, Mylord. Ich werde es brauchen können, denke ich. Mrs. Ambrose sieht teuer aus.«
»Aber sie ist es wert, sollte man meinen«, sagte Enders und bedachte Rothewell mit einem Seitenblick. »Das heißt, wenn es einen nicht stört, dass sie schon ein wenig in die Jahre gekommen ist.«
Der Comte lachte, aber es klang nervös. Rothewell hatte den Blick gehoben und musterte Enders. »Ich hoffe, Sir, dass Sie Ihre Bemerkung nicht als die Beleidigung gemeint haben, nach der sie geklungen hat«, sagte er ruhig. »Ich würde es hassen, dieses Spiel vorzeitig verlassen zu müssen, um mich mit Ihnen im Morgengrauen unter weniger gastfreundlichen Umständen erneut zu treffen.«
Enders versteifte sich. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte er. »Aber Ihre Absicht – und Ihr Temperament – gehen Ihnen voraus, Rothewell, denn im Gegensatz zu Ihnen ist Mrs. Ambrose nicht neu in der Stadt. Wir alle kennen sie seit Jahren. Ich selbst bevorzuge jüngeres Fleisch im Bett.«
»Mais oui, viel, viel jünger, wenn stimmt, was man so hört«, gluckste Valigny. »Noch nicht heraus aus dem Schulzimmer und mit Zöpfen, eh? Aber was soll’s? Viele Männer haben diesen Geschmack.«
Enders war ein korpulenter mittelalterlicher Witwer mit wulstigen Lippen und noch wulstigeren Fingern. Rothewell hatte ihn auf den ersten Blick verabscheut, und die Zeit hatte nicht dazu beigetragen, diese Meinung zu ändern. Ihn kümmerte die Wendung, die die Unterhaltung genommen hatte, nicht sonderlich.
Enders starrte noch immer den Comte an, sein Blick war finster. »Mit genügend Geld kann ein Mann normalerweise bekommen, was er will, Valigny«, sagte er. »Sie vor allem sollten das wissen.«
Valigny lachte wieder, aber dieses Mal schwang ein Missklang mit.
Rothewell beendete die Runde mit einem fast wundersamen Gewinn; einem, dem einige weitere folgten. Aber das Gespräch hatte doch einen sauren Geschmack in seinem Mund hinterlassen.
Es war ein wenig spät, um plötzlich von Skrupeln geplagt zu werden. Was ging es ihn an, wen Enders beschlief oder was Valigny darüber dachte? Er war der letzte Mann auf Erden, der mit dem Finger auf jemanden zeigen sollte. Und doch beschäftigte es ihn. Und es war nicht zu leugnen, dass Enders den Ruf hatte, Perversionen jeglicher Art zu mögen.
Der Comte und Enders hackten noch immer aufeinander herum.
»Gentlemen, wozu streiten?«, mischte sich Sir Ralph ein, der inzwischen betrunken genug war, um Milde gegen die ganze Menschheit walten zu lassen. »Etwas Junges im Bett eines Mannes ist doch sehr schön, aye? Aber im Augenblick würde mir eine reiche Frau noch besser zupass kommen. Meine Börse hat einen ordentlichen Schlag abbekommen.«
»Nun, dann viel Glück«, sagte Enders säuerlich. »Sie können mir glauben, wenn ich sage, dass reiche Heiratskandidatinnen um diese Zeit des Jahres dünn gesät sind.«
»Oui, es gibt nichts Tröstlicheres als eine reiche Ehefrau, eh?« Der Comte beugte sich eifrig vor. »Über dieses Thema, müssen Sie wissen, habe ich in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Aber Sie sind bereits ein verheirateter Mann, Sir Ralph, nicht wahr? Und Sie auch, Mr. Calvert?«
Beide Männer bejahten. »Tant pis«, sagte der Comte, seine Miene wirkte ein wenig bedrückt. »Aber Sie, Enders, sind doch Witwer. Hatten Sie in dieser Saison kein Glück auf dem Heiratsmarkt?«
»Es gab jede Menge arme und hässliche Mädchen«, grummelte Enders. »Die gibt es immer. Aber die jungen Mädchen mit Geld sind gehässige kleine Biester.«
Der Comte ließ ein schiefes Lächeln sehen. »Oui, das Leben kann sehr hart sein, nicht wahr, mein Freund?«, sagte er. »Aber nun – spielen wir weiter, Messieurs!«
Doch Rothewell war von dem plötzlichen Impuls gepackt worden, einfach seinen Stapel Geld auf dem Tisch liegen zu lassen und zu gehen. Reichtum hatte ihm nie viel bedeutet – und in letzter Zeit hatte er ihn noch weniger gekümmert. Seltsamerweise empfand er den Wunsch, nach Hause zu gehen.
Doch er wusste, dass er, würde er erst einmal dort sein, anfangen würde, durch die Korridore seines riesigen, leeren Hauses zu gehen, und dass ihn die Unruhe schon bald wieder hinaus auf die Straßen treiben würde. Um irgendwohin zu gehen. Um irgendetwas zu tun. Irgendetwas, was diese Teufel der Nacht vertreiben würde.
Er machte Valignys Diener ein Zeichen, sein Glas nachzufüllen, und zwang sich zu entspannen. In der folgenden Stunde trank er mehr als er spielte, und er weigerte sich, sein Glück durch ein mittelmäßiges Blatt wieder aufs Spiel zu setzen. Calvert hatte sich klugerweise zurückgezogen, war aber am Tisch sitzen geblieben und trank ein Glas Port. Sir Ralph war zu betrunken, um eine Bedrohung zu sein.
Während der nächsten Dutzend Runden steigerte sich das Spiel zu einer fieberhaften Anspannung. Hatte der Comte von Anfang an wie ein Verrückter gespielt, schien er nun offensichtlich die Absicht zu haben, wie ein Wahnsinniger zu enden, denn er setzte fast sein ganzes Geld. Seine Verzweiflung – und sein Bemühen, dieses Debakel zu verkraften – begann, sich zu zeigen. Der Mann musste nur noch wenige Schritte vom Schuldenarrest entfernt sein.
Plötzlich unterlief Valigny ein schwerwiegender Missgriff, indem er eine Acht zur Pik-Dame und zur Herz-Fünf zog. Lord Enders strich die Einsätze ein – zweitausend Pfund.
»Leider hat meine schwarze Dame mich im Stich gelassen!«, beklagte sich der Comte. »Frauen sind launische Geschöpfe, nicht wahr, Lord Rothewell? Spielen wir weiter, Messieurs!«
Die Karten für die nächste Runde wurden ausgegeben, jeder zog danach eine Extrakarte. Aber binnen Augenblicken lockerte sich Sir Ralph, der als Erster gezogen hatte, mit dem Finger seine Krawatte, als würde sie ihm die Luft abschnüren. Es war die Geste eines absoluten Amateurs. Valigny registrierte diese Reaktion und schlug so blitzschnell zu wie eine Katze, indem er den Spieleinsatz erhöhte.
Sir Ralph rülpste und starrte auf seine aufgedeckten Karten. »Überschritten! Hätte schon bei der letzten Runde aussteigen sollen, eh?« Er stand schwankend von seinem Stuhl auf. »Denke, ich sag am besten gute Nacht, Männer. Ich fühl mich nicht gut.«
Rothewell sah ihn an. Ralphs Blatt zählte in der Tat dreiundzwanzig Punkte, und er selbst sah im Gesicht so grün aus, als müsste er sich übergeben. Valigny zuckte gutmütig mit den Schultern, dann beeilte er sich, seinen taumelnden Gast in die Richtung der Haustür zu geleiten, bevor der seinem Bauchgrimmen auf dem Teppich nachgeben würde.
Rothewell entging nicht der feine Schweißfilm auf dem Gesicht des Comte, als dieser Sir Ralph an ihm vorbei zur Tür führte. Die Verzweiflung, die in der Luft lag, hatte sich spürbar verstärkt. Ja, Valigny brauchte Geld, und das ziemlich dringend. Aber mit Enders zu spielen – oder auch mit Rothewell selbst – war ein dummer Weg, daran zu kommen. Sie zählten zu den härtesten Spielern in London. Vermutlich würden sie den Comte binnen einer Stunde zum Bettler gemacht haben – aber dieses Wissen bereitete Rothewell keine Befriedigung.
Genau genommen war der ganze Abend unbefriedigend gewesen. Er verschwendete hier seine Zeit – obwohl das auf eine gewisse Weise genau die Ursache der Misere war. Sich mit Orgien abzulenken – mit Alkohol oder Frauen oder hundert anderen Dingen –, die ihn empfindungslos machen konnten für die Wahrheit darüber, was aus seinem Leben geworden war.
Aber wenn Rothewell ehrlich war, müsste er zugeben, dass die Jagd nach der Sündhaftigkeit auch nicht im Mindesten mehr vor ihm verbarg, wer oder was er war – und das Trinken, begann er zu befürchten, betäubte ihn auch nicht mehr.
Hatte es mit dem Auszug seiner Schwester angefangen? Nein, eigentlich nicht. Aber danach hatte einfach alles begonnen, auf tausend kleine Arten zum Teufel zu gehen.
Auf jeden Fall hatte es keinen Sinn, hier seine Zeit totzuschlagen. Aber wenn die Sünde nicht funktionierte, gab es immer noch das Schießpulver. Wenn ein Mann wünschte, Gottes Willen zuvorzukommen, würde es weniger schmerzvoll sein, einfach nach Hause zu gehen und sich eine Pistole an den Kopf zu setzen, als hierzubleiben und zuzuhören, wie Enders und Valigny einander verhöhnten.
Der Comte kehrte zum Tisch zurück, in seinem Gesicht lag ein Ausdruck amüsierten Ärgers. »Nun, Messieurs, Madame Fortuna hat mich heute Nacht verlassen, n’est-ce pas?«
»Und Sir Ralph kann verdammt noch mal nicht zählen.« Rothewell erhob sich. »Gentlemen, lassen Sie uns unsere Einsätze zurücknehmen und gute Nacht sagen.«
»Non!« Etwas, was Angst gewesen sein konnte, flackerte über Valignys Gesicht. Er drängte Rothewell zurück auf seinen Stuhl, sein Lächeln kehrte zurück. »Ich fühle, dass Madame Fortuna vielleicht zu mir zurückkehren wird. Darf ich nicht die Chance eines Gentlemans in Anspruch nehmen, das zurückzugewinnen, was ich verloren habe?«
»Mit welchen Einsätzen?«, fragte Enders herausfordernd. »Hören Sie, Valigny, ich kann nicht noch einen Schuldschein von Ihnen akzeptieren. Selbst wenn Sie dieses verpfuschte Blatt gewinnen sollten, wäre das nur ein Almosen für mich.«
Die Anspannung im Raum war jetzt fast greifbar. Der Comte leckte sich die Lippen. »Aber ich habe mir den besten Einsatz bis zum Schluss aufgehoben«, sagte er rasch. »Etwas, was von Interesse für Sie sein dürfte … und möglicherweise von Nutzen für mich.«
Mr. Calvert hob die Hände. »Ich bin nur Zuschauer.«
»Ich meinte auch nicht Sie«, sagte der Comte. »Ich wende mich mit diesem Vorschlag an Enders – und vielleicht auch an Rothewell.«
»Dann reden Sie schon«, sagte Rothewell ruhig. »Das Spiel wird sonst langweilig.«
Valigny stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und beugte sich vor. »Ich schlage vor, wir spielen diese letzte Runde zu Ende, auch wenn Sir Ralph gegangen ist«, sagte er und schaute zwischen Enders und Rothewell hin und her. »Der Gewinner wird alles bekommen, was heute Nacht auf dem Tisch liegt. Calvert wird nur die Bank halten und nicht mitspielen. Nur wir werden spielen.«
»Verdammt seltsame Art zu spielen«, stieß Calvert hervor.
»Was setzen Sie?«, wollte Enders wieder wissen.
Der Comte hob den Finger und warf den beiden Dienern einen raschen Blick zu. »Tufton«, bellte er dann, »ist Mademoiselle Marchand noch in ihrem Wohnzimmer?«
Der Diener sah verwirrt aus. »Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, Sir.«
»Mon Dieu, dann gehen Sie und suchen Sie sie!«, befahl Valigny.
»Sind … sind Sie sicher, Mylord?«
»Ja, verdammt!«, schnauzte der Comte. »Was geht Sie das überhaupt an? Dépêchez-vous!«
Der Diener riss die Tür auf und verschwand.
»Aufsässiger Bastard«, murrte der Comte. Dem verbliebenen Diener befahl er nachzuschenken und begann dann, auf dem Teppich hin und her zu gehen. Calvert schaute etwas unbehaglich drein. Die Karten lagen unberührt auf dem Tisch.
»Ich weiß nicht, was für eine Art Trick das werden soll, Valigny«, beklagte Enders sich, während sein Glas aufgefüllt wurde. »Rothewell und ich sind dabei zu gewinnen, deshalb haben wir in der Tat etwas zu verlieren. Ihr nächster Einsatz sollte sich als unbestreitbar verlockend erweisen.«
Der Comte sah ihn über die Schulter an. »Oh, das wird er, Mylord«, versicherte er mit seidenglatter Stimme. »Das wird er. Verstehe ich nicht Ihren Geschmack und Ihre – sollen wir sagen – Vorlieben?«
»Wer zum Teufel ist diese Frau, diese Marchand?«, fragte Rothewell ungeduldig.
»Ah, wer ist sie wohl!« Der Comte kehrte zum Tisch zurück und hob sein Glas, als wollte er einen Toast ausbringen. »Nun, sie ist meine reizende Tochter, Lord Rothewell. Mein zur Hälfte englischer Bastard. Der alte Klatsch ist doch sicherlich noch nicht vergessen?«
»Ihre Tochter!«, warf Enders ein. »Guter Gott, Mann. Bei einem Kartenspiel?«