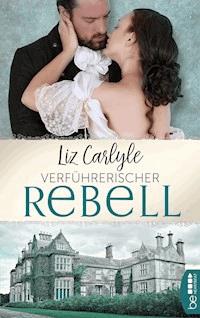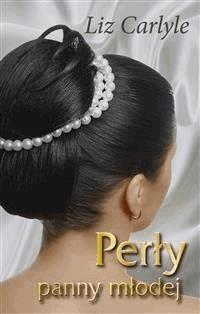4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MacLachlan Saga
- Sprache: Deutsch
Eine Leidenschaft gegen alle Widerstände
Einst begehrten Merrick und Madeline einander so heiß und innig, dass sie miteinander durchbrannten. Doch Maddies Vater verfolgte ihre Spur und trennte das Paar. Als sich die beiden nach vielen Jahren zufällig erneut gegenüberstehen, merken sie, dass ihre Leidenschaft füreinander niemals erloschen ist. Aber düstere Geheimnisse überschatten die Begegnung. Muss die bezaubernde Maddie ihre große Liebe erneut freigeben? Oder ist das Band zwischen ihr und dem charismatischen Merrick stark genug, um alle Hindernisse zu überwinden?
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Das süße Geheimnis der Leidenschaft" erschienen.
Weitere Regency-Liebesgeschichten aus der MacLachlan-Saga als eBook bei beHEARTBEAT: "Ein unwiderstehlicher Halunke", "Ein charmanter Schuft" und "Ein betörender Earl".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Verloren in deiner Sehnsucht
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Eine Leidenschaft gegen alle Widerstände
Einst begehrten Merrick und Madeline einander so heiß und innig, dass sie miteinander durchbrannten. Doch Maddies Vater verfolgte ihre Spur und trennte das Paar. Als sich die beiden nach vielen Jahren zufällig erneut gegenüberstehen, merken sie, dass ihre Leidenschaft füreinander niemals erloschen ist. Aber düstere Geheimnisse überschatten die Begegnung. Muss die bezaubernde Maddie ihre große Liebe erneut freigeben? Oder ist das Band zwischen ihr und dem charismatischen Merrick stark genug, um alle Hindernisse zu überwinden?
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck – auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Homepage der Autorin: www.lizcarlyle.com.
Liz Carlyle
EINGEHEIMNISVOLLERGENTLEMAN
Aus dem amerikanischen Englisch vonSusanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Susan Woodhouse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Three Little Secrets«
Originalverlag: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Das süße Geheimnis der Leidenschaft«
Textredaktion: Kerstin Fuchs, Berlin
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Jeffrey Banke | misha-photography | InnaFelker
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5778-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Deborah Bess, meine unermüdliche Kritikerin.
Sie hat alles gelesen, was ich je geschrieben habe -
wieder und wieder und wieder …
Prolog
Den Teufel soll man nicht rufen,
er kommt von selbst.
Er war allein, als sie kamen. Es war früh am Morgen. Der Hahn hatte noch nicht gekräht; die Regenschauer der Nacht lagen noch über dem Gras. Der Geruch nach Heu und Pferden hing schwer in der stillen Morgenluft. Die beiden grau lackierten Kutschen mit den geschwärzten Wappen und den geschlossenen Vorhängen rollten wie Schatten durch den Nebel, lautlos und heimtückisch.
Er wollte die Pferde selbst anspannen, um einen Schilling zu sparen. Das war ein dummer Gedanke gewesen. Man konnte nicht sagen, dass er ein vertrauensseliger Mensch war, aber seine Wachsamkeit hatte nachgelassen, und sein Verstand schlief noch halb. Seine Gedanken weilten bei seiner jungen Braut, die ihn bis in die Nachtstunden und darüber hinaus wach gehalten hatte. Bis zur Morgendämmerung war kein Geheimnis unerforscht geblieben. Kein atemloses, drängendes Flüstern mehr, kein Lachen, das von der alten Bettdecke erstickt wurde.
Sie war irgendwann eingeschlafen, eine Faust in das Kissen gedrückt, ein langes schlankes Bein ausgestreckt zu seiner Seite des Bettes. Es war ein Bild, das auf einmal so wunderbar neu und zugleich so wunderbar vertraut war. Er hatte nicht geschlafen. Vielleicht, weil er gewusst hatte, wie kostbar jeder Augenblick war.
Er war aufgestanden und hatte sie betrachtet. Die zierliche, rosa schimmernde Ohrmuschel. Den sanften Schwung ihres cremefarbenen Nackens. Das Heben und Senken ihrer Brüste, die so klein und so vollkommen waren, dass er sich fragte, ob Gott wirklich gewollt hatte, dass ein Mann sie sah. Mit großem Widerstreben hatte er nach seinen Hosen gegriffen und sich angezogen. Er wollte diesen einen Schilling sparen, wobei Gott doch wusste, dass sie gar nichts zum Sparen hatten.
Im Stall brannte noch kein Licht. Er fand eine Lampe, zündete sie an und ging zu seinen Pferden. Er fütterte und bürstete sie und holte Wasser aus dem Trog im Hof. Es waren einfache Pflichten; eine beruhigende Routine für einen Mann, der seinen Platz in der Welt erst noch finden wollte. Als diese Aufgaben erledigt waren, nahm er das Zaumzeug für das erste der Pferde von dem schmiedeeisernen Haken.
Die Hand, die ihn packte, war schwer und kalt.
Man sagt, dass ein Mensch, zu dem der Tod kommt, sein ganzes Leben vor seinem inneren Auge ablaufen sieht. Doch was durch sein Bewusstsein wirbelte, waren die Bilder seines Hochzeitstages. Er sah sie aufblitzen, wie man ein verwunschenes Haus zwischen alten Bäumen aus einer schnell dahinfahrenden Kutsche heraus aufschimmern sah.
Er ließ die Lederriemen fallen, die er von der Wand genommen hatte, und fuhr herum. Ja, er hatte diese schwarz-silberne Livree schon einmal gesehen. Und auch einige der Männer, die noch größer gewesen waren als der, der jetzt vor ihm stand, und dem die zunehmende Morgenwärme den Schweiß auf die Stirn trieb.
Die Hand zerrte ihn aus dem Dämmerlicht des Stalles auf den Hof. »Jemand will mit dir reden.« Die Stimme passte zu der Hand. Sie war kalt wie der Tod.
Die Männer, die auf ihn warteten, sahen nicht aus, als wollten sie plaudern. Natürlich versuchte er, sich zu wehren. Aber es waren vier gegen einen. Er war ein starker Mann und an harte, körperliche Arbeit gewöhnt, aber sie brauchten nicht lange, ihm das Hemd herunterzureißen und ihn fast bewusstlos zu schlagen. Er hätte einen von ihnen fast im Wassertrog ertränkt und einen anderen kopfvoran gegen eine der glänzenden grauen Kutschen gestoßen. Er brach die Nase des dritten, und es bereitete ihm große Genugtuung, das Blut auf dessen feine, fleckenlose Livree tropfen zu sehen.
Natürlich hatte er gewusst, dass sein Glück nicht von Dauer sein würde. Er wusste auch, dass sie vorhatten, ihn zu töten. Als sie ihn schließlich überwältigten, warfen sie ihn zu Boden wie einen Hirsch, der von einer geifernden Hundemeute gehetzt worden war. Und als er auf dem Hof lag und Blut und Dreck und Gott weiß was spuckte, rissen sie ihn hoch und begannen von Neuem, auf ihn einzuprügeln.
Er erinnerte sich nicht daran, wie er sie abgeschüttelt hatte. Er erinnerte sich weder an die Mistforke noch daran, dass er danach gegriffen hatte. Er erinnerte sich nur daran, wie es sich angefühlt hatte, als er sie seinem Gegner in den Leib gerammt hatte. Und er konnte sich an das Mädchen erinnern, das im Schatten des Stalles gestanden und geschrien hatte. Immer wieder geschrien hatte.
Dann hatte jemand die Tür der grauen Kutsche geöffnet, und ein Fuß in einem eleganten Schuh war sichtbar geworden.
Die Stimme, die er hörte, klang ruhig. Fast höflich. Aber die schwarze Pferdepeitsche, die der Mann um seine Hand geschlungen hatte, war alles andere als das.
Natürlich hatte er wie der Teufel gekämpft. Aber drei von Jessups Männern hielten ihn fest; hielten ihn fest, während der Earl of Jessup, sein Schwiegervater, ihn kurz und knapp über den kürzlich erfolgten Sinneswandel seiner Tochter in Kenntnis setzte. Peitschenhiebe begleiteten dabei jedes der Worte.
Erst nachdem er zusammengebrochen war, fand der Earl of Jessup den Mut, näherzutreten. »Vielleicht konnte dich das davon überzeugen, dass meine Tochter ihre Meinung geändert hat«, schnaubte er.
Doch Merrick war nicht davon überzeugt. Er würde niemals davon überzeugt sein. Irgendwie gelang es ihm, den Kopf aus dem Dreck zu heben und ihn dem Mädchen zuzuwenden, das jetzt im Schatten des Stalles kauerte. »Er lügt.« Er hatte die Worte herausgewürgt. »Sag mir … dass Jessup … lügt.«
Das Mädchen - es war die Zofe seiner Frau - trat endlich aus dem Halbdunkel und machte einen tiefen Atemzug. »Nun, Monsieur, nein«, sagte sie und verschränkte die Hände ineinander. »Meine Herrin, sie hat ihre Meinung geändert. Sie sagt, dass sie … sie ist très désolé. Oui, es tut ihr sehr leid. Sie hat Sehnsucht nach zu Hause, Monsieur. Und sie ist très jeune … zu jung, oui? Sie möchte jetzt zu ihrem Papa zurückkehren, nach Sheffield.«
In diesem Moment überfiel es ihn wie ein Verderben bringender Sturm. Ihre drängenden Fragen. Ihre kleinen Einwände. Ihre nagende Ungewissheit wegen der Miete und der Kosten für die Dienerschaft, die Furcht, von der guten Gesellschaft abgelehnt zu werden …
Konnte es sein? Du guter Gott, hatte sie ihre Meinung wirklich geändert?
Jessup wickelte die Peitsche wieder um seine Hand. Mit einem ruhigen, stillen Lächeln stieg er in seine quecksilberfarbene Kutsche. Seine Lakaien gingen davon, ließen ihr Opfer geschunden und blutend auf dem Hof zurück. Das Mädchen zog sich in den Schatten zurück und begann leise zu weinen.
Nein. Er glaubte es nicht. Niemals würde er das glauben. Niemals.
Dieser Bastard! Jessup würde ihm dafür büßen. Benommen und zerschunden brachte er irgendwie die Kraft auf, sich aufzurichten und einen Sprung hin zu Jessups Kutsche zu machen, als diese vorüberfuhr. Doch anstatt die Fahrt zu verlangsamen, trieb der Kutscher die Pferde an und fuhr ihn um, ohne zu zögern.
Sofort spürte er den Schmerz; er spürte, wie sein Körper auf den Kiesweg geschleudert wurde und zwischen den Rädern der Kutsche aufschlug. Dann kam die entsetzliche, unerträgliche Qual. Das Splittern von Knochen. Der Schmerz, als sein Schädel gegen den Torpfosten krachte. Und dann war da nur noch diese Finsternis. Das gnädige Vergessen, das den Tod bedeutete - oder etwas, das dem tröstlich nahekam.
Kapitel 1
Geld regiert die Welt.
Die Schotten sagen, dass eine Geschichte interessanter wird, je öfter man sie erzählt. Und die Geschichte von Merrick MacLachlan war wohl schon tausendmal erzählt worden. In den Salons, in den Klubs und in den Hinterzimmern Londons war MacLachlan von Jahr zu Jahr reicher, rätselhafter und bösartiger geworden.
Jene, die Geschäfte mit Black MacLachlan machten, taten dies auf ehrliche Weise, wenn auch mit einem nicht zu leugnenden Maß an Beklommenheit. Einige von ihnen wurden bei diesen Geschäften reich - getreu dem Grundsatz, dass Geld nicht stinkt. Anderen erging es weniger gut, und deren Geschichte wurde meistens nur vor dem Insolvent Debtor's Court erörtert. Miss Kitty Coates hatte von solchen Dingen keine Ahnung, und sie konnte das Wort ›insolvent‹ nicht einmal buchstabieren. Aber das spielte auch keine Rolle. Denn vom Lohn der Geschäfte, die sie mit MacLachlan machte, gab sie einen reichlichen Teil an ihre Puffmutter ab.
Im Augenblick jedoch hatte Kitty Besseres zu tun, als über ihr Unvermögen beim Buchstabieren nachzudenken. Denn die Strahlen der tief stehenden Nachmittagssonne fielen durch die Fenster von MacLachlans Schlafkammer und warfen ihr grelles Licht auf die nackten Schultern des Gentleman. Und auch auf die Narben auf seinen Schultern und seinem Rücken, die sich kreuz und quer über die festen Muskeln zogen. Kitty war schon seit Langem an diesen Anblick gewöhnt. Sie spreizte ihre Finger weit in das weiche dunkle Haar, das seine Brust bedeckte und hielt sich daran fest, während sie auf ihm ritt.
Im Büro schlug eine Uhr fünf Mal. Mit drei, vier harten Stößen brachte MacLachlan die Sache zu Ende, schob Kitty von sich herunter und legte den muskulösen Arm über seine Augen. Die Botschaft war unmissverständlich.
»Wir müssen nicht sofort aufhören, Mr. MacLachlan, oder?« Kitty drehte sich zu ihm herum und fuhr mit der Fingerspitze leicht über die Narbe, die sich wie die Klinge eines Krummschwertes über seine Wange zog. »Ich könnte noch ein wenig bleiben - sagen wir, zwei Pfund für die ganze Nacht?« Ihre Fingerspitze strich wieder nach oben. »Wir hatten doch bisher eine schöne Zeit, Sie und ich.«
MacLachlan schlug die Decke zurück, drehte sich von Kitty weg und erhob sich aus dem schmalen Bett. »Zieh dich an, Kitty.« Seine Stimme klang emotionslos. »Nimm die Hintertreppe, wenn du gehst. Meine Leute sind noch im Büro.«
Ihr Gesicht erstarrte, aber sie sagte nichts. MacLachlan stand vor dem Bett und biss die Zähne zusammen, um dem Schmerz in seinem Bein zu trotzen. Er machte keinen Schritt, bis er sicher war, dass er nicht humpeln würde. Erst dann ging er in sein Ankleidezimmer und wusch sich sorgfältig.
Als er zu zurückkam, um sich anzuziehen - seine Kleider lagen sorgsam zusammengefaltet auf einem Stapel -, zwängte sich Kitty gerade in ihr zerknittertes rotes Kleid. Sie hatte die Augenbrauen eng zusammengezogen und machte eine finstere Miene. »Wie lange komm ich schon hierher, Mr. MacLachlan?«
MacLachlan unterdrückte einen Seufzer der Verzweiflung. »Ich habe keine Ahnung, Kitty.«
»Nun, ich weiß genau, wie lange schon«, sagte sie mürrisch. »Vier Monate und zwei Wochen, auf den Tag.«
»Ich habe dich bisher nicht für sentimental gehalten.« MacLachlan war damit beschäftigt, seine Unterhosen anzuziehen.
»Jeden Montag und jeden Donnerstag seit dem 1. Februar«, redete Kitty weiter. »Und in der ganzen Zeit haben Sie kaum ein Dutzend Worte mit mir geredet.«
»Mir war nicht bewusst, dass du den weiten Weg von Soho hierher machst, um Konversation zu betreiben«, entgegnete er und faltete seine Hose auseinander. »Ich dachte, du kämst wegen des Geldes.«
»Ja, nur weiter so!« Sie griff nach ihren Strümpfen, die auf Boden lagen. »Gebrauchen Sie nur feine große Wörter, um sich Ihren Spaß zu machen und mich herumzustoßen. Leg dich hin, Kitty! Bück dich, Kitty! Verschwinde, Kitty! Ich habe eine Verabredung, Kitty! Sie sind ein gemeiner, abscheulicher Mann, MacLachlan!«
»Ich schließe daraus, dass ich in deiner Achtung gesunken bin«, erwiderte er. »Sag Mrs. Farnham, dass sie mir Donnerstag eine andere schicken soll, wenn dir das lieber ist.« Eine, die nicht so verdammt viel redet, fügte er im Stillen hinzu, während er sich das Hemd in die Hose steckte.
»Nun, ich kann ja mal fragen, aber ich bin die einzige Rothaarige bei Farnies«, warnte Kitty ihn, während sie sich den ersten Strumpf anzog und mit geschickten Handbewegungen an ihrem Bein hochstreifte. »Und wegen meinem Haar werd ich oft verlangt, das kann ich Ihnen sagen.«
»Mir ist jede Farbe recht«, erwiderte er und betrachtete ihren Hintern, als sie sich vorbeugte, um den zweiten Strumpf vom Boden aufzuheben. »Es könnte mir wirklich nicht gleichgültiger sein.«
Kitty verlor die Fassung. Sie sprang auf, fuhr herum und schlug ihm den Strumpf ins Gesicht. »Warum fickst du nicht ein Astloch in irgendeinem morschen Zaun, du undankbarer hartherziger Schotte!«
Einen Moment lang starrte er sie finster an. »Nun, das wäre eine Möglichkeit - und zudem ein weitaus billigere.« Schließlich war er Geschäftsmann. Und Zäune schwatzten, bettelten und heulten schließlich nicht.
Unbarmherzig schob Kitty ihren nackten Fuß in den passenden Schuh. »Nun, ich hab genug von Ihrem Gegrunze und Ihrem Sich-auf-mich-wälzen-und-wieder-runter! Und hinterher gibt es nicht mal ein Auf Wiedersehen! Ich bin nur eine Hure vom Haymarket, MacLachlan, aber ich will verdammt sein, wenn ich mich …«
Die Zehn-Pfund-Note, die er ihr in die Faust stopfte, brachte sie zum Schweigen. Einen Moment lang starrte sie ihn an und versuchte, ihre Tränen wegzublinzeln.
Irgendwie brachte MacLachlan die Freundlichkeit auf, ihr leicht die Hand zu drücken. »Du hast dich bewundernswert gehalten, Kitty«, murmelte er. »Und ich bin nicht undankbar. Aber ich lege keinen Wert darauf, eine Freundschaft zu beginnen. Mrs. Farnham soll mir am Donnerstag jemand anders schicken. Wir brauchen eine Abwechslung, du und ich.«
Mit einem abschätzigen Schnaufen stopfte Kitty die Banknote in ihren großzügigen Ausschnitt. Davon würde Mrs. Farnham ganz sicher nichts abbekommen. Sie ließ ihren Blick über ihn gleiten, vom Scheitel bis zu seinen Lenden, und seufzte dann dramatisch. »Mein Herz wird sich bestimmt nicht nach Ihnen sehnen, MacLachlan«, fauchte sie dann. »Und so gut Sie auch sein mögen - Sie sind es einfach nicht wert.«
MacLachlan legte sich seine Halsbinde um. »Ja, damit hast du ohne Zweifel recht.«
Kitty räusperte sich missbilligend. »Also gut. Ich werde am Donnerstag Bess Bromley schicken, damit sie Sie für eine Weile erträgt. Sie ist grässlich gemein, diese katzenäugige Hexe. Ihr werdet gut zusammenpassen.« Nach dieser abschließenden Bemerkung rauschte Kitty durch das Schlafzimmer und riss die Tür zu seinem Arbeitszimmer auf, wo sie sofort im hellen Sonnenlicht verschwand.
Eine ganze Weile noch stand MacLachlan einfach da und starrte in die Schatten in seinem Arbeitszimmer. Er wusste, dass ein besserer Mann als er Reue empfinden würde, vielleicht sogar ein gewisses Maß an Schuldbewusstsein. Aber nicht er. Oh, Kitty hatte ihn gut bedient, erinnerte er sich, während er sich weiter ankleidete. Sie war sauber, höflich und pünktlich gewesen. Und ganz gewiss würde ihr breiter, runder Hintern ihm für immer in Erinnerung bleiben.
Aber das war vermutlich auch alles, woran er sich erinnern würde. Genau genommen war es April geworden, ehe er sich die Mühe gemacht hatte, sich ihren Namen zu merken. Bis dahin hatte er sie einfach aufgefordert, sich auszuziehen und sich auf das Bett zu legen. An besonders hektischen Tagen hatte er sich nicht einmal damit aufgehalten, sich zu entkleiden, erinnerte er sich, als er an seinen Schreibtisch zurückkehrte. Er hatte einfach seinen Hosenstall geöffnet, das Mädchen angewiesen, sich über das Sofa in seinem Büro zu beugen, und hatte dann begonnen, eine irgendwie lästige Lust zu befriedigen.
Nein, mehr interessierte ihn nicht. Damals so wenig wie heute. Denn wenn es etwas gab, was MacLachlan erregender fand als den Anblick eines hübsch gerundeten breiten Hinterns, dann war das pure, unverfälschte Macht. Und Kittys Klagen, so tief empfunden sie auch sein mochten, würden ihn niemals die beiden unabänderlichsten Gesetze des Kapitalismus vergessen lassen. Zeit war Geld. Und Geld war Macht. Von Ersterem hatte er zurzeit nur sehr wenig, von Letzterem würde er niemals genug haben.
MacLachlan entrollte einige Bauzeichnungen und klingelte dann ungeduldig nach seinem Sekretär. Es war Zeit, seine Anwälte aus der Threadneedle Street herzubitten; es gab Arbeit, die getan werden musste. Binnen einer Woche wollte MacLachlan damit beginnen, drei neue Grundstücke zu erschließen, sechs zu verkaufen, einen wenig zahlungsfreudigen Ziegeleibesitzer als bankrott erklären zu lassen und ein benachbart liegendes Dorf dem Erdboden gleichmachen - alles in Vorbereitung auf die nächste Reihe eleganter Villen im georgianischen Stil, die er plante, und die ihm dabei helfen würden, die verschwenderischen Engländer von einer weiteren Wagenladung ihrer Pennies und Pfund Sterling zu trennen. Denn das war es, was ihm wirklich Lust bereitete.
Das Haus in der Mortimer Street sah eigentlich nicht so aus, als gehörte es einem reichen und einflussreichen Angehörigen des englischen Hochadels. Und es stand nicht in Mayfair, allerdings auch nicht weit davon entfernt. Es war kein imposantes Stadthaus, sondern eher schlicht mit zwei Fenstern, einer Tür und vier unscheinbaren Etagen darüber. Der schlichten Fassade nach zu urteilen vermutete man eher, dass es einen Bankier, einen Anwalt oder einen bescheidenen, aber wohlhabenden Kaufmann beherbergte.
Doch so war es nicht. Denn hier wohnte der mächtige Earl of Treyhern, einen Ausbund an Gediegenheit und Sachlichkeit, ein nüchtern denkender Bürger wie er im Buche stand. Er war ein bescheidener Mann, der, so sagte man, keine Narrheiten duldete und Falschheit zutiefst verabscheute. Und was es noch schlimmer machte: Die Komtesse of Bessett, die verzagt am Fuß der Treppe zu seinem Haus stand, war nicht hierhergekommen, um dem Earl einen Besuch abzustatten. Sie war gekommen, um seine Gouvernante aufzusuchen - oder genauer gesagt, um ihm seine Gouvernante zu stehlen. Wenn das auch nur im Geringsten möglich wäre, und was abzuwarten blieb.
Geld spielte keine Rolle. Ihre Nerven allerdings schon. Aber die Komtesse war verzweifelt, und deshalb klopfte sie auf die kleine Ausbuchtung in ihrem Ridikül, atmete noch einmal tief durch und stieg die Treppe hinauf, um anzuklopfen. Sie betete darum, dass die Gouvernante noch hier arbeitete. Erst als die Tür geöffnet wurde, kam es der Komtesse of Bessett in den Sinn, dass es möglicherweise nicht ganz der Etikette entsprach, am Vordereingang nach einer Angestellten zu fragen.
Nun, jetzt war es zu spät. Ein hochgewachsener, breitschultriger Diener starrte ihr direkt ins Gesicht. Lady Bessetts Hand zitterte leicht, als sie ihm ihre Karte reichte. »Die Komtesse of Bessett möchte Mademoiselle de Severs sprechen, wenn sie anwesend ist?«
Die Augenbrauen des Dieners hoben sich ein wenig indigniert, doch er führte die Komtesse die Treppe hinauf und bat sie, in einem kleinen, von Sonnenlicht durchfluteten Salon Platz zu nehmen.
Das Zimmer war mit erlesenen französischen Antiquitäten ausgestattet. Buttergelbe Seidentapeten bedeckten die Wände, und die gelben Seidenvorhänge passten perfekt zu dem kostbaren Aubusson-Teppich. Trotz ihrer Nervosität fand Lady Bessett das Zimmer angenehm und merkte sich im Geiste die Farben. Vorausgesetzt sie überlebte dieses Zusammentreffen, wollte sie morgen ein Haus kaufen. Ihr eigenes Haus - nicht das ihres Mannes oder ihres Vater oder ihres Stiefsohnes. Ihr Haus. Und dann würde sie auch einen gelben Salon haben. Darüber konnte sie ganz allein entscheiden, nicht wahr? Das würde sie dem Bauunternehmer morgen sagen.
Einige Augenblicke später betrat eine groß gewachsene, dunkelhaarige Frau das Zimmer. Sie sah ganz entschieden französisch aus, aber sie war vielleicht ein wenig eleganter gekleidet, als man es von einer Gouvernante erwartete. Ihr Benehmen war nicht besonders eilfertig, und ihr Gesichtsausdruck war der höflicher Neugier. Ehe sie es sich noch einmal anders überlegte, erhob Lady Bessett sich rasch vom Sofa und ging rasch auf die Frau zu.
»Sie sind Mademoiselle de Severs?«, fragte sie und ergriff die Hand der Frau.
Die Frau zögerte kurz. »Nun, ja, aber …«
»Ich möchte Sie engagieren«, unterbrach Lady Bessett sie. »Sofort! Sie müssen mir nur sagen, welches Gehalt Sie erwarten.«
Mademoiselle de Severs zog sich einen Schritt weit zurück. »Oh, ich fürchte, Sie irren sich, aber …«
»Nein, ich bin verzweifelt!« Lady Bessett drückte Mademoiselle de Severs' Hand etwas fester. »Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Von der Gräfin von Hodenberg aus Passau. Sie hat mir alles erzählt. Über Ihre Arbeit. Ihre Tätigkeit in Wien. Mein Sohn … Ich fürchte, er ist sehr krank. Ich möchte Sie engagieren, Mademoiselle de Severs. Ich muss! Ich weiß nicht, an wen sonst ich mich wenden soll!«
Die Frau drückte Lady Bessett tröstend die Hand. »Es tut mir leid«, sagte sie mit ihrem leichten französischen Akzent. »Die Gräfin ist falsch unterrichtet. Genau genommen habe ich sie seit zehn Jahren oder noch länger nicht mehr gesprochen.«
»Das hat sie mir gesagt«, erwiderte Lady Bessett.
»Bitte - woher kennen Sie die Gräfin?«
Lady Bessett senkte den Blick und schaute zu Boden. »Ich habe während meiner Ehe meistens im Ausland gelebt«, erklärte sie. »Ihr Gatte und der meine teilten das Interesse für antike Geschichte. Wir sind uns das erste Mal in Athen begegnet.«
»Wie freundlich von ihr, sich an mich zu erinnern.«
Lady Bessett lächelte schwach. »Sie wusste nur, dass Sie nach London gegangen sind, um für eine Familie namens Rutledge zu arbeiten, die ein kleines Mädchen hatte, das schrecklich krank war. Es war recht schwierig, diese Familie aufzuspüren. Und London - nun, es ist eine sehr große Stadt, nicht wahr? Ich war erst einmal in meinem Leben hier.«
Miss de Severs deutete auf zwei Sessel vor dem Kamin, der an diesem Spätfrühlingsnachmittag nicht brannte. »Bitte nehmen Sie doch Platz, Lady Bessett«, lud sie die Besucherin ein. »Ich werde mich bemühen, meine Stellung in diesem Haus zu erklären.«
Die Hoffnung in Lady Bessetts Herzen schwand. »Sie … Sie können uns nicht helfen?«
»Das kann ich jetzt noch nicht sagen«, erwiderte die Gouvernante. »Ich werde es gewiss versuchen. Ihr Sohn - wie alt ist er bitte und welcher Art ist seine Erkrankung?«
Lady Bessett unterdrückte ein Schluchzen. »Geoffrey ist zwölf«, antwortete sie. »Und er … er hat … nun, er bildet sich Dinge ein, Mademoiselle. Seltsame, erschreckende Dinge. Und er sagt Dinge, die keinen Sinn ergeben, und er kann nicht erklären, warum er das tut. Manchmal leidet er unter Schwermut. Er ist ein zutiefst verstörtes Kind.«
Miss de Severs nickte langsam. »In welcher Form treten diese Einbildungen auf? Als Träume? Halluzinationen? Hört das Kind Stimmen?«
»Träume, denke ich«, flüsterte Lady Bessett. »Aber auch Träume, wenn er wach ist, wenn das einen Sinn macht? Ich - ich bin nicht ganz sicher, verstehen Sie? Geoffrey spricht nicht mehr mit mir darüber. Genau genommen hat er sich sehr verschlossen.«
»Leidet er noch darunter?«, fragte die Gouvernante. »Kinder entwachsen solchen Dingen oft, müssen Sie wissen.«
Lady Bessett schüttelte den Kopf. »Es wird zunehmend schlimmer«, erklärte sie. »Ich weiß, dass er sehr beunruhigt ist. Ich habe sowohl einen Arzt als auch einen Phrenologen in der Harley Street aufgesucht. Sie sagen … o Gott! … sie sagen, er könnte eine Geisteskrankheit haben. Dass er vielleicht den Bezug zur Realität ganz und gar verlieren könnte und unter Aufsicht gehalten werden muss. Oder - oder eingesperrt.«
»Was für ein Unsinn!«, sagte die Gouvernante und verdrehte die Augen. »Nun, ich würde gar zu gern einige der Ärzte in der Harley Street fesseln und einsperren - ganz zu schweigen davon, was ich mit den Phrenologen machen würde.«
»Sie glauben ihnen nicht?«
»Aber ganz und gar nicht!«, nickte die Frau voller Nachdruck. »Und ganz besonders nicht in diesem Fall! Ein Kind von zwölf Jahren ist noch nicht ausreichend entwickelt, weder mental noch körperlich, dass solche schrecklichen Prognosen gestellt werden können. Vielleicht ist Ihr Sohn lediglich sehr empfindsam und sensibel?«
Lady Bessett schüttelte den Kopf. »So ist es nicht«, sagte sie entschieden. »Obwohl er ein ausgesprochen guter Zeichner ist. Er hat auch eine Begabung für Mathematik und alle wissenschaftlichen Dinge. Deshalb scheinen diese - diese Anfälle so gar nicht zu ihm zu passen.«
»Er ist also kein Kind, das eine zu lebhafte Fantasie hat?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Kommt er ansonsten gut mit seiner Umwelt zurecht? Lernt er? Versteht er alles?«
»Geoffs Lehrer sagt, er sei brillant.«
»Gab es in seiner Kindheit irgendwelche Traumata?«
Einen Augenblick lang zögerte Lady Bessett. »Nein, kein … kein Trauma.«
Die Gouvernante zog wieder die Augenbrauen hoch und öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen. Aber in diesem Moment kam ein hübsches blondes Mädchen in den Salon gestürmt. Sie trug ein elegantes Abendkleid.
»Maman, es ist fertig!«, rief sie und schaute über die Schulter auf ihre Fersen. »Was sagst du? Ist der Saum so richtig? Oder sehe ich damit von hinten zu …«
»Mein Liebes, wir haben einen Gast«, tadelte die Gouvernante - die, wie es jetzt schien, keine Gouvernante war. »Das ist Lady Bessett. Lady Bessett, meine Stieftochter, Lady Ariane Rutledge.«
Das Mädchen war rot geworden. »Oh! Ich bitte um Entschuldigung, Ma'am!« Sie knickste und zog sich sofort zurück.
»Es ist schon gut!«, murmelte Lady Bessett und spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. »Wer war - ich meine, war das …?«
»Lord Treyherns armes kleines Mädchen, das so schrecklich krank war«, sagte ihre Gastgeberin. »Ja, das ist, was ich versucht habe, Ihnen zu sagen, Lady Bessett. Wir sind verheiratet, er und ich. Und Ariane, wie Sie sehen konnten, ist jetzt eine ganz normale junge Dame. Wir haben noch drei weitere Kinder, deshalb besteht meine Arbeit zurzeit in nur wenig mehr darin, als einer Freundin oder einer Verwandten von Zeit zu Zeit einen Rat zu geben.«
»Oh.« Lady Bessetts Schultern sackten herunter. »Ach du liebe Güte! Sie sind jetzt Lady Treyhern! Und ich - nun, ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun kann.«
Ihre Gastgeberin beugte sich zu ihr und legte die Hand auf die Lady Bessetts. »Meine Liebe, Sie sind sehr jung«, sagte sie. »Sogar noch jünger als ich, nehme ich an?«
»Ich bin dreißig«, wisperte Lady Bessett. »Und ich fühle mich, als wäre ich doppelt so alt.« Und dann, zu ihrer größten Verlegenheit, rollte ihr eine Träne über die Wange.
Lady Treyhern reichte ihr ein frisch gestärktes Taschentuch. »Dreißig ist noch ziemlich jung«, sprach sie weiter. »Sie müssen mir vertrauen, wenn ich sage, dass Kinder solchen Dingen entwachsen.«
»Glauben Sie wirklich?«, schniefte Lady Bessett. »Ich wünschte, ich könnte mir dessen sicher sein! Geoffrey ist mein Leben! Wir haben nur noch uns.«
»Ich verstehe«, sagte Lady Treyhern. »Und wie lange werden Sie in London bleiben, meine Liebe?«
Lady Bessett hob den Kopf. »Für immer«, erwiderte sie. »Ich bin verwitwet, und mein Stiefsohn hat vor Kurzem geheiratet. Morgen werde ich den Kaufvertrag für ein Haus unterzeichnen. Es ist ganz in der Nähe.«
»Tatsächlich?«, lächelte Lady Treyhern. »Wie aufregend!«
Lady Bessett zuckte mit den Schultern. »Unser Dorfarzt hielt es für das Beste für Geoff, wenn wir in der Nähe von London wohnen. Er sagte, er habe keine Ahnung, was er für den Jungen tun könnte.«
Lady Treyhern drückte tröstend ihre Hand. »Sie müssen sich Zeit lassen und sich erst einmal eingewöhnen, meine Liebe«, sagte sie. »Und wenn Sie das getan haben, müssen Sie mit dem jungen Geoff zum Tee kommen. Wir werden damit anfangen, uns kennenzulernen.«
»Sie … Sie werden uns also helfen?«
»Ich werde es versuchen«, sagte Lady Treyhern. »Seine Symptome sind in der Tat rätselhaft. Aber ich bin ganz und gar nicht überzeugt, dass es sich um eine Erkrankung handelt.«
»Glauben Sie nicht? Gott sei Dank!«
»Selbst wenn es so wäre, meine Liebe, so gibt es in London einige Mediziner, die die Entwicklungen verfolgen, die sich in Wien und Paris tun«, sagte die Gastgeberin. »Sie wagen sich auf das Feld der Geisteskrankheiten und der Erkrankungen der Seele. Psychologie nennen sie es. Nicht alle sind unwissende Schwachköpfe, Lady Bessett.«
»Geisteskrankheiten!« Lady Bessett zuckte zusammen. »Ich kann es nicht ertragen, auch nur daran zu denken!«
»Ich bezweifle, dass Sie das überhaupt müssen«, beruhigte Lady Treyhern sie. »Und jetzt werde ich nach Kaffee klingeln und Sie müssen mir alles über Ihr neues Haus erzählen. Wo steht es, bitte?«
»In der Nähe von Chelsea«, erwiderte Lady Bessett gefasst. »In einem Dorf namens Walham Green. Ich habe mir dort ein Cottage gemietet, bis das Haus fertig ist, aber das wird noch einige Wochen dauern.«
»Nun, dann wohnen Sie ja ganz nah bei der Stadt«, sagte Lady Treyhern, während sie aufstand und an der Klingelschnur zog. »Ich gestehe, dass ich nicht viele Leute in London kenne. Nichtsdestotrotz müssen Sie mir erlauben, Ihnen bei den Einführungen behilflich zu sein.«
Wieder spürte Lady Bessett, wie ihre Wangen sich röteten. »Ich fürchte, ich habe bisher kaum am gesellschaftlichen Leben teilgenommen«, gestand sie ein. »Ich kenne fast niemanden.«
»Nun, meine Liebe, jetzt kennen Sie mich«, erwiderte ihre Gastgeberin. »Also - was ist mit diesem neuen Haus? Ich nehme an, es verfügt über alle modernen Annehmlichkeiten. Und natürlich werden Sie eine Menge neuer Möbel kaufen müssen. Wie aufregend das sein wird!«
Kapitel 2
Wie man sich bettet, so liegt man.
Die Glöckner von St. George am Hanover Square warteten schon im Portikus, als MacLachlans Kutsche im frühen Morgendunst vor der Kirche eintraf. Mit einem knappen Befehl wies er seinen Kutscher an, im Three Kings Yard auf ihn zu warten, dann stieg er aus der Kutsche. In einer Stunde würde die Straße vom Verkehr überflutet sein, und er hatte nicht vor, in dem Gewühl stecken zu bleiben.
Im Portikus der Kirche warf ihm einer der Glöckner einen neugierigen Blick zu. Ein anderer rieb sich geistesabwesend die Schwielen in seiner Hand, als dächte er über die vor ihm liegende Aufgabe nach, während ein weiterer sich nicht eben leise über den Nebel an diesem Spätfrühlingsmorgen beklagte. In diesem Moment wurde eine der Türen geöffnet. Einer nach dem anderen verschwanden die Glöckner in der Kirche. Schon bald konnte MacLachlan hören, wie sie mit schweren Schritten hintereinander die Wendeltreppe erklommen, die in den Turm hinaufführte.
MacLachlan war dankbar, jetzt allein zu sein. Er sah keinen Nutzen darin, sich von Leuten, die er nicht kannte, in müßiges Geschwätz verwickeln zu lassen. Und ganz gewiss hegte er nicht den Wunsch, die Kirche zu betreten, bevor es sich nicht länger aufschieben ließ. Ruhelos ging er auf der Straße hin und her, bewunderte dabei das schöne flämische Glas und die klassischen Säulen von St. George, wenn auch auf eine distanzierte, fast wissenschaftliche Art. Er hatte sich in der Nähe dieser Bastion der oberen Zehntausend Londons noch nie wohlgefühlt. Er hätte sich niemals träumen lassen, hierherzukommen, um einer Hochzeit beizuwohnen - nun, jedenfalls nicht, so lange er zurückdenken konnte.
Aber heute war der Hochzeitstag seines älteren Bruders. Heute blieb MacLachlan keine andere Wahl. Er wandte sich um und ging den Bürgersteig ein Stück weit zurück. Phipps hatte ihm die Krawatte zu eng gebunden, verdammt. MacLachlan steckte den Zeigefinger in den Kragen und versuchte, sie zu lockern.
Der Verkehr auf der St. George Street nahm allmählich zu. Verdammt. Er hatte kein Verlangen, hier noch länger auf und ab zu gehen wie ein gefangenes Tier. Aber er konnte sich auch nicht überwinden, in die Kirche zu gehen. Abrupt wandte er sich um und ging die schmale schattige Gasse hinunter, die entlang der Kirchenmauer verlief. Hier war die Luft dick vom Geruch moosbewachsener Steine und feuchter Erde. Vom Geruch, der aus den Gruften und Katakomben aufstieg, von kalten, toten Dingen. Vielleicht wie aus das Grab der Hoffnungen und Träume eines Menschen.
Es war ein Fehler gewesen, hierherzukommen. Zu dieser Kirche. In diese Gasse. Er schaute hoch und sah die Sonne durch grüne Baumkronen scheinen. Ihre Strahlen schufen ein flirrendes Licht. MacLachlan schloss die Augen. Der Lärm des Straßenverkehrs wurde leiser, verschwand dann ganz.
»Küss mich, Maddie.« Seine Stimme klang rau in der Dunkelheit.
»Merrick, meine Tante!« Sie schaute sich verschämt um und legte die Hand gegen seine Brust. »Sie wird schimpfen, wenn wir hinter den anderen zurückbleiben.«
Er legte einen Finger auf ihre Lippen. »Schsch, Maddie«, erwiderte er »Sie haben nicht einmal bemerkt, dass wir nicht mehr da sind.« Er beugte den Kopf und berührte mit den Lippen leicht ihren Mund. Aber so, wie es immer geschah, brachte dieser Kuss sofort eine Flamme zum Lodern. Seine Zunge drang tief in ihren Mund ein, ihre Hände verschlangen sich ineinander.
Ihr Duft machte ihn schwindelig. Er fühlte die Seide ihres Kleides unter seinen Händen, die Wölbung ihres Hinterns, fest und verheißungsvoll unter seinen Händen. Maddies Atem ging schneller, bis er zu einem süßen köstlichen Seufzen wurde. Sie besaß so viel Verstand, ihn von sich wegzuschieben.
»Merrick, wir sind in einer Kirche!«
Er lächelte auf sie herunter »Richtig, Mädchen, so ist es«, bestätigte er. »Aber an meinen Gefühlen für dich ist nichts Sündhaftes. In den Augen Gottes sind sie gut und rein.«
Sie schlug die Augen nieder und wandte den Blick ab, ihre Wangen färbten sich blütenblattrosa. Er wollte sie wieder küssen. Er wollte sie so berühren, wie ein Mann eine Frau berührte, die ihm gehörte. Aber er wagte es nicht, es hier an diesem Ort zu tun. Stattdessen lehnte er seine Schläfe gegen ihre und spürte, wie ihre Schultern sich entspannten, die sich gegen die kalte Mauer der Kirche drückten.
»Maddie.« Er flüsterte ihren Namen in ihr Haar, schlang die Arme um sie und zog sie an sich. »Ja?«
»Ist dies die Kirche, in der ihr Mayfair-Leute heiratet?«
»Ich gehöre nicht zu den Mayfair-Leuten«, wisperte sie zurück. »Nicht richtig jedenfalls. Aber ja, hier ist es.«
»Dann werde ich dich hier heiraten, Maddie«, schwor er. Seine Stimme war angespannt vor Gefühl. »Am Ende der Ballsaison, vor all diesen feinen Leuten werde ich das tun, das schwöre ich bei Gott.«
»Wird man … uns das erlauben, Merrick?«
Er vergaß manchmal, wie jung sie war. »Sie können uns nicht daran hindern«, sagte er rau. »Niemand, Maddie, kann wahre Liebe aufhalten.«
Vom Gang her waren plötzlich die lauten Schritte ihrer Tante zu hören …
»Großer Gott, hier steckst du!« Die Schritte verharrten.
Merrick wandte sich in der engen Gasse um und blinzelte in das Morgenlicht.
»In einer halben Stunde geht es los!« Sir Alasdair MacLachlans Stimme klang fast wie ein Knurren. »Kommst du jetzt mit hinein oder nicht?«
»Ja, gleich.«
»Nein, sofort!«, entgegnete der zukünftige Bräutigam. »Du warst damit einverstanden, Merrick. Und so schlimm ist es schließlich nicht. Dir soll doch kein Zahn gezogen werden! Du musst nur neben mir stehen.«
Merrick versuchte, sich zusammenzunehmen, während er langsam an der Kirchenmauer zurückging. Er hoffte, man würde ihm seine Gemütserregung nicht anmerken. »Du hast natürlich recht«, sagte er und trat aus dem Schatten in die Sonne. »Entschuldige bitte. Ich war mit den Gedanken woanders.«
»Deine Gedanken waren da, wo sie immer sind, würde ich meinen«, bemerkte sein Bruder garstig. »Bei deinen verdammten Geschäften.« Während er sprach, fuhr ein offener Landauer an der Kirche vorbei, schwenkte dann jäh nach links und hielt an. Ein korpulenter Mann stieg aus und kam den Gehsteig entlang auf die beiden MacLachlan-Brüder zu, eine Hand zu einer festen Faust geballt.
»Wer zum Teufel ist das?«, fragte Alasdair leise.
Merrick zog gelassen den Hut. »Guten Morgen, Chutley.«
Der Mann war hochrot im Gesicht und roch nach Alkohol. »Sie haben gut reden!«, polterte er anklagend los. »Es ist die reine Vorsehung, dass ich Sie hier treffe, nicht wahr?«
»Das kann ich nicht sagen«, erwiderte Merrick. »Darf ich Ihnen meinen Bruder vorstellen, Sir Alas …«
»Sparen Sie sich die Mühe«, knurrte der Mann. »Ich hatte gestern Abend Besuch, MacLachlan. Von einem Ihrer Gangster aus der Threadneedle Street.«
Merrick zog eine Augenbraue hoch. »Sie sprechen von meinen Anwälten in der City?«
»Nennen Sie sie, wie Sie wollen«, erwiderte der Mann barsch. »Habe ich das richtig verstanden, MacLachlan? Sie haben vor, mir mein Darlehen zu kündigen? Entgegen dem, was wir vereinbart haben?«
Alasdair räusperte sich laut, aber Merrick wollte darauf antworten. »Sie haben zugestimmt, das Darlehen in vierteljährlichen Raten zu tilgen, Chutley.«
»Großer Gott, Mann! Es ist doch noch Mai!«
»Richtig. Aber das Darlehen wurde am 2. Februar ausgezahlt«, erwiderte Merrick. »Die erste Zahlung war neunzig Tage später fällig.«
»Gentlemen, müssen wir das jetzt diskutieren?«, zischte Alasdair. »Wir stehen vor einer Kirche, um Himmels willen!!«
Die beiden Männer würdigten ihn keines Blickes. »Aber jeder Engländer weiß, dass in diesem Fall der 24. Juni der nächste Quartalstag ist«, protestierte Chutley.
Merrick zog beide Augenbrauen hoch. »Tatsächlich?«, murmelte er. »Nach dieser Auslegung hätte ich die Zahlung am Lady Day bekommen müssen, am 25. März. Ich fange an zu glauben, dass Sie das Kleingedruckte nicht gelesen haben, Chutley. Darin wurde die Rückzahlung nach schottischem Recht vereinbart. Und dementsprechend war die Zahlung am 15. Mai fällig.«
Chutley sackte in sich zusammen. »Aber - ich habe das Geld nicht, MacLachlan!«, sagte er mit dumpfer Stimme. »Verdammt! Sie spekulieren auf meine Ziegeleien! Wollen Sie das? Geht es darum?«
»Dann würde ich zumindest ein paar Ziegel als Entschädigung für meinen Ärger bekommen«, entgegnete Merrick scharf. »Wenn ich Ihre verdammte Ziegelei übernehmen muss, um diese Sache vom Tisch zu kriegen, dann sei es so.«
Alasdair berührte ihn leicht an der Schulter. »Also wirklich, Merrick, das ist jetzt aber mehr als kleinkrämerisch.«
Sein Bruder wandte sich kurz zu ihm um. »Aye, aber so ist das Geschäft«, entgegnete er. »Chutley, mein Bauleiter hat mir berichtet, dass Sie uns bei den letzten drei Projekten vierzehn Tage zu spät beliefert haben. Ohne Steine kann ich nicht bauen, Mann, und ich habe Ihnen dieses Darlehen nicht aus reiner Herzensgüte gewährt -«
»Nein, weil Sie gar kein Herz haben!«, fiel ihm der Mann ins Wort.
»Aye, und Sie tun gut daran, das nicht zu vergessen«, riet Merrick ihm. »Das Darlehen wurde Ihnen gewährt, damit die Chutley-Ziegelei ihre Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen und mir meine verdammten Baumaterialien rechtzeitig liefern kann. Ich brauche diese Ziegel jetzt, Chutley, und Sie haben Ihren Hof voll davon. Ich weiß das, weil ich es gestern gesehen habe.«
Chutleys wurde noch röter. »Aber diesen Bestand habe ich Fortnoy versprochen!«
»Dann brechen Sie Ihr Versprechen, verdammt noch mal!«, donnerte Merrick. »Oder war es etwa Fortnoy, der Ihnen zehntausend Pfund geliehen hat? Nein, ich denke nicht, dass er das getan hat. Guten Tag, Chutley. Bis heute Abend erwarte ich ein Dutzend Wagenladungen Ziegel in Walham Green, und den Rest dann bis zum Ende der Woche.«
Der Mann zitterte vor Wut und sah aus, als würde er jeden Moment auf dem Bürgersteig zusammenbrechen. Ohne weiteres Wort machte er auf dem Absatz kehrt und ging zu seinem wartenden Landauer.
»Oh, vielen Dank, Merrick!«, bemerkte sein Bruder kalt. »Danke, dass du diesen Tag so besonders für mich gemacht hast!«
Merrick wandte sich um und sah Alasdair verständnislos an. Dann fasste er sich und ihm wurde wieder bewusst, wo er sich befand. Inzwischen hatte sich eine kleine Gruppe von Hochzeitsgästen an der entgegengesetzten Seite des Portikus eingefunden. Sie wandten ihre Blicke ab und sprachen leise miteinander. Er begriff sofort, dass sie mit angesehen haben mussten, dass ein Streit stattgefunden hatte, auch wenn sie die Worte nicht verstanden hatten.
Er spürte, wie ihm heiße Röte ins Gesicht stieg. Der Bruder des Bräutigams zertrat im Portikus von St. Georges einen zahlungssäumigen Lieferanten unter seinem Absatz - ja, das war genau das, wonach Merricks Ruf verlangte. Normalerweise würde er keinen Pfifferling auf das Gerede der Leute geben. Aber sein Bruder hatte fast siebenunddreißig Jahre damit gewartet, um vor den Altar zu treten, und er war sehr glücklich, es heute endlich zu tun. Alasdair war der Frau seiner Träume begegnet. Und anders als Merricks Träume schienen die seines Bruders dazu bestimmt, wahr zu werden.
Irgendwie brachte er die Geistesgegenwart auf, den Arm um die Schultern seines Bruders zu legen. Er hatte Alasdair oft um dessen unbekümmerten Charme und engelsgleiche blonde Schönheit beneidet, aber etwas Schlechtes hatte er ihm nicht gewünscht. »Es tut mir leid, Alasdair«, entschuldigte er sich. »Dies ist ein besonderer Tag! Komm, lass uns hineingehen und damit beginnen, Esmée zu einem Teil unserer Familie zu machen.«
Wie mit den meisten Pflichten, die man besonders fürchtete, wog sie letztlich dann gar nicht allzu schwer. Die Zeremonie an sich war bald vorüber und Merricks Verpflichtung damit erfüllt - zumindest nahm er das an. Die Menge strömte zum aufjubelnden Läuten der Glocken aus der Kirche.
Während das Glockenläuten von den hohen Mauern Mayfairs widerhallte, begann die Hochzeitsgesellschaft, sich auf den Weg zum nahe gelegenen Grosvenor Square zu machen, wo im Hause Lady Tattons das Hochzeitsfrühstück auf sie wartete. Lady Tatton war eine der aufrechtesten Stützen der guten Gesellschaft - und nun durch diese Heirat mit Alasdair verwandt.
Vor der Kirche gesellte sich Esmée zu Merrick MacLachlan. Sie sah heute blendend aus. »Darf ich Ihren Arm nehmen, Merrick?«, fragte sie. »Immerhin sind Sie jetzt mein Schwager.«
Selbstverständlich bot er ihn ihr an. Alasdair nahm gerade die Glückwünsche einiger seiner weniger gut beleumdeten Freunde an. Er stand neben Esmée, als er ihnen die Hand schüttelte. Auf seinem Gesicht lag jener leicht verwirrte Ausdruck, der frisch verheirateten Männern zu eigen war.
»Sie werden uns doch in Tantes Haus ein wenig Gesellschaft leisten, hoffe ich?«, fragte Esmée.
Merrick zögerte. »Ich hatte nicht geplant, zu bleiben«, gestand er. »Sie werden mir das doch gewiss nachsehen?«
»Nein, das werde ich nicht«, erwiderte sie rundheraus. »Wo ist Ihre Kutsche? Warum können Sie nicht bleiben?«
»Die Kutsche steht beim Three Kings«, sagte er. »Und heute Nachmittag habe ich ein Treffen. Meine Leute erwarten mich.«
»Bis zum Nachmittag ist es noch eine Weile hin«, sagte Esmée. »Könnten Sie nicht ebenso gut ein paar Meter weiter gehen, Merrick, und zumindest auf unser Glück anstoßen?«
Es schien eine so kleine Bitte zu sein. »Sie sind Alasdairs einziger Verwandter in London«, fuhr sie fort. »Man erwartet von Ihnen, dass Sie an der Feier teilnehmen.«
Merrick war es verdammt gleichgültig, was man von ihm erwartete. Man hatte nichts für ihn getan, und für seinen Bruder verdammt wenig. Ein schottischer Baronet von bescheidenem Wohlstand hatte nicht viel Gewicht so weit im Süden, und sein jüngerer Bruder sogar noch weniger - besonders, wenn er es wagte, tatsächlich für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Alasdair war Esmée durch eine Laune des Schicksals begegnet und hatte sich in sie verliebt, sehr zum Leidwesen von deren Tante.
Niemand, Maddie, kann wahre Liebe aufhalten.
Nun. Zumindest war Merrick bei dieser Gelegenheit die Gültigkeit dieser Worte bewiesen worden. Alasdair und Esmée liebten sich bedingungslos. Niemandem wäre es gelungen, ihnen diese Heirat auszureden. Es war eine Verbindung, die ewig halten würde, dessen war Merrick sich mehr und mehr klar geworden. Um seiner neuen Schwägerin willen zwang er sich deshalb zu einem angestrengten Lächeln.
»Die Gesellschaft erwartet es, ja?«, fragte er. »Nun, Gott weiß, dass es nicht mein Wunsch ist, sie zu enttäuschen.«
Esmées grüne Augen funkelten vor Lachen. Merrick gab sich Mühe, ihr etwas Nettes zu sagen. »Sie freuen sich auf die Hochzeitsreise, hoffe ich? Auf Alasdairs Landsitz wird es zu dieser Jahreszeit wunderschön sein.«
Esmées Miene wurde weich. »Oh, es wird sein, als würde ich wieder nach Hause kommen!«, sagte sie wehmütig. »Ich habe mich nach Schottland gesehnt, seit ich von dort fortgegangen bin. Ich hoffe nur, dass …«
»Sie hoffen was?«, drängte Merrick.
»Ich hoffe nur, dass Ihre Großmutter sich nicht belästigt fühlen wird«, sagte sie. »Ich weiß, dass Castle Kerr ihre Domäne ist, und dass Alasdair es ihr überlassen hat, das Anwesen nach ihrem Gutdünken zu führen. Ich hoffe, ich kann sie überzeugen, dass sich daran nichts ändern wird.«
»Dann sollten Sie ihr das einfach sagen«, riet Merrick. »Granny MacGregor sagt, was sie denkt, und sie erwartet von ihren Mitmenschen das Gleiche.«
»Nun, das scheint eine Eigenheit der Familie zu sein.« Esmée neckte ihn mit ihrem Blick. »Hören Sie, Merrick, warum begleiten Sie uns nicht? Schließlich haben Sie doch auch Ihre Kindheit dort verbracht.«
Er sah sie ungläubig an. »Sie auf Ihrer Hochzeitsreise begleiten?«, entgegnete er. »Nein, damit wird Alasdair wohl kaum einverstanden sein.«
»Merrick, Alasdair liebt Sie«, sagte sie ruhig. »Und manchmal beneidet er Sie sogar. So wie vielleicht Sie ihn beneiden, denke ich? Aber Sie sind sein Bruder, und Sie bedeuten ihm die Welt.«
»Unser brüderlicher Wettstreit liegt weit in der Vergangenheit, Esmée«, entgegnete er. »Wir sind sehr verschieden, und wir haben das akzeptiert. Aber mit euch beiden in den Norden reisen? Nein, ich denke nicht.«
»Dann kommen Sie später nach«, beharrte sie. »Wir wollen bis zum Herbst dort bleiben, wenn nicht sogar das ganze Jahr. Kommen Sie jederzeit! Ihre Großmutter würde es so sehr freuen. Mich würde es sehr freuen.«
Sie hörte sich an, als meinte sie es aufrichtig. Auch wenn Merrick nicht wusste, wieso. Er war anfangs nicht sehr freundlich zu Esmée gewesen. Sie hatte jeden Grund, ihn zu verabscheuen.
»Wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln«, sagte er ausweichend und verneigte sich elegant vor ihr. »Ich danke Ihnen, Lady MacLachlan, für die Einladung.«
Esmée lächelte, aber gerade in diesem Moment kam der Marquis of Devellyn vorbei, legte seine großen Hände um Esmées Gesicht und küsste sie, recht schamlos und geräuschvoll, auf beide Wangen. »Mein liebes Kind!«, sagte er und stieß Alasdair dabei mit dem Ellbogen in die Rippen. »Jetzt haben Sie sich also wirklich diesen alten Wüstling aufgebürdet! Wie alt sind Sie? Siebzehn? Und dieser Bursche hier ist wie alt? Doch mindestens fünfundvierzig! Ich schwöre, das Schicksal ist schrecklich ungerecht mit Ihnen verfahren!«
Esmées Wangen färbten sich rosa. Auch wenn sie nicht so aussah, so war sie immerhin dreiundzwanzig, und Devellyn wusste das mit Sicherheit. Neben dem Marquis stand dessen Frau, die ihn jetzt auszuschelten begann und Esmée dabei mitfühlend zulächelte. Merrick nutzte diese Gelegenheit, um in der Menge unterzutauchen. Zumindest war das seine Absicht. Doch als er an Lady Tattons Stadthaus vorbeikam, traf er dort auf einen der wenigen guten Freunde, die er unter den oberen Zehntausend Londons hatte - den Earl of Wynwood.
»Wo ist deine bezaubernde Frau?«, fragte Merrick den Freund, während die Menge der Hochzeitsgäste um sie herum wogte.
Lord Wynwood wies mit einem Kopfnicken zur Treppe. »Vivie steckt irgendwo mittendrin in diesem Menschenauflauf«, grinste er, »und nimmt die Komplimente ihrer zahlreichen Bewunderer entgegen.«
Merrick verzog leicht den Mund. »Ich bin mir ganz und gar nicht sicher, ob ich mir wünschen sollte, mit einer berühmten italienischen Sopranistin verheiratet zu sein.«
Wynwood schüttelte den Kopf. »Ich habe zu viele Jahre damit vertan, nicht mit Vivie verheiratet zu sein«, erwiderte er. »Lieber ihren Ruhm in Kauf nehmen als mein Elend. Abgesehen davon willst du doch mit niemanden verheiratet sein - berühmt oder nicht ber …« Dann, als sei ihm bewusst geworden, was er gerade gesagt hatte, verzog er das Gesicht. »Verdammt, es tut mir leid, alter Knabe!« Er legte Merrick die Hand auf die Schulter. »Hör mal, können wir kurz etwas Geschäftliches besprechen? Vivie und ich brauchen deine Hilfe.«
»Welche Art von Hilfe?«
»Wir wollen ein neues Haus«, sagte Wynwood. »Wir wohnen entsetzlich beengt, um die Wahrheit zu sagen.«
Merrick war überrascht. »Du willst aus Mayfair wegziehen?«
»Ach, du kennst doch Vivie! Sie macht sich nicht das Geringste aus Mayfair. Aber wir brauchen Platz, und um den zu bekommen, müssen wir ein Stück weit aus London herausziehen. Ich dachte, Walham Green könnte perfekt sein.« Er bedachte Merrick mit einem frechen Grinsen. »Du hast vor, das ganze Dorf dem Erdboden gleichzumachen, oder? Sei doch so nett, einige Hektar davon für uns zu reservieren.«
Merrick lächelte angespannt. »Im Gegensatz zu den dunklen Gerüchten werde ich nur das unterpflügen, was die guten Leute von Walham an mich zu verpachten oder zu verkaufen bereit sind.«
»Ja, aber dein Geld ist schrecklich reizvoll für sie, nicht wahr?«, sagte Wynwood. »Und es ist auch so viel davon vorhanden.«
Merrick zuckte mit den Schultern. »Ich zahle faire Preise.«
Wynwood lachte so laut, dass die Umstehenden zu ihm hinschauten. »Oh, ein Schotte zahlt niemals einen fairen Preis!«, entgegnete er. »Aber wirst du uns helfen, Merrick? Wirst du ein Haus für uns entwerfen? Und es in der Nähe von Chelsea bauen?«
»Warum ich, Quinn?« Merricks Stimme war leise. »In meinem Unternehmen gibt es ein Dutzend junger fähiger Architekten. Offen gestanden habe ich den Zeichenstift in den letzten zehn Jahren kaum noch in die Hand genommen.«
»Wir brauchen etwas Besonderes«, beharrte Wynwood. »Und dir sagt man nach, nicht nur in Sachen Geldanlagen ein Genie zu sein, sondern auch als Architekt.«
»Tatsächlich?« Merrick schnaubte abfällig. »Wer sagt das?«
»Nun, unter anderem sagen das all diese hübschen Urkunden und Preise, die drei Wände deines Büros schmücken«, erwiderte er. »Und diese akademischen Dinge aus St. Andrews, die an der Fensterseite hängen.«
»Dinge?«, fragte Merrick spöttisch.
»Du weißt doch, dass ich nicht auf die Universität gegangen bin«, grummelte Wynwood. »Ich weiß nicht genau, was sie bedeuten, aber ich weiß, was ich höre. Also, ich brauche ein Haus - ein verdammt großes -, und ich will erstklassige Qualität.«
»Was ist mit einem anderen Architekten? Cubitt zum Beispiel hat noch ein oder zwei Häuser am Belgravia Square zum Verkauf stehen.«
Wynwood schüttelte den Kopf. »Ich habe mir Belgravia angesehen, und es gefällt mir einfach nicht. Alles ist wunderschön, aber es sieht alles so gleich aus - was zeigt, dass er ein guter Baumeister, aber kein guter Architekt ist. Dich hingegen hat man schon als genial gelobt, kaum dass du auch nur dein erstes Torhäuschen gebaut hattest.«
»Vor mehr als einem Jahrzehnt und einer halben Ewigkeit«, sagte Merrick. »In der Welt der Architektur, Wynwood, muss man ein hungernder Künstler sein, um solch eine Zustimmung zu bekommen. Ist man erstmal reich, hält man das für Belohnung genug.«
»Ach!« Wynwoods Ton klang beunruhigend verständnisvoll. »Und ist dem so?«
Merrick zögerte nur einen Herzschlag lang. »Aye, du hast verdammt recht, dem ist so.«
»Ich verstehe«, sagte Lord Wynwood. »Dann wirst du also morgen mit mir im Walham Arms den Lunch einnehmen und mich durch das Dorf führen?«
»Wenn das dein Wunsch ist«, erwiderte Merrick und zuckte gleichmütig die Schultern. »Komm kurz nach eins dorthin. Und, Wynwood - wenn du ernsthaft interessiert bist -«
»Das bin ich.«
»Aye, dann bring einen Bankwechsel mit. Ich bin, wie du schon sagtest, Schotte.«
Wynwood lachte wieder und mischte sich dann in die Menschenmenge, die seine schöne, ihm frisch angetraute Frau umringte.
Kapitel 3
Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
Nachdem vierzehn Tage seit ihrem Umzug in das kleine Dorf Walham Green vergangen waren, war Lady Bessett zu der Überzeugung gelangt, dass der späte Morgen zu ihrer Lieblingszeit des Tages geworden war. Kurz nach Tagesanbruch setzte in aller Regel der Straßenverkehr zum Markt ein. Dann rumpelten die mit Gemüse beladenen Wagen durch das stille Dorf, die Karren, die hoch mit Heu oder Lattenkisten mit gackerndem Federvieh beladen waren. Sie fuhren in Richtung London und ließ das kleine Dorf friedlich zurück.
Auch an diesem Morgen saß die Komtesse in dem kleinen, hinter ihrem Häuschen gelegenen Garten, nippte an ihrem Tee und nahm dazu ein wenig Toast zu sich. Sie schloss die Augen und lauschte dem Gesang der Vögel, während sie den letzten Schluck aus ihrer Tasse trank. Der Frühling lag in der Luft - der Geruch von frisch umgegrabener Erde und der Duft der ersten Blumen. Ja, sie konnte fast meinen, wieder in Yorkshire zu sein.
Sie vermisste es wirklich schmerzlich. Lady Bessett öffnete die Augen und ließ den Blick durch den winzigen, von einer Mauer umgebenen Garten schweifen, über die Rosenbüsche, die den geharkten schmalen Pfad säumten, und die alte Wisterie, die sich um das Küchenfenster rankte. Seit sie an diesen bezaubernden Ort gekommen war, hatte sie sich nicht gestattet, an Yorkshire zu denken - nicht bis es erforderlich geworden war, Lady Treyhern ihre Situation zu erklären.
Die Wahrheit jedoch war, dass die Täler Yorkshires nur vier kurze Jahre lang ihre Heimat gewesen waren. Aber in dieser Zeit hatte sie gelernt, deren unendliche, von Hügeln durchzogene Weite zu lieben. Und sie hatte begonnen, die Freiheit zu genießen, die der Witwenstand ihr gebracht hatte. Ein neugewonnenes Gefühl der Selbstachtung war langsam in ihr gewachsen, und Loughton Manor war nach den langen Jahren der Vernachlässigung durch den abwesenden Besitzer, ihren Ehemann, zu neuem Leben erwacht.
Vielleicht war dabei noch wichtiger gewesen, dass sie angefangen hatte, Loughton und die Menschen, die dort lebten, zu lieben. Sie werden mich vermissen, dachte sie. Mrs. Pendleton hatte hemmungslos geweint, als sie und Geoff in die Kutsche gestiegen waren, um die lange Fahrt nach London anzutreten. Sogar Simms, der alte Butler, war zweimal gezwungen gewesen, sich zu schnäuzen. Ja, sie alle würden sie vermissen - und sich nicht darüber freuen, dass sie eine neue Herrin bekommen hatten.
Ihr Stiefsohn Alvin, jetzt der Earl of Bessett, hatte sich verheiratet, kaum dass er mündig geworden war. Bedauerlicherweise war seine Wahl auf eine Frau gefallen, der das Personal nicht gewogen war. Miss Edsell war die Tochter eines in der Nachbarschaft lebenden Gutsherren und oft Gast in Loughton Manor gewesen. Sie hatte ihre Netze sehr früh und ganz offen nach Alvin ausgeworfen. Und sie hatte ebenso unverhohlen deutlich gemacht, dass sich auf Loughton einiges ändern würde, wenn sie dort erst die Herrin wäre.
Was Alvin anging, so wünschte sich dieser nichts als ein friedliches Leben als Großgrundbesitzer und Jäger. Er war nicht unfreundlich, wenn auch ein wenig langweilig. In seiner Art war Alvin von dem eifrigen, unermüdlichen Wissenschaftler, der sein Vater gewesen war, so weit entfernt, dass die Leute sich oft verwundert fragten, wie zwei so verschiedene Menschen überhaupt Vater und Sohn sein konnten.
Vielleicht hatten die Erfahrungen seiner Kindheit, die Jahre, die er mit seinem Vater in Italien und Kampanien herumgezogen war, Alvin dazu gebracht, sich danach zu sehnen, irgendwo Wurzeln schlagen zu können. Er wollte keine Abenteuer mehr erleben und keine Reisen mehr machen. »Und letztlich, Cousine Madeleine«, hatte Alvin gesagt, »warum soll ich für eine Saison nach London fahren, wenn ein Mädchen hier aus der Gegend am besten zu mir passt?«
Und so hatte er Miss Edsell geheiratet. Madeleine hatte Mrs. Pendleton geholfen, nach dem Hochzeitsfrühstück den Abwasch zu beaufsichtigen. Dann war sie nach oben gegangen, um zu packen.
Oh, Alvin hatte sie nicht gebeten, zu gehen. Genau genommen mochte er sie sogar - sie waren Cousin und Cousine zweiten Grades, und sie zudem seine Stiefmutter, seit er acht Jahre alt war. Und Alvin mochte auch Geoff sehr. Er war dem Jungen immer wohlgesonnen gewesen, soweit Madeleine es beurteilen konnte.
Bei Miss Edsell allerdings verhielt es sich anders. Madeleine hatte oft genug den Ausdruck in deren Augen gesehen, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind bald wehen würde. Außerdem sollte Geoff näher bei London wohnen. Der Dorfarzt war in diesem Punkt sehr beharrlich gewesen. Und sie selbst - nun, sie brauchte eine Veränderung. Eine Ablenkung. Eine Abwechslung oder eine Zerstreuung. Irgendwetwas. Irgendetwas, das sie den Klauen dieser hartnäckigen Niedergeschlagenheit entreißen würde, die sie seit so vielen Jahren plagte.
Also war jetzt London ihr Zuhause, auf Gedeih und Verderb. Und Madeleine fühlte sich ein wenig besser, nachdem sie Lady Treyhern kennengelernt und mit ihr über Geoff gesprochen hatte. Man sagte ihr eine große Erfahrung mit schwermütigen Kindern nach. Auf dem Kontinent hatte man sie sogar für eine Art Wunderwirkerin gehalten.
In diesem Moment kam Geoff aus dem Haus. Er streckte sich während des Gehens, als wären seine Knochen während der Nacht um ein, zwei Zentimeter gewachsen. Schließlich aß er mehr als genug, um solche Wachstumsschübe zu erklären.
»Guten Morgen, Mummy«, begrüßte er sie, ehe er ihr einen Kuss auf die Wange gab. »Du hast gut geschlafen?«
»Recht gut, mein Liebling«, erwiderte sie. »Und du siehst aus, als könntest du das auch von dir sagen.«
Er sah in der Tat ausgeruht aus. Madeleine empfand eine große Erleichterung, als er sich ihr gegenüber auf die Gartenbank fallen ließ. Als kleiner Junge hatte er angefangen, schrecklich unter Schlaflosigkeit zu leiden. Sie vermutete, dass es noch immer so war, auch wenn er im zarten Alter von zwölf Jahren begonnen hatte, es vor ihr zu verbergen.
Clara, das neue Hausmädchen, trug eifrig das Tablett mit dem Frühstück herbei, über das sich Geoff mit Appetit hermachte. Madeleine betrachtete ihn nachdenklich. Lieber Gott, er würde einmal sehr attraktiv aussehen! Schon jetzt reichte er ihr bis an die Schulter - und sie war für eine Frau recht groß. Aber Geoff hatte nicht ihr helles Haar. Madeleine wandte den Blick ab und schenkte ihm eine Tasse Tee ein.
»Ich habe Eliza gebeten, mir heute Morgen meine Wanderschuhe herauszustellen«, sagte sie. »Möchtest du noch immer spazieren gehen?«
Seine Augen strahlten. »Oh ja, ich möchte mir gern das Krankenhaus in Chelsea ansehen«, sagte er, und seine Stimme überschlug sich in kindlicher Aufregung. »Und ich will an der Themse entlanglaufen so weit es geht und mir die Handelsschiffe ansehen.«
Madeleine lachte über seine Begeisterung. »Ich glaube, die Themse fließt bis zum Meer, mein Liebling«, sagte sie. »Und die meisten Handelsschiffe werden eher flussabwärts zu finden sein. London ist eine sehr große Stadt. Aber vielleicht könnten wir die Kutsche nehmen?«
Geoff schüttelte den Kopf. »Dann heute nur das Krankenhaus«, sagte er. »Ich möchte mir es genau ansehen. Mr. Frost sagt, dass es von Sir Christopher Wren gebaut worden ist - genau wie St. Paul's.«
Sie hatten die St. Paul's Kathedrale in der ersten Woche ihres Aufenthaltes in Walham Green besichtigt. Geoff war von den hoch aufragenden Dächern und der puren Herrlichkeit des Ortes zutiefst beeindruckt gewesen. Sein Lehrer, Mr. Frost, hatte dem Jungen von all den Wundern Londons erzählt. Infolgedessen war Geoff wie besessen davon, alles in sich aufzusaugen, was ihn an Geschichte und Architektur umgab.
Madeleine hatte ihren Tee ausgetrunken und erhob sich. »Dann also in einer Viertelstunde«, sagte sie und ging zur Tür. »Bist du bereit?«
Ihr Spaziergang durch Chelsea bot den beiden nur wenig Herausforderung, waren sie doch daran gewöhnt, durch die Yorkshire Dales zu wandern. Sie verbrachten gute zwei Stunden damit, die Umgebung des Krankenhauses zu erkunden und die Sonne zu genießen, die warm auf ihre Gesichter schien. Danach gingen sie über den Cheyne Walk zurück und bewunderten den Blick auf die Themse und die schönen Häuser, die ihre Ufer säumten.
»Schau, Mummy!«, sagte Geoff, als sie zur Oakley Street kamen. »Schau dir dieses schmiedeeiserne Tor an! Mr. Frost sagt, dass die Häuser von Chelsea berühmt sind für ihre wunderbaren Schmiedeeisenarbeiten. Ich weiß! Vielleicht können wir uns hier ein Haus kaufen? Es würde mir gefallen, jeden Tag den Fluss zu sehen.«
Madeleine lachte. »Wir haben doch schon ein Haus gekauft, Geoff«, erwiderte sie. »Genauer gesagt, wir haben zugesagt, es zu tun, was dasselbe ist. Und du wirst aus der oberen Etage den Fluss sehen können.«
»Wirklich?«
»Ich kann es dir heute Nachmittag zeigen«, schlug sie vor. »Ich habe vor, mich dort umzusehen und mir Gedanken über Farben und Vorhänge zu machen.«
Er zog die Nase kraus. »Nein, vielen Dank, Mummy!«
Madeleine lächelte nachsichtig. »Na gut«, sagte sie. »Zur Strafe werde ich dein Zimmer dunkelbraun streichen lassen. Oder violett. Oder vielleicht orange? Aber es ist fast Zeit fürs Mittagessen. Wie wollen wir nach Hause gehen? Schau, da vorn ist die Beaufort Street. Ich glaube, sie führt zum King's Highway. Der Weg könnte am besten sein.«
»Dann also dort entlang«, stimmte Geoff gutmütig zu. »Aber wir müssen uns beeilen, Mummy. Jetzt, da ich daran denke, bekomme ich schon wieder Hunger.«