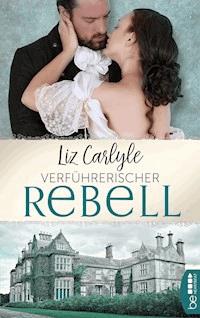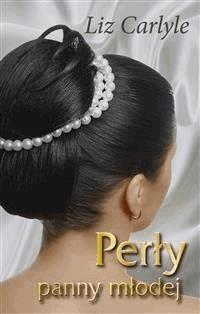4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rutledge Family
- Sprache: Deutsch
Wie ein wahrer Gentleman das Herz einer Lady erobert
Um sich von der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann abzulenken, reist die junge Witwe Lady Catherine nach London. Bei einem Ausritt im Park begegnet ihr der Polizist Max de Rohan und bringt mit seinem rauen, unnahbaren Charme ihr Herz zum Schmelzen. Als er sie mit einem skandalösen Kuss vor einer Gefahr schützt, ist es um die Lady geschehen. Zwar würde sich kein wirklicher Gentleman so verhalten - doch der attraktive Max lässt sie bald vergessen, dass er gesellschaftlich nicht angesehen ist. Ein Mordfall führt die beiden noch enger zusammen, und Catherines Gefühle für den unstandesgemäßen Polizisten werden immer leidenschaftlicher ...
Der nächste historische Liebesroman aus der Rutledge-Family-Reihe als eBook bei beHEARTBEAT: "Verführerischer Rebell".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Geschichtlicher Hintergrund
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Verloren in deiner Sehnsucht
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Wie ein wahrer Gentleman das Herz einer Lady erobert
Um sich von der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann abzulenken, reist die junge Witwe Lady Catherine nach London. Bei einem Ausritt im Park begegnet ihr der Polizist Max de Rohan und bringt mit seinem rauen, unnahbaren Charme ihr Herz zum Schmelzen. Als er sie mit einem skandalösen Kuss vor einer Gefahr schützt, ist es um die Lady geschehen. Zwar würde sich kein wirklicher Gentleman so verhalten – doch der attraktive Max lässt sie bald vergessen, dass er gesellschaftlich nicht angesehen ist. Ein Mordfall führt die beiden noch enger zusammen, und Catherines Gefühle für den unstandesgemäßen Polizisten werden immer leidenschaftlicher …
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck – auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
VERBOTENESBEGEHREN
Aus dem amerikanischen Englisch vonNicole Friedrich
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002 by Susan Woodhouse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »No true Gentleman«
Originalverlag: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Goodsouls | javarman3; © hotdamnstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5516-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
»Gebt mir tugendhafte Handlungen, und ich werde nicht mit den Motiven hadern.«
Lord Chesterfield, 1776,The Fine Gentleman’s Etiquette
April 1826
Sie war nun eine alte Frau. Viele glaubten gar, sie sei bereits betagt zur Welt gekommen und schon in Bombasin und altertümliche schwarze Spitze gehüllt dem Schoße der Toskana entsprungen, und waren davon überzeugt, dass ihr Starrsinn, ihr Rosenkranz und ihr Temperament – Letzteres konnte ausgesprochen hitzig sein – sie seit jeher knechteten. Sofia Josephina DiBiase Castelli hatte bereits drei Ehemänner, ihre heiß geliebte Tochter und – so hatte es zuweilen den Anschein – ihren Enkelsohn zu Grabe getragen.
Sie hatte viel von der Welt gesehen, hatte sich in Paris verliebt, war in Florenz vor den Altar getreten und lebte nun in London, wo sie alt, weise und müde geworden war. Einst jedoch, vor unzähligen Lenzen, war auch sie einmal jung und gänzlich von romantischen Gefühlen erfüllt gewesen, genau wie jene verzückt dreinschauenden Verliebten, die am Sonntagnachmittag über den Platz vor ihrem Hause schlenderten. Doch sie war längst noch nicht so betagt, als dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wäre, nagende Einsamkeit zu erkennen, wenn diese andere quälte.
Die schweren Samtvorhänge vor den Fenstern des geräumigen Speisezimmers der Signora Castelli sorgten dafür, dass kein Strahl der Nachmittagssonne in den Raum drang, und obwohl außerhalb der dicken Mauern ihres Stadthauses der Frühling sein blaues Band flattern ließ, prasselte im Kamin ein stattliches Feuer. Die alte Dame saß majestätisch steif in ihrem schwarzen hochlehnigen Stuhl an der Speisetafel. Mit der Tatsache, dass ihre Hände immerzu eisig waren, hatte sie sich längst abgefunden. Mit dem Sturm in ihrem Herzen hingegen, der vom Scheitern ihrer Pläne herrührte, wollte und konnte sie sich nicht würdevoll arrangieren. Deshalb hoben ihre von Gicht gezeichneten Finger nun nacheinander die Deckel der vier kleinen, kunstvoll gearbeiteten Tiegel, die vor ihr standen.
»Erde, Wasser, Wind und Feuer«, murmelte die alte Frau, als sie jedem der Behältnisse eine Prise entnahm und in eine prunkvoll verzierte Messingschale warf, die sich ebenfalls auf dem Tisch befand.
Im Schatten des Raumes weilte noch eine zweite Frau, die einen recht verzagten Eindruck machte.
»Maria!«, rief Signora Castelli mit einem herrischen Fingerschnippen. »ITarocchi! Bring sie her!«
Die Frau im Dunkeln machte einen Knicks. »Subito, Signora Castelli.« Als sie aber die kleine Doppeltür der Anrichte öffnete, tat sie dies mit sichtlichem Widerwillen, und ihre Hände zitterten, als sie eine kleine aus Ebenholz geschnitzte Truhe mit angelaufenen Kupferbeschlägen zum Vorschein brachte.
Mit einem dumpfen Geräusch stellte Maria das Kästchen auf dem Tisch ab, ohne es jedoch loszulassen. »Signora Castelli«, flüsterte sie zögerlich. »Halten Sie das wirklich für eine gute Idee?«
Die Augen der betagten Dame wurden hart und schmal. »Ich bin alt, Maria«, rief sie bedeutungsvoll aus. »Mein Enkelsohn lässt mir keine andere Wahl. Er wird heiraten, und seine Ehefrau wird mir unter diesem meinem Dach Urenkel gebären, und zwar noch bevor ich das Zeitliche segne!« Bei jeder Silbe zeigte sie mit ihrem verknöcherten Zeigefinger auf das Porträt, das über dem Kamin hing.
Marias skeptischer Blick sprach Bände. »Sie müssen verzeihen, Signora, doch Maximilian ist längst kein junger, unschuldiger Bursche mehr.«
»Scusa, Maria, aber du hast selbst miterlebt, wie die Frauen ihn anschauen.«
Maria senkte den Blick auf das schwarze Kästchen, das vor ihr stand. »Si, doch Vater O’Flynn …«
»… hat sich eine neue Barutsche zugelegt«, zischte die Signora, »die mit meinem Geld bezahlt wurde. Er wird mir also keine Probleme bereiten. Und außerdem, Maria, spricht die Heilige Mutter auf vielen Wegen zu uns, aber auf dem Ohr bist du ja taub.«
Mit geschürzten Lippen stieß Maria das Holzkästchen von sich, als wäre es in Flammen aufgegangen.
Liebevoll nahm Signora Castelli es entgegen und entnahm ihm ein in schwarze Seide gehülltes Bündel. Mit flinken Bewegungen riss sie den Stoff herunter und legte einen dicken Stapel Karten frei, der – im Gegensatz zu seiner Besitzerin – mit dem Alter weiche Züge angenommen hatte. Die Karten in der rechten Hand haltend, griff die Signora mit der anderen nach einer der Kerzen und tauchte sie in die Messingschüssel, sodass die getrockneten Kräuter darin Feuer fingen und weiße Rauchspiralen schlängelnd emporstiegen. Als Nächstes wedelte sie die Karten theatralisch durch den aufsteigenden Rauch.
»Erde, Wasser, Wind, Feuer«, wiederholte sie feierlich. »Alles muss bereinigt werden.«
Allmählich löste sich der Rauch auf, und sie schwenkte die Karten noch drei Mal zu ihrer Rechten, bevor sie sie behände in Form eines Kreuzes vor sich austeilte. Ihre Hand eilte zur mittleren Karte, blieb jedoch einige Sekunden drüber schwebend stehen, bevor sie sie umdrehte. »Dio mio«, flüsterte die Alte.
Begierig beugte Maria sich nach vorn. »Il Re di Spade«, raunte sie ehrerbietig. »Der König der Schwerter. Das ist Maximilian, nicht wahr?«
Die alte Dame schaute ihre Gefährtin gereizt an. »Si, Cousine. Jetzt möchtest du wohl doch zuschauen, oder wie?«
Verlegen rückte Maria sich einen Stuhl zurecht und nahm Platz. Signora Castelli widmete sich sogleich wieder den Karten und drehte mit schnellen Bewegungen die nächsten drei um. Maria stieß einen kurzen Schrei aus und wich zurück. »Nerone!«, zischte sie. »Ach, du Gütiger! Wer ist dem Tode geweiht?«
»Niemand, du dummes Ding«, schalt die alte Dame sie, bevor sie drei weitere Karten umdrehte. Beim Anblick der zuletzt aufgedeckten Karte schnellten ihre Augenbrauen in die Höhe. »Nun … vorerst niemand.« Ihre Finger strichen kurz über jede der Karten. »Aber etwas Teuflisches liegt in der Luft. Ein blonder Mann mit verdorbenem Herzen. Betrug. Verrat. Doch nicht hier, nicht in diesem Hause.« Die letzten Worte hatten recht hochnäsig geklungen.
Als sie eine weitere Karte umdrehte, bekreuzigte sie sich mit einem Raunen. »Maria, hier haben wir schon die Antwort: Eine Frau schwebt in höchster Gefahr – die Königin der Kelche.« Mit ihrer schrumpeligen Fingerspitze tippte sie auf die angesprochene Karte. »Eine Vase voller Schlangen, ein Herz voller Habgier. Ich kenne sie nicht, dem Herrn sei Dank.« Sie stieß ein leises »tss-tss« aus und studierte anschließend die angrenzenden Karten. »Eine Schande, wahrhaftig, eine Schande!«
»Was denn?«
Die alte Dame schüttelte traurig den Kopf. »Sie ist verdammt, Maria, denn ihre Habgier wird sie teuer zu stehen kommen«, erläuterte sie und drehte feierlich die Karte der Fünf Stäbe um. »Hier. Siehst du?«
»Aber was ist denn nun mit Maximilian?«, fragte Maria flehentlich und beugte sich erneut vor. »Was hat das alles mit ihm zu tun?«
Die alte Dame zuckte mit den Schultern, die in steife schwarze Seide gehüllt waren. »Das Böse nähert sich meinem Enkel. Diese Frau hier stellt … eine gewisse Gefahr dar.« Bedächtig verfolgte sie mit der Fingerspitze die einzelnen Karten zurück. »Mehr kann ich momentan nicht erkennen.« Maria stieß einen Seufzer aus, und Signora Castelli drehte die nächste Karte um. »Aha!«, rief sie aus. Ihre Laune hatte sich schlagartig gebessert. »Schau mal, Maria. Siehst du hier? La Regina di Dischi. Nun kommt sie doch noch! Alles, was wir uns immer gewünscht haben, ist in greifbare Nähe gerückt. Si, ich habe es gewusst, habe gespürt, dass die Zeit reif ist!«
»Die Königin der Pentakel?«, sinnierte Maria. »Diese Karte haben Sie doch noch nie umgedreht …«
Signora Castelli unterbrach sie mit einem ungeduldigen Zischen. »Weil sie sich bis jetzt noch nie gezeigt hat.«
Maria blickte zur Signora auf. »Wer ist sie?«
Die alte Dame lächelte kaum merklich in sich hinein. »Sie ist die Eine welche, Maria. Die Mutter der Erde. Sie ist alles in einer Person – Warmherzigkeit und Sinnlichkeit, Wahrhaftigkeit und Güte. Schau selbst …« Signora Castelli unterbrach sich, um auf die Karte mit der Königin zu tippen. »Sie hält die Mysterien der Natur in ihrer Hand. Aber dabei das Gleichgewicht nicht zu verlieren, stellt sich als eine schwierige Angelegenheit für sie dar, denn in ihrem Herzen wohnen zugleich gewaltige kosmische Disharmonien – das spüre ich deutlich.«
Sie hielt inne und zog ihre dichten schwarzen Augenbrauen nachdenklich in die Höhe, bevor sie die verbliebenen Karten umdrehte. Es waren ausschließlich Pentakel. Plötzlich ruckte ihr Kopf in die Höhe, und mit kecken und agilen Augen fing sie Marias Blick ein. »Che la fortuna ci assista! Schnell, schnell, wo ist mein Rosenkranz?«
Maria lehnte sich vor und zog ihn aus der Tasche des Kleides der alten Damen hervor. »Was haben Sie noch gesehen, Signora? Was gedenken Sie, nun zu unternehmen?«
»Jetzt kann ich nur noch beten.« Die alte Frau hielt die Perlen zwischen ihren Händen und hob sie Maria zitternd vors Gesicht. »Sie ist uns nah, sehr nah sogar. Aber das Böse ist noch viel näher. Wir müssen dafür beten, dass Maximilian nicht mit ihm in Berührung kommt und dafür, dass diese Frau, la Regina di Dischi, uns unversehrt in die Arme läuft. Denn nur dann können wir in Angriff nehmen, was getan werden muss.«
Kapitel 1
»Ein wahrer Gentleman sollte stets darauf bedacht sein, niemals düster und geheimnisvoll zu wirken.«
Lord Chesterfield, 1776,The Fine Gentleman’s Etiquette
Tragische Unfälle können all jenen zustoßen, die sich auf unbekanntes Terrain hinauswagen, das wusste Catherine nur zu gut. Dennoch gab ihr der gräuliche und dichte Nebel, der sich vor ihr ausbreitete, nicht zu denken. Sie preschte achtlos weiter und ließ zu, dass die Feuchtigkeit sich wie nasskalte Wolle um sie legte. Orions schnelle Hufschläge wurden durch die weiche Erde gedämpft, als sie ihn blindlings auf eine Rhododendronböschung zusteuerte.
Ihr Verhalten in jüngster Zeit fußte nicht mehr auf Logik, sondern auf dem unerklärlichen Bedürfnis, vor etwas Vergangenem zu fliehen, ohne dabei auch nur eine Sekunde an die Gefahren zu denken, die möglicherweise vor ihr lauerten. Sie hatte es zugelassen, dass Kummer und Verwirrung sie aus Gloucestershire hatten fliehen lassen und sie nach London geführt hatten. Aber vielleicht hätte sie es unterbinden sollen, dass ihre Sorgen sie nun auch noch mutterseelenallein in den dichten Nebel trieben. Vielleicht hätte sie besser daran getan, erst am helllichten Tage und nicht schon vor Sonnenaufgang in die entfernten Ausläufer des Hyde Parks zu galoppieren. Doch wie die vielen Male zuvor hatte sie die erdrückende Stille im Haus – und in ihrem Herzen – nicht mehr ausgehalten.
Ungeduldig spornte sie Orion an und dachte nur flüchtig daran, dass ihr Bruder Cam – würde er je von ihrer Leichtsinnigkeit erfahren – übelst mit ihr schimpfen würde.
Plötzlich ertönte im Nebel vor ihr ein Geräusch. Es klang schrill und gedämpft zugleich, so als berste ein Zweig unter einer Schicht nasser Blätter.
Und dann sah sie ihn – im selben Moment, in dem auch Orion ihn erspähte. Wie ein heidnischer Zauberer, der das Feuer eines Drachens heraufbeschwor, ragte er hünenhaft vor ihr auf. Sein langer schwarzer Mantel flatterte im Nebel, seine riesige Gestalt versperrte ihr die Sicht auf den Weg hinter ihm.
Mit einem schrillen Wiehern bäumte Orion sich auf und drehte, wild mit den Hufen in den Nebel schlagend, nach rechts ab. Fast schwebend kam der Hüne näher, packte den Wallach beim Geschirr und zog seinen Kopf in die Tiefe, ganz so, als hätte er es lediglich mit einem störrischen Pony zu tun. Orion verdrehte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, und seine Hinterläufe schlugen derart unruhig aus, dass er Rasenstücke aufwarf. Mit stoischer Ruhe hielt der Fremde den Kopf des Pferdes fest. Schließlich schnaubte Orion ein letztes Mal verächtlich und fügte sich.
Einen unbehaglichen Moment lang herrschte absolute Stille.
»Entschuldigen Sie vielmals, Madam«, setzte der Fremde mit rauer Stimme an. »Ich fürchte, der Nebel hat die Geräusche Ihres Herannahens gedämpft.«
Catherine schaute auf ihn hinab und ließ ihren Blick zu seinen Händen wandern, die das Zaumzeug eisern festhielten. »Ich habe mein Pferd bestens unter Kontrolle, Sir«, fuhr sie ihn an, wobei sie sich nicht erklären konnte, warum ihr urplötzlich das Blut in den Ohren rauschte.
Blitzschnell drückte sie ihr Rückgrat durch und beobachtete bewundernd, wie seine langen und eleganten Finger vom Zaumzeug glitten. »Ich dachte, dem sei vielleicht nicht so«, entgegnete er mit unterkühlter Stimme und brennendem Blick. »Aber augenscheinlich habe ich mich getäuscht.«
»Das haben Sie in der Tat«, brachte sie mühsam hervor.
Blankes Misstrauen stand dem Fremden ins Gesicht geschrieben, als er seinen Blick den Teil des Weges, der trotz des Nebels erkennbar war, hinauf- und hinunterwandern ließ. Catherine beschlich das sonderbare Gefühl, er könnte Dinge sehen, die ihr verborgen blieben. »Madam, reiten Sie etwa ohne Begleitung?«, erkundigte er sich betont lässig.
Schlagartig wurde Catherine das Ausmaß ihrer Torheit bewusst. Sie befand sich mutterseelenallein mit einem kräftigen und Angst einflößenden Fremdling inmitten dieses undurchdringlichen Nebels. Schnell richtete sie sich noch ein wenig weiter auf und blickte auf den Fremden herab, wobei sie den wütenden Blick ihres älteren Bruders nachahmte. »Meine Angelegenheiten gehen nur mich etwas an, Sir«, erwiderte sie spitz. »Aber wenn wir schon einmal dabei sind, das Kind beim Namen zu nennen, so möchte ich gern darauf zu sprechen kommen, dass Sie hier unvorsichtigerweise mitten auf dem Reitweg herumlungern.«
Für einen flüchtigen Moment schien Zustimmung in seinen Augen aufzuflackern, bevor er sie mit einem befremdlichen Seitenblick bedachte. »Wie dem auch sei, dies ist kein Ort, an dem eine Lady sich ohne Begleiter aufhalten sollte.«
Zu ihrem Verdruss musste Catherine sich eingestehen, dass er Recht hatte. Geschwind musterte sie ihn: Der Mann war hager und dunkel, musste aber jünger sein, als er auf den ersten Blick wirkte, wenngleich die Zeit bereits deutliche Spuren in seinem Gesicht hinterlassen hatte. Seine Augen zeichneten sich eher durch Scharfsinnigkeit als durch Freundlichkeit aus, und aufgrund seiner hohen Wangenknochen, die sein Gesicht kantig wirken ließen, war er nicht unbedingt das, was man landläufig als attraktiv bezeichnete. Dennoch verströmte er etwas … Fesselndes. O ja! Und seltsam, sprach er nicht mit einem leichten Akzent? Deutsch? Italienisch? Aber das war eigentlich nicht weiter wichtig. Obgleich er einen schweren, am Knauf versilberten Spazierstock bei sich führte und seine dunkle Kleidung mit sichtlicher Anmut trug, war auf den ersten Blick zu erkennen, dass er kein leibhaftiger englischer Gentleman sein konnte. Dafür wirkte er viel zu gefährlich.
Der Fremde schien gehört zu haben, wie sie sanft und tief eingeatmet hatte, und fing mit seinen kalten und harten Augen ihren Blick ein. »Treten Sie unverzüglich den Heimweg an, Madam«, befahl er streng. »Der Hyde Park ist um diese Zeit kein sicherer Ort.«
Catherine wusste nicht, warum sie noch zögerte. »Ich muss schon sagen, Sie haben mich ziemlich erschreckt«, überging sie seine Aufforderung und hob dabei absichtlich die Augenbrauen. »Lungern Sie immer im Nebel herum?«
Unruhig warf Orion den Kopf hin und her. Mit einem fremdländischen Fluch packte der Fremde ihn erneut am Zaumzeug. »Verzeihen Sie mir, Madam, aber mein Herumlungern hat Sie nicht im Geringsten zu interessieren«, gab er barsch zurück. »Dagegen dürfte es für Sie jedoch sehr wohl von Bedeutung sein, dass der schlimmste Abschaum Londons zu dieser frühen Stunde noch nicht in den Federn liegt.«
Catherine erkannte, dass er es ernst meinte, und ließ ihren Wallach einen Schritt zurückweichen, bevor sie zustimmend das Haupt senkte. »Vielleicht haben Sie sogar Recht, Mr ….«
Mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck zog sich der Unbekannte den Zylinder vom Kopf und machte eine anmutige, wenn auch taktlose Verbeugung, die gänzlich … unenglisch war. Und dann, so schnell wie er aufgetaucht war, schritt er an ihr vorbei und verschwand mit wehenden Frackschößen im Nebel.
Erst jetzt entdeckte Catherine das riesige schwarze Tier, das ihm dicht auf den Fersen folgte. Obwohl sie auf dem Rücken eines Pferdes saß, musste sie den Blick nicht weit nach unten lenken, um auf das Tier zu schauen, so groß war es. Ein Hund …? Gütiger Gott! Sie betete, dass es wirklich ein Hund gewesen war.
Ein wenig aufgewühlt von der eigenartigen Begegnung mit dem seltsamen Mann, musste Catherine sich eingestehen, dass sich ihr Wunsch, der städtischen Enge zu entfliehen, plötzlich in Luft aufgelöst hatte. Deshalb beschloss sie, der Anweisung des Fremden – und es war unmissverständlich eine solche gewesen – Folge zu leisten. Aus seiner barschen Art und Weise, mit der er sie angewiesen hatte, den Park zu verlassen, schloss Catherine, dass er mit einer autoritären Rolle bestens vertraut war.
Nachdem sie einige Minuten lang auf dem sich windenden Pfad zurückgetrottet war, lenkte sie Orion scharf nach links auf eine Anhöhe. Sie ließ die Bäume hinter sich und befand sich auf einem weitläufigen grünen Areal. Hier oben hatte sich das trübe Morgenlicht des Spätapriltages bereits seinen Weg durch die Wolkendecke gebahnt, und Catherine bot sich ein guter Blick auf den weiteren Verlauf des Weges. Da – jetzt kam der Fremde wieder in Sichtweite. Er weilte auf einer Erhebung im Nordwesten und hatte sich elegant auf seinen Gehstock gestützt. Seine ernsten Augen folgten ihr, als sie sich wieder in Bewegung setzte und in Richtung Oxford Street ritt.
Sein wachsamer Blick hätte ihr eigentlich ein unangenehmes Gefühl bescheren müssen, aber das Gegenteil war der Fall. Es war seltsam beruhigend zu wissen, dass er sie im Auge behielt. Fast schien es, als hätte er noch gewartet, um sicherzugehen, dass ihr ja nichts zustieß. Vielleicht hatte er sogar gehofft, noch einmal mit ihr ins Gespräch zu kommen.
In diesem Punkt jedoch irrte Catherine gewaltig. In dem Moment, in dem sie in Sichtweite gekommen war, hatte er sich auf den Fußpfad zurückbegeben und war entschlossenen Schrittes in die entgegengesetzte Richtung davongeeilt. Erst im allerletzten Augenblick war er noch einmal stehen geblieben und hatte zu ihr zurückgeschaut. Catherine senkte zum Dank den Kopf und hob ihre behandschuhte Hand.
Der Fremdling jedoch erwiderte ihre Geste nicht.
Kaum eine Meile entfernt hatte sich das Tageslicht noch nicht seinen Weg über die hohen Dächer der Princes Street gebahnt. Im Kamin von Lord Sands’ Salon kämpfte ein unlängst entfachtes Feuer tapfer gegen die Feuchtigkeit an. Die Stille des Raumes wurde nur durch das Zischen der Kohlen und das dumpfe Ticken der Standuhr unterbrochen, die zwischen zwei mit schweren Vorhängen beladenen Fenstern stand. In einem Sessel dicht beim Kamin lümmelte sich Harry Markham-Sands – oder besser gesagt, der Earl of Sands, wie es richtig lauten musste –, der aufgrund seines rötlichen Teints, seiner hohen Stirn und seines kleinen Bäuchleins die vollendete Verkörperung des Landadels darstellte.
Die Stimmung im Salon war alles andere als gut. Schon eine halbe Ewigkeit lang gebärdete Lord Sands sich ausgesprochen griesgrämig. Vor allem seine Schwester Cecilia hatte aufgegeben, darüber zu sinnieren, wann er so unausstehlich geworden war. Eine weniger erbarmungsvolle Frau hätte einen Miesepeter wie Harry mit einem Schulterzucken und der Erklärung abgetan, er hätte sein Unglück selbst zu verantworten. Für gewöhnlich erbarmte Cecilia sich seiner, doch heute schmerzten sowohl ihre Füße als auch ihr Rücken, und aus ihren Brüsten ergoss sich ein beständiger Strom Muttermilch, weshalb acht lange Jahre der Geduld endlich ihren Tribut forderten.
»Harry!«, verkündete sie, während sie unruhig im Salon auf und ab lief. »Du hast dein Unglück selbst zu verantworten!«
Harrys einzige Reaktion bestand darin, einen silbernen Flachmann aus der Tasche seines Morgenmantels hervorzuholen. »Das habe ich mir redlich verdient«, ließ er gleichmütig verlauten und dirigierte seine zitternde Hand in Richtung Kaffeetasse.
Wie ein Falke, der eine Feldmaus im Visier hatte, beugte Cecilia sich blitzschnell von hinten über ihn und entriss ihm den Flachmann. »Mensch, Harry, das hilft uns kein bisschen weiter! Den jüngsten aller Skandale wirst du nicht im Alkohol ertränken.«
Die Röte in Harrys Gesicht wurde eine Spur dunkler. »Das is’ kein Skandal, Cely.« Die Worte noch nicht hingen unausgesprochen in der Luft.
»Deine Gattin ist die reinste Verkörperung eines Skandals, Harry!«, machte Cecilia ihm unmissverständlich klar. »Aber als du auch noch gedroht hast, sie über die Balustrade deiner Theaterloge zu befördern, hast du zusätzliches Öl ins Feuer gegossen.«
Bedächtig fuhr Harry sich mit den Fingerknöcheln über sein raues, zerkratztes Gesicht. »Das hatte ich doch nich’ wirklich vor!«
Cecilia jedoch kannte kein Erbarmen. »Wie viel hattest du eigentlich getrunken, Harry?«, wollte sie wissen und wedelte dabei mit dem Flachmann, den sie zwischen zwei Fingern hielt. »Hat Julia versucht, dir an Ort und Stelle das Fell über die Ohren zu ziehen, oder hat sie damit gewartet, bis ihr alles im Foyer ausdiskutieren konntet?«
Harry verschränkte die Arme vor der Brust und sank tiefer in den Sessel. »Niemand hat uns gehört, Cely«, murmelte er. »Na ja, abgesehen von den Herrschaften in den Nachbarlogen.«
Gedemütigt sank Cecilia in einen mit Gold beschlagenen Sessel, der dem ihres älteren Bruders gegenüberstand. »O Harry«, flüsterte sie und verbarg ihren Kopf in den Händen. »Wir sprechen hier über die Crème de la crème der Gesellschaft, mein Lieber. Ein einziger Zeuge eures Debakels reicht da völlig aus. Mir ist bereits heute früh zugetragen worden, dass … Und das schon kurz nach Sonnenaufgang!«
»Ich bin eine Schande für dich«, stammelte Harry kleinlaut. »Für dich und für Delacourt.«
Bei diesen Worten hob Cecilia den Kopf und blickte zu ihm. »O Harry! Meine Besorgnis gilt doch nicht David und mir«, bekundete sie schwermütig, »sondern einzig dir!«
Verdrossen schüttelte Harry den Kopf. »Zu spät, Cely, schließlich habe ich diese Frau ja auch noch geehelicht. Schon seit Jahren setzt das Biest mir Hörner auf, und halb London ahnt es. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, da sie so unverfroren offen damit umgeht, ist, die Scheidung einzureichen. Damit drohe ich ihr übrigens schon seit Monaten.«
Gedankenverloren kaute Cecilia am Fingernagel ihres Daumens. »Das könnte funktionieren, Harry«, meldete sie sich zu Wort. »Aber es wird alles andere als einfach werden. Dein Einfluss im Parlament ist eher gering, und es gibt dort zu viele so genannte Gentlemen, die nicht wollen, dass Namen ins Spiel gebracht werden – wenn du verstehst, was ich meine.«
»Oh«, entfuhr es Harry leise. »Daran habe ich noch gar nich’ gedacht.« Er fuhr sich durch seine ohnehin schon vollkommen zerzausten Locken. Armer Harry! Er war nicht gerade das hellste Juwel in der Familienkrone.
Voller Tatendrang rutschte Cecilia auf die Sesselkante und stellte den Flachmann neben sich ab. »Hör mal, Harry, warum löst du nicht einfach den Mietvertrag für dieses Haus und schleifst sie zurück nach Holly Hill oder … streichst ihr das Haushaltsgeld? Sapperlot, sie hat dir noch nicht einmal einen Erben geschenkt.«
Bei den letzten Worten hatte Harry höhnisch gegrinst. »Nein, und dazu wird sie auch keine Gelegenheit mehr bekommen«, gelobte er feierlich. »Ich kann ihr nämlich keinen Zoll über den Weg trauen, und ehe ich mit ansehen muss, dass mein Titel an den Bastard eines fremden Mannes geht, werde ich verdammt noch mal dafür sorgen, dass er Onkel Reggie zufällt. Julia gefügig zu machen, ist ebenso sinnlos wie der Versuch, mit einem Sieb Wasser zu schöpfen. Und was Julias Finanzen betrifft: Ihr Taschengeld ist fast höher als meine gesamten Einkünfte, dafür hat sie mit einer Klausel im Ehevertrag gesorgt.«
Cecilia fluchte etwas ausgesprochen Undamenhaftes und händigte ihrem Bruder den Flachmann wieder aus.
Mit einem gequälten Lächeln nahm er ihn entgegen, goss sich einen großzügigen Schluck in den Kaffee und hob einladend die Augenbrauen. Für einen flüchtigen Moment geriet Cecilia in Versuchung, schüttelte dann aber den Kopf und führte sich den unverdünnten Kaffee an die Lippen. Sie nahm jedoch nur einen winzigen Schluck, bevor sie die Tasse wieder bedächtig abstellte. »Harry, mit wem ist sie denn dieses Mal im Bunde? Lord Bodley? Mr. Vost? Oder einem der anderen?«
Missmutig schüttelte Harry den Kopf. »Konnte ich nicht genau erkennen. Die Kutsche trug keine Insignien.«
»Mist! Was für ein Pech!«
Schweigend tranken die Geschwister ihren Kaffee, bevor Cecilia sich erhob und sich anschickte zu gehen. Mit ernstem Blick schaute sie ihrem Bruder in die Augen. »Nun Harry, David und ich werden dir immer beistehen, egal, was auch passieren mag. Das weißt du doch hoffentlich, oder?«
Harry nickte stumm.
Cecilia legte eine Hand auf seine stoppelige Wange. »Mein Mann wird schon bald aus Derbyshire zurückkehren,« sagte sie und streichelte Harry. »Ich werde ihn direkt fragen, was wir gegen Julia unternehmen können. David wird bestimmt etwas einfallen, wie wir sie am besten in die Schranken weisen können, davon bin ich mehr als überzeugt.«
Beim Gedanken an seinen unbarmherzigen Schwager besserte sich Harrys Laune schlagartig. Einem spontanen Impuls folgend, stellte Cecilia sich auf die Zehenspitzen und drückte ihrem Bruder einen Kuss auf die Wange. Sehr zu ihrer Überraschung packte dieser sie daraufhin fest bei den Schultern und grub seine Finger mit einer Verzweiflung in ihre Haut, die seine Stimme zuvor nicht hatte erahnen lassen.
»Alles wird gut, Harry«, flüsterte sie dicht an seinem Ohr. »Bestimmt sogar. Das verspreche ich dir.« Aber gerade, als sie ihre Lippen von den warmen Wangen ihres Bruders löste, zerriss ein gellender Schrei die Stille des Hauses, und Cecilia wurde schlagartig klar, dass sie sich geirrt hatte – gewaltig geirrt hatte. Nichts würde je wieder gut werden.
Nur einen Steinwurf südlich der Princes Street, in einem der hohen Backsteinhäuser am Berkley Square, entfaltete sich ein weitaus angenehmeres Morgenszenario. Um halb zehn hatte die eifrige Isabel, Lady Kirton, bereits ihren Liebhaber mit einem Kuss verabschiedet, ihre Kamine fegen, sämtliche Vorhänge aufziehen und das Frühstück im kleinen Speisezimmer servieren lassen. Ferner hatte sie längst die Order gegeben, zu diesem Morgenmahl ihre Nichte aus der Mortimer Street abzuholen.
Erfüllt von einem behaglichen Gefühl und gestärkt durch ihre mütterlichen Absichten, schaute die überaus achtbare Isabel nun über die morgendliche Tafel hinweg auf Lady Catherine Wodeway, die etwas zu heftig mit Messer und Gabel ihren Frühstücksspeck bearbeitete. Unauffällig gab Lady Kirton ihren Bediensteten das Zeichen zum Rückzug.
»Ich bin ja froh«, setzte sie behutsam an, »dass du doch endlich der Bitte einer armen und nicht mehr ganz jungen Frau nachgekommen bist und hierher in die Stadt gekommen bist, Catherine.«
Verzweifelt gab Catherine sich im Kampf gegen den knusprigen Speck geschlagen. »Ist das der Grund, warum ich hier bin?«, hakte sie nach und ließ sowohl die Gabel als auch die Augenbrauen in die Höhe wandern. »Um für die Belustigung meines schrulligen Tantchens zu sorgen?«
Lady Kirton lachte leise auf. Es war ein helles, mädchenhaftes Lachen, das im Kontrast zu ihrer matronenhaften Figur und ihrem silbrigen Haar stand. »Ich möchte, dass du für die Dauer der gesamten Saison bleibst, meine Liebe«, bat sie Catherine nachdrücklich. »Seitdem meine Tochter nach Indien abgereist ist, bin ich so schrecklich einsam.«
Catherine warf ihrer Tante einen fragenden Blick zu. »Aber du hast doch Colonel Lauderwood.«
Lady Kirton schaute auf die Teetasse vor sich. »Ach, weißt du, Jack interessiert sich eigentlich nur für seine Vereine und den Militärclub. Für vornehme Gesellschaft hat er nichts übrig.«
»Ganz im Gegensatz zu dir, oder wie?«
»Fürwahr, und wie!« Lady Kirton lächelte verschmitzt. »Schon seit Ewigkeiten freue ich mich auf die vielen Bälle, Soireen und Ausflüge dieser Saison. Die darf man einfach nicht verpassen!«
Jetzt lachte Catherine auf. »Was für ein Humbug!«, erklärte sie, legte die Gabel beiseite und blickte in die großen blauen Augen ihrer Tante. »Du hast dich doch in deinem ganzen Leben noch nie auch nur ein Fünkchen für den gesellschaftlichen Trubel interessiert.«
Nach einem langen Moment der Stille lehnte Lady Kirton sich nach vorne. »Meine liebe Catherine«, setzte sie mit gedämpfter Stimme an. »Will war der Sohn meiner Schwester, und auch ich habe ihn fest in mein Herz geschlossen. Aber du kannst doch nicht für den Rest deines Lebens verwitwet bleiben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dir das zusagt.«
Catherine spürte, wie zarte Röte ihre Wangen erwärmte. »Nein, das tut es in der Tat nicht, aber der Gedanke daran, auf den Heiratsmarkt geschubst zu werden oder mich ständig in piekfeiner Gesellschaft tummeln zu müssen, schreckt mich regelrecht ab.«
Lady Kirton ließ ihre Handflächen in einer verzweifelten Geste gen Himmel wandern. »Meine Liebste, nenn mir auch nur eine Alternative.«
»Aber Isabel, ich kenne doch keine Menschenseele hier in der Stadt«, protestierte Catherine schwach.
Lady Kirton lächelte gütig. »Eben drum. Du hast gerade Wasser auf meine, statt auf deine Mühlen gegossen, Cat.«
»Um Gottes willen, Isabel! Ich bin ein Mädchen vom Lande und war nie in meinem Leben Debütantin. Will und ich haben geheiratet, als ich gerade mal siebzehn war. Mein Leben ist bisher immer in ruhigen Bahnen verlaufen, und so soll es auch bleiben. Es ist nur, dass ich … dass ich …«
»Dass du dir nichts sehnlicher als einen Ehemann und eine Familie wünschst«, beendete Isabel einfühlsam den Satz.
»Nun, ich möchte nicht mehr allein sein«, gab Catherine zögerlich zu. »Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich je wieder heiraten möchte.«
Etwas länger als nötig spielte Isabel mit der Kruste einer angetrockneten Scheibe Weißbrot. »Dann tu es mir gleich und leg dir einen Liebhaber zu«, brachte sie schließlich hervor, wobei ihr anzumerken war, dass ihr die Worte nur schwer über die Lippen kamen.
»Ja«, pflichtete Catherine ihr bei. »Daran habe ich auch schon gedacht.«
Isabel nahm die Schultern ein wenig zurück und hob das Kinn. »Diskretion ist hier der Schlüssel«, erklärte sie abschätzig, bevor sie im nächsten Moment heftig den Kopf schüttelte. »Ach, meine Liebste! Du bist doch noch so jung! Warum solltest du dich mit einem Liebhaber zufrieden geben?«
Catherine hüllte sich in langes Schweigen. »Will und ich waren acht Jahre verheiratet, Isabel«, setzte sie mit dünner Stimme an. »Mittlerweile glaube ich … nun, ich vermute stark, dass ich unfruchtbar bin.«
Isabel schaute Catherine prüfend an, ganz so, als wollte sie ergründen, wie stark die Nerven ihrer Nichte waren. »Ja, das könnte in der Tat sein, meine Liebe«, gab sie sanft zu bedenken. »Vielleicht wäre in diesem Fall ein Witwer genau das Richtige für dich. Einer, der bereits eigene Kinder hat. Davon wimmelt es dieses Jahr nur so in der Stadt und einige von ihnen sind sogar recht annehmbare Zeitgenossen. Sie alle hegen die Hoffnung, nicht mit einem allzu affektierten Frauenzimmer vor den Altar treten zu müssen. Du wärst das Beste, was ihnen passieren könnte, Cat. Schließlich bist du eine intelligente und hübsche Frau mit einem wunderbaren Sinn für Humor.«
»Humor! O ja, Humor steht bestimmt ganz oben auf der Wunschliste eines Gentlemans, wenn es um die Tugenden geht, die eine Frau mit in die Ehe bringen sollte.«
»Wenn er wirklich gedenkt, mit ihr gemeinsam alt und vor allem glücklich zu werden, dann schon«, kam Isabels weise Antwort. »So, jetzt aber zu etwas ganz anderem: Dein älterer Bruder hat sich doch noch per Brief gemeldet. Ich hatte zwar bis zuletzt gehofft, er ließe sich dazu überreden, noch dieses Jahr nach London zu kommen und seinen Sitz im Parlament anzutreten, aber ich fürchte, Treyhern ist nicht so flexibel wie du, meine Liebste.«
»Ich habe dir doch gleich gesagt, dass er nicht kommen würde«, warf Catherine ein. »Außerdem ist Helene wieder schwanger, und unter diesen Umständen würde Cam nie und nimmer Gloucestershire verlassen.«
Mit einem tiefen Seufzer, begleitet von einem Schulterzucken, gab Isabel sich geschlagen und stellte ihre Teetasse laut klirrend vor sich ab. »Warum brichst du nicht die Zelte in der Mortimer Street ab und quartierst dich bei mir ein, meine Liebe?«, flehte sie Catherine förmlich an. »Bei deinem jüngeren Bruder Bentley weiß man doch nie, wann er sich das nächste Mal blicken lässt. Auf ihn zu warten macht keinen Sinn. Komm und wohn bei mir. Du würdest mir damit eine Riesenfreude bereiten.«
Catherine winkte mit einer bedächtigen Handbewegung ab. »Ich stünde dir und deiner Romanze mit Jack nur im Wege«, protestierte sie lachend. »Und außerdem wollte ich mir doch selbst einen Liebhaber zulegen, schon vergessen? In dem Fall bräuchte ich ein wenig Privatsphäre.«
»Ach du liebe Zeit.« Für einen kurzen Moment sah Isabel ein wenig mitgenommen aus. »Treyhern wird mir den Kopf abreißen.«
Catherine lachte erneut und griff sich beherzt das Marmeladentöpfchen. »Mein geliebtes Brüderlein wird erst gar nichts von meinem heimlichen Liebhaber erfahren, Isabel. Ich kann ein Geheimnis sehr wohl hüten, verlass dich drauf.«
Verständnislos schüttelte Isabel den Kopf. »Manchmal weiß ich nicht, welchem deiner Brüder du ähnlicher bist, Cat, aber so langsam komme ich zu der Überzeugung, dass du doch eher Bentley nachschlägst.«
»Genug der Rede von meinen Brüdern, Isabel«, erhob Cat Einspruch. »Erzähl mir lieber, wie es Jack geht. Werde ich ihn diesen Sommer überhaupt zu Gesicht bekommen?«
Isabel schaute ein wenig schwermütig drein. »Seiner Meinung nach ist er zu alt für das gesellschaftliche Treiben«, antwortete sie. »Aber ich zähle auf dich, Cat, du wirst mich schon auf Trab halten. Und jetzt reich mir doch bitte die Einladungen, die du erhalten hast und die ich dich bat mitzubringen. Zum Glück hast du sie nicht vergessen. Ich wusste doch, dass du eine ganze Menge Briefe erhalten würdest – dafür habe ich nämlich im Vorfeld gesorgt.«
Brav tat Catherine, wie ihr geheißen, und schon bald hatte Isabel die Briefe in drei kleine Stapel sortiert. »Gut, sehr gut«, sinnierte sie laut, nahm eine elfenbeinfarbene Karte und studierte sie ein wenig genauer. »Lady Mertons musikalische Soiree findet heute Abend statt, und am Donnerstag gibt Lord Walrafen einen Wohltätigkeitsball.«
»Ein Ball?«, hakte Catherine schelmisch nach. »Doch nicht etwa mit Musik und Tanz?«
»Doch, mein Kind, zu einem Ball gehört auch der Tanz«, erwiderte Isabel belehrend und fächelte sich hektisch mit der Einladung Luft zu. »Und dieser Ball ist ein absolutes Muss! Wir dürfen keine Zeit verlieren und lassen dir umgehend ein Ballkleid aus dunkelblauem Taft schneidern. Walrafen ist nämlich ein ganz besonderer Freund von mir … und außerdem ein unglaublich begehrter Junggeselle!«
Kapitel 2
»Sorgen Sie dafür, dass Ihr Wesen, Ihr Auftreten, Ihre Wortwahl und Ihr Tonfall immerzu sanfter und zuvorkommender Natur sind.«
Lord Chesterfield, 1776,The Fine Gentleman’s Etiquette
Um halb elf beförderte Maximilian de Rohan seinen Federkiel mit einem verbitterten Fluch derart schwunghaft ins Tintenfass, dass dieses gefährlich ins Wanken geriet. Sein Büro erdrückte ihn, und in den letzten Tagen war es ihm kaum möglich gewesen, auch nur einen leserlichen oder plausiblen Satz zu Papier zu bringen. Nichts ergab einen Sinn. Oben war unten, Westen fühlte sich an wie Osten, und die Mosaikstücke seines aktuellen Falles ergaben kein schlüssiges Gesamtbild, wie es eigentlich hätte sein sollen.
Und jetzt, dio mio, war diese Frau erneut im Hyde Park aufgetaucht – wie auch schon an den sechs Morgen zuvor. Er wünschte, sie würde verdammt noch mal fern bleiben. Schließlich hatte er einen Auftrag, einen ziemlich gefährlichen sogar, den es zu erfüllen galt. Dennoch hatte er es nicht lassen können, hatte sie heimlich aus der Ferne beobachtet, auch wenn ihm der Grund für seine Faszination schleierhaft blieb. Zuerst hatte er sich eingeredet, die Ursache dafür läge in der Eintönigkeit seiner Überwachungstätigkeit begründet, die er im Park ausübte. Peels neuester Kreuzzug hatte de Rohan dazu verdonnert, zwei Wochen lang in den frühen Morgenstunden im Park auf der Lauer zu liegen, und wenn er schon einer solch frustrierenden und eintönigen Aufgabe nachging, warum sollte es seinen Augen vergönnt sein, sich an schönen Objekten zu weiden?
Sie zu beobachten, hatte sich jedoch als außerordentlich verführerisch herausgestellt: Sie war hoch gewachsen und gelenkig, mochte vielleicht fünfundzwanzig Lenze zählen und bestach durch ihre erfrischende und unverdorbene Schönheit. Sie und ihr kräftiger, haselnussbrauner Wallach verschmolzen förmlich miteinander, wenn sie anmutig und temperamentvoll auf den ansonsten menschenleeren Pfaden des Parks galoppierte. Manchmal stieg sie für einen kleinen Spaziergang ab, und das Ross folgte ihr dann wie ein treu ergebener Spaniel. In ihren Bewegungen lag Poesie, sie schien förmlich über das Gras zu schweben. Immer wenn er sie anschaute, ertappte er sich dabei, wie er sich vorstellte, wonach sie wohl riechen mochte.
Mit dem Finger leicht gegen die Kante seines Schreibpultes trommelnd, gab de Rohan sich noch ein wenig den für ihn eher untypischen Tagträumen hin. Sie roch wahrscheinlich wie Mutter Natur. Wie damals sein Zuhause. Dieser reine und liebliche Geruch nach frisch gemähten Feldern und sonnengewärmter Erde. Düfte, die sich in einer Stadt wie London kaum entfalten konnten, da sie – sollte es sie überhaupt geben – sofort vom städtischen Rauch und Ruß überlagert wurden.
Wie dem auch sei, sie war durch und durch eine englische Lady, was sich nur unschwer an ihrer aufrechten Haltung und dem Urvertrauen ablesen ließ, mit dem sie sich bewegte. Nein, sie und er würden niemals Bekanntschaft schließen, auch nicht nach ihrem eher plumpen Bestreben, sich einander vorzustellen. Er hatte sie mit voller Absicht vor den Kopf gestoßen. Und das, obwohl er seit sechs Tagen außer Stande war, seine Augen von ihr zu lassen. Jedes Mal, wenn sie aus seiner Sichtweite geritten war, hatte er sie mit der Kraft seiner Gedanken zur Wiederkehr zwingen wollen und eine ausdauernde Geduld an den Tag gelegt, bis sie ihm am nächsten Morgen seinen Wunsch erfüllte.
Einmal waren seine Blicke ihr gefolgt, als sie entgegen den Regeln der Etikette den Reiterpfad verlassen und ihr mächtiges Ross über eine Reihe von Buchsbaumhecken hatte segeln lassen, ganz so, als könnte nichts und niemand sie aufhalten. Und das ausgerechnet im Hyde Park! Als sie die letzte Hürde hinter sich gelassen hatte und weitergeritten war, hatte ihn das seltsame Gefühl beschlichen, dass der Park und sein urbanes Ambiente für ihren Geschmack zu einengend waren. Es hatte fast den Anschein, als versuchte sie, einer weltlichen Last zu entfliehen.
Was mochte das sein? Eine repressive Familie? Nein, dazu war sie bereits zu erwachsen. Ein dominierender Ehemann vielleicht? Das glaubte er schon gar nicht, denn sie erweckte nicht den Eindruck, als gehörte sie zu der Sorte Frau, die sich leicht von einem Mann beherrschen ließ. Und außerdem würde es kein gescheiter Mann zulassen, dass seine Gattin zu solch früher Stunde durch London ritt, egal, durch welchen Stadtteil.
Heute war sie noch früher als gewöhnlich aufgetaucht, lange bevor die Morgensonne den vom Fluss herübergezogenen Nebel hatte vertreiben können. Deshalb hatte er sie auch nicht wie gewöhnlich aus der Ferne beobachten können. Nein, heute hatte sie ihn mit ihrer Anwesenheit überrascht, als er im Rhododendrongebüsch seinen Wachtposten bezogen hatte. Zu allem Übel hatte sie ihn auch noch wütend und verletzt zurückgelassen. Maledizione! Ein Mann in seiner Position konnte sich Derartiges einfach nicht bieten lassen. Und schon gar nicht von einer wunderhübschen Engländerin aus gutem Hause.
Wie von Geisterhand bewegten sich seine Finger zur Schublade des Schreibtisches und brachten ein Buch zum Vorschein, das er vor etlichen Monaten dorthin verbannt hatte. Es war eine edle und altertümliche Ausgabe, von der es wahrscheinlich nicht mehr viele Exemplare gab, was sie besonders wertvoll machte. Er balancierte das Buch in der Hand und schaute auf den Buchrücken, auf dem in goldenen Lettern der Titel prangte: The Fine Gentleman’s Etiquette. Es wieder einmal in Händen zu halten, setzte in de Rohan ein befremdliches Gefühl frei – eine Mischung aus Verdruss und Scham. Verdruss, weil er es behalten hatte, und Scham, weil sein eigenes Leben in so gänzlich anderen Bahnen verlief. Unbändige Wut packte ihn, aber zum Teufel noch mal, schließlich hatte er sich doch jetzt die Zeit genommen, um sich dem albernen Inhalt zu widmen. Zählte das denn gar nicht?
Das in rotes Leder gebundene und an den Rändern vergoldete Werk war de Rohan von einem Mann mit Sinn für die feineren Dinge im Leben anlässlich seiner überraschenden Berufung ins Innenministerium überreicht worden. Er hatte es aus Höflichkeit und mit einem dankbaren Gesichtsausdruck entgegengenommen, wenngleich er keinerlei Verwendung für einen solchen Wälzer hatte, der zudem auch noch von dem alten, blasierten und wichtigtuerischen Lord Chesterfield verfasst worden war, der schon vor einer halben Ewigkeit das Zeitliche gesegnet hatte. De Rohan war sich sicher, dass die Ursache für sein Ableben Ersticken durch Arschkriecherei gewesen sein musste. Das Buch bestand nämlich ausnahmslos aus ungeheuerlich hochnäsigen Ratschlägen, die im besten Falle kriecherisch und im schlimmsten Fall machiavellistisch anmuteten. De Rohan las zum wiederholten Male die Widmung:
Mein lieber Junge,auch ein Rohdiamant benötigt eines Tages einen Schliff.Dein dir treu ergebener Diener,George Jacob Kemble
Wie verdammt lächerlich es doch war, dass er ein solches Buch überhaupt besaß! De Rohan schnaubte und beförderte den Wälzer just in dem Moment unsanft in die Schublade zurück, als ein kurzes und ungeduldiges Klopfen an seiner Bürotür ertönte. Zuerst war er erleichtert, so unsanft in die Realität zurückgeholt zu werden, aber dieses angenehme Gefühl versiegte jäh, als Mr. Hobhouse’ nervtötender und überpenibler Assistent in das Büro platzte. Wie gewöhnlich trug Feathershaw einen Stapel Akten bei sich und hatte sich einen Bleistift hinters Ohr geklemmt. Er erinnerte de Rohan immer an ein ungestümes und fleißiges Eichhörnchen.
De Rohan gab sich geschlagen und winkte den Assistenten näher, damit er sich setzte, was er auch ohne Umschweife tat. Einen Moment später hatte Feathershaw seinen Bleistift gezückt, schob seinen Kneifer ein Stück höher und trommelte ungeduldig mit dem Bleistift auf der Armlehne, wie es seine Angewohnheit war. »Haben Sie die Akten über die Gesetzesinitiativen zur Reform des Strafrechtes studiert, die ich Ihnen gab?«, setzte er mit einer Stimme an, die de Rohan förmlich dazu herausforderte, ihm zu widersprechen.
Aber er verkniff sich eine solche Reaktion und starrte ihn stattdessen mit herablassender Miene und weit nach oben gezogenen Augenbrauen über den Tisch hinweg an. »Bitte fahren Sie doch fort, Mr. Feathershaw.«
Einen Moment lang schien es, als könnte sich der Beamte behaupten, doch dann hielt er dem prüfenden Blick seines Gegenübers letztlich nicht stand. »Sie haben sie nicht gelesen, richtig?«, fragte er gereizt und löste sich aus de Rohans Blick. »Das Komitee tritt in einer Viertelstunde zusammen, und wie immer haben Sie nicht einmal einen Blick in die …«
»Ich bin Polizist, Mr. Feathershaw«, unterbrach de Rohan ihn. »Und kein verdammter Politiker. Ich habe diesen Posten nur angenommen, um dabei behilflich zu sein …«
»Falsch, de Rohan«, korrigierte der Beamte ihn. »Sie waren Polizist …« Ein lautes Klopfen schnitt ihm jedoch das Wort ab. Feathershaw wirbelte herum und starrte zur Tür. Als ein Angestellter vom Empfang de Rohans schlicht eingerichtetes Büro betrat, nahm Feathershaw sein impertinentes Bleistifttrommeln sogleich wieder auf.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Mr. de Rohan«, setzte der junge Mann mit sorgenvoll gerunzelter Stirn an, »aber ein Bote überbrachte dies soeben aus Mayfair. Er sagt, es sei äußerst dringend.« Behutsam schob er einen Brief über die polierte Oberfläche des Schreibpultes. De Rohan studierte die winzige, hastig und schwungvoll auf das Pergament gekritzelte Adresse. Seine vom Polizeidienst geschulten Augen registrierten jedes Detail: das teure Papier und die gute Tinte. Ein Siegel hingegen fehlte – der Absender musste in Eile gewesen sein. Als er die Nachricht öffnete, fiel sein Blick auf ein Wappen, das er nicht kannte.
Lieber Max,ich muss Sie dringend sprechen. Bitte machen Sie sich umgehend auf den Weg zu mir in die Princes Street, zum Haus meines Bruders, Lord Sands. Glauben Sie mir, ich würde niemals einen liebenswerten Freund belästigen, wäre die Situation nicht derart desolat.Ihre Ihnen treu ergebeneCecilia, Lady Delacourt
Dringend! Desolat! Um Gottes willen, Cecilia klang, als wäre jemand ermordet worden. Mit einem verzweifelten Schnauben warf de Rohan den Brief auf sein Pult. Seit Monaten, seit ihrer Abreise nach Derbyshire, hatte er nichts mehr von Lord und Lady Delacourt gehört – ach, wie friedlich diese Monate doch gewesen waren! Aber nun war Cecilia wieder da, woraus er schloss, dass ihre Niederkunft problemlos verlaufen war. Das freute ihn natürlich in gewisser Weise. Und wenn er ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass ein winziger Teil in ihm erleichtert war, ihre unordentliche Schrift auf dem fremden Briefbogen zu sehen. Aber war er wirklich ein liebenswerter Freund? Fest stand, dass de Rohan sie mehr mochte, als ihm selbst recht war, oder anders ausgedrückt: Er hegte mehr Sympathie für Cecilia, als es für einen Mann in seiner Position schicklich war. Er ahnte insgeheim, dass auch sie sich ihrer Wirkung bewusst war. Oder irrte er? Vielleicht war Cecilia sich gar nicht bewusst, wie charmant sie wirkte.
Charme hin, Charme her – de Rohan hatte weder die Zeit, noch verspürte er das Bedürfnis, sich im Londoner East End auf die Suche nach einem gefallenen Mädchen zu machen, das vermisst wurde, oder nach einem verrückten Zuhälter, der ständig seine Fäuste sprechen ließ. Um einen derartigen Gefallen würde Cecilia ihn wahrscheinlich wieder einmal bitten. Ihr Gatte, Delacourt, schaffte es einfach nicht, sie zu bändigen, und Cecilias fehlgesteuerte und fast aussichtslose Bemühungen, sich sozial zu engagieren – sei es um Prostituierte zu retten oder Diebe zu bekehren –, zogen fast unweigerlich immer Probleme nach sich. Sie würde ihn wieder und wieder um Hilfe bitten, und er würde wieder einmal nicht Nein sagen können und alles tun, was in seiner Macht stand. So wie er es auch die letzten Dutzend Male im vergangenen Jahr getan hatte. Es war ihm schleierhaft, warum er es einfach nicht schaffte, ihr eine Bitte abzuschlagen.
Ha! Noch eine Lüge! Er kannte den Grund sehr wohl, denn schuld war nur ihr besagtes liebreizendes Wesen. O Gott, wie er das hasste – nicht ihren Charme, sondern seine Empfänglichkeit für die Ausstrahlung des weiblichen Geschlechts. Cecilia war zum Glück nicht wie die meisten adligen Frauen, denn sie hatte ein Herz für andere und schreckte nicht vor harter Arbeit zurück, egal, wie aussichtslos die Lage auch sein mochte. Vielleicht lag genau darin begründet, warum er ihr jedes Mal aufs Neue seine Hilfe zukommen ließ.
»Mr. de Rohan?« Die Stimme des Empfangsjungen riss ihn aus seinen Gedanken. De Rohan schaute zu ihm auf und sah, dass der Jüngling mit dem ernsten Gesicht ihn noch immer ansah. »Ja, Mr. Howard?«
»Der Bote wartet unten«, kam Howards unsichere Antwort. »Er gab an, den Befehl zu haben, auf Ihre Antwort zu warten. Ich glaube, das bedeutet so viel wie … nun … dass die Kutsche nicht ohne Sie abfahren soll, Sir.«
Bei diesen Worten brach Mr. Feathershaws Trommeln abrupt ab. »Hobhouse wartet ebenfalls, de Rohan!«, feuerte er einen verbalen Warnschuss ab. »Die Gesetzesvorlage zur Reform des Strafrechts! Er erwartet Ihre Mitarbeit. Diesmal werden Sie nicht einfach das Weite suchen.«
Gütiger Himmel, schon wieder eine verdammte Sitzung! Cecilias Brief, dachte de Rohan, war seine Rettung, und bevor er seine Entscheidung überdenken konnte, war er aufgesprungen und hatte sich seine Aktenmappe geangelt. »Die Sitzung muss ohne mich stattfinden, Mr. Feathershaw. Lord Delacourt hat mich aufgrund einer dringenden Angelegenheit zu sich gerufen. Sie kennen ja sein Gemüt – ganz zu schweigen von seinem Einfluss. Wir sollten ihn besser nicht warten lassen.«
De Rohan war überzeugt davon, sich einer nicht allzu schlimmen Lüge bedient zu haben. Er riss seinen Mantel vom Kleiderhaken, schnappte sich seinen Gehstock aus Elfenbein und eilte zur Tür hinaus. Howard und Feathershaw starrten ihm ungläubig hinterher, als er wie der Blitz im Schatten des Korridors verschwand.
»Was für ein arroganter und aufgeblasener Fremdling!«, zischte Feathershaw. »Er ist alles andere als ein Gentleman!«
»Ich wette, Sie trauen sich nicht, ihm das ins Gesicht zu sagen«, höhnte Howard und beugte sich mit einem breiten Grinsen zum Ohr seines Kollegen hinunter. »Ach, übrigens, in seiner Personalakte steht, dass er in Middlesex geboren und in Allhallows, also unweit des Towers, getauft worden ist.«
Feathershaw schürzte die Lippen. »Ach, wirklich?«, fragte er mit sarkastischer Stimme. »Welch ein vornehmes Stadtviertel, jetzt bin ich aber mächtig beeindruckt!«
Das große Rundbogenfenster von Madame Germaines Geschäft für den gehobenen Geschmack konnte das Getrappel des mittäglichen Verkehrs auf der Bond Street nicht dämpfen. Catherine bekam von dem zauberhaften Frühlingstag so gut wie nichts mit, denn sie steckte – wahrscheinlich bis zur Teatime – im Umkleideraum fest, wo sie gezwickt und gezwackt und in edle Garne gezwängt wurde, deren Namen sie nicht einmal fehlerfrei aussprechen konnte und deren Verwendung ihr zudem vollends schleierhaft blieb.
Und warum das alles? Weil sie töricht genug gewesen war, der bäuerlichen Schönheit Aldhamptons zu entfliehen. An einem solch zauberhaften Tag würden die Lämmer umhertollen, in ihrem Obstgarten würde ein rosa-weißer und süßlich duftender Blütenregen niedergehen, die Felder wollten gepflügt werden, und es gäbe unendlich vieles, was sie mit ihrem Verwalter zu besprechen hätte. Aber trotz oder gerade wegen dieser lieblichen Erinnerungen, dachte Catherine, würde sie einen weiteren Frühling dort nicht überstehen. Alles war so leer.
Sicherlich, ihr Besuch in der Stadt hatte Tante Isabel in Verzückung versetzt, und was konnte jemand, der keine persönliche Freude mehr am Leben hatte, Besseres tun, als anderen eine Freude zu bereiten? Was machte es da schon, wenn sie Isabel einige Wochen ihres Lebens schenkte? Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, würde sie ja einem interessanten Mann begegnen. Nun, möglich, dass das bereits geschehen war. Mit einem Mal kehrten Catherines Gedanken zu ihrem seltsamen Ausritt im Hyde Park an jenem Morgen zurück.
Ein Nadelstich katapultierte sie jedoch wieder jäh in die Gegenwart zurück. »Autsch!«
Madame Germaines Näherin machte einen Satz nach hinten, weg von dem Podium, auf dem Catherine stand. »Mille pardons, madame!«
Mit geschürzten Lippen kam Lady Kirton durch die schweren Vorhänge in den Ankleideraum geeilt. In einer Hand trug sie einen Ballen elfenbeinfarbener Seide. »Sie können nichts dafür, Michelle.« Isabel warf Catherine einen finsteren Blick zu. »Ihre Kundin zappelt ja auch ständig hin und her.«
»Ich gebe mir wirklich allergrößte Mühe stillzuhalten«, verteidigte sich Catherine.
Mit kritischem Blick taxierte Lady Isabel ihre Nichte vom Scheitel bis zur Sohle, bevor sie zustimmend nickte. »Wie der Stoff deine schlanken Beine zur Geltung bringt, meine Liebe!«
Catherine, die noch immer auf dem Podest weilte, musste lachen. »Auf dass ich eher einem Fohlen als einem ausgewachsenen Pferd gleichen möge, oder wie?«, kam ihre kecke Antwort, als die Näherin wieder ans Werk ging.
Isabel lächelte besonnen und ließ sich in einem unweit stehenden Sessel nieder. »Du bist wunderhübsch, Cat.«
Catherine senkte den Blick auf die flinken Finger der Näherin. »Aber ich bin weder blond noch zierlich – geschweige denn zerbrechlich.«
»Nein, das bist du alles nicht«, pflichtete Isabel ihr bei, »doch du bist durch und durch eine Frau und strahlst Vernunft und Eleganz aus.« Mit ihrer behandschuhten Rechten gab sie der Angestellten einen Wink. »Lassen Sie die großen Rüschen am Kragen weg, Michelle. Sie ist alt genug, um ihre Vorzüge zur Schau zu stellen.«
»Ha!« Catherine rutschte tiefer in das Mieder hinein. »Du meinst wohl, ich sollte das Wenige, das ich habe, auch entsprechend präsentieren? Jetzt aber etwas anderes, Isabel: Lass uns die Zeit, in der der Saum gesteckt wird, sinnvoll nutzen und erzähl mir ein wenig über diesen Lord Walrafen. Hat er noch alle Zähne? Wie ist es um sein Haar bestellt?«
Wenngleich sein Abgang aus Whitehall, dem Regierungsviertel Londons, eher impulsiver statt besorgter Natur gewesen war, so änderte sich de Rohans Gemütsverfassung schnell, als er in der Princes Street eintraf. Eine Traube Bediensteter mit aschfahlen Gesichtern stand tuschelnd auf Lord Sands Treppe. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckte de Rohan eine ihm bestens bekannte Kutsche. Es war eine Leichenkutsche, dessen spindeldürres, schwarzes Pferd den Kopf hängen ließ, als wäre ihm bewusst, welcher Art Arbeit es nachging.
De Rohan wurde klar, dass er Cecilias Hilferuf auf die leichte Schulter genommen hatte. Er bahnte sich einen Weg durch die kleine Menge, schritt durch das Portal und fand sie im puren Chaos wieder. Im Innern des Hauses wimmelte es von Bediensteten, die teils hin und her eilten, während andere, aufgeregt flüsternd, im hinteren Teil der Empfangshalle standen. An der Wandtäfelung neben der Tür zum Salon kauerte eine dralle, goldblonde Bedienstete, die schluchzend in den zusammengeknüllten Saum ihrer gestärkten Schürze weinte.
Eine stattliche Frau, die die für eine Haushälterin üblichen Kleider trug, schritt auf sie zu. »Genevieve!«, sprach sie mit strafendem Blick auf sie ein. »Du gehst jetzt auf der Stelle nach oben und sammelst dich.«
»Oui, madame«, murmelte das Mädchen und ging in Begleitung einiger Kolleginnen die Treppe hinauf.
Ein Mann, der allem Anschein nach der Butler sein musste, unterhielt sich in gedämpftem Ton mit zwei Wachtmeistern, die de Rohan vom Polizeirevier in Westminster, vom Queen Square, her kannte. Als der Butler de Rohan bemerkte, eilte er auf ihn zu. »Sie müssen der Herr vom Innenministerium sein.«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, rang er die Hände. »Ich nehme an, Sie möchten sich sofort den Leichna … äh … direkt nach oben gehen.«
»Wohin nach oben?«, wollte de Rohan wissen. »Was ist denn überhaupt passiert?« Aber in Gedanken spielte er bereits mehrere Möglichkeiten durch, eine furchtbarer als die andere.
Der Butler öffnete und schloss den Mund, als fehlten ihm die Worte für eine Erklärung. Der Mann, den de Rohan als Polizeiwachtmeister Sisk erkannt hatte, kam nun auf sie zu, dicht gefolgt von seinem Kollegen. »Ordern Sie den Leichenwagen zum Hintereingang, Eversole«, befahl Sisk seinem Mitarbeiter mit ruhiger Stimme, während er de Rohan zur Seite zog.
De Rohan packte den Wachtmeister mit unbarmherziger Härte am Arm. »Wo ist Lady Delacourt?«, zischte er. »Herrgott noch mal, was ist ihr zugestoßen?«
Mit einem zynischen Lächeln ließ Sisk seinen Blick an de Rohans dunkler Kleidung herabwandern. »Oho, Sie verkehren heutzutage wohl in feinerer Gesellschaft als in den guten alten Zeiten, Kumpel, oder wie?«, stieß er hervor.
»Klappe, Sisk«, knurrte de Rohan. »Wo ist sie?«
»Sie wittern wohl schon ein Schäferstündchen, oder was?«, fauchte der Wachtmeister. »Hat sich mit ihrem Bruder im Salon verschanzt, der wie ein Schlosshund heult. Scheint, als hätte seine Frau letzte Nacht ein Rendezvous mit Gevatter Tod gehabt.«
De Rohan blickte Sisk verwundert an. »Lady Sands? Tot?«
»Aye. War wohl ’ne recht grausame Nummer. Und da sie die Olle eines Lords ist, wird das bestimmt ’ne gehörige Portion Trubel geben. Mann, bin ich froh, dass Sie die Chose hier übernehmen.«
Übernehmen? Zu spät bemerkte de Rohan, dass er noch immer seinen Zylinder trug, dessen er sich nun schnell entledigte. Mit der linken Hand fuhr er sich durch die Haare. Cecilias Schwägerin war tot?
Wenn das stimmte, fiel dies in die Zuständigkeit des Gerichts am Queen Square. Seit der Tragödie im Nazareth-Zirkel, einem der wohltätigen Projekte Cecilias, war er nicht mehr mit einem Mordfall betraut gewesen. Bei besagtem Fall hatte er auch Cecilia sowie Lord Delacourt und Lady Kirton kennen gelernt. Seitdem jedoch hatte sich sein Aufgabengebiet mächtig gewandelt. Heutzutage gehörte es eher zu seinen Aufgaben, in Whitehall Papier von einem auf den nächsten Stapel zu schieben, statt Schmugglern in Wapping aufzulauern. Leichte Verwunderung machte sich in ihm breit, denn er war doch als Cecilias Freund gekommen, und außerdem hatte er Lady Sands so gut wie nicht gekannt. Wohl aber ihren Namen und was für einen Ruf sie genoss. Julia Markham-Sands war eine Schönheit, eine atemberaubende Schönheit sogar, aber wenn er den Gerüchten Glauben schenkte, so war sie ihrem Gatten ein ziemlicher Dorn im Auge.
»Wie hat Lord Sands es aufgenommen?«
Der Wachtmeister setzte ein unangenehmes Lächeln auf. »Wie ein Schuldiger es eben aufnimmt, de Rohan«, antwortete er beschwingt und klopfte ihm mit gespieltem Mitleid auf die Schulter. »Und da Sie der Mann vom Innenministerium sind, sollten Sie mit nach oben kommen und sich den Tatort näher anschauen, bevor der gute Lord auf die Idee kommt, Sie rauszuschmeißen.«
Der Sarkasmus in Sisks Stimme traf de Rohan. »Ich erhielt eine Nachricht«, gab er bissig zurück. »Von der Schwester des Lords.«
Sisk jedoch polterte mit seinen schweren Stiefeln bereits die Stufen hinauf. Die Aktenmappe und seinen Zylinder noch immer in der Hand, folgte de Rohan dem Wachtmeister bis in die zweite Etage. Sie erreichten just in dem Moment die Tür des Schlafgemachs von Lady Sands, als der zugedeckte Leichnam von Cecilias Schwägerin auf einer Bahre herausgetragen wurde. Eversole und der Krankenwärter blieben stehen und schauten de Rohan mit respektvollen, aber auch fragenden Blicken an.
Nun, ob es ihm recht war oder nicht, die Anwesenden hatten ihn als eine wie auch immer geartete Autorität akzeptiert. Er blickte kurz zu Sisk, bevor er eine Ecke des Lakens zurückschlug, unter dem die Tote lag. Julia Markham-Sands war nicht mehr die atemberaubende Schönheit von früher.
»Tod durch Erdrosseln?«, erkundigte de Rohan sich sachlich.
Mit einem finsteren Gesichtsausdruck schob Wachtmeister Eversole behutsam das Laken noch ein Stück weiter zurück. De Rohan traute seinen Augen nicht, Lady Sands schien die Angewohnheit gehabt zu haben, sich nackt zu betten. Dunkle Blutergüsse überzogen ihren Hals und streuten fast bis zu ihren Brüsten aus.
Sisk sah sich die Verletzungen ein wenig näher an. »Erst geknebelt, dann erwürgt, würde ich sagen«, lautete seine Diagnose. »Schnelle saubere Arbeit. Die arme Lady hat nich’ mal geschrien.«
»Oh!« De Rohan zog eine Augenbraue hoch. »Wer sagt das?«
»Ihre Kammerdienerin. Und natürlich Lord Sands.« Der Wachtmeister stieß ein makaberes Lachen aus und bedeutete den Helfern, die Leiche abzutransportieren. »Alle anderen schliefen eine Etage höher oder tiefer. Niemand hat was gehört.«
De Rohan grunzte und schritt über den wertvollen Perserteppich, um sich ein Paar silberne Augengläser, die neben einer leeren Flasche auf dem Nachttisch lagen, näher anzuschauen, aber sie entpuppten sich nur als Lesehilfe für vornehme Damen. De Rohan blickte hindurch. Lady Sands war offensichtlich ein klein wenig kurzsichtig gewesen. Als Nächstes untersuchte er die Flasche. Champagner, ein teurer, aber schlechter Jahrgang. Er zuckte mit den Schultern. Die Engländer waren echte Banausen. »Wo ist das Glas dazu?«, blaffte er Sisk an. »Wie viele Gläser gab es insgesamt?«
Sisk hatte die Antwort sofort parat. »Nur eins. Ihre Kammerdienerin hat es vor Schreck fallen lassen. Sie haben ja den Hals der Toten selbst gesehen. Da war kein Gift im Spiel.« Sisk hatte Recht. Gütiger Gott, hoffentlich lag er mit seinen Vermutungen über Sands’ Schuld falsch! »Vielleicht war es jemand, der nicht im Haus wohnt«, dachte de Rohan laut nach, »der die Lady aber kannte.«
Der Wachtmeister hob die Schultern. »Dann wär’s Raubmord«, schlussfolgerte er. »Und zu Lord Sands’ Verteidigung: Das Fenster dort sieht aus, als wär es mit einem Meißel oder Brecheisen aufgehebelt worden.«
Ein wenig irritiert legte de Rohan die Sehhilfe zurück. »Ich nehme an, auch das will niemand gehört haben.«
Sisk kratzte sich am Kinn und machte eine ruckartige Kopfbewegung in Richtung Fenster. »Verstehe. So wie der Fensterriegel bearbeitet worden ist, hätte es einen Höllenlärm geben müssen, selbst wenn’s nur eine falsche Fährte für uns sein soll.«
»Ist dieser Raum gründlich untersucht worden?«, wollte de Rohan wissen.
»Ich hab ihn mir kurz angeschaut.«
»Sind die Aussagen der Dienstboten erfasst worden?«
»Sobald die Leiche auf dem Weg ins Leichenschauhaus ist, wird Eversole sich um die wenigen kümmern, die noch nicht vernommen worden sind.« Sisk verlagerte unruhig das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. »Übernehmen Sie den Fall jetzt oder nicht?«