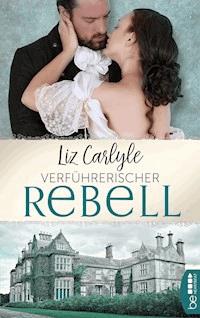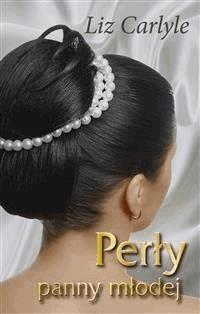4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: MacLachlan Saga
- Sprache: Deutsch
Das ergreifende Wiedersehen mit der verloren geglaubten Liebe
Als Quin Hewitt seine Verlobung mit der hübschen Esmée Hamilton feiert, ist auch ein ganz besonderer Gast geladen: Contessa Bergonzi di Vicenza, die stimmgewaltige und erfolgreiche Sängerin aus Europa. Der Earl ist mehr als überrascht, als er erkennt, dass diese Frau keine andere ist als seine Jugendliebe Viviana. Nun stehen sie sich nach langen Jahren der Trennung wieder gegenüber. Und Quin merkt, dass sich seine Gefühle zu Viviana nicht geändert haben: Ihr Anblick raubt ihm auch heute noch den Verstand. Doch kann diese Liebe jetzt noch eine Zukunft haben?
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Das süße Lied der Liebe" erschienen.
Weitere Regency-Liebesgeschichten aus der MacLachlan-Saga als eBook bei beHEARTBEAT: "Ein unwiderstehlicher Halunke", "Ein charmanter Schuft" und "Ein geheimnisvoller Gentleman".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Verloren in deiner Sehnsucht
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Das ergreifende Wiedersehen mit der verloren geglaubten Liebe
Als Quin Hewitt seine Verlobung mit der hübschen Esmée Hamilton feiert, ist auch ein ganz besonderer Gast geladen: Contessa Bergonzi di Vicenza, die stimmgewaltige und erfolgreiche Sängerin aus Europa. Der Earl ist mehr als überrascht, als er erkennt, dass diese Frau keine andere ist als seine Jugendliebe Viviana. Nun stehen sie sich nach langen Jahren der Trennung wieder gegenüber. Und Quin merkt, dass sich seine Gefühle zu Viviana nicht geändert haben: Ihr Anblick raubt ihm auch heute noch den Verstand. Doch kann diese Liebe jetzt noch eine Zukunft haben?
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck - auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
EINBETÖRENDEREARL
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonSusanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by S. T. Woodhouse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Two little Lies«
Originalverlag: Pocket Books, New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Das süße Lied der Liebe«
Textredaktion: Kerstin Fuchs, Berlin
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: GTMedia | AlinaMD | InnaFelker; © hotdamnstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5515-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
In dem ein Heiratsantrag gemacht wird
Frühling 1821
Signorina Alessandri fühlte sich schlecht. Schon wieder wurde sie von heftiger Übelkeit geplagt. Sie hielt mit einer Hand ihr seidenes Nachthemd zusammen, als sie sich über den Leibstuhl beugte, und betete in flammendem Italienisch darum, dass der Tod sie erlösen möge.
»Oh bitte, Miss, sprechen Sie doch Englisch!«, bat ihre Zofe sie inständig. Sie hielt Signorina Alessandri das Haar zurück, damit es ihr nicht ins Gesicht fiel. »Ich verstehe kein Wort. Aber wir sollten besser einen Arzt holen.«
»Unsinn«, widersprach die Signorina und umklammerte die Rückenlehne des Leibstuhls, bis ihre Fingerknöchel weiß hervortraten. »Es liegt am Fisch, den Lord Chesley gestern Abend hat servieren lassen.«
Die Zofe schürzte die Lippen. »Ja, und was war es gestern, Miss?«, fragte sie. »Kein Fisch, möchte ich wetten.«
Viviana stützte die andere Hand in den Rücken, schloss die Augen und richtete sich mühsam auf. »Silenzio, Lucy«, sagte sie leise. »Kein Wort mehr davon. Das Schlimmste ist jetzt vorbei.«
»Oh, das bezweifle ich, Miss«, murmelte die Zofe.
Viviana überhörte diese Bemerkung und ging zum Waschtisch. »Wo ist die Morgenpost, per favore?«, fragte sie und verschüttete ungeschickt etwas von dem Wasser in der Schale.
Lucy seufzte, ging in den Salon und kehrte mit einem Tablett zurück. Darauf lagen ein Brief, adressiert in der fast unleserlichen Handschrift des Vaters der Signorina, und ein zusammengefaltetes Schreiben, das keine Adresse trug. »Die Nachricht hat der Diener von Mr. Hewitt gebracht«, erklärte sie ungefragt.
Mit noch zittrigen Händen beendete Viviana ihre Morgenwäsche und tupfte sich das Gesicht mit einem Handtuch ab, während Lucy ihr mitfühlend zuschaute. Das Mädchen hatte sich in den vielen Monaten als loyal und freundlich erwiesen. »Danke, Lucy«, sagte sie. »Warum gehen Sie nicht eine Tasse Tee trinken? Ich werde jetzt meinen Brief lesen.«
Lucy zögerte. »Aber wünschen Sie denn nicht, dass Ihr Badewasser gebracht wird, Miss?«, drängte sie. »Mittag ist schon vorbei. Mr. Hewitt wird bald hier sein, oder nicht?«
Quin. Lucy hatte natürlich recht. Viviana legte das Handtuch zur Seite und griff nach der Nachricht. Quin besuchte sie gewöhnlich am frühen Nachmittag. Ja, das würde er auch heute tun. Wie sehr sie sich danach sehnte – und wie sehr sich im selben Atemzug davor fürchtete.
Sie warf die Nachricht ins Feuer. Ihr war nicht entgangen, wie wütend er gestern Abend im Foyer der Oper jeden ihrer Schritte beobachtet hatte. Viviana hatte wunderbar gesungen, sie hatte jeden hohen Ton in ihrer letzten Arie mit kristallener Schärfe getroffen, ehe sie in den Armen ihres Liebhabers in eine perfekte Ohnmacht gesunken war. Die Vorstellung war ausverkauft gewesen, der Applaus frenetisch.
Aber Quins Aufmerksamkeit schien nur dem gegolten zu haben, was danach gewesen war. Die Komplimente und die Glückwünsche ihrer Bewunderer. Der Champagner und die Toasts, die auf sie ausgebracht wurden. Die versteckten, aber eindeutigen Angebote, die ihr gemacht wurden – durch das Hochziehen einer Augenbraue oder das Neigen des Kopfes –, und die ebenso versteckt von ihr abgelehnt wurden. Für Quin war diese Ablehnung nicht deutlich genug gewesen. Sein arrogantes Gehabe und sein beleidigtes Lächeln waren kaum zu übersehen gewesen. Ein Glas Brandy fest umklammert, war er auf dem zerschlissenen grünen Teppich im Foyer hin und her gegangen. Sein Onkel, Lord Chesley, hatte sogar die Dreistigkeit besessen, ihn damit aufzuziehen.
Quin hatte den Scherz seines Onkels nicht gut aufgefasst. Und er war ganz und gar nicht darüber erfreut gewesen zu sehen, dass Viviana an Chesleys Arm das Theater verlassen hatte, wie sie es so oft tat. Und heute, Gott stehe ihnen bei, heute würde er ohne jeden Zweifel darüber zu streiten wünschen. Viviana war nicht sicher, ob sie sich in der Lage fühlte, eine pointierte Verteidigung zustande zu bringen. Aber das zählte jetzt fast schon nicht mehr.
»Miss?«, erkundigte sich die Zofe. »Was ist mit Ihrem Badewasser?«
In ihrem Magen regte sich wieder die Übelkeit, und Viviana ging langsam zu einem Stuhl. »In zehn Minuten, Lucy«, erklärte sie. »Ich werde Papàs Brief lesen, während mein Magen sich beruhigt. Sollte es doch später werden, empfange ich Mr. Hewitt hier.«
Lucy schürzte wieder die Lippen. »Also gut«, sagte sie schließlich. »Aber ich würde ihm gleich von dem verdorbenen Fisch erzählen, wenn ich Sie wäre, Miss.«
Endlich lachte Viviana.
Der kurze Anflug von Humor legte sich jedoch gleich wieder, als sie den Brief ihres Vaters öffnete. Allein der Duft seines Briefpapiers berührte ihre tiefsten Gefühle. Sie wusste genau, aus welcher Schublade seines Schreibtisches er es genommen hatte; derselbe Schreibtisch, in dem er seinen Tabak verwahrte. Dann war da die Schrift an sich. Die breiten, gestochen scharfen Buchstaben riefen ihr immer seine eiserne Kraft in Erinnerung, die festen Bögen und Schwünge seine Klugheit und Bestimmtheit, und die gefühlvollen Worte seinen Sinn für die Poesie. Er war nicht ohne Grund einer der gefeiertsten Komponisten Europas.
Noch einmal atmete sie den Duft ein, der dem Papier entströmte, dann faltete sie den Brief auf ihrem Schoß auseinander. Sie las ihn durch, ungläubig, dann noch einmal, sehr sorgsam dieses Mal. Chesley, so schien es, hatte seinen alten Freund gut auf dem Laufenden gehalten. Auch Papà wusste bereits, dass sie heute Abend ihre letzte Vorstellung in Die Entführung geben würde und dass Londons West End ihr anbetend zu Füßen lag. Als Konstanze hatte sie letztlich triumphiert.
Und jetzt schrieb Papà ihr, sie könne wieder nach Hause kommen. Viviana schloss die Augen. Du lieber Gott, was für eine seltsame Laune des Schicksals das doch war – ausgerechnet jetzt! Es schien eine Ewigkeit her zu sein, seit sie aus Venedig geflohen war mit nichts als ihrer Angst, ihrer Violine und ihren Notenblättern im Gepäck. Und jetzt zurückzukehren! Oh, dafür hatte sie gelebt und danach hatte sie sich gesehnt in fast jedem Augenblick – bis auf jene, die sie in Quins Armen verbracht hatte. Er hatte ihr fürwahr die Erlösung gebracht.
Aber jetzt konnte sie nach Hause zurückkehren. Was ihr da angeboten wurde, hatte gleichwohl ein wenig von einem Pakt mit dem Teufel. Und das war gewiss nicht das, was sie wollte. Nichtsdestotrotz hätte ein solches Arrangement einige Vorteile, Papà hatte zu Recht darauf hingewiesen. Große Vorteile. Es würde auch sein Leben sehr viel leichter machen – obwohl ihr Vater eher sterben würde, als das zuzugeben.
Und nun lag die Entscheidung bei ihr. Sie würde zu nichts gezwungen werden. Ha! Das waren nicht die Worte ihres Vaters, darauf wettete sie. Offensichtlich hatte Conte Bergonzi seine Taktik geändert. Mehr noch: Viviana glaubte, aus den vorsichtigen Formulierungen ihres Vaters herauszulesen, dass er erwartete, dass sie Bergonzis Angebot ablehnen würde, und dass er ihr vergeben würde, wenn sie sich dazu entschied. Viviana legte die Hand auf ihren Bauch. Sie war sich ganz und gar nicht sicher, ob sie sich den Luxus leisten konnte, abzulehnen.
Das Badewasser war herrlich heiß, und das Bad war wunderbar belebend. Mit dem Gefühl, wieder ein wenig mehr mit sich im Reinen zu sein, genoss Viviana das Wasser immer noch, als Quin das Zimmer betrat. Er sah sofort wieder wütend aus, wirkte zugleich aber auch jungenhaft unsicher.
Er starrte auf ihren nackten Körper und schenkte ihr ein freudloses Lächeln. »Musst du dir die Spuren der Nacht abwaschen, Vivie?« Das war eine überaus zynische Bemerkung, selbst für seine Begriffe.
Einen Moment lang sah sie ihn aus ihren schwarzen Augen unverwandt an. »Silenzio, Quin«, entgegnete sie schließlich. »Ich hatte gestern Abend schon mehr als genug von deiner eifersüchtigen Schmollerei. Benimm dich oder geh wieder.«
Er kniete sich neben die Wanne und legte einen Arm auf deren Rand. Seine Augen blickten heute trübe, und die Linien um seinen Mund waren für einen so jungen Mann wie ihn fast erschreckend tief. Er roch nach Brandy und Zigarrenrauch und einer langen Nacht. »Ist es das, was du willst, Viviana?«, flüsterte er. »Versuchst du, mich zu vertreiben?«
Sie ließ die Seife ins Wasser fallen. »Wie denn, Quin?«, fragte sie herausfordernd und hob dann frustriert die Hände. »Mio Dio, wie stelle ich es denn angeblich an, dieses Vertreiben? Ich tue nichts dergleichen, und das ist die Wahrheit, sì?«
Er wandte den Blick ab. »Man sagt, Lord Lauton hat dir ein Haus in Mayfair versprochen und mehr Geld, als ich mir jemals erträumen könnte«, entgegnete er. »Jedenfalls nicht, bevor ich meinen Titel bekomme. Stimmt das Gerücht, Vivie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Und wenn es so wäre, Quin? Ich bin nicht mehr zu kaufen – vielleicht nicht einmal für dich. Warum musst du nur so eifersüchtig sein?«
»Wie könnte ich es nicht sein, Viviana?«, fragte er rau und strich mit der Fingerspitze über ihre Brust. Ihre Knospe richtete sich auf, flehte um seine Berührung. »Die Männer verschlingen dich mit ihren Blicken, wo immer du gehst und stehst. Aber zumindest begehrst du mich noch.«
Viviana sah ihn finster an, aber sie schob seine Hand nicht fort. »Mein Körper begehrt dich, sì«, gab sie zu. »Aber manchmal, amore mio, tut meine Seele das nicht.«
Er umfing ihre Brustspitze mit Daumen und Zeigefinger und reizte sie herausfordernd. »Und was ist mit deinem Herzen, Viviana?«, flüsterte er und sah unter einem Kranz schwarzer Wimpern zu ihr auf. »Voller Umsicht habe ich deinen Körper versteckt, hier in dieser Wohnung, für die ich bezahlt habe. Besitze ich auch dein Herz?«
»Ich habe kein Herz!«, fauchte sie. »Das jedenfalls hast du mir erst letzte Woche an den Kopf geworfen. Und, Quin, du musst mich nicht daran erinnern, wer dieses Dach über meinem Kopf finanziert. Ich bin mir dessen bei jedem Atemzug bewusst.«
Als wollte er sie quälen, schloss er die Augen, beugte sich über sie und berührte ihre harte Knospe mit den Lippen. Viviana ließ es reglos geschehen. Doch als er die empfindsame Brustspitze in den Mund nahm, zwischen seine Zähne, keuchte sie auf. Sie verfluchte das vertraute, lustvolle Ziehen, das sich auf verräterische Weise ihres Körpers bemächtigte. Es wanderte tief in ihren Schoß, machte sie atemlos.
Quin hob den Kopf und sah Viviana mit einem zufriedenen Lächeln an. »Wohin bist du gestern Abend gegangen, meine Liebe?«, fragte er.
Sie erwiderte seinen Blick trotzig. »In Chesleys Stadthaus«, sagte sie. »Wir haben mit Lord und Lady Rothers diniert, und mit einigen Bekannten, die sie in Paris kennengelernt haben.«
»Ah ja, und alle sind Förderer der Kunst, ohne Zweifel«, bemerkte Quin fast höhnisch. »Der erlauchte Zirkel meines Onkels!«
»Warum musst du immer so schlecht von ihm denken? Er ist freundlich zu mir, mehr nicht.«
»Mein Onkel ist ein feiner Mann«, erwiderte Quin. »Es sind seine Freunde, denen ich nicht traue. Übrigens, meine Süße, was ist das? Das hier, genau unter deinem Kinn? Eine Narbe? Oder etwas anderes?«
Ihre Röte vertiefte sich, als er mit dem Rücken eines Fingers über ihre Halsbeuge strich. »Es ist gar nichts«, schnappte sie. Sie musste es nicht sehen, auch wenn er versuchte, eine Art schuldbewusster Reaktion bei ihr hervorzurufen. »Da ist nichts, und da ist auch noch nie etwas gewesen, Quin«, sprach sie weiter. »Chesley ist der Freund meines Vaters. Hier in London ist er mein väterlicher Freund. Er sieht mich als seine Schutzbefohlene, um Gottes willen! Wie oft müssen wir diesen dummen Streit denn noch haben?«
Er wandte den Blick von ihr ab. »Ich kann nichts dagegen tun, Viviana.« Fast würgte er diese Worte heraus. »Du – du machst mich wahnsinnig. Chesley hat seine Draufgänger um sich versammelt. Ich kann es nicht ertragen, wie alle diese Männer dich ansehen.«
»Und was, bitte, soll ich dagegen tun?«, fragte sie ihn. »Was erwartest du von mir, Quin? Dass ich meine Karriere aufgebe? In ein Kloster gehe? Herrgott noch mal, ich bin Sängerin! Ich brauche nun mal ein Publikum.« Sie griff unvermutet nach dem Handtuch, das auf dem Boden lag, und schob Quin von sich weg.
»Ich – ich könnte dich bezahlen«, schlug er vor. »Jetzt wäre es noch wenig, aber eines Tages würde es sehr viel mehr sein. Dann musst du überhaupt nicht mehr singen.«
Sie sah ihn ungläubig an. »Manchmal, Quin, glaube ich nicht, dass du mich verstehst«, flüsterte sie. »Ich muss singen. Das hat nichts mit Geld zu tun.«
Er beobachtete sie fast misstrauisch, als sie aufstand und sich abtrocknete. Viviana unternahm keinen Versuch, ihre Nacktheit vor seinem begehrlichen Blick zu verstecken. Denn schließlich gehörte sie ja doch ihm. Er hatte sie gekauft und für sie bezahlt. Sie hatte zugelassen, dass er das tat – auch wenn sie anfangs wie eine Tigerin dagegen angekämpft hatte.
»Leg dich aufs Bett, Viviana«, befahl er, als sie sich abgetrocknet hatte. »Mach deine Beine breit. Ich will dich.«
Einen Moment lang dachte sie daran, sich zu weigern. Aber mochte Gott ihr beistehen, sie begehrte ihn. Auch wenn es jetzt so weit gekommen war. Sie hatte genügend Wunden und Narben für ein ganzes Leben – wie er ohne Zweifel auch. Kleinliche Eifersucht und Bitterkeit hatten sich in ihre Herzen gefressen. Er war zu jung. Zu unerfahren. Und sie – nun, sie war einfach zu einsam. Sie brauchten einander. Das sah er doch auch so?
Sie verstand es. Dennoch sehnte sie sich nach der Lust und dem Frieden, die sein männlicher junger Körper ihr geben konnte. Sie sehnte sich nach ihm. Und sie erinnerte sich an eine Zeit, es war noch gar nicht lange her, als es genug gewesen war, um ihr Kraft zu geben. Eine Zeit, als sie einander angebetet hatten und zusammen all die süßen Verzückungen der ersten Liebe erfahren hatten.
»Leg dich hin«, wiederholte er wieder, entschlossener dieses Mal. »Du bist meine Geliebte, Viviana! Ich habe das Recht, das von dir zu verlangen.«
Und auch das war die absolute Wahrheit. Viviana warf das Handtuch fort und schlug die Bettdecke zurück. Dann tat sie, was er verlangt hatte.
Das Licht des frühen Nachmittags fiel über seine Schulter, als Quin sich seiner Kleider entledigte – mit der geübten Fertigkeit eines Mannes, der daran gewöhnt war, dass seine Bedürfnisse und Launen befriedigt wurden. Er war schon hart und erregt. Wie immer.
Nachdem er seine braungelben Hosen heruntergezogen und zur Seite geworfen hatte, kam er auf eine fast raubtierhafte Art zu ihr ins Bett, legte sich auf sie und drang ohne Vorspiel in sie ein. Viviana keuchte bei dieser Invasion. Ihr Körper bäumte sich auf.
»Du gehörst mir, Viviana«, flüsterte er und stieß seine ganze Länge in sie hinein. »Vergiss das niemals.«
Sie gehörte ihm nicht, aber sie widersprach auch nicht. Stattdessen stemmte sie die Füße gegen das Bett und drängte ihm ihre Hüften entgegen, um seine tiefen Stöße besser in sich aufnehmen zu können.
Daraufhin umschloss er ihre Hände mit seinen, Handfläche an Handfläche, zog sie hoch über ihren Kopf und auf das Kissen, und hielt sie dort fest, während er sie ritt. In ihrer Lust waren sie wie Katzen, sie und Quin, fauchend und zankend, auch wenn sie füreinander brannten. Sie spürte die treibende Lust in seinem Körper – und in ihrem, trotz der Kränkung, die er ihr zugefügt hatte. Welche Sorte Frau war sie, sich nach diesem hier zu sehnen und daran festzuhalten?
Es war, als hätte Quin ihre Gedanken gelesen. »Du gehörst mir, Viviana«, sagte er rau, beugte sich über sie und starrte ihr in die Augen. Noch immer presste er ihre Hände hoch über ihrem Kopf auf das Kissen. »Du gehörst mir, verdammt, und keinem anderen. Sag es!«
Viviana wandte den Kopf ab. Es war den Kampf nicht wert. »Ich gehöre dir«, wisperte sie.
»Sieh mich an, Viviana«, befahl er und stieß schneller in sie hinein. »Sieh mich an, wenn ich es mit dir tue. Ich schwöre dir, manchmal denke ich, du willst mir das Herz brechen. Sag es noch einmal. Du gehörst mir und keinem anderen!«
Sie sah ihn an, voller Trotz. »Ich gehöre mir, Quin«, fauchte sie, und ihre Stimme zitterte. »Ich gehöre nur mir selbst. Aber ich habe mich entschieden, mit dir zusammen zu sein. Das ist etwas anderes.«
Aber Quin schien ihre Worte nicht zu hören. Er hatte die Augen geschlossen, und sein Gesicht wirkte angespannt, als er sie noch heftiger ritt. Sie fühlte ihren Bauch gegen seinen drücken, drängend und gierig. Oh Gott, er war so unglaublich gut! Sie wollte sich in diesem rein körperlichen Akt verlieren. Wollte nichts fühlen als die Vereinigung ihrer Körper.
Er spürte es, und das Drängen trieb ihn an. Auf diese eine Weise zumindest verstand er sie. »Sì, caro mio«, keuchte sie. »Ja, ja. Genau so.«
Schweiß perlte an seinen Schläfen. Sein Gesicht war starr vor Anspannung, stark und wunderschön. »Gott, Vivie!«, stöhnte er. »Oh Gott, ich bete dich an!«
Sie machte ihre Hände von ihm frei und klammerte sich an ihn, rang keuchend nach Atem. Er stieß wieder und wieder, härter noch, dann ein letzter, vollkommener Stoß. Viviana schrie auf, ihr Körper zitterte. Die Lust riss sie fort, verschlang sie, löschte alles Denken und alle Vernunft.
Er fiel über sie, seine Brust hob sich, sein Gewicht drückte sie tief in die weiche Matratze. Sie strich mit einer Hand über seinen festen, muskulösen Rücken und spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. »Oh, amore mio«, murmelte sie. »Oh, ti amo, Quin. Ti amo.«
Und in diesem Moment liebte sie ihn. Sie liebte ihn von ganzem Herzen, auch wenn sie sich nie gestattet hatte, diese Worte auszusprechen – nicht in einer Sprache, die er verstehen konnte. Beruhigt und erschöpft lauschte sie einfach eine Weile auf seinen Atem. Es war die schlichteste aller Leidenschaften: in den Armen dieses Mannes zu liegen, befriedigt und glücklich, und ihm einfach zu lauschen.
Aber der Frieden währte nicht lange. Bald stritten sie wieder über die Ereignisse des vergangenen Abends. Quin hatte offensichtlich von jedem Mann Notiz genommen, der ihr die Hand geküsst oder ein Glas Champagner geholt hatte. Es war ein so dummes, anmaßendes, unreifes Verhalten, das Quin da zeigte – und je größer ihr Ruhm geworden war, desto schlimmer war es geworden. Aber Viviana kannte kein Pardon. Sie war mit ihrer Weisheit am Ende, und das sagte sie ihm auch.
Quin reagierte überaus heftig. »Gott, wie ich diese Art hasse, auf die wir leben müssen!«, rief er schließlich. »Ich habe das Recht, dich zu beschützen. Ich habe das Recht, Viviana, der ganzen Welt zu zeigen, dass du mir gehörst.«
»Quin, amore mio, wir haben doch schon tausendmal darüber gesprochen«, flüsterte sie. »Es würde meinen Vater umbringen, wenn er davon erführe. Er hat nicht alles geopfert, um mich nach England schicken zu können, nur, damit ich dort die Geliebte eines reichen Mannes werde.«
Genau genommen hatte ihr Vater sie aus genau dem entgegengesetzten Grund fortgeschickt. Aber das würde sie Quin nicht sagen. Es würde bei ihm nur zu einer noch wütenderen Reaktion führen.
»Aber wegen der Kreise, in denen seine Tochter verkehrt, macht Signor Alessandri sich keine Sorgen?«, entgegnete er gereizt. »Es kümmert ihn nicht, wer dich mit Blicken auszieht? Und Lord Rothers! Grundgütiger Gott, Vivie! Seine Protektion hat ihren Preis. Er hat mit der Hälfte der Schauspielerinnen im West End geschlafen.«
»Nun, mit mir hat er nicht geschlafen«, erwiderte sie. »Und das wird er auch nicht. Und er wünscht es auch nicht. Mein Gott, Quin, er war in Begleitung seiner Frau. Was, glaubst du, ist passiert? Eine ménage à trois auf Chesleys Esszimmertisch?«
Er presste die Lippen zusammen und machte eine Bewegung, als wollte er ihr den Rücken zukehren. »Ja, mach nur weiter so. Mach einen Witz daraus, Viviana. Mach einen Witz aus mir.«
Sie legte die Hand auf seine Brust. »Oh, caro mio, du bist so jung!«
Er drehte sich abrupt zu ihr um. »Verdammt, Vivie, ich hasse es, wenn du das sagst!«, stieß er hervor. »Hör auf, so zu tun, als wäre ich ein dummer grüner Junge. Ich bin fast einundzwanzig.«
»Ja, Quin, und als das hier angefangen hat, waren wir uns einig, dass–«
»Ich weiß, zum Teufel!«, unterbrach er sie. Er legte die Hand auf ihre und drückte sie heftig. »Ich weiß. Und ich werde mein Wort halten, Viviana. Aber es gefällt mir verdammt noch mal ganz und gar nicht.«
Bedrückendes Schweigen breitete sich in Vivianas Schlafzimmer aus, nur durchbrochen vom fernen Lärm, der von Covent Garden her zu hören war. Irgendwann rollte sie sich auf den Bauch und stützte sich auf die Ellbogen, um Quin anzusehen, wie sie es so oft getan hatte am Beginn ihrer stürmischen Beziehung.
Du lieber Himmel, er war so wunderschön! Halb noch Junge, halb schon Mann. Sie liebte ihn mit einer nahezu atemberaubenden Intensität. Und ganz plötzlich erkannte sie, dass sie es trotz allem nicht ertragen konnte, ihn zu verlieren. Auch nicht nach all den harten Worten – und davon waren viele von ihnen beiden gesagt worden – konnte sie sich ein Leben ohne Quin vorstellen. Aber gab es irgendeine Hoffnung? Sie betete darum, nicht nur für sich selbst.
»Quin, caro mio«, rief sie impulsiv. »Sag mir eines: Wohin wird das Leben dich führen?«
Er hob den Kopf vom Kissen und sah sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen an. »Wie meinst du das, Vivie?«
Viviana zuckte langsam die Schultern. »Ich weiß nicht genau … Hast du vielleicht daran gedacht … fortzugehen? Ins Ausland, meine ich?«
»Ins Ausland?«, fragte er verständnislos. »Guter Gott! Wohin denn?«
»Auf den Kontinent?« Viviana zog die Augenbrauen hoch. »Vielleicht nach Venedig oder nach Rom?«
Er lachte. »Warum um alles in der Welt sollte jemand England verlassen?«
Viviana fühlte einen Anflug von Zorn. »Vielleicht weil es ein erdrückender, moralisierender Ort ist?«
»Vivie, ich bin hier zu Hause.« Er strich ihr übers Haar. »Lass uns nicht mehr davon reden, dass irgendjemand irgendwohin geht, einverstanden?«
»Aber was ist mit deiner Zukunft, Quin?«, beharrte sie. »Was willst du mit deinem Leben anfangen?«
»Es leben, würde ich sagen«, entgegnete er. »Was sonst kann man damit anfangen?«
»Aber hast du je gedacht, wir könnten–« Sie verstummte und schluckte mühsam. »Hast du je an … an eine Heirat gedacht, Quin?«
Er riss die Augen auf. »Großer Gott! Mit dir?«
Sie wandte mühsam den Blick ab. »Mit … mit jemandem, den du anbetest«, brachte sie fertig, zu antworten. »Mit – ja, mit mir.«
Seine Gesichtsausdruck wurde sanft. »Oh Vivie«, flüsterte er. »Oh, wenn das Leben doch so einfach wäre.«
Sie bedrängte ihn weiter, sich ganz und gar der Kränkung bewusst, die ihr Stolz würde ertragen müssen. »Vielleicht ist es so einfach, Quin«, erwiderte sie. »Du sagst, du kannst ohne mich nicht leben. Dass du mich für dich haben möchtest. Und ich frage dich, wie sehr du dir das wünschst.«
Er sah sie von der Seite an. »Ist das der Grund für all das Zögern?«, wollte er wissen. »Spekulierst du auf eine Ehe? Oh Viviana! Du wusstest doch, dass ich dich nicht heiraten kann, als wir diese Sache begonnen haben! Du wusstest es, oder nicht?«
Viviana schüttelte den Kopf. »Ich hoffe auf nichts, Quin«, erwiderte sie. »So ist es nicht.«
Aber Quin sah sie noch immer ungläubig an. »Um Gottes willen, Viviana, ich bin der Erbe eines Grafentitels!«, rief er. »Hast du eine Vorstellung davon, was für eine Verpflichtung das bedeutet? Wenn ich irgendwann heiraten muss – was mindestens noch ein Jahrzehnt Zeit hat, hoffe ich–, wird Mum mich mit einer blassen blonden englischen Miss verheiraten. Und deren Vater wird einen ganzen Rattenschwanz von Titeln tragen und fünfzigtausend Pfund in irgendeinem Fonds besitzen. Ich werde dabei nur wenig zu melden haben.«
Viviana musterte ihn aus schmalen Augen. »Oh! Ich bin also zu alt und zu ausländisch und zu gewöhnlich für die große Hewitt-Dynastie? Ist es das?«
»Also hör mal, Vivie«, tadelte er sie und setzte sich auf. »Das habe ich nie gesagt.«
»Ich glaube, das musst du auch nicht!« Viviana packte das Laken mit einer Hand, als die Übelkeit sie wieder packte. Warum in Gottes Namen hatte sie dieses Thema angeschnitten? Er hatte ja recht. Sie hatte die ganze Zeit gewusst, dass diese Beziehung keinen Bestand haben würde. Aber sie hatte gefragt, und jetzt gab es keinen Weg zurück.
»In einigen Wochen, Quin, wirst du einundzwanzig!« Sie zitterte innerlich vor Zorn. »Dann wird es bei dir liegen, wen du dir zum Heiraten aussuchst. Und wage nicht, etwas anderes zu behaupten! Damit beleidigst du meine Intelligenz.«
»Ach Vivie!« Er verzog das Gesicht und sah ganz wie der ungeduldige junge Mann aus, der er war. »Wir haben noch unser ganzes Leben vor uns! Ich werde sobald niemanden heiraten. Warum sollen wir uns das verderben, was wir jetzt haben?«
Sie bedachte ihn mit einem spöttischen Lächeln. »Sì, sie ist eine langweilige Angelegenheit, die Zukunft, nicht wahr?«
Quin bemerkte den Sarkasmus nicht. »Braves Mädchen! So gefällst du mir«, sagte er und küsste sie wieder. »Schau, Vivie, ich habe dir etwas mitgebracht. Etwas, was dich aufmuntern wird.« Er stieg aus dem Bett und suchte in seinen Manteltaschen nach etwas, dann kam er mit einer kleinen Schachtel zurück. »Mach auf«, befahl er.
Viviana öffnete den Deckel und hielt den Atem an. In der Schachtel lag ein Ring: ein breiter, ziselierter Reif mit einem großen, quadratischen Rubin. Es war ein wunderbares Stück Juwelierkunst. Doch Viviana gab Quin die Schachtel zurück. Warum bestand er darauf, sie mit Geschenken zu überhäufen? Was sie wollte, war etwas, was sein Geld nicht kaufen konnte – und dieser Ring hatte Quin zweifelsohne weitaus mehr gekostet, als sogar er sich leisten konnte.
Quin schob ihr die Schachtel wieder zu. »Steck ihn an, Vivie«, beharrte er. »Steck ihn an, aber versprich mir eines.«
Widerstrebend schob Viviana den Ring auf ihre rechte Hand. »Ich … also gut, ich werde es versuchen.«
»Versprich mir, dass du ihn behalten wirst«, verlangte er. »Versprich mir, dass du ihn nie verkaufen wirst, und dass du ihn von Zeit zu Zeit tragen und dabei an mich denken wirst.«
Viviana starrte den Ring an und drängte die Tränen zurück, die ihr Kummer und Zorn und Liebe und hundert andere widerstreitende Gefühle in die Augen trieben. »Ich höre nie auf, an dich zu denken, Quin«, wisperte sie.
»So wie ich niemals aufhöre, an dich zu denken, Vivie.« Aber in seinen Augen lag leichte Skepsis. »Nun, wann musst du im Theater sein?«
»Um sechs«, antwortete sie hohl.
»Nun, und ich muss auch bald gehen«, sprach er weiter. »Wir verschwenden kostbare Zeit! Wir sollten uns doch viel besser miteinander vergnügen. Du bist das wundervollste Geschöpf auf dieser Erde, Viviana! Deine Augen rauben mir den Atem, und der Anblick deiner Brüste lässt mir fast das Herz stehenbleiben. Leg dich hin, meine Liebe, und lass mich dich noch einmal lieben.«
Jetzt sprach er von lieben. Benutzte nicht mehr die vulgären Worte von vorhin.
Sie hätte sich ihm verweigern sollen. Sie hätte ihn in genau diesem Moment auffordern sollen, aus ihrem Bett zu verschwinden. Aber die Erinnerung an eine süßere, glücklichere Zeit war so schmerzlich nah, und die Zukunft lag so grau und trostlos vor ihr. Deshalb drehte Viviana sich auf den Rücken und ließ zu, dass sein starker, kraftvoller Körper sich ein letztes Mal mit dem ihren vereinte.
Als Quin ihr Bett später verließ, hatte seine Stimmung sich gebessert, auch wenn sein Blick noch immer ein Quäntchen Argwohn verriet. Viviana beobachtete ihn, als er sich ankleidete. Sie ergötzte sich an seiner geschmeidigen, schlanken Schönheit und fragte sich, nicht zum ersten Mal, wie er in einigen Jahren aussehen würde, in der vollen Blüte seiner Männlichkeit. Schon jetzt waren seine Schultern breit und sein Kinn von Bartstoppeln beschattet, die ebenso dicht und dunkel waren wie sein Haar.
Er zog sich das Hemd über den Kopf, und sie bewunderte einmal mehr die Ebenmäßigkeit seiner Gesichtszüge. Die hohe Patrizierstirn, den geraden Nasenrücken, die hohen, ausgeprägten Wangenknochen, und, das Verwirrendste von allen, die Augen, die die Farbe der Ägäis hatten, wenn die Abenddämmerung heraufzog. Aber wie hatten sie eine solche Närrin sein und zulassen können, dass er ihr das Herz stahl?
Sie versuchte, unbeteiligt zuzusehen, als er seine Strümpfe anzog und in seine Hosen stieg. Es war kein Zorn, den sie für ihn empfand, nein. Es war eher ein resigniertes Akzeptieren. Sie gab ihm auch nicht die Schuld. Es war ihre eigene leidenschaftliche, romantische Natur, die sie in diese Lage gebracht hatte. Aber ohne Leidenschaft konnte man nicht singen. Und man konnte ohne Romantik nicht wahrhaft leben. Viviana akzeptierte die Tatsache, dass man auf dieser Erde das Schlechte und das Gute hinnehmen musste, wie es kam, und dass man dafür mit einem reichen Leben belohnt wurde.
Quin zog seinen Mantel an, dann beugte er sich über das Bett, wobei er sich mit beiden Händen auf der Matratze abstützte. Er hielt ihren Blick für einen Moment gefangen. Seine Augen sahen sie so intensiv an, dass ihr für den Bruchteil einer Sekunde zumute war, als würde er ihr in die Seele schauen. »Sag mir eines, meine Liebe«, verlangte er zu wissen. »Liebst du mich?«
Er überraschte sie ein wenig; er hatte diese Frage noch nie gestellt. Und Viviana wusste, was ihr Herz fühlte, genau so sicher, wie sie wusste, wie ihre Antwort lauten musste. Sie hatte sich zumindest noch ein bisschen Stolz bewahrt. »Nein, Quin«, antwortete sie. »Ich liebe dich nicht. Und du liebst mich nicht.«
Seine Augen blickten wie die eines alten Mannes, als er sie ansah. »Nein. Vermutlich tue ich das nicht.«
Sie zuckte die Schultern. »So ist es das Beste, oder nicht?«
Er richtete sich abrupt auf. »Nun, Viviana«, entgegnete er. »Zumindest bist du ehrlich.«
Aber sie war nicht ehrlich. Sie hatte ihm ins Gesicht gelogen. Als sie ihm nachsah, wie er mit großen Schritten zur Tür ging, fragte sie sich flüchtig, ob er vielleicht dasselbe getan hatte.
Nein. Nein, es war unmöglich.
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Viviana stieß den Atem aus, den sie angehalten hatte, dann schloss sie die Augen und zwang sich, nicht zu weinen. Sie lauschte auf seine schweren Schritte, als er von ihr fortging. Eine Träne rollte an ihrer Nase herunter und tropfte mit einem leisen Plopp! auf ihr Kopfkissen.
Abrupt setzte sie sich im Bett auf. Nein, bei Gott, sie würde nicht weinen. Nicht um ihn. Um niemanden. Nicht einmal um sich selbst. Schon eine Träne war zu viel – und wenn eine weitere folgte, würden sie vielleicht nicht mehr aufhören.
Lucy kam in das Zimmer, als Viviana sich gerade den Morgenrock überzog. »Soll ich jetzt aufräumen, Miss?«, fragte sie.
»Grazie.« Viviana ging zu dem kleinen Schreibtisch am Fenster. »Heute Abend ist meine letzte Vorstellung als Konstanze, Lucy«, sagte sie und schloss die kleine Schublade auf, in der sie ihre mageren Ersparnisse verwahrte.
»Ich weiß, Miss.« Die Zofe begann, das Bett zu richten. »Es ist ein großer Erfolg gewesen, nicht wahr? Was werden Sie als Nächstes tun? Vielleicht sollten Sie runter ans Meer nach Brighton fahren und sich ausruhen. Vielleicht würde Mr. Hewitt Sie begleiten? Es ist schön da, habe ich gehört.«
Viviana verschloss die Schublade wieder. »Eigentlich, Lucy, werde ich morgen nach Hause fahren.« Sie reichte der Zofe ein mitleiderregend schmales Bündel Banknoten. »Hier. Ich wünsche, dass Sie das nehmen. Lord Chesley muss nichts davon erfahren.«
Das Mädchen sah sie ungläubig an und schob Vivianas Hand zurück. »Aber ich kann doch nicht Ihr Geld nehmen, Miss!«, protestierte sie. »Außerdem ist es ja nicht so, als könnten Sie es sich leisten, es zu verschenken. Es steht mir nicht zu, das zu sagen, aber trotzdem … Ich habe es gesagt.«
»Lucy!«, tadelte Viviana sie sanft.
»Was?«, erwiderte das Mädchen. »Glauben Sie, ich weiß nicht, Miss, dass Sie jeden Penny, den Sie entbehren können, nach Hause schicken – und dass Sie Ihren Schmuck verkaufen und altes Brot essen? Abgesehen davon zahlt Lord Chesley mir genug dafür, dass ich mich um Sie kümmere. Und es ist mir eine Freude, das zu tun.«
Mit einem wehmütigen Lächeln drückte Viviana dem Mädchen das Geld in die Hand und schloss deren Finger um die Banknoten. »Nehmen Sie es«, beharrte sie. »Dort, wo ich hingehe, werden weder Papà noch ich es brauchen. Und ich wünsche, dass Sie auf Lord Chesleys Besitz zurückkehren und diesen gut aussehenden Diener heiraten, von dem Sie mir erzählt haben. Das Geld ist mein Hochzeitsgeschenk für Sie. Sie müssen davon eine Wiege kaufen, eine sehr schöne Wiege, für Ihr Erstgeborenes, und an mich denken, wenn Sie das Kind hineinlegen, sì?«
Lucy öffnete die Hand und starrte auf die Banknoten. »Aber wie können Sie England einfach so verlassen, Miss?«, fragte sie. »Was wird aus Ihnen, so weit weg an einem fremden Ort?«
Innerlich vertiefte sich Vivianas Lächeln. Das arme Mädchen war so naiv und provinziell – genau wie Quin. »Es ist mein Zuhause«, sagte sie ruhig. »Es ist Zeit, dass ich dorthin zurückkehre. Und jetzt müssen Sie sich mit mir freuen, Lucy. Ich habe gerade erfahren, dass auch ich heiraten werde.«
Auf dem Gesicht der Zofe breitete sich ein unglaublich strahlendes Lächeln aus. »Oh, wirklich, Miss?«, rief sie und hob beide Hände. »Ich wusste es! Ich wusste, dass Mr. Hewitt das Richtige tun würde, sobald Sie es ihm sagen! Ich wusste, dass alles irgendwie gut wird.«
Viviana spürte heiße, drängende Tränen hinter ihren Lidern und wandte sich abrupt zu ihrem Schreibtisch um. »Ich fürchte, Sie haben mich falsch verstanden, Lucy.« Sie tat, als würde sie ihre Federhalter und ihre Briefbögen ordnen. »Ich fahre zurück nach Hause, um jemanden zu heiraten, den ich … nun, den ich von früher kenne.«
»Oh nein, Miss!« Sie spürte, dass Lucy sie leicht am Arm berührte. »Aber … aber was ist mit Mr. Hewitt?«
Viviana fasste sich und wandte sich wieder um. Eine Opernsängerin zu sein erforderte es, dass man nicht nur eine gute Sängerin, sondern auch eine fähige Schauspielerin war. »Oh, ich denke, wir sind zu einer Übereinkunft gekommen, er und ich«, erwiderte sie und zwang sich zu einem Lächeln.
»Aber ich verstehe nicht, was das soll!«, sagte das Mädchen.
»Lucy, nicht!« Viviana legte der Zofe die Hände auf die Schultern und küsste sie leicht auf die Wangen. »Ich verlasse England, meine treue Freundin. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Alles Gute muss irgendwann ein Ende haben, sì?«
Kapitel 1
In dem Lord Chesley etwas Großes plant
Herbst, 1830
Nun, alles Gute muss einmal ein Ende haben«, murmelte der Marquis of Devellyn, während er die Auslage im Schaufenster des teuersten Juweliers am Piccadilly Circus betrachtete. »Mein Freund, du musst versuchen, die Ehe als den Beginn eines neuen Lebens zu sehen, das reich an Möglichkeiten ist.«
»Ja, und auch voll verdammt vieler Unmöglichkeiten«, entgegnete der Earl of Wynwood.
Devellyn grinste verstehend. »Als da wären?«
»Meine Absicht, in Soho eine kleine verschwiegene Wohnung für Ilsa Karlsson zu mieten. Was ich schon seit Längerem vorhabe.«
Devellyn nickte. »Eine wahre Tragödie!«, pflichtete er bei. »Obwohl Ilsa eine Spur über dem für deine Investitionen üblichen Satz liegt, alter Knabe. Aber wie dem auch sei – wir sind hier, um ein Hochzeitsgeschenk für deine zukünftige Gattin zu kaufen, nicht wahr?«
Er zeigte auf ein Armband, das mit großen roten Cabochons besetzt war. »Nun, wie wäre es damit?«, fragte er. »Mir gefällt die Farbe. Das sind wohl Rubine, oder?«
»Wohl eher Granat, vermute ich«, sagte Devellyn. »Aber denk nicht einmal daran – weder an die Granatsteine noch an die talentierte Miss Karlsson. Deiner Zukünftigen werden die billigeren Steine vielleicht nicht auffallen, aber ihr Drachen von Tante wird es sicherlich bemerken. Und Ilsa, nun, sie wird nie unbemerkt bleiben. In deinem Fall, Quin, müssen es sowohl echte Rubine als auch wahre Treue sein, fürchte ich.«
Lord Wynwoods Gesicht zeigte einen gequälten Ausdruck, und er streckte die Hand nach dem Türgriff aus. »Nun, dann komm! Wir können genauso gut hineingehen und irgendetwas kaufen.«
Eine kleine Glocke bimmelte über der Tür, als sie eintraten. Eine junge Frau polierte die Glasflächen der Holzvitrinen, und der Geruch nach Essig hing in der Luft. »Guten Tag, Mylord«, begrüßte sie Devellyn überschwänglich und mit wissendem Lächeln. »Und Mr. Hewitt, nicht wahr? Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit?«
»Bei sehr guter, Ma’am«, entgegnete der Marquis gut gelaunt. »Aber Mr. Hewitt ist jetzt Lord Wynwood. Sie können ihm dementsprechend mehr abknöpfen.«
Die Frau lachte heiser. »Mylord, Sie und Ihre Späße!«, erwiderte sie. »Ich fürchte, mein Mann steht nicht zur Verfügung, er macht eine Besorgung. Kann ich Ihnen behilflich sein, bis er zurückkommt?«
Wynwood schaute von einem Diamantarmband auf, das er zwar betrachtet, aber nicht wirklich wahrgenommen hatte. »Ich würde gern einige Schmuckstücke sehen«, brachte er fertig zu sagen. »Brillanten vielleicht? Oder – oder Smaragde?«
»Sie müssen seine Unentschlossenheit entschuldigen, Mrs. Bradford«, mischte sich Devellyn ein und zwinkerte der Frau des Juweliers zu. »Mein Freund sucht nach einem Geschenk für einen ganz besonderen Anlass.«
Mrs. Bradford zog die fein geschwungenen Augenbrauen hoch. »Nun, wir von Bradford und Burnet haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Passende für ganz besondere Anlässe zu haben«, sagte sie glatt. »Höre ich da vielleicht Hochzeitsglocken?«
»Wohl eher die Totenglocke, so wie er dreinschaut!«, erwiderte Devellyn lachend. »Es ist eine vertrackte Geschichte, Ma’am: Ein feiner und fröhlicher Bursche wird aus seinem glücklichen Junggesellendasein gerissen. Man legt ihm die Schlinge des heiligen Ehestandes um den Hals, und man wird ihn daran aufknüpfen.«
»Oh, solch ein Anlass erfordert ganz gewiss ein besonderes Schmuckstück«, fiel Mrs. Bradford ein, ohne eine Miene zu verziehen. »Suchen Sie nach einem Ehering, Mylord?«
»Nein!« Lord Wynwoods Kopf fuhr hoch wie der eines aufgeschreckten Jagdhundes. »Ich meine … jetzt noch nicht.«
»Nur ein Verlobungsgeschenk«, fügte Devellyn hinzu. »Anlässlich der Verlobung wird es eine Gesellschaft geben, und er möchte, dass dieses Fest etwas ganz Besonderes für die Braut wird.« Er stieß seinen Freund sanft mit dem Ellbogen an. »So ist es doch, nicht wahr, Quin?«
Wieder schaute Wynwood auf. »Ganz genau so«, stieß er hervor. »Ich will etwas, hmm … Sie wissen schon … etwas ganz Besonderes.«
Mrs. Bradford lächelte breiter und ging zusammen mit Wynwood ein Stück weiter den Ladentisch hinunter. »Und Sie haben an Brillanten gedacht?«, griff sie seine frühere Bemerkung auf. »Aber es soll kein Ring sein. Vielleicht ein Armband? Oder eine Brosche?«
»Eine Halskette, denke ich«, sagte Wynwood.
»Ja, und zwar eine sehr schöne«, fügte Devellyn hinzu. »Sie ist eine ganz besondere junge Dame.«
Ganz und gar Zyniker, begann Wynwood sich zu fragen, wie oft sie alle es wohl noch fertigbrachten, das Wort besonders zu verwenden, bis sie dieses schwierige Geschäft erledigt hätten. Er hatte eine tiefe und andauernde Abneigung gegen Juwelierläden. Und Dev war wegen dieser Heirat verdammt penetrant, fast, als wollte er ihn drängen, es so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Gerade jetzt drängte Dev ihn weiter und weiter an den Vitrinen entlang: Er schob ihn, schien es, unausweichlich auf die Dauerhaftigkeit des Ehestandes zu.
Ach, verdammt! Am besten, Quin nahm irgendetwas. Etwas Besonderes, natürlich, das schon. Aber für ihn sah alles gleich aus. »Das da.« Er zeigte auf eine schwere Kette aus gehämmertem Gold, besetzt mit einem großen, facettenreich geschliffenen blau-grünen Stein. »Es ist kein Brillant, aber er sieht sehr … groß aus.«
»Hmm.« Der Marquis beugte sich näher. »Das wohl eher nicht, Quin.«
Mrs. Bradford zog leicht die Stirn kraus. »Ist es eine sehr junge Lady, Mylord?«, fragte sie. »Und welche Farbe, bitte, haben ihre Augen?«
»Ihre Augen?« Wynwood dachte darüber nach. »Nun, ihre Augen sind … nun, sie sind eine Art von …« Zum Teufel! Welche Farbe hatten Miss Hamiltons Augen denn nun? »Sie sind schwer zu beschreiben, aber –«
»Grün«, warf Devellyn ein. »Sie ist sehr zierlich und sehr jung, und ihre Augen sind von einem kühlen Moosgrün mit kleinen goldenen Sprenkeln darin. Diese Kette würde sie niederdrücken wie ein Kettenhemd. Wirklich, Quin, ich fange an, mich zu fragen, ob du überhaupt bei der Sache bist.«
Wynwood zog ein finsteres Gesicht. »Du vergisst, Dev, dass ich kein Leben geführt habe, das sich sklavisch darum gedreht hat, eine Reihe kostspieliger, überaus hingebungsvoller Balletttänzerinnen zu vernaschen.«
»Oh nein, natürlich nicht!«, stimmte der Marquis mit einem tiefen Unterton zu. »Die Sorte Frauen, mit denen du verkehrst, ziehen Bares vor.«
Mrs. Bradford entschlüpfte ein undamenhaftes leises Lachen, und sie wandte sich rasch ab. Ihre Wangen hatten sich flammend rot gefärbt.
Devellyn räusperte sich. »Nun, ich würde gern einige Ohrringe sehen, Mrs. Bradford«, fuhr er fort, als hätte es keine peinliche Situation gegeben. »Ich habe Lust, für Sidonie ein Paar Saphir-Ohrringe zu kaufen; passend zu dem Kleid, das sie vor einigen Wochen auf Mums Dinnerparty getragen hat. Was hältst du davon, Quin?«
»Ich denke, du solltest ihr jede Woche ein Paar kaufen«, entgegnete sein Freund. »Andernfalls könnte sie zur Vernunft kommen und sich anfangen zu fragen, warum sie dich geheiratet hat.«
Devellyn grinste und fuhr fort, Mrs. Bradford zu veranlassen, drei oder vier samtbeschlagene Tabletts hervorzuziehen, die er mit akribischer Ehrerbietung betrachtete. Er war, wie Wynwood festgestellt hatte, in der Tat sehr eifrig dabei, seiner eigenen Frau eine Freude zu machen.
Wynwood jedoch hatte inzwischen jegliches Interesse an seinem Vorhaben verloren. Oh, natürlich wünschte er, Miss Hamilton zu erfreuen. Er wünschte es wirklich. Aber die Wahrheit war, dass er Esmée nicht so gut kannte, wie ein Gentleman es sich wünschen würde, seine Verlobte zu kennen. Natürlich wusste er, dass sie sehr schön war. Sie war zudem erfrischend pragmatisch und geradeheraus. Er hätte eine dumme, alberne Londoner Miss nicht ertragen können, oder eine, die einen Mann lieber manipulierte als ihm die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Gott wusste, dass er davon für ein ganzes Leben genug gehabt hatte.
Esmée liebte ihn nicht. Natürlich nicht. Das war nur eine der vielen direkten Wahrheiten, die sie ihm gesagt hatte. Aber für Quin war Liebe ohnehin weder nötig noch befriedigend. Er und Esmée würden lernen, leidlich miteinander zurechtzukommen. Daran hatte er keinen Zweifel. Er freute sich sehr darauf, sie in seinem Bett zu haben, und noch mehr darauf, sie zu schwängern – vorzugsweise mit dem Sohn, den seine Mutter so sehr herbeisehnte.
Der Tod seines Vaters war verfrüht gewesen, er war unerwartet und zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Und im Alter von knapp dreißig Jahren hatte Quin nicht den Wunsch verspürt, sein sorgloses Junggesellenleben aufzugeben, um die Hewitt-Dynastie vor dem Zusammenbruch zu retten. Seine Mutter jedoch befand sich jetzt in einem Zustand, der einer Panik sehr nahe kam, auch wenn ihre gute Erziehung und wohlbewahrte Haltung das vor allen verbargen – bis auf jene, die sie gut kannten. Würde Quin ohne einen Erben sterben, würde alles an den verabscheuten Cousin Enoch fallen, der sie – und seine Mutter übertrieb dabei durchaus nicht – sofort auf die Straße setzen würde. Seine Mutter wäre dann von Lord Chesley, ihrem jüngeren Bruder, abhängig oder würde nach Oxfordshire verbannt werden, um dort bei Quins Schwester Alice zu wohnen. Und seine Mutter würde eher sterben, als eine dieser beiden Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.
Es musste also sein – für den Fortbestand der Dynastie. Er und Esmée würden sich nach Buckinghamshire zurückziehen und drei oder vier Kinder haben und ein geordnetes Leben führen. Dafür, so sagte sich Quin, war er bereit, jedes notwendige Opfer zu bringen. Und diese Opfer schlossen seine Fantasien bezüglich Ilsa und seine schamlose und verruchte Lebensweise ein – nun ja, jedenfalls den überwiegenden Teil. Das war es wert, Esmée zu haben. Denn wäre sie es nicht, wäre es ein Mädchen, das seine Mutter für ihn aussuchen würde.
»Ich werde diese nehmen«, hörte er Devellyn sagen.
Mrs. Bradford nannte einen Preis, für den man in Chelsea ein Grundstück erwerben könnte. Devellyn stimmte ohne Zögern zu, dann wandte er sich zu Wynwood um. »Was ist mit dir, Quin?«, fragte er. »Was hast du für deine kleine hübsche Schottin ausgesucht?«
»Ich bin unentschlossen«, gab dieser zu. »Ich denke, es ist das Beste, ich frage zuerst Lady Tatton. Sie wird wissen, was ihre Nichte bevorzugt, nicht wahr?«
»Oder Alasdair?«, schlug Devellyn vor, während Mrs. Bradford in den Tiefen des Ladens verschwand, um seinen Einkauf einzupacken. »Du solltest einfach Alasdair fragen, was Esmée seiner Meinung nach gefallen würde. Er mag sie sehr und kennt sie besser als jeder andere. Ich bin überzeugt, dass er dir am besten raten kann.«
Wynwood spürte Ärger in sich aufsteigen. Sir Alasdair MacLachlan war einer ihrer amüsantesten, aber auch übel beleumdetsten Freunde. Zumindest war er das bis jetzt gewesen. Denn zurzeit benahm Alasdair sich sehr seltsam. Wie Esmée war er Schotte. Und wegen eines komplizierten Missgeschicks, bei der eine Maskerade in einer Silvesternacht ebenso eine Rolle spielte wie viel zu viel Whisky, schien Alasdair der Vater von Esmées kleiner Schwester zu sein. Kaum jemand wusste davon. Wynwood gehörte dazu, und er wurde es langsam verdammt leid, dass Devellyn Esmée und Alasdair immer im selben Atemzug nannte. Was zum Teufel bezweckte der Mann damit?
In diesem Moment war von irgendwoher im Laden das Schlagen einer Uhr zu hören.
»Teufel auch!«, rief Devellyn. »Geht die Uhr genau? Ich komme zu spät zum Tee im Grosvenor Square. Mum wird meinen Kopf auf ihrem besten Silbertablett servieren lassen. Mrs. Bradford? Mrs. Bradford! Ich brauche das Päckchen, bitte.«
Die Frau des Juweliers kam in den Laden geeilt und legte ihm einen Kaufbeleg vor, auf dem die Unterschrift des Marquis’ erforderlich war. Nachdem er etwas Unleserliches daraufgekritzelt hatte, schob Devellyn die Schachtel in seine Tasche und klopfte Quin aufmunternd auf die Schulter, ehe er aus der Tür eilte. »Kopf hoch, alter Junge!«
Mrs. Bradford notierte Devellyns Kauf in einem grünen Kassenbuch. »Darf ich Ihnen etwas anderes zeigen, Mylord?« Sie sah ihn höflich abwartend an.
»Nein, ich denke nicht, vielen Dank«, lehnte Quin ab und setzte seinen Hut wieder auf. »Ich werde mich nach den Vorlieben der Lady erkundigen und ein anderes Mal wiederkommen.«
Quin ging zurück zur Burlington Arcade und hielt auf den Piccadilly Circus zu, wo geschäftiges Treiben herrschte. Auf der Straße wirbelten trockene Blätter auf, von denen einige so kühn waren, bis zurück in den Eingang der eleganten Arkaden zu wehen. Der Herbsttag war überraschend klar, auch wenn die kalte Luft schon vom Herannahen des Winters kündete.
Er blieb auf dem Fußsteig stehen und kniff die Augen gegen die Helligkeit zusammen. Herrgott, er war sich in dem kleinen, überheizten Juwelierladen wie ein Idiot vorgekommen. Devellyn hatte recht gehabt mit seiner Bemerkung: Er verkehrte nicht mit der Sorte Frauen, für die man echten Schmuck kaufte. Nicht mehr. Und selbst wenn er es einmal getan hatte, dann waren es Rubine gewesen, und nichts weniger.
Das war der Grund, warum ihm die Granatsteine aufgefallen waren. Er hatte sie gesehen, und einen Moment lang hatte er an sie gedacht … an Viviana Alessandri. Er hatte seinen Irrtum sofort bemerkt. Granat wäre niemals gut genug für sie gewesen; so viel hatte er gewusst, auch ohne zu fragen. Der dunkle, blutrote Rubin hatte immer für Viviana gestanden, und ihre zarte, leicht olivfarben getönte Haut hatte sie mit ihrem Schimmer zum Leben erweckt. Deshalb hatte er jedes Armband, jede Brosche und jede Halskette mit der äußersten Sorgfalt ausgesucht, mit der Devellyn die Saphir-Ohrringe für seine geliebte Sidonie gewählt hatte.
Doch trotz aller Aufmerksamkeit, die er beim Erwerb eines jedes Stückes hatte walten lassen, hatte Viviana sich umgedreht und es verkauft, ganz herzlos und berechnend – vermutlich, um ihre Schneiderin zu bezahlen oder ihre Spielschulden zu begleichen. Was natürlich ihr Vorrecht war als seine von ihm ausgehaltene Geliebte. Oder genauer gesagt: als Hure. Und am Ende dieser schrecklichen, herzzerreißenden Affäre hatte er sich geschworen, niemals wieder ein Geschenk für eine Frau mit Gefühl auszuwählen – auch nicht die unbedeutendste Kleinigkeit. In den vergangenen neun Jahren war er nicht einmal in die Nähe eines Juwelierladens gegangen. Bis heute.
Quin setzte seinen Weg die Straße hinunter in Richtung Green Park fort, aber schon nach wenigen Metern blieb er gegenüber vom Hotel Bath stehen. Eine elegante vierspännige Kutsche hatte kurz vor der Ecke angehalten, und ein Gentleman und eine Lady schienen in einen Disput verwickelt zu sein, wobei die Hände ebenso heftig zum Einsatz kamen wie ihre Worte. Quin erkannte auf den ersten Blick, dass es reiche Leute waren – und Ausländer. Das Erste ließ sich aus ihrer feinen Kleidung schließen, das Letztere daraus, dass Engländer, die der guten Gesellschaft angehörten, eher sterben würden, als dass sie sich auf offener Straße wie die Fischweiber stritten.
Das Gesicht der Lady konnte Quin nicht sehen, aber seltsamerweise war er überzeugt, dass sie umwerfend schön war. Der Herr war viel älter als sie; er stand gebückt da und wirkte zerbrechlich. Quin fing einige Wortfetzen der fremden Sprache auf. Italienisch oder etwas Ähnliches. Als wäre er ein ungehobelter Bauer blieb Quin stehen, um zu gaffen, auch wenn er nicht sagen konnte, warum er es tat.
Aus den heftigen Gesten und dem lauten Schimpfen ließ sich die Ursache des Streites leicht bestimmen. Die Lady wünschte, dass der Gentleman in die Kutsche einstieg. Der Gentleman wünschte, zu Fuß zu gehen. Der Streit setzte sich noch um einige scharfe Worte weiter fort, dann ging der alte Gentleman davon, als wollte er seine Begleiterin allein zurücklassen.
Schließlich hob die Frau die Hände und zeigte damit an, dass sie nachgab. Der Gentleman zögerte. In einer fast mütterlichen Geste griff die Lady nach seinem Schal und legte ihn fester um seinen Hals. Dann steckte sie die beiden Enden in seinen Mantelaufschlag. Der Gentleman nahm ihr Gesicht in beide Hände und küsste sie auf die Wangen. Dann ging er in Richtung Mayfair davon.
Und dann drehte sie sich um.
Und Quin spürte, wie plötzlich alle Kraft aus seinem Körper wich.
Als Junge war er einmal aus Übermut mit seinem Pferd über einen Zaun gesprungen, der viel zu hoch gewesen war. Sein Pferd war klüger als er gewesen. Quin war abgeworfen worden und schmachvoll im Gras gelandet. Das Herz hatte ihm bis zum Hals geklopft und eine Ewigkeit lang hatte er nach Luft gerungen.
Dieses Mal dauerte die jungenhafte Schmach nur einen Moment. Sie wurde ersetzt von einer brennenden, rechtschaffenen Wut. Doch die stolze Lady würdigte ihn keines Blickes, ehe sie in die Kutsche stieg und eine behandschuhte Hand hob, um das Zeichen zur Abfahrt zu geben.
Später, als er darüber nachdachte, wurde ihm bewusst, dass er genau genommen nur sehr wenig von ihr gesehen hatte. Da war ein Aufblitzen von Farbe gewesen, als die Frau sich umgewandt hatte, Röcke von tiefem Burgunderrot, wie Juwelen gegen den schwarzen Samt ihres wehenden Umhangs. Ein schwarzer Hut, keck auf die Seite gerückt, und üppige schwarze Bänder, die unter dem Kinn gebunden waren, die sich leicht im Wind bewegten. Diese unverwechselbare stolze Haltung der Schultern. Diese geraden schwarzen Augenbrauen. Die Art, wie sie sich hielt, wie die hochmütigste aller Königinnen war sie in die Kutsche gestiegen, so, als gehörte ihr die ganze Welt.
Ihr Gesicht jedoch – ja, da war etwas anders an ihrem Gesicht. Sie sah nicht mehr so aus wie früher. Die Nase … sie war nicht ganz gerade. Und doch hätte er diese Frau überall wiedererkannt, selbst wenn tausend Jahre vergangen wären. Es war Viviana Alessandri, oh ja. Und noch immer wollte sein Herz nicht aufhören, ihm bis zum Hals zu klopfen.
Am späten Nachmittag, die Kaminuhr im Stadthaus Lord Chesleys in Belgravia ging zehn Minuten nach, hallte das klagend klingende Tock-Tock-Tock des Pendels durch das Haus, als würde es jeden Augenblick seinen letzten Schlag tun. Auch die Stimmung im Salon war seltsam bedrückt. Mit einem leisen Rascheln legte Chesley seine Zeitung beiseite und sah seinen schweigsamen Gast prüfend an.
»Ich denke, ich werde nach oben gehen, Vivie, und vor dem Dinner noch ein wenig schlafen«, sagte er und stand auf. »Man schätzt die Anstrengung einer Reise doch niemals richtig ein, nicht wahr?«
Viviana schaute von dem Bündel flüchtig beschriebener Notenblätter auf und lächelte ihren Gastgeber an. »Sì, es ist anstrengend, Mylord«, stimmte sie zu. »Sogar der kleine Nico war gestern erschöpft. In der Tat ein bemerkenswerter Umstand.«
Chesley ging zu den Fenstern, von denen aus man auf die prächtigen Bäume am Hans Place schaute. »Was möchtest du heute Abend unternehmen, Vivie?«, fragte er nachdenklich. »Sollen wir Digleby besuchen und uns die Proben zu Fidelio ansehen? Oder – warte, ich weiß genau das Richtige! Wir könnten mit den Kindern zu Astley’s gehen!«
Ihre Augen leuchteten einen Moment lang auf. »Aber ist Nicolo nicht noch zu klein?«
»Unsinn«, erwiderte Chesley. »Es wird ihm Spaß machen.«
Viviana schob die Tasse mit dem kalt gewordenen Tee zur Seite. Sie hatte sich vorgenommen, nicht mehr in London zu unternehmen, als absolut notwendig war. Man konnte nie wissen, wem man über den Weg laufen würde. Aber bei Astley’s? Doch die Reise von Venedig nach London war lang gewesen.
»Wie freundlich von dir, Chesley, an die Kinder zu denken!« Sie erhob sich ebenfalls. »Aber vielleicht sollten wir einfach einen ruhigen Abend hier verbringen? Ich fürchte, Papà hat sich mit seinem Spaziergang heute Nachmittag überschätzt. Jetzt ist er oben und spielt mit Nicolo.«
»Aber natürlich, meine Liebe«, stimmte der Earl zu. »Manchmal vergesse ich einfach, wie alt Umberto jetzt ist.«
»Sì, so wie er es vergisst«, erwiderte Viviana.
Chesley ging zu ihr und ergriff ihre Hände. »Vivie, meine Liebe, geht es dir wirklich gut?«, fragte er. »In den letzten beiden Tagen scheinst du irgendwie nicht du selbst zu sein. War es die Reise? Habe ich zu viel von dir verlangt? Habe ich dich wegen dieser Reise nach England zu sehr bedrängt?«
Sie lächelte und drückte seine Hände. »Ich wollte kommen«, log sie unverfroren. »Ich wollte für eine Weile weg aus Venedig.«
Chesley lachte und hob ihre Hände, als wollte er mit ihr im Zimmer herumtanzen. »Oh, tatsächlich! Warum in Venedig bleiben, wenn man den Winter in England verbringen kann?«, flachste er. »Ich bin sicher, aber es muss all dieser Zorn sein. Nein, gib es zu, Vivie. Du wolltest diesen französischen Marquis loswerden, richtig? Armer Teufel! Wie war doch gleich sein Name?«
»Gaspard.«
»Ja, richtig, der arme Gaspard!«, nickte Chesley.
Viviana lachte. »Gaspard ist lästig geworden«, gab sie zu. »Ich werde ihn nicht vermissen.«
Chesleys Miene wurde ernst. »Aber der Frühling ist noch weit, meine Liebe«, gab er zu bedenken. »Und Buckinghamshire ist im Januar sehr kalt. Ich fühle mich ein wenig schuldig, dich und deinen Vater um so viel gebeten zu haben.«
»Chesley, du musst wissen, dass ich es nicht ertragen kann, Papà aus den Augen zu lassen«, gestand Viviana. »Und um ehrlich zu sein, so hat die Aussicht, an dieser Oper zu arbeiten, ihn wieder jung werden lassen. Ich denke, er war mit seinem Rückzug aus der Welt der Musik und der Oper nicht glücklich.«
Chesley schaute auf die vielen Notenblätter, die auf dem Teetisch lagen. »Nun, was hältst du von Diglebys Libretto, meine Liebe? Wird es deinen Vater ansprechen?«
Viviana zuckte mit den Schultern. »Sì, das glaube ich«, nickte sie. »Aber einen Einwand hätte ich schon jetzt.«
»Was ist es, meine Liebe? Ich schätze deine Meinung.«
»Nun, diese Oper – Nel Pomeriggio –, sie gefällt mir«, antwortete Viviana dem Earl. »Der Titel ist zweideutig, nicht wahr? Am Nachmittag. Man fragt sich unwillkürlich, wie die Charaktere handeln werden.«
»Ja, du hast recht. Sprich weiter.«
Viviana nickte langsam. »Und zugegeben, es enthält Elemente, die ausgesprochen geistreich sind«, sprach sie weiter. »Deshalb halte ich es für passender, die Oper in Paris zur Uraufführung zu bringen. Vielleicht in der Komischen Oper? Aber nicht in der Scala – auch wenn Lord Digleby sie zu favorisieren scheint.«
»Er wünscht sich die Uraufführung weitaus mehr herbei als einen Erfolg«, bemerkte Chesley trocken. »Dein Hinweis ist klug, meine Liebe. Ich werde ihm erklären, wie es in der Welt der Oper und des Belcanto zugeht. Er möchte auch, dass die Maria fünf Arien zu singen hat. Das ist zu viel, meinst du nicht auch?«
Viviana schüttelte den Kopf. »Papà wird schon für das richtige Maß sorgen«, sagte sie zuversichtlich. »Aber du wirst für diese Rolle eine sehr gute Sopranistin brauchen.«
Lord Chesley zwickte sie ins Kinn, als wäre sie noch ein Kind. »Ja, das weiß ich, meine liebe Vivie«, pflichtete er ihr bei. »Du hast doch nicht etwa gedacht, du wärest nur deines guten Aussehens wegen eingeladen worden, oder?«
Viviana empfand einen Moment lang Panik. »Oh nein, das kann ich nicht!« Sie setzte sich wieder hin. »Oh, Chesley, das kann ich nicht für dich tun. Nicolo ist noch zu klein, und ich – ich–«
»Nicolo ist jetzt vier Jahre alt«, unterbrach Chesley sie. »Und du hast in all den Jahren in nur in zwei Produktionen gesungen.«
»Ja, und das war zu Hause, in Venedig«, entgegnete sie. »Nicht in Paris, geschweige denn in Mailand.«
»Und überhaupt nicht in den letzten beiden Jahren.«
Viviana wandte den Blick ab, ihre Augen starrten in die Tiefen des Zimmers. Sie hatte nicht den Mut, Chesley die Wahrheit zu sagen – oder ihm von ihren Ängsten zu erzählen. »Ich musste um meinen Ehemann trauern«, sagte sie ruhig. »So viel war ich ihm wohl schuldig, oder nicht?«
Der Earl schüttelte den Kopf. »Lass deine Stimmbänder nicht einrosten, mein Mädchen«, warnte er. »Außerdem werden bis zur Aufführung noch Monate vergehen.«
Viviana warf einen sehnsüchtigen Blick auf die durcheinanderliegenden Blätter des Librettos. »Nun, wir werden sehen, was Papà alles einfallen wird«, versprach sie. »Aber ich kann wohl sagen, es wird etwas sehr Kluges und absolut Unwiderstehliches sein. Und ich werde mir zutiefst wünschen, meine Kinder zu vernachlässigen und den armen Gaspard völlig zu vergessen.«
»Wenn du mich fragst, so ist Gaspards Schicksal bereits besiegelt«, konterte Chesley trocken. »Aber du und deine Kinder vernachlässigen? Nicht in tausend Jahren.«
In diesem Augenblick ertönte ein entsetzlicher Lärm von der Eingangshalle her. Die Kinder kamen die Treppe heruntergepoltert, ihre schrillen Schreie hallten im Treppenhaus wider. Zwei kleine Mädchen stürmten in einem Wirbelwind aus Pastell und Rüschen in den Salon, gefolgt von Signor Alessandri, der einen kleinen Jungen auf seinen gebeugten Schultern trug.
»Papà!« Viviana sprang von ihrem Stuhl auf. »Essere attento!«
»Oh, es geht ihm gut, Viviana«, beruhigte der alte Mann sie.
»Ich bin ganz sicher, dass es ihm gut geht«, erwiderte Viviana. »Was ist mit dir?«
»Lauf! Lauf! Weiter!«, rief der Junge und drängte seinen Großvater mit den Fersen zum Weitergehen, als gäbe er ihm die Sporen. »Lauf, Nonno!«
Lauf war sein neuestes englisches Wort. Viviana versuchte, finster dreinzuschauen, aber es gelang ihr nicht. »Vieni qui, Nicolo!«, sagte sie und hob den Jungen herunter.
Die beiden Mädchen kicherten miteinander. »Mamma, Lord Chesley hat eine große Sau!«, verkündete die kleinere der beiden.