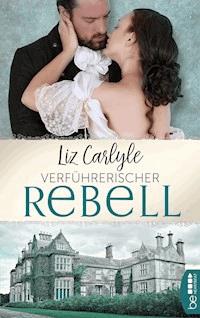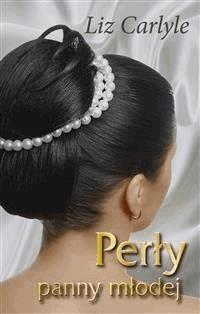4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neville Family
- Sprache: Deutsch
Wahre Liebe überwindet jedes Hindernis
Zum zweiten Mal verwitwet, hat die schöne Antonia, Herzogin von Warneham, der Ehe abgeschworen und will ihre Freiheit niemals mehr aufgeben. Aber als der natürliche Tod des Herzogs angezweifelt wird, muss sie ihr Schicksal erneut in die Hände eines Mannes legen: Gareth Lloyd, einziger Erbe des Herzogtitels von Warneham und des dazugehörenden Anwesens. Dieser tritt nur widerwillig sein Erbe an, bis er zum ersten Mal auf Antonia trifft. Die junge Witwe seines Ziehvaters verzaubert ihn bereits bei der ersten Begegnung, und seine Gefühle für sie erschüttern ihn bis ins Mark. Doch kann eine solche Liebe eine Chance haben?
Weitere historische Liebesromane aus der Neville-Family-Reihe als eBook bei beHEARTBEAT: "Entflammt von deiner Liebe" und "Bezwungen von deiner Leidenschaft".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Wahre Liebe überwindet jedes Hindernis
Zum zweiten Mal verwitwet, hat die schöne Antonia, Herzogin von Warneham, der Ehe abgeschworen und will ihre Freiheit niemals mehr aufgeben. Aber als der natürliche Tod des Herzogs angezweifelt wird, muss sie ihr Schicksal erneut in die Hände eines Mannes legen: Gareth Lloyd, einziger Erbe des Herzogtitels von Warneham und des dazugehörenden Anwesens. Dieser tritt nur widerwillig sein Erbe an, bis er zum ersten Mal auf Antonia trifft. Die junge Witwe seines Ziehvaters verzaubert ihn bereits bei der ersten Begegnung, und seine Gefühle für sie erschüttern ihn bis ins Mark. Doch kann eine solche Liebe eine Chance haben?
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck – auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
VERLORENIN DEINERSEHNSUCHT
Aus dem amerikanischen Englisch vonSusanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Susan Woodhouse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Never Deceive a Duke«
Originalverlag: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Susanne Bartel, Nürnberg
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © hotdamnstock; © thinkstock: NataliiaKucherenko | yurok; © iStock: stocknshares
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5780-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Die seltsame Geschichte der Familie Ventnor begann mit einem Verräter, und es sollte ein gutes Jahrhundert dauern, bis sie ein Ende fand. Die Ventnors waren von überwiegend normannischem Blut und so überzeugt von sich, dass sie kaum außerhalb ihrer Familie heirateten. Auch Mathilde Ventnor war keine Ausnahme. Im fortgeschrittenen Alter von fünfzehn Jahren heiratete sie pflichtbewusst ihren Cousin zweiten Grades, den dritten Duke of Warneham, und gebar ihm in den nächsten Jahren eine so außerordentliche Zahl an Kindern, dass selbst die Ventnors beeindruckt waren.
Alles war in Ordnung bis zu einem kalten Novembertag im Jahre 1688, als der Duke, bekannt als überzeugter Königstreuer, die wohlüberlegte Entscheidung traf, seinen König und – je nachdem, wen man fragte – sein Land zu verraten. Eine verfluchte Rebellion drohte, und der König stand kurz davor, von den Protestanten verdrängt zu werden, die ihm seit seiner umstrittenen Krönung im Nacken saßen. Die Ventnors waren keine Katholiken, sondern gottesfürchtige Opportunisten, die der Lehre der unverfrorenen Anmaßung anhingen. In Anbetracht der Lage floh der Duke nach Salisbury – viele andere von höherem und niedrigerem Rang als er waren ihm bereits vorausgegangen – und schlug sich auf die andere Seite. Die Seite der Gewinner.
Warneham hatte viel, für das zu leben es sich lohnte. Seine Besitzungen gehörten zu den größten Englands, obwohl deren Bestand in der Familie nicht gesichert war. Trotz ihrer bemerkenswerten Fruchtbarkeit hatte Mathilde bislang das Pech gehabt, ausschließlich Töchter zur Welt zu bringen – sechs an der Zahl, jede von ihnen auffallend hübsch. Und jede vollkommen nutzlos. Warneham brauchte einen Sohn, und er brauchte einen Sieg.
Moralisch überzeugt von seiner Entscheidung führte der Duke die Gruppe der Abtrünnigen an, erklomm ein laubübersätes Hügelchen und erblickte mit Erleichterung das Banner William von Oraniens, das in der Brise flatterte. Daneben standen Williams edle Anhänger, riefen laut Warnehams Namen und winkten ihm, zu ihnen zu kommen. Der Duke war so dankbar für das herzliche Willkommen, dass er die Gräben nicht sah, die eifrige Füchse nahe des Fußes des grasbewachsenen Hügels gegraben hatten. Von Warnehams Sporen zum gestreckten Galopp angetrieben, verfing sich sein Pferd in einem der tiefen Erdlöcher und strauchelte. Der Duke landete kopfüber auf dem Lagerplatz, schlug mit dem Schädel auf, brach sich das Genick und tat somit seinen letzten Atemzug im Dienste seines neuen Königs.
Englands Glorious Revolution endete fast so schnell, wie Warneham der Tod ereilte. Wilhelm von Oranien errang einen leichten Sieg, König James floh nach Frankreich, und auf den Tag genau neun Monate später gebar Mathilde Zwillinge – beides kräftige, muntere Knaben. Niemand jedoch wagte es, darauf hinzuweisen, dass die Jungen sich nicht im Entferntesten ähnelten. War der ältere eine Miniaturausgabe seiner Mutter, ein rosiger, pummeliger Cherub, so war der zweitgeborene ein knochiges Geschöpf mit langen Beinen und einem blonden Haarschopf. Beide hatten immerhin eins gemeinsam: Sie ähnelten nicht einmal im Entferntesten dem Vater. Nein, es war ein Wunder. Ein Glücksfall.
König William und Queen Mary bestimmten, dass die Säuglinge an ihren Hof gebracht wurden, wo der König höchstselbst verkündete, dass beide Söhne dem toten Duke wie aus dem Gesicht geschnitten seien. Niemand wagte zu widersprechen, weil – nun, weil dies eine romantische Liebesgeschichte ist. Und was wäre eine Liebesgeschichte ohne einen Hauch Dramatik und eine Prise Verrat?
Warnehams erstgeborenem Sohn sicherte König William den Herzogtitel zu, dem jüngeren versprach er den Befehl über ein Regiment – und nicht nur ihm, sondern auch all seinen Nachkommen, die folgen würden. Alles als Ausdruck der Anerkennung für die Tapferkeit seines Vaters. Mit dieser Entscheidung, so sagt es die Chronik, wurde die Spaltung der Familie auf ewig festgelegt und ihr Schicksal vorbestimmt.
Der Junge, der jetzt in der Mitte der riesigen Bibliothek Warnehams stand, war sich dieser Geschichte nur allzu bewusst. Nachdem mehr als zweihundert Jahre seit den genannten Ereignissen vergangen waren, stellte die Teilung der Familie nicht nur eine Spaltung, sondern genau genommen einen unüberbrückbaren Abgrund dar. Und im nächsten Moment würde sich der Junge auch noch übergeben müssen. Auf die Schuhe der Duchess.
»Steh gerade, Junge.« Die Duchess umkreiste ihn, als begutachtete sie eine Statue. Die dünnen Absätze ihrer Schuhe klackerten laut auf dem Marmorboden.
Der Junge schluckte mühsam, die Galle brannte ihm in der Kehle. Und als wäre die fünf Meilen lange Reise am Morgen in einem nicht besonders stabilen Farmkarren noch nicht Folter genug gewesen, beugte sich die Duchess jetzt auch noch zu ihm herunter, um ihm einen harten Stoß in den Magen zu versetzen. Seine Augen weiteten sich, aber er blieb so aufrecht stehen, wie es ihm möglich war, und zwang sich, unterwürfig zu Boden zu starren.
»Nun, robust genug sieht er aus«, stellte die Duchess nachdenklich fest und warf einen kurzen Blick zu ihrem Gatten. »Er scheint kein Schwächling zu sein. Und angemessen bescheiden gibt er sich auch. Zumindest ist er nicht verwahrlost.«
»Ihr habt recht«, pflichtete der Duke seiner Gattin lässig bei. »Zudem sieht er Major Ventnor ähnlich, Gott sei Dank, vor allem mit den schlaksigen Beinen und den hellblonden Haaren.«
Die Duchess wandte der alten Frau, die den Jungen gebracht hatte, den Rücken zu. »Nun, Warneham, welche Wahl bleibt uns?«, fragte sie. »Wir dürfen die christliche Nächstenliebe nicht außer Acht lassen. Mit Verlaub natürlich, Mrs. Gottfried.« Die letzten Worte hatte sie achtlos über die Schulter gesprochen.
Die alte Frau beobachtete von ihrer Ecke aus abschätzend den Duke, der sein attraktives Gesicht vor Zweifel und Widerwillen verzog. »Christliche Nächstenliebe!«, wiederholte er. »Warum ist es nur immer die christliche Nächstenliebe, auf die geachtet werden soll, wenn man sich Unannehmlichkeiten gegenübersieht?«
Die Duchess faltete anmutig die Hände. »Ihr habt natürlich recht, Warneham«, pflichtete sie ihm bei. »Aber das Kind ist von Eurem Blut – zumindest zu einem sehr kleinen Teil.«
Der Duke schien an dem Hinweis seiner Gattin Anstoß zu nehmen. »Wohl kaum!«, widersprach er brüsk. »Er kann nicht hier bleiben, Livie. Wir können nicht zulassen, dass jemand wie er das Schulzimmer mit Cyril teilt. Was würden die Leute sagen?«
Die Duchess eilte an die Seite ihres Mannes. »Natürlich nicht, mein Lieber«, besänftigte sie ihn. »Das kommt ganz und gar nicht infrage.«
Als Mrs. Gottfried sich erhob, schmerzten ihre arthritischen Knie. Trotzdem knickste sie vor dem Ehepaar. »Habt Mitleid, Euer Gnaden«, bat sie. »Der Vater des Jungen ist im Kampf für England in Rolica den Heldentod gestorben. Gabriel hat niemanden, an den er sich sonst wenden könnte.«
»Niemanden?«, wiederholte die Duchess scharf, während sie ihr einen weiteren herablassenden Blick über die Schulter zuwarf. »Wirklich? Habt Ihr denn keine Familie in England, Mrs. Gottfried?«
Die alte Frau knickste erneut demütig. »Keine direkten Blutsverwandten, Euer Gnaden«, murmelte sie und bereitete sich darauf vor, ihren einzigen Trumpf auszuspielen. »Aber die würden Gabriel natürlich bei sich aufnehmen und ihn als einen der unseren aufziehen – wenn das Euer Wunsch ist.«
»Nein, bei Gott, das ist es nicht!« Warneham sprang abrupt von seinem Stuhl auf und begann auf und ab zu gehen. Er war ein eleganter Mann, noch jung und dynamisch, und bewegte sich wie jemand, der in den Adelsstand hineingeboren worden war. »Ventnor sei verflucht dafür, dass er uns in eine so unerträgliche Lage gebracht hat, Livie«, fuhr er fort. »Wenn ein Mann eine unpassende Ehe eingeht, dann hat er bei Gott kein Recht, fortzuziehen und sich irgendwo im Ausland totschießen zu lassen, König hin oder her. Das ist meine Meinung dazu.«
»Ganz recht, mein Lieber«, gurrte die Duchess. »Aber für Vorhaltungen ist es nun zu spät. Der Mann ist tot, und jemand muss sich um das Kind kümmern.«
»Nun, hier auf Selsdon Court kann der Junge nicht wohnen«, machte der Duke erneut seinen Standpunkt klar. »Wir müssen auch an Cyril denken. Was würden die Leute sagen?«
»Dass Ihr ein anständiger Christenmensch seid?«, schlug seine Frau sanft vor, bevor sie schwieg. Dann klatschte sie plötzlich wie ein kleines Kind in die Hände. »Warneham, ich habe die Lösung! Er wird im Witwenhaus wohnen. Mrs. Gottfried kann sich um ihn kümmern, und wir können diesem seltsamen kleinen Vikar – ach herrje, wie war noch gleich sein Name?«
»Needles«, erwiderte der Duke aufgebracht.
»Ja, richtig, Needles«, sagte die Duchess. »Wir können ihm Bescheid sagen, dass er vorbeikommen und das Kind unterrichten soll.« Sie drängte ihren Mann sanft zurück auf seinen Stuhl. »So schlimm wird es nicht werden, mein Lieber. Außerdem wird es ja nur vorübergehend sein. In gut zehn Jahren kann für ihn ein Offizierspatent erworben werden, dann wird er in die Armee eintreten – so wie sein Vater und sein Großvater vor ihm.«
»Im Witwenhaus also?« Der Duke schien über den Vorschlag nachzudenken. »Das Dach ist undicht, und die Böden sind verrottet, doch ich würde meinen, wir könnten es herrichten lassen.«
In der Mitte des Zimmers stand der Junge so still und starr, wie er es vermochte. Er versuchte einem Soldaten zu ähneln – seinem Vater. Dieses Zusammentreffen, das wusste er, war seine einzige Hoffnung. Und wäre es ihm nicht bewusst gewesen, so hätten die Tränen und Gebete seiner Großmutter heute Morgen, bevor sie das heruntergekommene Gasthaus verlassen hatten, es ihm deutlich gemacht. Er schluckte seinen neun Jahre alten Stolz und die bittere Galle herunter und straffte die Schultern.
»Darf ich etwas sagen, Sir?«, piepste er.
Der Kopf des Dukes fuhr in seine Richtung herum, während sich eine tödliche Stille in der Bibliothek ausbreitete. Zum ersten Mal betrachtete der Duke den Jungen von oben bis unten. »Nun«, sagte er schließlich mit Ungeduld in seiner Stimme, »dann sprich, Junge.«
»Ich … ich würde gern Soldat werden, Euer Gnaden«, bot er an. »Ich würde gern nach Spanien gehen, Sir, und wie mein Vater gegen Napoleon kämpfen. Bis dahin – nun, ich werde Euch keine Probleme machen, Sir. Das verspreche ich.«
Der Duke sah ihn empört an. »Keine Probleme, eh?«, sagte er. »Keine Probleme! Nun, warum bezweifle ich das nur?«
»Es wird keine Probleme geben, Sir«, wiederholte der Junge fest. »Das verspreche ich.«
Doch er konnte nicht wissen – genau genommen konnte es niemand von den Anwesenden wissen –, als welch schrecklicher Irrtum sich das Versprechen herausstellen sollte.
Kapitel 1
Die Sonne schien warm auf das duftende Gras von Finsbury Circus. Gabriel stellte seine Holztiere in einer Reihe auf die Decke. Papas schmale braune Hand senkte sich und griff nach einem davon. »Gabe, wie heißt dieses Tier?«
Gabriel stellte seinen Tiger an den frei gewordenen Platz. »Frederick«, sagte er.
Sein Vater lachte. »Nein, von welcher Gattung ist das Tier?«
Was für dumme Fragen sein Vater stellte! »Frederick ist ein Elefant. Du hast ihn mir aus Indien geschickt.«
»Das ist richtig«, sagte Papa.
Seine Mutter lachte leise. »Gabriel kennt das gesamte Tierreich, seit er drei ist, Charles. Ich bezweifle sehr, dass du ihm noch viel darüber beibringen kannst.«
Seufzend lehnte Papa sich auf der Bank zurück. »Ich habe so viel versäumt, Ruth«, sagte er und nahm ihre Hand. »Zu viel – und ich fürchte, ich werde noch sehr viel mehr versäumen.«
Mamas Gesicht verzog sich. »Oh, Charles, ich wollte nicht –« Rasch zog sie ein Taschentuch aus ihrer Tasche und hustete dezent hinein. »Entschuldige. Ich klinge schrecklich, nicht wahr?«
Papa runzelte die Stirn. »Du musst dich um den Husten kümmern, sobald ich fort bin, meine Liebe«, ermahnte er sie. »Gabriel, wirst du Mama helfen, daran zu denken? Sie muss morgen zu Dr. Cohen gehen, keinen Tag später.«
»Ja, Sir.« Gabriel nahm einen der Affen und reichte ihn seinem Vater.
Papa balancierte die kleine Holzfigur auf seiner Handfläche. »Ist der für mich?«
»Das ist Henry«, erklärte Gabriel. »Er wird mit dir nach Indien zurückgehen. Als Begleitung.«
Papa steckte den Affen in seine Uniformjacke, bevor er Gabriel durch das Haar strich. »Danke, Gabe«, sagte er. »Ich werde dich ganz schrecklich vermissen. Geht es dir hier bei Zayde und Bubbe gut? Dir und Mama?«
Gabriel nickte. Seine Mutter legte die Hand auf Papas Knie. »Es ist besser, wir belassen die Dinge so, wie sie sind, bis sich alles für uns geklärt hat«, sagte sie leise. »Es ist wirklich das Beste. Stört es dich sehr?«
Papa legte seine Hand auf ihre. »Meine Liebe, mich würde nur eines stören – wenn du unglücklich wärst.«
In den Büroräumen von Neville Shipping an der Wapping Wall summte es vor Geschäftigkeit wie in einem Bienenstock. Angestellte eilten mit Verträgen, Frachtbriefen, Versicherungspolicen oder der gelegentlichen Tasse Tee die Treppen hinauf und hinunter. Londons schwüle Augusthitze trug wenig dazu bei, die Hektik zu mindern, obwohl jedes Fenster geöffnet worden war, um die Morgenbrise hereinzulassen, die gerade mal ausreichte, um den Gestank der Themse hereinzutragen.
Miss Xanthia Neville hatte sich über ihren Schreibtisch gebeugt und nahm den Geruch von gärendem Schlamm und brackigem Wasser kaum wahr. Auch das Rumpeln der Wagen der Böttcherei oder das Geschrei der Kahnführer unten am Wasser beachtete sie nicht. Nach knapp einem Jahr in Wapping war sie unempfindlich gegen jegliche Sinneseindrücke geworden. Aber diese verdammte Buchhaltung – das war eine ganz andere Sache! Entnervt warf Miss Neville den Stift auf den Tisch und strich sich das Haar aus dem Gesicht.
»Gareth?« Sie schaute auf, als einer der Angestellten vorüberging. »Siddons, wo ist Gareth Lloyd? Ich brauche ihn sofort.«
Siddons knickste knapp und eilte die Treppe hinunter. Binnen Sekunden tauchte Gareth auf. Seine breiten Schultern füllten die Tür des kleinen Büros, das sie sich teilten. Für einen Moment ruhte sein Blick auf ihrem Gesicht.
»Gut Ding will Weile haben, altes Mädchen«, sagte er lakonisch und stützte die Hand lässig gegen den Türrahmen. »Kommst du mit dem Addieren nicht klar?«
»So weit bin ich noch gar nicht«, gab sie zu. »Ich kann Eastleys Abrechnungsunterlagen nicht finden, um die Summen zu übertragen.«
Langsam ging er zu ihrem Schreibtisch und zog die Papiere unter dem Stapel mit Buchungsunterlagen hervor. Xanthias Schultern sackten hinunter, als sie einen verzweifelten Blick gen Himmel warf.
Gareth betrachtete sie stumm. »Nervös?«, fragte er schließlich. »Das ist nur allzu verständlich, Zee. Morgen um diese Zeit wirst du schließlich eine verheiratete Frau sein.«
Xanthia schloss die Augen und legte eine Hand beschützend auf ihren Bauch; eine beredte, urweibliche Geste. »Ich stehe Todesängste aus«, gestand sie. »Nicht wegen der Hochzeit – ich will das alles, will Stefan von ganzem Herzen heiraten. Es ist nur … diese Zeremonie. Die vielen Menschen. Sein Bruder kennt wirklich jeden und hat auch jeden eingeladen. Doch ich traue mich nicht, die Heirat abzublasen …«
Gareth stützte sich mit der Hand auf die Rückenlehne ihres Stuhls, berührte sie jedoch nicht. Er würde sie nie wieder berühren; das hatte er sich geschworen – und dieses Mal meinte er es auch so. »Dir muss bewusst sein, dass es immer so sein wird, Zee«, sagte er ruhig. »Und das ist noch nicht das Schlimmste. Wenn du Lady Nash bist und die Leute dahinterkommen, dass du die Unverfrorenheit besitzt, für deinen Lebensunterhalt zu arbeiten, dann werden sie sagen –«
»Aber ich arbeite nicht für meinen Lebensunterhalt!«, unterbrach sie ihn. »Ich besitze eine Reederei – genauer gesagt, du und meine Familie, wir besitzen sie. Wir alle. Zusammen. Ich helfe nur dabei, den … Überblick zu behalten.«
»Das Haar ist zu dünn, um es zu spalten, meine Liebe«, entgegnete er. »Aber ich wünsche dir viel Glück bei dem Versuch.«
Endlich sah sie zu ihm auf, und ihr Gesicht verzog sich. »Oh, Gareth«, flüsterte sie. »Sag mir, dass alles gut werden wird.«
Er wusste, dass sie nicht von der Heirat sprach, sondern vom Geschäft, das für sie so etwas wie ihr Kind war. Genau genommen war es ihr wichtiger als jemals zuvor. »Alles wird gut werden, Zee«, versprach er. »Nächste Woche schon wirst du auf deine Hochzeitsreise aufbrechen, und wir werden hier alles fest im Griff haben. Zudem können wir noch jemanden einstellen, falls es nötig sein sollte. Ich werde jeden Tag im Kontor sein, bis du wieder zurückkommst.«
Sie lächelte schwach. »Danke«, sagte sie. »Oh, Gareth, danke. Wir werden auch nicht lange fortbleiben, das verspreche ich.«
Dann brach er seinen Schwur, sie nicht mehr zu berühren, und legte einen Finger unter ihr Kinn. »Mach dir bitte keine Sorgen, Zee«, murmelte er. »Schwör es mir. Denk an das neue und glückliche Leben, das auf dich wartet.«
Für einen Moment erstrahlte ihr Gesicht in einer Art und Weise, für die nur ein Mann verantwortlich sein konnte. »Du wirst doch morgen Vormittag dabei sein, oder?«, fragte sie fast atemlos. »In der Kirche?«
Er wandte den Blick ab. »Ich weiß es nicht.«
»Gareth.« Ihre Stimme klang plötzlich rau. »Ich brauche dich dort. Du bist mein … mein bester Freund. Bitte komm, ja?«
Er bekam nicht die Chance zu antworten, da ein leises Klopfen an der Tür erklang. Gareth wandte sich um und erblickte einen älteren, weißhaarigen Mann auf der Schwelle. Mr. Bakely, der Hauptbuchhalter, stand hinter einem Besucher und schaute sichtlich unbehaglich drein.
»Können wir Euch helfen?« Xanthias Stimme klang ein wenig ungeduldig. Es war Mr. Bakelys Job, dafür zu sorgen, dass Besucher sich unten im Kontor aufhielten und nicht in den Räumen der Geschäftsleitung im Obergeschoss.
Als der Mann das Zimmer betrat, fiel das helle Sonnenlicht auf seinen schlichten, aber gut geschnittenen Anzug. Er trug eine Brille mit Goldfassung und eine Tasche aus glänzendem Leder. Ein Banker aus der City, vermutete Gareth – oder, schlimmer noch, ein Anwalt. Wer oder was auch immer er war, der Mann sah nicht nach erfreulichen Nachrichten aus.
»Miss Neville, nehme ich an?« Der Mann verbeugte sich steif. »Howard Cavendish von Wilton, Cavendish und Smith in der Gracechurch Street. Ich möchte mit einem Eurer Angestellten sprechen. Mit Mr. Gareth Lloyd.«
Im Zimmer war plötzlich eine Art Spannung zu spüren. Gareth trat vor. »Ich bin Lloyd«, erwiderte er. »Aber Ihr werdet Euer juristisches Anliegen mit einem unserer Anwälte in –«
Der Mann hob die Hand. »Ich fürchte, mein Anliegen ist eher privater Natur«, sagte er. »Ich bitte dringend um eine Minute Eurer Zeit.«
»Mr. Lloyd ist kein Angestellter, Sir, er ist einer der Eigentümer«, sagte Xanthia arrogant, als sie hinter dem Schreibtisch hervortrat. »Normalerweise muss man einen Termin vereinbaren, um mit ihm zu sprechen.«
Überraschung flackerte in den Augen des Anwalts auf, wurde aber rasch überspielt. »Wenn das so ist, bitte ich um Entschuldigung, Mr. Lloyd.«
Sich in das Unvermeidliche ergebend, setzte sich Gareth an seinen Schreibtisch aus glänzendem Mahagoni und bedeutete dem Anwalt, ihm auf dem Lederstuhl gegenüber Platz zu nehmen. Der Mann verursachte Gareth ein tiefes Unbehagen, und er war froh, dass Xanthia ein kleines Vermögen ausgegeben hatte, um das einst eher schäbige Büro neu auszustatten. Vermutlich sah es jetzt ebenso elegant aus wie die Kanzlei eines Anwalts.
Mr. Cavendish warf einen fragenden Blick in Richtung Xanthia.
»Das ist in Ordnung«, erklärte Gareth. »Miss Neville und ich haben keine Geheimnisse voreinander.«
Die dunklen Augenbrauen des Mannes schossen in die Höhe. »Tatsächlich?«, murmelte er und öffnete seine Ledermappe. »Ich gehe davon aus, Ihr seid Euch dessen ganz sicher?«
»Du liebe Güte«, sagte Xanthia leise. »Das klingt ja wirklich aufregend.« Ein neugieriger Ausdruck lag auf ihrem Gesicht, als sie sich in den Armstuhl zur Linken von Gareth’ Schreibtisch setzte.
Der Anwalt zog einen Stapel Papiere aus der Mappe. »Ich muss schon sagen, Mr. Lloyd, dass Ihr Euch als erstaunlich schwer zu fassende Beute erwiesen habt.«
»Mir war nicht bewusst, dass ich gejagt wurde.«
»Das nehme ich an.« Um die Lippen des Mannes lag ein unwirscher Zug, als würde ihm seine Aufgabe zuwider sein. »Meine Kanzlei versucht schon seit einigen Monaten Euch ausfindig zu machen.«
Trotz seines geschäftlichen Tons verstärkte sich Gareth’ Unbehagen. Als er Xanthia kurz anschaute, war er sich plötzlich sicher, dass er sie doch besser hinausschicken sollte. Er räusperte sich vernehmlich. »Wo genau habt Ihr denn nach mir gesucht, Mr. Cavendish?«, fragte er. »Neville Shipping war bis vor einigen Monaten auf den Westindischen Inseln ansässig.«
»Ja, ja, das habe ich auch herausgefunden«, entgegnete Cavendish ungeduldig. »Und es hat mich Zeit genug gekostet. Es gibt nicht mehr viele Menschen in London, die sich an Euch erinnern, Mr. Lloyd, aber schließlich ist es mir gelungen, in Houndsditch eine ältere Frau zu lokalisieren – die Frau des örtlichen Schmieds –, die sich an Eure Großmutter erinnern konnte.«
»Houndsditch?«, fragte Xanthia ungläubig. »Was hat Houndsditch mit dir zu tun, Gareth?«
»Meine Großmutter hat die letzten Monate ihres Lebens dort verbracht«, murmelte er. »Sie hatte viele Freunde, aber wahrscheinlich sind die meisten von ihnen inzwischen verstorben.«
»Ganz richtig.« Mr. Cavendish blätterte in den Papieren. »Und die einzige noch lebende Person war senil. Die Frau hat uns erzählt, dass Ihr Eurer Großmutter geschrieben habt – von den Bermudas, so behauptete sie. Und als sich diese Information als falsch erwies, entschied sie, dass es die Bahamas gewesen seien. Aber auch das traf nicht zu. Also entschloss sie sich, es mit einem anderen Buchstaben des Alphabets zu versuchen und schickte uns nach Jamaica.«
»Es war Barbados«, murmelte Gareth.
Cavendish lächelte schwach. »Ja, mein Angestellter hat es praktisch geschafft, die ganze Welt zu bereisen, um Euch aufzuspüren«, sagte er. »Das alles hat ein ziemliches Vermögen gekostet, so fürchte ich.«
»Wie bedauerlich für Euch«, sagte Gareth.
»Oh, das geht nicht zu meinen Lasten«, erwiderte der Anwalt, »sondern zu Euren.«
»Wie bitte?«
»Genauer gesagt: Es geht zu denen Eures Vermögens«, korrigierte sich der Anwalt. »Ich arbeite für Euch.«
Gareth lachte. »Ich fürchte, da liegt ein Irrtum vor.«
Aber der Anwalt hatte nun offensichtlich das Dokument gefunden, nach dem er während des Gesprächs gesucht hatte, und schob es nun über den Schreibtisch. »Euer Cousin, der Duke of Warneham, ist tot«, erklärte er sachlich. »Vergiftet, sagen einige – aber unabänderlich tot, ein Fakt, der höchst angenehm für Euch ist, Mr. Lloyd.«
Xanthia starrte den Anwalt mit offenem Mund an. »Der Duke von was?«
»Warneham«, wiederholte der Anwalt. »Hier ist der Bericht des amtlichen Leichenbeschauers. Tod durch Unfall, so lautet sein Urteil, obwohl dem kaum jemand Glauben schenkt. Und dies hier ist das Ergebnis der Überprüfung durch das College of Arms – es weist Euch als den Erben des Titels aus.«
»Des … was?« Gareth war wie betäubt. Er fühlte sich krank. Das musste ein Irrtum sein.
Xanthia beugte sich zu ihm. »Gareth?«
Aber Mr. Cavendish ergriff schon wieder das Wort. »Zudem gibt es einige Papiere, die dringend Eure Unterschrift erfordern. Die Verhältnisse sind recht ungeordnet, wie Ihr Euch vorstellen könnt. Der Duke starb bereits im Oktober vergangenen Jahres, und die Gerüchte um seinen Tod sind seitdem nicht weniger geworden.«
»Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht«, sagte Xanthia, dieses Mal in schärferem Ton. »Was für ein Duke? Gareth, wovon spricht er?«
Gareth schob die Papiere von sich, als hätten sie Feuer gefangen. »Ich weiß es nicht.« Er fühlte sich unsicher. Wütend. Seit einem Dutzend Jahren hatte er nicht mehr an Warneham gedacht – zumindest hatte er es versucht. Und jetzt verschaffte ihm die Nachricht von dessen Tod nicht einmal die Freude und Befriedigung, mit denen er so lange gerechnet hatte, sondern nur eine seltsame, unangenehme Dumpfheit. Warneham vergiftet? Und er sollte jetzt die Herzogswürde erben? Nein. Das war ausgeschlossen.
»Ich denke, Ihr geht jetzt am besten, Sir«, wandte er sich an Cavendish. »Es muss sich um einen Irrtum handeln. Zudem haben wir hier im Kontor eine Menge Arbeit zu erledigen.«
Der Anwalt hob abrupt den Kopf und sah Gareth an. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte er, »aber Ihr seid doch Gabriel Gareth Lloyd Ventnor, oder nicht? Sohn von Major Charles Ventnor, der in Portugal gestorben ist?«
»Ich habe meinen Vater nie verleugnet«, entgegnete Gareth. »Er war ein Held, und ich war immer stolz, sein Sohn zu sein. Aber der Rest der Ventnor-Familie kann von mir aus in der Hölle schmoren.«
Mr. Cavendish schaute über den Goldrand seiner Brille. »Aber genau das ist der Punkt, Mr. Lloyd«, sagte er ungeduldig. »Es gibt keinen Rest der Familie Ventnor. Ihr seid der Einzige. Ihr seid der achte Duke of Warneham. Wenn Ihr Eure Aufmerksamkeit nun also freundlichst diesen Dokumenten zuteilwerden lassen könntet und –«
»Nein«, unterbrach Gareth ihn entschlossen. Er schaute Xanthia an, deren Augen groß wie Untertassen geworden waren. »Ich will mit diesem Bastard nichts zu tun haben. Gar nichts. Guter Gott, wie ist es nur dazu gekommen?«
»Ich denke, Ihr wisst genau, wie es dazu gekommen ist, Mr. Lloyd«, erwiderte Cavendish unerwartet gereizt. »Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und weitermachen, nicht wahr? Übrigens erlaubt es das Gesetz nicht, dass Ihr den Titel ablehnt. Es ist nun mal, wie es ist. Ihr könnt Euch jetzt um Euren Besitz und Eure Pflichten kümmern, oder Ihr könnt alles vor die Hunde gehen lassen, wenn das Euer Wille –«
»Aber Warneham hat ein langes und aktives Leben geführt«, fiel Gareth ihm ins Wort und sprang auf. »Es … es muss doch noch andere Kinder geben, um Himmels willen?«
Mr. Cavendish schüttelte den Kopf. »Nein, Euer Gnaden«, sagte er ernst. »Das Schicksal war dem verstorbenen Duke in dieser Hinsicht nicht gut gesonnen.«
Gareth wusste sehr gut, wie sich die Ungnade des Schicksals anfühlte – und diese Erfahrung hatte er Warneham zu verdanken. War es möglich, dass dieser Hurensohn bekommen hatte, was er verdiente? Gareth begann auf und ab zu gehen, während er die Hand in den Nacken legte und ihn sich rieb. »Großer Gott, das kann doch alles nicht wahr sein«, stieß er hervor. »Wir sind kaum verwandt – bestenfalls Cousins dritten Grades. Sicherlich lässt das Gesetz so etwas gar nicht zu?«
»Ihr und Warneham seid beide Ururenkel des dritten Dukes of Warneham, der als Held in der Schlacht für Wilhelm von Oranien gefallen ist«, führte der Anwalt aus. »Der dritte Duke hatte Zwillingssöhne, die nach seinem Tod mit nur wenigen Minuten Abstand geboren wurden. Warneham ist tot, sein Sohn Cyril ist vor ihm gestorben, und Ihr seid der einzige lebende Blutsverwandte des Zwillingsbruders, der als Zweiter geboren wurde. Ergo hat das College of Arms festgestellt, dass Ihr –«
»Mich kümmert es einen Dreck, was das College of Arms feststellt«, sagte Gareth. »Ich will –«
»Gareth, deine Ausdrucksweise!«, tadelte Xanthia ihn sanft. »Jetzt setz dich und erkläre mir das alles. Ist dein Familienname wirklich Ventnor? Hat wirklich irgendjemand deinen Onkel getötet?«
In diesem Moment stürmte ein dunkelhaariger Gentleman das Büro, der, im Gegensatz zu Mr. Cavendish, elegant wie ein Dandy gekleidet war. Er trug etwas sehr Großes und Glänzendes vor sich her. »Guten Morgen, meine Lieben!«, säuselte er.
Gareth, der mit seiner Geduld ohnehin schon am Ende war, fuhr herum. »Was, zum Teufel, soll gut an diesem Morgen sein?«
Xanthia ignorierte die Bemerkung. »Du lieber Himmel, Mr. Kemble«, sagte sie und erhob sich. »Was habt Ihr denn da?«
»Ohne Zweifel eine weitere seiner überteuerten Kleinigkeiten.« Gareth baute sich vor ihm auf.
Mr. Kemble nahm den Gegenstand beschützend in einen Arm. »Das ist eine Vase aus der Tang-Dynastie«, fuhr er Gareth an. »Berührt sie ja nicht, Ihr Kulturbanause!«
»Aber was sollen wir damit?«, fragte Xanthia überrascht.
»Sie wird der Blickfang auf der Marmorsäule dort am Fenster sein.« Mr. Kemble tänzelte durch das Büro und platzierte die Vase vorsichtig auf dem Pilaster. »Wunderbar! Absolut wunderbar! Hiermit erkläre ich Euer Büro für perfekt eingerichtet.« Er fuhr herum. »Und jetzt entschuldigt bitte mein Hereinplatzen. Wo wart Ihr stehen geblieben? Dass Mr. Lloyd seinen Onkel beseitigt hat, richtig? Das überrascht mich nicht im Geringsten.«
»Ich hatte mich versprochen«, sagte Xanthia. »Es war ein Cousin, nicht wahr?« Sie stellte Kemble rasch dem Anwalt vor.
»Und ich habe niemanden beseitigt«, fauchte Gareth.
»Das habt Ihr in der Tat nicht. Wir haben alles überprüft«, versicherte der Anwalt trocken. »Mr. Lloyd besitzt das perfekte Alibi. Er befand sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Atlantik.«
Xanthia schien immun gegen Sarkasmus zu sein. »Und jetzt noch das Schockierendste, Mr. Kemble«, sie legte ihm die Hand auf den Arm, »Gareth wird ein Duke sein!«
»Oh, du großer Gott, Zee!« Gareth spürte, wie sein Blut zu kochen begann. »Sei still, bitte.«
»Aber es stimmt«, sagte sie, immer noch an Kemble gewandt. »Gareth hatte einen geheimen Duke in seiner Familie.«
»Ja, nun, haben wir den nicht alle?« Mr. Kemble lächelte angespannt. »Und welcher ist der Ihre?«
»Warnley«, erwiderte Xanthia rasch.
»Warneham«, korrigierte der Anwalt.
»Keiner von beiden«, sagte Gareth grimmig. »Cavendish wird diesen Familienstammbaum so lange weiterschütteln müssen, bis ein anderer Affe aus ihm herausfällt.«
Mr. Kemble hob die Hände. »Nun, ich kann Euch in der Sache nicht helfen, alter Freund«, sagte er zu Gareth. »C’est la vie, non? Und jetzt, meine Lieben, muss ich mich wirklich sputen. Ich hatte nicht vor zu stören – aber die Erwähnung eines Mordes war zu verlockend, um sie zu ignorieren. Ich werde mir die schmutzigen Details später anhören.«
»Danke für die wunderbare Vase, Mr. Kemble«, sagte Xanthia.
Der elegante Gentleman blieb stehen, ergriff Xanthias Hand und beugte sich darüber. »Ich werde bis morgen damit warten, diese Hand zu küssen, meine Liebe – im Portikus von St. George«, sagte er, »wenn ich Euch offiziell Marchioness of Nash nennen darf.«
Bei diesen Worten richtete sich der Anwalt auf seinem Stuhl auf. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte er, nachdem Mr. Kemble gegangen war, »kann ich das so verstehen, dass Glückwünsche angebracht sind?«
Xanthia errötete. »Ich werde morgen Vormittag heiraten.«
In diesem Moment erschien ein weiterer Schatten an der Tür. Gareth schaute frustriert auf. »Ich bitte um Entschuldigung, Sir«, sagte Mr. Blakely. »Aus Woolwich ist soeben ein Reiter eingetroffen. Die Margaret Jane ist gesichtet worden, sie hat Blackwall Reach passiert.«
Xanthia presste die Hand auf ihre Brust. »Oh, Gott sei Dank!«
»Das wurde aber auch Zeit, verdammt noch mal«, stellte Gareth fest und schob seinen Stuhl zurück, der laut über den Boden kratzte.
»Soll sie an den West India Docks anlegen, Sir«, drängte Blakely, »oder den Fluss heraufsegeln?«
»Bei den Docks anlegen«, entschied Gareth. »Und lasst meine Kutsche vorfahren. Ihr werdet mit mir hinfahren und feststellen, ob und welche Probleme es gibt.«
Auch Xanthia war aufgestanden. »Ich entschuldige mich, Mr. Cavendish«, sagte sie. »So faszinierend Eure Geschichte auch ist – und ich gestehe, dass ich sehr neugierig auf deren Ausgang bin –, wir müssen uns leider jetzt unverzüglich um die Margaret Jane kümmern. Sie hat drei Monate im Hafen von Bridgetown festgelegen, und ein Drittel der Besatzung ist an Typhus gestorben. Wir sind ernstlich besorgt, wie Ihr sicherlich verstehen werdet?«
»Aber du wirst uns nicht begleiten, Zee.« Gareth’ Stimme klang streng. Er zog sich bereits seinen Mantel an und war unempfänglich für alles außer der Pflicht, die auf ihn wartete.
Xanthias Hand legte sich instinktiv wieder auf ihren Bauch. »Nein, das sollte ich wohl nicht.« Sie lächelte Mr. Cavendish an, der sich nur sehr widerstrebend erhob.
»Aber was soll ich jetzt mit den Dokumenten machen?«, fragte er.
Gareth konzentrierte sich darauf, seine Sachen zusammenzupacken, und schwieg.
»Lasst sie einfach auf Mr. Lloyds Schreibtisch liegen«, schlug Xanthia vor. »Ich bin sicher, er wird sie sich später ansehen.«
Mr. Cavendish wirkte verärgert. »Aber wir haben eine Reihe dringlicher Punkte zu klären«, protestierte er. »Die Aufmerksamkeit Seiner Gnaden ist unbedingt erforderlich.«
Xanthia lächelte sanft. »Verzweifelt nicht, Sir«, beruhigte sie ihn. »Gareth wird seine Pflicht erfüllen. Das hat er bisher immer getan. Und ich bin voller Zutrauen, dass er mit der ihm eigenen sachlichen Kompetenz alle Probleme lösen wird – welche auch immer Ihr ihm antragen werdet.«
Doch der Anwalt beachtete sie kaum. »Sir«, sagte er zu Gareth, der ihm den Rücken zuwandte, »die Sache kann nicht warten.«
Gareth nahm eines der Kontobücher aus dem Regal. »Ich werde in ein oder zwei Stunden zurück sein«, sagte er zu Xanthia. »Ich werde Captain Barrett deine Grüße ausrichten.«
»Wartet, Euer Gnaden!«, rief der Anwalt. Er klang jetzt flehend. »Ihr werdet sofort auf Selsdon Court erwartet. Die Duchess erwartet Euch.«
»Die Duchess?«, fragte Xanthia.
Cavendish ignorierte sie. »Alles hängt in der Schwebe, Sir«, beharrte der Anwalt. »Es kann nicht länger warten.«
»Das wird es aber müssen, verdammt noch mal«, beschied Gareth, ohne Cavendish oder Xanthia anzusehen. »Genau genommen kann es von mir aus auch bis zum Jüngsten Tag warten.«
»Also wirklich, Sir, das ist unverantwortlich!«
»Die Abstammung macht nicht den Mann, Cavendish«, fauchte Gareth. »Viel eher ist sie des Öfteren sogar sein Verderben.« Ohne noch etwas hinzuzufügen, folgte er Blakely polternd die Treppe hinunter.
Xanthia begleitete den Anwalt zur Bürotür. Mit streng zusammengezogen Augenbrauen schaute er auf sie hinunter. »Ich kann das wirklich nicht glauben«, murmelte er. »Er ist der Duke. Er wird doch wissen, was für ein Glück das für ihn ist? Er ist jetzt ein Angehöriger des britischen Hochadels – einer der reichsten sogar, wenn man genau ist.«
»Gareth besitzt ein Selbstvertrauen, das manchmal etwas ungehobelt wirken kann, Mr. Cavendish«, erwiderte Xanthia. »Er ist ein Selfmademan – und dennoch bedeutet ihm Geld sehr wenig.«
Beide Gedanken überstiegen offensichtlich Cavendishs Vorstellungskraft. Nach einigen weiteren gemurmelten Gemeinplätzen führte Xanthia den Anwalt schließlich in den Flur. Auf dem Treppenabsatz fiel ihr noch eine Frage ein. »Mr. Cavendish«, sagte sie, »darf ich fragen, von wem man glaubt, er könnte sich den Tod des Dukes gewünscht haben? Gibt es … Verdächtige? Irgendeine Hoffnung auf eine Festnahme?«
Der Anwalt schüttelte den Kopf. »So, wie die meisten mächtigen Männer, hatte auch der Duke Feinde«, räumte er ein. »Was Verdächtige angeht, so hat sich die Gerüchteküche bedauerlicherweise seine Witwe als Zielscheibe ausgesucht.«
Xanthia fühlte, wie ihre Augen sich weiteten. »Guter Gott! Die arme Frau – falls sie unschuldig ist?«
»Ich glaube nicht, dass sie eine Schuld trifft«, sagte der Anwalt. »So wie auch der amtliche Leichenbeschauer. Zudem stammt die Duchess aus einer einflussreichen Familie. Niemand würde es wagen, sie öffentlich anzuklagen – nicht ohne einen zwingenden Beweis.«
»Obwohl in der englischen Gesellschaft doch allein schon der Hauch eines Skandals genügt …« Xanthia fröstelte es plötzlich, und sie schüttelte den Kopf. »Die Duchess wird gesellschaftlich ruiniert sein.«
»Sie ist es schon fast, würde ich meinen«, stimmte Cavendish ihr traurig zu.
Mit seiner teuren Ledertasche in der Hand ging er die Treppe hinunter. Er wirkte erschöpfter als bei seiner Ankunft. In Xanthias Kopf schwirrten die Gedanken. Leise schloss sie die Bürotür und lehnte die Stirn gegen das kalte, polierte Holz.
Was, um alles in der Welt, war eben geschehen? Was hatte Gareth Lloyd all die Jahre vor ihr verborgen? Etwas Ernsteres als nur eine schreckliche Kindheit, wie es jetzt schien. Aber Gareth – ein Duke?
Abrupt hob sie den Kopf. Ihr Bruder Kieran könnte die Wahrheit kennen. Sie durchquerte das Zimmer, klingelte und stopfte die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch achtlos in ihre Tasche.
»Schickt nach meiner Kutsche«, trug sie dem jungen Angestellten auf, der ins Obergeschoss gekommen war und die Tür geöffnet hatte. »Ich werde mit Lord Rothewell zu Mittag essen.«
Kapitel 2
Gabriel hielt die Hand seines Großvaters fest umklammert. Die sich schnell drehenden Kutschenräder und preschenden Hufe machten ihm Angst. Alle hatten es eilig, riefen lauthals durcheinander, stürzten sich in den Verkehr. Meshuggenehs, so hätte seine Großmutter diese Menschen genannt.
»Zayde, ich … ich will nach Hause.«
Sein Großvater schaute ihn lächelnd an. »Was denn, gefällt es dir hier nicht, Gabriel? Das sollte es aber.«
»Warum? Es ist so hektisch hier.«
»Ja, es ist tatsächlich hektisch«, stimmte ihm sein Großvater zu, »weil dies hier das Herz Londons ist. Hier wird Geld gemacht. Auch du wirst eines Tages hier arbeiten. Vielleicht als Bankkaufmann oder als Börsenmakler. Würde dir das gefallen, Gabriel?«
Gabriel war verwirrt. »Ich … ich denke, ich werde ein englischer Gentleman sein, Zayde.«
»Oi vey!« Sein Großvater nahm ihn auf den Arm. »Welchen Unsinn die Frauen dir beigebracht haben. Es ist nicht die Abstammung, die einen Mann macht. Ein Mann ist nichts, wenn er nicht arbeitet.«
Und dann überquerten sie zusammen die Straße und wurden ein Teil dieses verrückten, wimmelnden Gedränges.
Die Duchess of Warneham hatte sich in den Rosengarten von Selsdon zurückgezogen, um für eine Stunde allein zu sein, als Mr. Cavendish am darauffolgenden Vormittag eintraf. Sie trug einen Korb am Arm, aber nach einer Stunde ziellosen Umherstreifens hatte sie erst eine einzige Rose geschnitten, die sie noch immer in der Hand hielt.
Sie hing ihren Gedanken nach. Dachte an ihre Kinder, obwohl man ihr immer und immer wieder gesagt hatte, sie solle sich keine Gedanken machen. Dass es nicht gut sei, in der Vergangenheit zu verweilen. Aber hier, jenseits der einengenden Mauern des Hauses, konnte ihr Mutterherz in Frieden bluten. Sie hatte sich schon so vielem ergeben, doch ihrem Kummer, das schwor sie sich, würde sie nicht öffentlich erliegen.
Der Spätsommer war heiß. In der Luft lag die Vorahnung eines Regenschauers, aber die Duchess nahm es kaum wahr. Auch die Schritte des Anwalts ihres verstorbenen Mannes hörte sie nicht, bis er ihr auf halbem Weg entgegenkam. Sie schaute auf und sah ihn in respektvoller Entfernung warten, eine leichte Brise wirbelte verwelkte Rosenblätter um seine Füße.
»Guten Tag, Cavendish«, sagte sie ruhig. »Ihr seid sehr schnell aus London zurück.«
»Euer Gnaden.« Der Anwalt ging auf sie zu und machte eine elegante Verbeugung. »Ich bin in diesem Augenblick zurückgekommen.«
»Willkommen auf Selsdon«, erwiderte sie mechanisch. »Habt Ihr schon zu Mittag gegessen?«
»Ja, Euer Gnaden, in Croydon«, erwiderte er. »Und Ihr?«
»Pardon?«
»Habt Ihr etwas zu Euch genommen, Ma’am?«, drängte er. »Denkt daran, dass Dr. Osborne gesagt hat, Ihr müsstet essen.«
»Ja, natürlich«, murmelte sie. »Ich … vielleicht später eine Kleinigkeit. Erzählt mir nun, was Ihr in London herausgefunden habt.«
Cavendish schaute unbehaglich drein. »Wie ich Euch versprochen hatte, bin ich direkt zu Neville Shipping gegangen. Doch ich bin nicht sicher, was ich dort erreicht habe.«
»Ihr habt ihn also gefunden?«, fragte sie. »Diesen Mann, der für die Reederei arbeitet?«
Cavendish nickte. »Ja. Ich habe ihn gefunden.«
»Und?«
Cavendish atmete heftig aus. »Es war Gabriel Ventnor, ich bin ganz sicher«, räumte er ein. »Er ist das absolute Abbild seines verstorbenen Vaters. Die Größe. Die blonden Haare und die hellen Augen. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Mann gefunden haben.«
Die Duchess blieb gleichmütig. »Dann wäre es also vollbracht. Wann können wir ihn auf Selsdon erwarten?«
Cavendish zögerte. »Ich bin mir nicht sicher, Ma’am«, gestand er. »Er schien … an unseren Neuigkeiten nicht besonders interessiert zu sein.«
»Nicht besonders interessiert?«, wiederholte die Duchess tonlos.
Der Anwalt hüstelte verlegen. »Ich fürchte, er ist nicht einfach nur irgendein Hafenarbeiter oder Büroangestellter. Genau genommen ist er Miteigentümer der Reederei. Er sah … nun, er sah recht wohlhabend aus und war in der Tat genauso eigensinnig.«
Ihr Lächeln war schwach. »Wohl kaum der arme Waisenknabe, den Ihr erwartet hattet.«
»Nein.« Cavendishs Stimme klang säuerlich. »Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sein Glück, den Titel geerbt zu haben, schon begriffen hat. Ich bin nicht einmal sicher, ob oder wann er geruhen wird, nach Selsdon Court zurückzukehren, Ma’am. Er ist mir seine Antwort schuldig geblieben.«
Auch die Duchess blieb auf diese Neuigkeit hin stumm. Stattdessen betrachtete sie die Rose, die sie noch immer umklammert hielt. Die Blütenblätter schimmerten blutrot gegen ihre Haut. Blutrot. Gegen tödliche Blässe. Wie Fleisch, aus dem jegliches Leben gewichen war – und dennoch lebte sie noch. Einen langen Augenblick sann sie über die verschlungenen Pfade des Schicksals nach. Dachte an den Tod und an das, was er anrichtete. An das, was er unumkehrbar veränderte.
Was machte es aus, ob dieser Mann nach Selsdon Court kam oder nicht? Was würde es ändern? Was konnten seine Macht und sein Stolz ihr schon antun, was ihr Leben noch unerträglicher machen würde, als es ohnehin schon war? Die Tage vergingen in dem schweigenden Vergessen, in dem sie bereits in den zurückliegenden vier Jahren vergangen waren. Vielleicht waren es sogar schon fünf. Sie war sich nicht sicher, zählte sie nicht mehr.
Gabriel Ventnor. Alle glaubten, er hielte ihr Schicksal in seinen Händen. Doch es bedeutete ihr nichts. Er konnte sie weder verletzen noch quälen, denn sie fühlte keinen irdischen Schmerz mehr.
»Euer Gnaden?«
Als sie aufschaute, hielt Cavendish einen eindringlichen Blick auf sie gerichtet. Ihr wurde bewusst, dass sie sich in ihren Gedanken verloren hatte. »Ich – ich bitte um Verzeihung, Cavendish. Was habt Ihr gesagt?«
Der Anwalt runzelte die Stirn, trat zögernd näher und löste ihren Griff um die Rose. »Euer Gnaden, Ihr habt euch wieder geschnitten«, tadelte er sie und zog sanft zwei Dornen aus ihrer Handfläche. Einer davon hatte ziemlich tief gesessen, sodass ein Blutstropfen aus ihrer Haut quoll. Er nahm sein Taschentuch und presste es auf die Wunde. »Macht eine Faust um das Tuch«, wies er sie an.
»Es ist doch nur Blut, Cavendish«, murmelte sie.
Er legte die Rose in den leeren Korb. »Kommt, Euer Gnaden, wir müssen jetzt ins Haus gehen«, sagte er und nahm sie sanft am Arm.
»Aber meine Rosen!«, protestierte sie. »Ich bin noch nicht fertig.«
Cavendish gab nicht nach. »Ma’am, es hat zu regnen begonnen«, sagte er und führte sie in Richtung Terrasse. »Eigentlich regnet es bereits seit einer ganzen Weile.«
Die Duchess schaute auf. Regentropfen fielen auf die Gartenmauer, spritzten auf. Die Ärmel ihres Kleides waren bereits feucht – ein weiteres irdisches Unbehagen, das sie nicht mehr wahrnahm.
»Wollt Ihr denn wieder krank werden, Ma’am?«, drängte Cavendish. »Wozu wäre das denn gut?«
»Zu nichts, vermutlich.« Die Worte klangen heiser und zittrig.
»Genau, stattdessen würde es Nellies Leben noch schwieriger machen«, sagte Cavendish, »denn ihr würde die Last zufallen, euch zu pflegen.«
Die Duchess blieb abrupt auf dem Gartenweg stehen. »Ihr habt ganz recht, Cavendish«, sagte sie und sah ihn jetzt direkt an. »Und wie ich immer schon gesagt habe, hasse ich es – mehr als alles andere –, eine Last zu sein. Für jeden.«
Am darauffolgenden Nachmittag entledigte sich Baron Rothewell am Berkeley Square seiner feinen Lederslipper und schenkte sich ein großes Glas Brandy ein – genug, um einem weniger gestandenen Mann die Besinnung zu rauben. Verdammt, er hatte einen Drink bitter nötig. Bis jetzt war dieser Tag eine einzige Qual gewesen – wenn seine Schwester es auch, Gott sei Dank, nicht bemerkt hatte.
Zees Hochzeitstag. Oft hatte er gedacht, diesen Tag nie zu erleben. Dann wieder hatte er angenommen, sie würde irgendwann eine Vernunftehe eingehen, gegründet auf Freundschaft, und zwar mit Gareth Lloyd. Doch dann war der Hochzeitstag tatsächlich gekommen, und es war nicht genug gewesen, dass Rothewell hatte zusehen müssen, wie seine Schwester vom Berkeley Square mit einem Mann fortgefahren war, der beinahe ein vollkommen Fremder für ihn war – und ein verdammt gut aussehender Fremder noch dazu. Und auch Gareth hatte es mitansehen müssen.
Xanthias Bräutigam, der Marquess of Nash, hatte die Neuigkeit über Gareth Lloyds gesellschaftlichen Aufstieg mit seiner gewohnt gleichmütigen Anmut zur Kenntnis genommen und ihn allen Hochzeitsgästen als »Duke of Warneham, einen lieben Freund der Familie« vorgestellt. Nash hatte es nicht böse gemeint, aber Rothewell fühlte mit Gareth, dem armen Teufel. Nashs direkte Worte würden die Gerüchteküche der Gesellschaft mit Sicherheit zum Brodeln bringen.
In diesem Moment wurde die Tür zu seinem Arbeitszimmer geöffnet, und Gareth trat ein. »Da bist du ja, alter Knabe«, begrüßte Rothewell ihn. »Ich habe mich gerade gefragt, wo du abgeblieben bist.«
»Ich war unten und habe Trammel geholfen, die überzähligen Stühle wegzutragen.«
»Ein Duke hilft dem Butler, Möbel zu rücken?«, bemerkte Rothewell nachdenklich. »Sag mir, warum mich das nicht überrascht.«
»Ein Mann ist nichts, wenn er nicht arbeitet«, entgegnete Gareth.
»Oh«, brummte Rothewell, »ein wahrhaft schrecklicher Gedanke. Willst du mir nicht bei einem Brandy Gesellschaft leisten?«
Gareth warf sich in einen von Rothewells großen Ledersesseln. »Nein, dafür ist es für mich noch zu früh am Tag«, lehnte er ab, zögerte dann aber. »Aber vielleicht nicht für den Duke of Warneham?«
Lachen wallte tief in Rothewells Brust auf. »Du bist und bleibst derselbe, alter Freund.«
»Dann ja, verdammt, schenk mir einen kleinen Schluck ein«, brummte Gareth. »Ich denke, wir beide haben uns ein Glas dafür verdient, diesen Tag überlebt zu haben.«
»Nun, du hast ihn übertroffen«, erwiderte Rothewell und ging zum Sideboard. »Den Marquess of Nash, meine ich. Du hast die Führung übernommen, Gareth, in eurem Wettstreit. Sehr beeindruckend.«
»Oh, ich habe solche Spiele schon vor Jahren aufgegeben.« Gareth’ Stimme klang plötzlich grimmig. »Außerdem haben wir heute Vormittag eine Hochzeit gefeiert, falls du dich noch daran erinnerst.«
»Nur zu gut.« Rothewell ließ den Brandy nachdenklich in dem Glas kreisen, bevor er es seinem Gast reichte. »Du hast das Objekt deiner Jugendschwärmerei verloren, Gareth, und ich – nun, ich mache mir da nichts vor –, ich habe eine Schwester verloren. Zweifellos denkst du, dass das nicht das Gleiche ist. Aber als du so allein warst wie wir drei – Luke, Zee und ich –, ohne jemanden, auf den man sich stützen konnte, hast auch du ein Band geschmiedet, das ähnlich einer Familienbande ist.«
Gareth schwieg für einen Moment. »Luke ist fort, aber du bist nie ohne Xanthia gewesen, nicht wahr?«
Rothewell schüttelte den Kopf. »Ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, an dem sie geboren wurde.« Seine Stimme wurde bei dem letzten Wort brüchig. »Ach, genug der rührseligen Gefühle für heute. Wie wird es für dich weitergehen, Gareth? Muss ich dich am Kragen packen und zu deinen Pflichten schleifen?«
»Ich vermute, du sprichst von der Herzogswürde.« Gareth klang emotionslos. »Nein, ich habe Zee versprochen, dass ich bis zu ihrer Rückkehr jeden Tag bei Neville Shipping sein werde. Ich werde weder dich noch sie im Stich lassen.«
»Ich habe nie gedacht, dass du das tun würdest«, murmelte Rothewell. »Seit dem Tag, an dem mein Bruder dich als Laufburschen eingestellt hat, haben wir uns alle auf dich verlassen. Aus diesem Grund sind wir ja auch die Partnerschaft mit dir bei Neville Shipping eingegangen – und natürlich um vorzubeugen, dass man dich abwirbt.«
Gareth lächelte schwach. »Ihr habt mir goldene Fesseln angelegt, nicht wahr?«
»Verdammt richtig.« Der Baron nahm noch einen Schluck Brandy, seine muskulöse Kehle arbeitete wie eine gut geölte Maschine. »Und jetzt hast du vor, dich an deinen Teil der Abmachung zu halten. Ich respektiere das. Doch auch, wenn dein Anteil an Neville Shipping dich recht wohlhabend gemacht hat, kann sich das wahrscheinlich kaum mit dem Reichtum messen, den du geerbt hast.«
»Worauf willst du hinaus?« Die Worte klangen schärfer, als Gareth sie beabsichtigt hatte.
»Vielleicht kümmerst du dich um die falsche Sache.« Rothewell hatte mit dem Glas in der Hand begonnen im Zimmer auf und ab zu gehen. »Es liegt mir fern, einen Mann von deinem Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein zu belehren, aber ich lege dir wirklich ernsthaft nahe, dorthin zu fahren. Nach … nach … Wie heißt es gleich noch?«
»Selsdon Court.«
»Ah ja, Selsdon Court«, wiederholte Rothewell. »Wie pompös das klingt.«
»Das ist es auch. Obszön pompös geradezu.«
»Nun, obszön oder nicht, es gehört jetzt dir. Vielleicht solltest du dem Anwesen einen Besuch abstatten. Es ist nicht sehr weit, nicht wahr?«
Gareth zuckte mit den Schultern. »Eine halbe Tagesreise vielleicht. Man kann auch von Deptford aus mit dem Boot über den Croydon Kanal dorthin fahren.«
»Nur einen halben Tag?«, fragte Rothewell ungläubig. »Das ist doch gar nichts. Also los, kümmere dich um die Dinge, die am dringendsten sind, und sprich der schwarzen Witwe dein Beileid aus. Letztere waren übrigens Zees Worte, nicht meine.«
Gareth stöhnte auf. »Die Duchess ist eine kaltherzige Hexe, das ist allgemein bekannt«, sagte er. »Aber eine Mörderin? Das bezweifle ich. Sie würde es nicht riskieren, sich in den Augen der Gesellschaft zu ruinieren.«
Rothewell sah ihn seltsam an. »Wie ist sie denn so?«
Gareth wandte den Blick ab. »Damals war sie äußerst arrogant«, murmelte er, »aber nicht übermäßig grausam. Dafür war ihr Ehemann zuständig.«
»Ich frage mich, ob sie jetzt eine reiche Witwe ist.«
»Zweifellos«, sagte Gareth. »Warneham war geradezu unverschämt wohlhabend. Ihre Familie wird für großzügige Vereinbarungen gesorgt haben.«
»Und jetzt erwartet sie dich«, murmelte Rothewell. »Vielleicht sollst du hinsichtlich ihrer Zukunft eine Entscheidung treffen?«
Der Gedanke war Gareth noch gar nicht gekommen. Für einen kurzen Moment schwelgte er in der Fantasie, sie in die Kälte hinauszuwerfen, um sie dort verhungern – oder Schlimmeres – zu lassen. Doch er konnte keine Freude bei der Vorstellung empfinden – genau genommen konnte er es sich gar nicht erst vorstellen. Und ganz gewiss lag die Entscheidung über ihre Zukunft nicht bei ihm. Oder etwa doch?
»Du denkst darüber nach?«, fragte Rothewell.
Gareth antwortete nicht. Er wusste ja selbst kaum, wie ihm geschah. In all den schrecklichen Tagen, die seiner Verbannung von Selsdon Court gefolgt waren, hatte er nicht ein einziges Mal den Wunsch verspürt, dorthin zurückzukehren. Oh, anfangs hatte er sich viele Dinge gewünscht, die er nicht hatte haben können. Dinge, nach denen Kinder sich in ihrer Naivität sehnen. Eine freundliche Berührung. Einen warmen Herd. Ein Zuhause. Aber er hatte stets genau das Gegenteil bekommen. Kopfüber war er in die Abgründe der Hölle geworfen worden. Die Sehnsucht nach Liebe aus seiner Kindheit hatte sich in einen puren, unverfälschten Hass eines Mannes gewandelt. Und jetzt, da er nach Selsdon Court zurückkehren könnte – jetzt, da er ihrer aller Herr sein könnte –, empfand er Widerwillen bei dem Gedanken. Was für ein Spiel das Schicksal doch mit ihm gespielt hatte!
Rothewell räusperte sich und holte Gareth damit in die Gegenwart zurück. »Luke hat nie viel über deine Vergangenheit erzählt«, gab er zu. »Nur, dass du ein Waisenjunge bist, der aus guter Familie stammt, die schwierige Zeiten erlebt hat.«
Schwierige Zeiten. Luke Neville war immer ein Meister der Untertreibung gewesen. »Es war reines Glück, dass es mich nach Barbados verschlagen hat«, gab Gareth zu, »wo ich durch Gottes Gnade deinem Bruder begegnet bin.«
Rothewell lächelte. Eine seltene Gefühlsregung bei ihm. »Ich erinnere mich, dass er dich aufgegabelt hat, als du im Hafen vor einer Horde übler Seeleute geflüchtet bist.«
Gareth wandte den Blick ab. »Er hat mich am Kragen gepackt, weil er mich für einen Taschendieb hielt«, erwiderte er. »Luke war ein mutiger Mann.«
Rothewell zögerte. »Ja. Das war er wirklich.«
»Und ich … großer Gott, ich muss ausgesehen haben wie eine halb ertrunkene Ratte.«
»Du warst nur Haut und Knochen, als er dich mit nach Hause brachte«, bestätigte Rothewell. »Es war schwer zu glauben, dass du schon – wie alt warst? Dreizehn?«
»Knapp, ja«, sagte Gareth. »Ich verdankte Luke mein Leben, weil er mich vor diesen Bastarden gerettet hat.«
Wieder umspielte ein Lächeln Rothewells Lippen, aber diesmal wirkte es angespannt und freudlos. »Nun, deren Verlust war unser Gewinn«, sagte er. »Aber als Luke sagte ›aus guter Familie‹, da hat er mit deiner Abstammung anscheinend ziemlich untertrieben.«
»Ich habe es ihm nicht erzählt«, räumte Gareth ein. »Das mit Warneham, meine ich. Ich habe nur gesagt, dass mein Vater ein Gentleman war – ein Major der Armee, der bei Rolica gefallen ist – und meine Mutter früh gestorben ist.«
Rothewell setzte sich auf eine Ecke seines massigen Schreibtischs und sah Gareth nachdenklich an. »Luke wusste, wie es sich anfühlt, in jungen Jahren Waise zu werden«, sagte er schlicht. »Wir haben uns gefreut, dich als, nun, als neues Mitglied unserer Familie zu begrüßen, Gareth. Aber jetzt ruft dich eine größere Pflicht.«
»Oh, das bezweifle ich«, schnaubte Gareth und trank den letzten Schluck seines Brandys.
»Fahr für zwei Wochen hin«, schlug Rothewell vor, »und überzeug dich davon, dass ein kompetenter Verwalter sich dort um alles kümmert. Wirf einen gründlichen Blick in die Kassenbücher und stell sicher, dass du nicht betrogen wirst. Bring den Leuten das Fürchten bei – und sorg dafür, dass sie wissen, für wen sie jetzt arbeiten. Und dann kehrst du nach London zurück und ziehst aus deinem heruntergekommenen kleinen Haus in Stepney aus.«
Gareth sah ihn ungläubig an. »Was soll ich tun?«
Rothewell beschrieb mit dem Glas in der Hand einen Kreis in der Luft. »Eines von den großen Stadthäusern hier in der Gegend muss dem Duke of Warneham gehören, so habe ich gehört«, meinte er. »Und falls nicht, kauf dir eines. Du musst ja nicht den Rest deiner Tage auf dem Land verbringen – und ganz gewiss hast du es nicht nötig, im Dienste von Neville Shipping weiterhin wie ein Sklave zu schuften.«
»Unmöglich«, sagte Gareth. »Ich kann die Reederei nicht sich selbst überlassen, nicht einmal für vierzehn Tage.«
»Zee wird erst in ein paar Tagen zu ihrer Hochzeitsreise aufbrechen«, sagte Rothewell. »Und falls es zum Schlimmsten kommt, denke ich, dass der alte Blakely und ich damit schon zurechtkom–«
»Du?«, unterbrach Gareth ihn. »Rothewell, weißt du überhaupt, wo sich die Büros von Nevilles befinden?«
»Nein, aber mein Kutscher ist in den vergangenen neun Monaten fast jeden Tag dorthin gefahren«, entgegnete er. »Wer ist Nevilles schärfster Konkurrent?«
Gareth zögerte. »Carwell’s, drüben in Greenwich. Sie sind ein wenig größer als wir, aber wir liefern ihnen einen harten Wettbewerb.«
Rothewell stellte sein Glas auf dem Sideboard ab. »Dann werde ich ganz einfach ihren besten Handelsagenten abwerben«, erklärte er. »Jeder Mensch hat seinen Preis.«
»Du willst ihn engagieren, um mich zu ersetzen?«
Rothewell nahm Gareth das leere Glas aus der Hand und ging zum Sideboard zurück. »Mein Freund, du machst dir selbst etwas vor, wenn du denkst, dass du dein altes Leben weiterführen kannst«, sagte er und zog den Stopfen aus der Karaffe mit dem Brandy. »Ich weiß, wie es ist, eine Last aufgebürdet zu bekommen, die man nicht haben will. Aber du hast keine Wahl. Du bist ein englischer Gentleman. Eine Verweigerung wird dich nirgendwohin bringen.«
»Du bist gerade der Richtige, um mir Ratschläge in Sachen Verweigerung zu erteilen«, stellte Gareth unverblümt fest. »Du trinkst zu viel, verdammt noch mal, und lässt dein Leben und deine Fähigkeiten einfach verkommen.«
»Et tu, Brute?«, fauchte Rothewell ihn über die Schulter hinweg an. »Vielleicht sollte ich dich in ein Kleid aus Musselin stecken und dich ›Schwester‹ nennen! Ich kann jedenfalls sagen, dass ich Xanthia nicht im Mindesten vermissen werde.«
Gareth schwieg. Rothewell füllte beide Gläser erneut, zog heftig an der Klingelschnur, und Trammel erschien fast sofort. »Sagt den Leuten, sie sollen meine Reisekutsche vorbereiten«, befahl er. »Mr. Lloyd wird sie bei Tagesanbruch brauchen. Man soll ihn in seinem Haus in Stepney abholen.«
»Wirklich, Rothewell, das ist vollkommen unnötig«, protestierte Gareth und sprang auf.
Aber Trammel war schon wieder gegangen. »Du kannst nicht gut in einem kleinen Einspänner auf Selsdon Court vorfahren«, erklärte Rothewell. »Und auch nicht mit einem Boot auf dem Kanal.«
»Schön und gut, aber ich werde auch nicht in einer geliehenen Kutsche fahren, bei Gott.«
Rothewell durchquerte das Arbeitszimmer und drückte Gareth das Glas in die Hand. »Die Kutsche, wenn ich mich nicht sehr irre, gehört zum Gesellschaftsvermögen von Neville’s.«
»Einer Firma, deren Angestellter ich nicht länger bin«, fauchte Gareth.
»Aber deren stiller Teilhaber du immer sein wirst«, entgegnete Rothewell. »Ich bin sicher, auf dich wartet eine ganze Reihe feiner Kutschen auf Selsdon Court. Du kannst mir meine zurückschicken, wenn du dich dort eingerichtet hast.«
»Du wirst mir keine Ruhe lassen, nicht wahr, Rothewell?«
»Mir wurde sie auch nicht gelassen. Warum also sollte es dir besser gehen?« Mit spöttischem Ernst erhob der Baron sein Glas. »Auf Seine Gnaden, den Duke of Warneham. Möge er lange herrschen.«
Kapitel 3
Im Haus war es totenstill, der Geruch von frischem Brot und Kohl hing schwer in der Luft. Die Seile, die das Bett hielten, ächzten, als seine Mutter sich mühsam aufrichtete, Zentimeter um schmerzhaften Zentimeter. »Gabriel, tatellah, komm zu mir.«
Er kroch auf allen vieren auf das Bett und schmiegte sich wie ein Welpe an sie. Die Finger seiner Mutter fühlten sich kalt an, als sie ihm durchs Haar strich. »Gabriel, ein englischer Gentleman tut immer seine Pflicht«, sagte sie mit schwacher Stimme. »Versprich mir … versprich mir, dass du ein guter Junge sein wirst – ein englischer Gentleman. Wie dein Vater. Ja?«
Er nickte, sein Haar rieb sich an der Bettdecke. »Mama, wirst du sterben?«
»Nein, tatellah, nur meine menschliche Hülle«, flüsterte sie. »Die Liebe einer Mutter stirbt nie. Sie währt immer, Gabriel, über alle Zeit und über das Grab hinaus. Die Liebe einer Mutter kann niemals zerstört werden. Verstehst du das?«
Er verstand es nicht, nickte aber trotzdem. »Ich werde immer meine Pflicht tun, Mama«, schwor er. »Ich werde ein Gentleman sein. Ich verspreche es.«
Seine Mutter seufzte und sank zurück in den gnädigen Schlaf des Vergessens.
»Ich sage ja nur, dass mir das nicht sehr gerecht erscheint, Mylady.« Nellie fuhr mit der Bürste durch das lange blonde Haar ihrer Herrin. »Eine Frau sollte nicht aus ihrem eigenen Haus geworfen werden – und schon gar nicht eine Witwe.«
»Dies ist nicht mein Haus, Nellie«, entgegnete die Duchess mit fester Stimme. »Frauen besitzen keine Häuser. Männer entscheiden, wo sie leben.«
Nellie schnaubte verächtlich. »Meine Tante Margie hat ein eigenes Haus«, sagte sie. »Und auch eine Schänke. Und kein Mann wird sie daraus vertreiben, verlasst Euch darauf.«
Die Duchess schaute in den Spiegel und lächelte leicht. »Ich beneide deine Tante Margie. Sie hat eine Freiheit, die Frauen … nun, die Frauen, die wie ich erzogen wurden, niemals erwarten können.«
»Adlige Frauen, meint Ihr«, sagte Nellie wissend. »Nein, Mylady, ich habe gesehen, wie einige Leute Eurer Gesellschaftsschicht leben, und ich verdiene mir lieber jeden Tag mein Brot im Schweiße meines Angesichts.«
»Du bist sehr klug, Nellie.«
Der Blick der Duchess fiel auf ihre Hände, die sie auf dem Schoß gefaltet hielt. Nellie arbeitete jetzt seit zehn Jahren für sie. Ihre fähigen Hände hatten begonnen ihr Alter zu zeigen, und ihre Stirn war beständig gefurcht. Wenn sie allein waren – was oft der Fall war –, benutzte die Zofe oft die früheren Namen oder Titel ihrer Herrin, manchmal auch eine Kombination aus beidem. Die Duchess hielt sich nicht damit auf, sie zu korrigieren. Sie hegte keine besondere Vorliebe für den hohen Rang, den das Schicksal ihr beschert hatte. Schon vor dieser Ehe hatte sie darauf gehofft, die Jahre ihrer Witwenschaft ruhig verleben zu können. Vielleicht würde ihr dieser Wunsch nun endlich erfüllt werden.
»Habt Ihr von Lord Swinburne Nachricht erhalten?« Nellie legte die Bürste zur Seite und suchte in einer Porzellanschale, die mit Haarnadeln gefüllt war, nach einer passenden.
»Ein Brief kam aus Paris.« Die Duchess versuchte fröhlich auszusehen. »Papa wird wieder Vater werden – und das schon sehr bald. Seine Hochzeitsreise ist offensichtlich so verlaufen, wie man sie sich wünscht.«