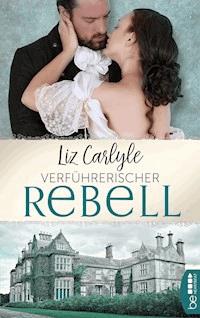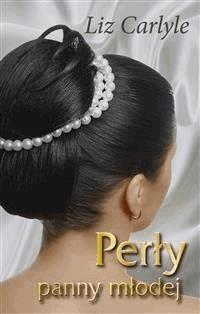4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannend und verführerisch zugleich - ein sinnliches Katz- und Maus-Spiel
Als neue Haushälterin von Cardow Castle bringt Aubrey das vernachlässigte Schloss wieder auf Vordermann. Wenig später stirbt der alte Schlossherr, und sein Neffe, Earl Walrafen, kehrt nach langer Abwesenheit wieder auf das Anwesen seiner Vorfahren zurück. Dort will er dem mysteriösen Tod seines Onkels nachgehen. Schon bald fällt sein Verdacht auf die hübsche Haushälterin. Doch auch wenn Aubrey ganz offensichtlich etwas zu verbergen hat, kann sich der junge Earl ihrem Charme nur schwer entziehen. Wann immer die beiden sich begegnen, lässt die Leidenschaft sie jede Vorsicht vergessen ...
Weitere historische Liebesromane von Liz Carlyle als eBook bei beHEARTBEAT u.a.: "Ein unwiderstehlicher Halunke", "Verbotenes Begehren" und "Entflammt von deiner Liebe".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Entflammt von deiner Liebe
Verloren in deiner Sehnsucht
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über das Buch
Spannend und verführerisch zugleich – ein sinnliches Katz- und Maus-Spiel
Als neue Haushälterin von Cardow Castle bringt Aubrey das vernachlässigte Schloss wieder auf Vordermann. Wenig später stirbt der alte Schlossherr, und sein Neffe, Earl Walrafen, kehrt nach langer Abwesenheit wieder auf das Anwesen seiner Vorfahren zurück. Dort will er dem mysteriösen Tod seines Onkels nachgehen. Schon bald fällt sein Verdacht auf die hübsche Haushälterin. Doch auch wenn Aubrey ganz offensichtlich etwas zu verbergen hat, kann sich der junge Earl ihrem Charme nur schwer entziehen. Wann immer die beiden sich begegnen, lässt die Leidenschaft sie jede Vorsicht vergessen …
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck - auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
STÜRMISCHESSPIELDER HERZEN
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Britta Evert
beHEARTBEAT
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Digitale Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2004 by S. T. WoodhouseAll rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon Schuster, Inc., New York
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»A Deal With the Devil«Originalverlag: Pocket Books
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Purestock | ke77kz; © hotdamnstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5512-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meinen geliebten EhemannFortis in arduis.
Prolog
Der Teufel zeigt sein Angesicht
Es hieß, der Winter an der Küste von Somerset sei von einer gewissen düsteren Schönheit geprägt. Einigen jedoch erschien der Februar des Jahres 1827 vor allem düster. Es hätte schlimmer sein können, nahm Aubrey Farquharson an. Es hätte der Winter des Jahres 873 sein können.
In jenem Jahr errichteten die Bewohner des Dorfes, geplagte, hungernde und erschöpfte Bauern, auf einer Anhöhe hoch über dem Bristol-Kanal einen Steinhügel, um von dort Ausschau nach normannischen Eroberern zu halten. Aber wie es bei Eroberern zu sein pflegt, waren sie heimtückisch und ausdauernd. Bald wurde aus der kleinen Erhebung notgedrungen ein Wachturm und aus dem Turm ein Bollwerk, bis viele Jahre später aus dem ursprünglichen Steinhügel Castle Cardow geworden war, benannt nach der Anhöhe, auf der es stand.
Angesichts seiner strategischen Bedeutung flatterte auf den Zinnen bald das Banner der Könige von Wessex. Doch von Anbeginn an schien der Burg das Schicksal bestimmt zu sein, ein Ort des Leids zu sein. Einige meinten, Cardow wäre aus Steinen und Tränen erbaut worden, und ganz gewiss wurden dort viele Tränen vergossen. Bei der endgültigen Eroberung im zweiten Krieg mit den Dänen wurden die tapferen Männer, die die Festung hielten, von Gunthrum dem Wikinger und seinen Gefolgsleuten verbrannt, gefoltert und bei lebendigem Leib gehäutet. Der barbarischste unter ihnen hieß Mangus der Walrafen oder »der Todesrabe«, benannt nach der Galionsfigur seines Schiffs, einem gewaltigen schwarzen Vogel mit weit ausgebreiteten Schwingen, der sich wie ein Racheengel auf seine unschuldigen Opfer zu stürzen schien.
Der Vergleich war durchaus zutreffend. Nachdem Mangus die Burg verwüstet hatte, beschloss er, sich über die kläglichen Reste herzumachen. Er stieß auf etwas nach seinem Geschmack – die Erbin von Cardow – und nahm sie gewaltsam zur Frau. Sie war ein blondes, blauäugiges Sachsenmädchen namens Ermengild, deren Name wörtlich übersetzt »stark im Kampf« bedeutete. Mangus jedoch ignorierte den Hinweis. Er benannte Burg und Dorf nach sich selbst und ließ sich dort nieder.
Zwei Jahre lang beuteten die Wikinger das Königreich Wessex aus, und Mangus beutete seine Frau aus. Aber Ermengild hielt sich tapfer. Und eines Tages zwang der König von Wessex, der Mann, der eines Tages den Namen Alfred der Große tragen sollte, die heidnischen Wikinger, sich zu beugen, nicht nur vor England, sondern auch vor dem Christentum. Gunthrum wurde schmählich geschlagen und segelte mitsamt seinem Gefolge davon. Mangus verließ seine Frau, die im dritten Monat schwanger war, mit dem Schwur, er werde wiederkommen.
Als er tatsächlich zurückkehrte, war die Burg auf dem Berg Cardow – oder wie immer man ihn nennen wollte – zu einer starken Festung ausgebaut worden. Für das, was Ermengild vorhatte, wurden die Verteidigungsanlagen allerdings kaum benötigt. Als sie das Schiff ihres Ehemanns den Kanal heraufkommen sah, ging sie zum Burggraben hinunter, umarmte kurz darauf Mangus auf der Zugbrücke und stieß ihm dann ihr bestes Küchenmesser zwischen die Schulterblätter. Damit endete – so sagt man jedenfalls – die erste von vielen unglücklichen Ehen auf Castle Cardow.
Aubrey Farquharson hatte auf ihrer Reise von Birmingham diese und etliche andere Geschichten gehört. Der Schiffsarzt, der ihnen in der Postkutsche gegenübergesessen hatte, stammte aus Bristol und hatte es offensichtlich von ganzem Herzen genossen, zum Vergnügen all jener, die seine Gesellschaft teilten, sein Garn zu spinnen. Aubrey hatte ihm höflich gedankt, war bei Minehead rasch aus der Kutsche gestiegen und in die schäbige, kleine Poststation geeilt, nur um ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt zu sehen.
Sie seien zu spät dran für die Kutsche, hatte der Gastwirt gesagt, die geschickt worden war, um sie nach Cardow zu bringen. Major Lorimers Bedienstete hätten vor ungefähr zwei Stunden aufgegeben. Aber es gebe auch eine gute Nachricht, fügte der Wirt hinzu. Er könnte ihnen einen alten Zweispänner anbieten. Gegen Bezahlung. Dieser Teil der Nachricht war nicht ganz so gut gewesen. Aber Aubrey blieb kaum etwas anderes übrig. Sie nahm ein paar Münzen aus ihrer Börse und machte sich auf den Weg, um ihrem Schicksal entgegenzutreten.
Als der Wagen ratternd von der Hauptstraße abbog und den Burggraben überquerte, um die Steigung in Angriff zu nehmen, lehnte sich Aubrey näher ans Fenster und blickte hinaus, wobei sie mit einer Hand die beschlagene Scheibe abwischte. Das Schloss, das hoch über ihnen aufragte, hätte gut und gern Mrs. Radcliffe als Inspiration für einen ihrer Schauerromane dienen können. Das Einzige, was tatsächlich noch fehlte, war ein Schwarm Raben, der wie eine bösartige Wolke vor dem bleigrauen Himmel aufstieg.
Aber dieser Gedanke rief Erinnerungen an die düstere Geschichte derer von Walrafen wach. Aubrey erschauerte und wandte den Blick ab. Sie hatte keineswegs den Wunsch, die nächsten zehn Jahre an diesem Ort buchstäblich eingesperrt zu sein. Und schon gar nicht behagte ihr die Vorstellung, ein Kind an einen derart beklemmenden Ort zu bringen. Unter ihr ächzte und knarrte der schlecht gefederte Wagen, als der Kutscher seine Pferde um die nächste Biegung lenkte und die Räder dabei tief durch den Schlamm pflügten. Das Innere des Gefährts roch nach feuchtem Leder und morschem, verrottendem Holz. Iain, der ihr gegenübersaß, blickte zu ihr auf. Die Augen des Jungen waren geweitet, und sein Gesicht war immer noch blass. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, einen Fünfjährigen ins Unbekannte zu entführen? Die Strapazen hatten seinen Zustand eindeutig verschlechtert. Sicher hätte irgendjemand ihn in seine Obhut nehmen können …
Nein. Es gab niemanden. Niemanden, dem sie Iain hätte anvertrauen können.
»Wird der Mann dir die Stellung trotzdem geben, Mama?«, fragte Iain leise. »Ich wollte in Marlborough nicht, dass mir schlecht wird. Soll ich dem Mann … dem Major sagen, dass es meine Schuld ist?«
Aubrey beugte sich vor und strich mit einer Hand über Iains schimmerndes schwarzes Haar. Er hatte das Haar ihres Vaters. Und seinen Namen. Daran hatte Aubrey nichts zu ändern gewagt. Es war schön und gut, einem Kind einzureden, dass es einen neuen Nachnamen tragen und vergessen müsse, jemals einen anderen gehabt zu haben. Und es war nicht schwer gewesen, die Kanten seines leichten Akzents abzuschleifen und ihn als einen der vielen Jungen aus der Gegend um Newcastle auszugeben, dessen Vater bei der Arbeit im Bergwerk das Leben verloren hatte. Aber seinen Vornamen ändern, auf den er getauft worden war? Oder ihren eigenen?
Nein. Es widersprach jeder inneren Überzeugung. Noch dazu könnte sich sein Name heute als ihre Trumpfkarte erweisen. Sie hoffte, dass es nicht so weit kommen würde, aber sie würde alles tun, was nötig war, um dem Jungen ein Dach über dem Kopf zu geben und die Bluthunde von ihrer Fährte abzubringen. Und konnte es dafür einen besseren Ort geben als Castle Cardow, das so weltabgeschieden und unzugänglich war?
»Iain«, meinte sie leise, »es ist nicht deine Schuld. Sag nichts, mein Schätzchen, ja? Wir finden schon einen Platz, wo du dich hinlegen kannst, und mit Major Lorimer werde ich bestimmt fertig. Er wird mir die Stellung geben, das verspreche ich dir.«
Iain lehnte sich zurück und schloss die Augen. Bald klapperte die Kutsche über die Pflastersteine zum Torhaus. Hoch über ihnen, in der Mitte des gewölbten Torwegs, drang fahles Licht durch ein schmales Fenster, und Aubrey konnte darunter die massiven Eisenspitzen eines alten Fallgitters erkennen, das hochgezogen worden war, um sie hereinzulassen. Vielleicht aber war es auch vor dreihundert Jahren hochgezogen und dort oben gelassen worden, verrostet und vergessen. Als die Kutsche unter dem Gitter hindurchrollte, starrte Aubrey an die schwarze Wagendecke. Sie spürte, wie ihre Haut prickelte, als sie plötzlich die völlig absurde Vorstellung hatte, das Fallgitter würde sich knarrend hinter ihnen senken und sie für immer innerhalb der Burgmauern gefangen halten.
Im Burghof setzte der gebeugte Kutscher sie unter einem verwitterten Vordach ab, lud ihr Gepäck ab und stieg wieder auf den Kutschbock. Aubrey hätte ihm beinahe zugerufen, er möge bitte warten, hielt die Worte aber zurück. Es regnete wieder in Strömen, und der Mann hatte es bestimmt eilig, nach Hause zu kommen, bevor der Matsch auf der schrecklichen, gewundenen Straße noch schlimmer wurde. Aubrey nahm Iain fest an der Hand, drehte sich zu der massiven Eingangstür um und betätigte den Türklopfer.
»Von einem Kind war aber nicht die Rede«, bemerkte das Dienstmädchen, das sich beeilte, ihnen ihre Umhänge abzunehmen. Die Miene der jungen Frau wirkte skeptisch, doch ihre Augen waren freundlich. Aubrey, die sich nicht vorstellen konnte, dass das Mädchen sie hinauswerfen würde, zwang sich zu einem Lächeln.
Das Mädchen zuckte mit den Schultern und plauderte weiter. »Na ja, Pevsner – das ist der Butler – ist mit den Dienern ins ›King’s Arms‹ gegangen«, fuhr sie fort. »Sonst würde ich ihn fragen, was ich machen soll.«
Dienstboten, die zu dieser Tageszeit in die Schenke gingen? Sehr eigenartig. »Ich habe nicht daran gedacht, Iain in meinem Brief an Major Lorimer zu erwähnen«, log Aubrey. »Aber er macht bestimmt keine Schwierigkeiten. Darf ich fragen, wie Ihr Name ist?«
»Betsy, Ma’am.«
»Danke, Betsy.« Aubrey lächelte das Mädchen an. »Vielleicht könnte man für Iain ein Klappbett beim Herd aufstellen. Ich bin überzeugt, Sie werden nicht einmal merken, dass er da ist.«
Betsy musterte den Jungen aus zusammengekniffenen Augen. »Ich denke, das lässt sich machen, Ma’am«, antwortete sie schließlich. »Aber man hat Sie vor der Teestunde erwartet. Danach empfängt der Major keine Besucher mehr.«
»Es tut mir sehr leid«, murmelte sie. »Unsere Postkutsche hatte Verspätung.« Das war nur eine kleine Notlüge.
Betsy vertraute sowohl die Umhänge als auch den Jungen einem anderen, jüngeren Mädchen an, das in der Nähe wartete und die Neuankömmlinge aus großen, arglosen Augen anstarrte. Offensichtlich wurden hier auf Cardow nicht sehr oft Gäste empfangen, denn auf den Möbeln lag eine dicke Staubschicht. Aubrey gab Iain einen leichten Kuss auf die Wange, bevor er mit dem Mädchen eine Treppe hinunter verschwand, die sich am anderen Ende der Halle befand.
Wie es ihrer neuen gesellschaftlichen Position entsprach, wurde Aubrey nicht in den Salon gebeten, sondern aufgefordert, auf einer harten schwarzen Bank in der Halle Platz zu nehmen. Betsy schenkte ihr ein weiteres zweifelndes Lächeln, bevor sie eine breitere und weit elegantere Treppe zu einer offenen Galerie hinaufging, die sich über die ganze Länge des Raumes erstreckte.
Aubrey versuchte, ihre Nerven zu beruhigen, indem sie sich umschaute. Die Halle war groß und wirkte mit ihrer Gewölbedecke sehr mittelalterlich. Und auch der Geruch erinnerte ans Mittelalter, denn es roch nach Feuchtigkeit und Verfall. Aubrey konnte sich den Schimmel lebhaft vorstellen, der sich hinter den riesigen Wandbehängen verbarg. Spinnweben von der Größe eines kleineren Segels hingen von den Konsolen der Pfeiler herab, auf denen die Galerie ruhte. Die beiden gewaltigen Feuerstellen waren verdreckt und die marmornen Kaminsimse mit Ruß überzogen. Über dem südlichen Kaminaufsatz waren Wappen und Schild der Familie zu sehen: Ein schwarzer Rabe mit ausgebreiteten Flügeln vor einem blutroten Hintergrund bildete das Wappenemblem, und der Schild zeigte zwei kämpfende Löwen.
Nun, die Grafen von Walrafen verkündeten ihre Botschaft laut und deutlich, wie es schien. Dennoch war Cardow ungeachtet seines Wappenschilds und des Moders im Lauf der letzten tausend Jahre offensichtlich ein, zwei Mal modernisiert worden. Auf dem Steinboden lagen orientalische Teppiche, die allerdings schon bessere Tage gesehen hatten. Das Mobiliar schien während der Regentschaft von William und Mary entstanden zu sein, während die eine Hälfte der Wände mit Gobelins behängt und die andere mit Holzvertäfelungen aus der Zeit Jakobs I. verkleidet war, deren kunstvolles Schnitzwerk aus Eiche vom Alter geschwärzt war und sich damit dem Zustand der Galerie anpasste.
Als Aubrey aufblickte, um die Galerie zu betrachten, fiel ihr das Echo leisen Stimmengemurmels auf – eines Gemurmels, das sich rasch zu hitzigen Worten erhob. Gleich darauf dröhnte eine tiefe Stimme durch das Gebäude:
»Sag ihr, dass der gottverdammte Posten vergeben ist!«, brüllte ein Mann. »So sieht’s aus! Und jetzt raus mit dir, du Trampel! Und nimm das Tablett mit. Den gottverdammten Fraß kann man nicht mal Schweinen vorsetzen!«
Leises Murmeln folgte. Geschirr klapperte.
»Es wird gemacht, was ich gesagt habe«, ließ sich die Männerstimme erneut vernehmen. »Raus mit dir, zum Teufel noch mal! Keine Widerworte!«
Noch mehr Gemurmel, noch mehr Klappern von Geschirr.
»Dann setz das Kind eben auch vor die Tür! Es ist halb fünf. Zum Donnerwetter noch mal, ich will jetzt in Ruhe meinen Whisky trinken.«
Weiteres Gemurmel. Dann ein kurzer, scharfer Aufschrei, dem das Geräusch klirrenden Glases folgte.
Ohne zu überlegen, sprang Aubrey auf und lief die Treppe hinauf. Die Galerie war breit, aber unbeleuchtet und führte in einen Gang mit einer Reihe von Türen, die tief in steinernen Torbögen saßen. Ein paar Schritte weiter fiel schwaches Licht auf den Steinboden des Korridors. Aubrey trat ohne Zögern in das Zimmer.
Direkt hinter der Tür kniete Betsy am Boden, hob Porzellanscherben auf und ließ sie in ihre Schürze fallen. Aubrey spähte in das Dämmerlicht. Im Kamin brannte ein kleines Feuer, die einzige Lichtquelle im Raum. Es war eine Bibliothek.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Aubrey und kniete sich neben Betsy, die vor unterdrückter Aufregung zitterte.
»Nein, ist es nicht«, knurrte ein Mann aus dem Schatten. »Das Mädchen ist ein verdammter Schwachkopf. Wer sind Sie, und was fällt Ihnen ein, einfach hier hereinzuplatzen?«
Aubrey stand auf und bemühte sich, ihre Augen auf die Dunkelheit einzustellen. »Major Lorimer?«
Im hintersten Winkel des Zimmers stand ein Sessel mit hoher, gewölbter Lehne; er stand tief im Schatten, als wollte sein Benützer nicht gesehen werden, und Aubrey konnte nur die undeutlichen Umrisse eines Mannes erkennen. Er stand unsicher auf, indem er sich auf einen Stock stützte, und kam mit schwerer Schlagseite nach Steuerbord auf sie zugehumpelt.
Das Dienstmädchen, das immer noch am Boden kauerte, duckte sich und zupfte weiter an den Scherben, die sich im Teppich verhakt hatten. Der Mann blieb ein paar Schritte von Aubrey entfernt stehen und musterte sie mit seinem rechten Auge von oben bis unten. Das linke Auge war nicht mehr als ein verrunzeltes, knotiges Stück Fleisch, tief in die Höhle eingesunken wie ein dicker, obszöner Bauchnabel. Sein linker Arm schien steif zu sein, und sein linkes Bein war unterhalb des Knies offenbar amputiert worden. Er war wesentlich schlechter gelaunt und älter, als Aubrey erwartet hatte. Und viel betrunkener.
Er humpelte auf seinem Holzbein ein Stück näher und starrte sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Verdammt noch mal, wer sind Sie?«
Aubrey stand auf und sah ihm direkt ins Auge – so gut sie es bei den herrschenden Lichtverhältnissen vermochte. »Guten Abend, Major Lorimer«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich bin Mrs. Montford, die neue Haushälterin.«
»Ach ja?«, schnarrte der alte Mann und beugte sich über das Dienstmädchen. »Geben Sie mir Ihre gottverdammte Hand.«
Aubrey streckte unsicher eine Hand aus. Der Major nahm sie und rieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger, als wollte er einen Ballen Tuch prüfen. »Hmpf!«, schnaubte er. »Wenn Sie eine gottverdammte Haushälterin sind, bin ich der Erzbischof von Canterbury.«
Aubrey hatte allmählich genug. »Eigentlich bin ich nur eine ganz gewöhnliche Haushälterin«, gab sie zurück. »Nicht eine gottverdammte Haushälterin. Wirklich, Sir, gibt es kein anderes Wort in Ihrem Vokabular?«
Einen Moment lang stand der Major einfach nur da und blinzelte sie aus seinem unversehrten Auge an. Dann starrte er auf Betsy hinunter und brüllte: »Raus! Raus!« Er stieß bei jeder Silbe mit seinem Stock nach ihr. »Verschwinde, du dumme Kuh!«
»Schluss damit!«, befahl Aubrey scharf und langte nach seinem Stock. »Hören Sie sofort auf!« Aber Betsy hastete bereits, begleitet vom Klirren der Scherben in ihrer Schürze, aus dem Zimmer.
Der Major umklammerte seinen Stock mit beiden Händen und beugte sich zu Aubrey vor. »Na schön, Miss … Mrs. … wie zum Teufel heißen Sie?«
»Montford«, antwortete sie mit Nachdruck. »Mrs. Montford.«
»Mrs. Montford also«, fuhr er höhnisch fort. »Und wie alt zum Teufel sind Sie?«
»Achtundzwanzig, Sir«, log sie.
Der Major lachte. »Oh, das bezweifle ich.« Aber seine Stimme klang etwas weniger zornig. »Und der Junge, den Sie mitgebracht haben, von wem ist er? Ein Andenken an Ihren letzten Dienstherrn?«
Aubrey spürte, wie ihr heiße Röte in die Wangen schoss. »Von meinem verstorbenen Gatten, Sir.« Diese Lüge fiel ihr weniger leicht.
Major Lorimer, der ihr Zögern spürte, nahm ihre andere Hand. Der Ehering, den sie trug, blinkte im Schein des Feuers.
»Er war Angestellter in einem Bergwerk«, sagte sie. »Wir kommen aus Northumberland.«
Der Major ließ ihre Hand los. Sein Blick huschte über ihr Gesicht. »Für mich sehen Sie wie eine verdammte Schottin aus.«
»Ich … äh, ja, das ist möglich«, gab sie zu. »Meine Großmutter stammte aus Stirling.«
»Ist auch egal«, knurrte er. »Der Posten ist vergeben.«
Aubrey schüttelte eigensinnig den Kopf und langte in ihre Tasche. »Sie haben mir die Stellung zugesichert, Major Lorimer«, beharrte sie, während sie ihr gefälschtes Empfehlungsschreiben hervorzog. »Sie haben geschrieben, dass ich eine Empfehlung von meinem letzten Arbeitgeber mitbringen soll. Und dass der Posten mir gehören würde, falls Sie mit meinen Referenzen zufrieden wären.«
»Na schön, da haben Sie’s!«, brauste er auf. »Ich bin eben nicht damit zufrieden!«
Aubrey hielt ihm das Schreiben vors Gesicht. »Sie haben doch noch nicht einmal einen Blick darauf geworfen!«, sagte sie empört. »Ich bin den weiten Weg von Birmingham gekommen, um für Sie zu arbeiten.«
Der Major griff nach dem Brief. »Nicht für mich!«, fuhr er sie an und humpelte zu einem Schreibtisch in der Nähe der Fenster. »Für meinen gottverdammten … ich meine, für meinen verflixten Neffen Giles. Es ist sein Haus, nicht meins.« Er warf ihren Brief auf den Schreibtisch.
»Jeder weiß, wer der Earl of Walrafen ist«, erwiderte Aubrey. »Aber soweit ich weiß, besucht Seine Lordschaft Cardow nur äußerst selten. Nun, können Sie mir vielleicht erklären, wie Sie es geschafft haben, einen Posten zu vergeben, der vor nicht ganz drei Tagen noch mir angeboten worden ist?«
Major Lorimer warf ihr ein höhnisches Grinsen zu. »Sie haben eine vorlaute Zunge, Mrs. Montford.«
Aubrey ließ nicht locker. »Ich schätze es nicht, wenn man mich zum Narren hält, Major Lorimer«, erklärte sie fest. »Noch dazu ist nicht zu übersehen, dass Cardow dringend eine Haushälterin braucht. Hat Seine Lordschaft eine Ahnung, in welchem Zustand sich sein Familiensitz befindet?«
Der Major lachte rasselnd. »Würde nicht den geringsten Unterschied machen, wenn er’s wüsste«, gab er zurück. »Giles würde es keinen Pfifferling scheren, wenn das verdammte Gemäuer schon morgen zu Staub und Asche zerfällt. Und jetzt gehen Sie schon, Mädchen. Raus mit Ihnen. Betsy wird für heute Nacht schon einen Schlafplatz für Sie und den Jungen finden. Hab meine Meinung wegen einer Haushälterin geändert. Kann nicht noch mehr Dienstboten brauchen, die hier herumschleichen, meinen Whisky trinken und ihre Nase in meine Angelegenheiten stecken.«
Es war ihm völlig ernst, stellte Aubrey fest. Er war betrunken, daran bestand kein Zweifel; er dünstete aus jeder Pore den Geruch ständiger Trunkenheit aus. Sein Halstuch war in Unordnung geraten, und auf seinem Gesicht zeigten sich Bartstoppeln. Dennoch konnte man spüren, dass noch ein Rest von Ehre in ihm steckte. Lorimer war älter als ihr Vater, aber er hatte immer noch das steife Rückgrat eines Soldaten. Sie verabscheute allein seinen Anblick – und doch fand sie den Mann eigentlich nicht unsympathisch.
Da sie keine andere Möglichkeit sah, holte Aubrey tief Luft und schnürte ihr Retikül auf, zog einen zweiten Brief hervor, dessen Papier sich an den Rändern bereits wellte, und reichte ihn wortlos dem Major.
Lorimer warf ihr einen eigenartigen Blick zu. »Was ist das?«
»Noch ein Brief, Sir.«
»Hä?« Widerwillig nahm er den Brief. »Von wem?«
»Von Ihnen, Sir«, antwortete sie. »Es ist Ihr Wort als Offizier und Gentleman. Sie schrieben meiner Mutter, als mein Vater starb, und boten uns Ihre Hilfe an, wann immer wir sie benötigen sollten.«
Mit undurchdringlicher Miene setzte sich der Major in einen Sessel neben dem Schreibtisch. Aubrey folgte ihm. Lorimer breitete den Briefbogen aus und hielt ihn ans Licht des Kaminfeuers. Nach einer langen Pause faltete er den Brief mit dem ersten Schreiben zusammen und legte beide in eine Schreibtischschublade. »Ach Gott, arme Janet«, sagte er leise. »Dann ist sie also tot?«
»Ja, Sir.«
»Was ist mit der Ältesten von euch?«, knurrte er. »Hat eine gute Partie gemacht, oder? Kann sie Ihnen nicht helfen?«
»Muireall war immer kränklich«, erwiderte Aubrey. »Sie starb kurz nach Mama.«
Der Major schaute sie nicht an. »Bei Gott, ich wusste doch, dass Sie schottisch aussehen«, murmelte er und stützte seinen Kopf auf eine Hand. »Sie haben die Augen und das Haar Ihrer Mutter.«
»Ja«, stimmte sie ihm leise zu.
Der Major schnaubte. »Sie stecken jetzt also in der Klemme, was, Mädchen? Und erwarten, dass ich Ihnen heraushelfe? Nun, hier sind Sie am falschen Platz. Ich bin nichts als ein müder, alter Soldat ohne Einfluss und habe gerade genug Geld, dass es für Whisky und Huren reicht.«
»Sir«, sagte sie bittend, »ich möchte nur eine Anstellung. Eine Chance, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.«
Wieder lachte er und starrte in die Dunkelheit. »Es war Iains Schuld, dass ich eine so schlechte Angewohnheit angenommen habe, wissen Sie«, gestand er ruhig. »Nicht die Huren. Der Whisky. ›Glasgow Gold‹ nannte er ihn.«
»Papa wusste einen guten Whisky zu schätzen.«
Jetzt sah der Major zu ihr und kniff sein unversehrtes Auge zusammen. »Ihr Vater war eine ganze Menge Geld wert, Mädchen«, bemerkte er argwöhnisch. »Warum brauchen Sie Arbeit?«
Aubrey zögerte. »Ich brauche sie eben«, antwortete sie schließlich. »Beim Leben meines Vaters, fragen Sie mich bitte nicht mehr. Sagen Sie bitte niemandem, dass Sie mich kennen.«
»Bei Gott, ich kenne Sie ja auch nicht!«
»So ist es«, meinte Aubrey schnell. »Ich bin einfach Mrs. Montford. Ihre Haushälterin.«
Statt einer Antwort beugte der Major sich vor und langte nach seiner halb leeren Whiskyflasche. Ein schmieriges Glas stand neben seinem Ellbogen auf dem Schreibtisch, und er füllte es langsam. »Beim Leben Ihres Vaters, wie?«, brummte er. »Ich denke, an mich war es verschwendet.«
»Sir, das können Sie unmöglich glauben.«
Sein Blick richtete sich plötzlich flammend auf sie. »Sie haben doch keine Ahnung, was ich glaube oder nicht!«, brauste er auf. »Verdammt noch mal, hören Sie auf, dummes Zeug zu reden!« Dann verengte sich sein Auge zu einem schmalen Schlitz. »Warten Sie, bei Jupiter! Irgendetwas klingelt bei mir.«
Aubrey schluckte schwer. »Sir?«
»Da war doch letztes Frühjahr in den Zeitungen von irgendeinem Skandal die Rede.« Er legte den Kopf zur Seite und kratzte sich am Ohr. »Oder war es im Jahr davor? Ein vertrauter Name, dachte ich mir damals noch. So sehr hänge ich noch nicht an der Flasche, um das zu vergessen. Ha! Mrs. Montford, dass ich nicht lache! Ich wette zehn Guineas, dass Sie auch in diesem Punkt nicht die Wahrheit sagen.«
Aubrey schloss die Augen. »Fragen Sie mich nichts mehr, Sir. Bitte.«
»O nein, ganz bestimmt nicht«, versicherte er ihr. »Ich will gar nicht mehr über Sie oder die Schwierigkeiten, in denen Sie stecken, wissen. Ich werde meine Pflicht Ihrem Vater gegenüber erfüllen, aber das ist auch schon alles, verstanden?«
»Ja, Sir.«
Jetzt sah er sie nicht mehr an, sondern starrte ins Feuer. »Ein Mädchen von Ihrer Herkunft sollte nicht als Dienstbote arbeiten.«
»Es ist ehrliche Arbeit, Sir«, erwiderte Aubrey. »Ich habe Erfahrung darin, einen großen Haushalt zu führen.«
Der Major schnaubte. »Mir egal, und wenn Sie eine Wäschemangel nicht von einem Flaschenöffner unterscheiden können«, brummte er. »Ich würde die ganze Bande rausschmeißen, wenn Giles es zuließe. Aber das tut er nicht. Und jetzt habe ich Sie auch noch am Hals, was?«
Aubrey antwortete nicht.
Der Major fluchte halblaut und setzte unsicher die Flasche ab, als könnte er die Entfernung zum Schreibtisch nicht richtig einschätzen. »Na schön, es läuft folgendermaßen, Mädchen«, fuhr er fort und hielt gleich darauf kurz inne, um sich mit seinem Ärmel den Mund abzuwischen. »Ich will, dass mein Whisky kühl und mein Bad heiß bereitsteht. Ich wünsche meinen Tee um vier und mein Dinner um sechs. Hier drinnen, auf einem Tablett.«
Aubrey stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. »Ja, Sir.«
»Und ich will von keinem von euch auch nur einen Mucks hören, es sei denn, das Schloss steht in Flammen oder die Franzosen kommen den Kanal heraufgesegelt. Fragen Sie mich nicht um Rat bei der Führung des Haushalts, denn dazu habe ich keine Meinung. Und fragen Sie mich auch nichts, was die Verwaltung der Ländereien betrifft, denn davon verstehe ich genauso wenig, und ich habe nicht vor, es zu lernen.«
Aubrey schaffte es zu nicken. »Ja, Sir.«
Aber Lorimer holte erneut tief Luft. »Ich esse morgens nichts zum Frühstück. Ich empfange keine Besucher. Öffnen Sie die Post. Wenn es eine Rechnung ist, bezahlen Sie sie. Wenn es sich um Verwaltungsfragen handelt, wenden Sie sich an Giles. Alles andere kann verbrannt werden. Wenn ich ins Dorf gehe und eine Hure mit nach Hause bringe, ist es meine Angelegenheit. Wenn ich hier drinnen betrunken umkippe und mich von oben bis unten einnässe, ist es meine Angelegenheit. Wenn ich beschließe, mich splitternackt auszuziehen und mit bloßem Hintern über die Brustwehr zu laufen … nun, was wäre das wohl, Mrs. Montford?«
»I-ihre Angelegenheit, Sir?«
»Verdammt richtig. Und wem das nicht passt, der kann jederzeit gehen. Konnten Sie mir folgen, Mrs. Montford?«
»Ja, Sir.«
Lorimer lächelte zynisch. »Und noch etwas, Mrs. Montford – ich hasse Kinder. Halten Sie mir Ihren flennenden Balg vom Leib, verstanden? Denn wenn Sie ihn in meine Nähe lassen, werde ich ihm alles beibringen, was ich weiß, angefangen mit dem Wort gottverdammt, das schwöre ich bei Gott!«
Aubrey spürte, dass ihre Knie unter ihr nachzugeben drohten. »Ja, Sir«, antwortete sie. »Er wird Sie nicht belästigen, das verspreche ich. Gibt es … sonst noch etwas?«
Der Major lachte keuchend. »Das will ich meinen!«, erwiderte er. »Innerhalb von zwei Tagen werden alle im Dorf die Köpfe zusammenstecken und darüber tuscheln, dass Sie eins meiner kleinen Täubchen aus London sind. Das sagen sie immer, wenn eine hübsche Frau hier in Stellung geht.«
Leichte Übelkeit stieg in Aubrey auf.
»So!«, knurrte er und kippte das ganze Glas Whisky mit einem Schluck hinunter. »Jetzt haben Sie Ihre heiß begehrte Anstellung, Mrs. Montford. Möge sie Ihnen viel Freude bereiten.«
Aubrey machte einen unsicheren Knicks. »D-danke, Sir.«
Major Lorimer rülpste.
Aubrey floh.
Kapitel 1
In welchem Lord de Vendenheim nicht erheitert ist
September 1829
Es war ein schöner Nachmittag in Mayfair. In Geschäften wie in Privathäusern hatte man die Fenster weit aufgerissen, um die Herbstluft hereinzulassen, und auf der Hill Street nutzten Hausmädchen die Gelegenheit, die Stufen zum Hauseingang zu kehren, solange die Sonne noch warm schien. Kutscher lüpften bereitwilliger als sonst ihre Hüte, wenn sie vorbeifuhren, und auf dem Bürgersteig lungerte ein halbes Dutzend Diener herum, um frische Luft zu schöpfen und darauf zu warten, etwas – oder auch nichts – zu tun.
Das Arbeitszimmer des Earl of Walrafen, das sich in einem Eckzimmer im ersten Stock befand, schien wie geschaffen dafür, um darin einen solchen Tag zu genießen. Alle vier Schiebefenster waren hochgeschoben worden, und hinter seinem Rücken konnte der Earl das Gurren der Tauben hören, die auf den Simsen paradierten und an ihrem Gefieder zupften. Aber im Gegensatz zu den Hausmädchen war Walrafen nicht zufrieden – das war er kaum jemals –, daher warf er den Brief, den er gerade gelesen hatte, auf seinen Schreibtisch, und musterte finster seinen Privatsekretär.
»Ogilvy!«, blaffte er ihn an. »Die Tauben! Die Tauben! Schaffen Sie die Mistviecher von den verdammten Fenstersimsen!«
Ogilvy verriet mit keiner Miene, was er dachte, bewies aber seinen guten Willen, indem er von seinem Arbeitstisch aufsprang und mit einem Lineal in den Händen ans Fenster preschte. »Husch, husch!«, rief er in das Flattern und Rascheln von Flügeln. »Weg mit euch, ihr kleinen Teufel!«
Nachdem er das erledigt hatte, machte er eine steife Verbeugung und setzte seine Arbeit fort. Walrafen, der sich ein bisschen albern vorkam, räusperte sich. Der junge Ogilvy war vielleicht noch etwas unerfahren in seinem Beruf, doch es gehörte wohl kaum zu seinen Aufgaben, Tauben zu verscheuchen. Walrafen war gerade im Begriff, sich zu entschuldigen, als sich die leichte Brise von einem Moment auf den anderen zu einer heftigen Bö steigerte und den Deckel des Karteikastens auf seinem Schreibtisch aufspringen ließ. Die Korrespondenz von zwei Jahren wirbelte wie ein winziger Tornado aus Briefpapier durch das Zimmer.
Walrafen fluchte laut. »Reicht es nicht, Ogilvy, dass diese Frau mich jede Woche mit ihren Forderungen plagen muss?«, knurrte er, während sie zusammen die Papiere auflasen. »Jetzt scheint es, als wäre auch die Ablage mit Mrs. Montfords Briefen vom Teufel besessen.«
Und so schien es tatsächlich zu sein, denn nach diesem kurzen Ausbruch herrschte wieder völlige Windstille. Ogilvy tippte leicht an den Rand des Karteikastens. »Nichts passiert, Sir.« Er schob den Kasten ein Stück vor. »Es ist alles da.«
Der Earl lächelte trocken. »Genau das macht mir ja Angst.«
Der junge Mann grinste und widmete sich wieder seiner Arbeit. Walrafen öffnete den Kasten und nahm sich erneut den obersten Brief vor.
Castle Cardow21. September
Mylord,
wie ich Ihnen bereits in meinen letzten vier Briefen zur Kenntnis gebracht habe, ist es nunmehr dringend vonnöten, eine Entscheidung bezüglich des Westturms zu treffen. Da ich nichts von Ihnen gehört habe, habe ich es auf mich genommen, einen Architekten aus Bristol kommen zu lassen. Die Herren der Firma Simpson & Verney berichten, dass sich in der Außenmauer ein tiefer Setzungsriss befindet und das Fundament besorgniserregend verschoben ist. Bitte, Sir, sollen wir den Turm abreißen oder abstützen? Ich versichere Ihnen, dass mir egal ist, was geschieht, und ich nur wünsche, dass ein Entschluss gefasst wird, bevor der ganze Turm zusammenbricht und auf einen der Gärtner stürzt, da gute Gärtner nur schwer zu bekommen sind.
Hochachtungsvoll
Mrs. Montford
Guter Gott, war das wirklich ihr fünfter Brief wegen des baufälligen alten Turms? Man sollte meinen, dass sie das verdammte Ding mittlerweile hätte instand setzen lassen. Walrafen verspürte jedenfalls nicht den Wunsch, sich näher damit zu befassen. Immerhin hatte sie bereits Architekten engagiert. Ja, in Mrs. Montfords fähigen Händen konnte man Cardow mitsamt allem, was dazugehörte, getrost vergessen, genau, wie er es sich wünschte. Er brauchte nichts zu tun. Es war ein geradezu erstaunlicher Luxus.
Er griff nach dem nächsten Briefbogen. Ha! Eine weitere Lieblingsklage Mrs. Montfords – Onkel Elias’ schlechte Verfassung. Der arme Kerl hatte keine ruhige Minute mehr.
Mylord,
Ihrem Onkel geht es nach wie vor sehr schlecht – ein Leberleiden, wie ich vermute. Er weigert sich, Dr. Crenshaw zu empfangen, und hat letzte Woche, als der Doktor gerade wieder in seine Kutsche stieg, mit einer Flasche nach ihm geworfen. Da es um seine Sehkraft kaum besser bestellt ist als um seine Leber, verfehlte er sein Ziel. Dennoch wende ich mich mit der Bitte an Sie, Ihren Onkel davon zu überzeugen, sich medizinisch behandeln zu lassen …
»Madam«, murmelte Walrafen dem Papier zu, »wenn Ihr konstantes Genörgel ihn nicht überzeugt, habe ich nicht die geringste Chance.«
»Wie bitte, Sir?« Ogilvy blickte von seiner Schreibarbeit auf.
Walrafen hob den Brief auf, indem er ihn zwischen zwei Fingern hielt, als wäre es ein schmutziges Taschentuch.
»Ah!«, sagte der junge Mann wissend. »Die Haushälterin.«
Ja, die Haushälterin. Ein wohlbekannter Stachel in seinem Fleisch. Walrafen lächelte reumütig und legte den Brief zurück, zog dann aber, einem seltsamen Impuls folgend, ein weiteres Schreiben aus dem Stapel. Es war vom März vor zwei Jahren und eines seiner frühen Favoriten.
Mylord,
Ihr Onkel hat mir wieder einmal gekündigt. Bitte teilen Sie mir mit, ob ich bleiben oder gehen soll. Für den Fall, dass ich Cardow verlassen muss, darf ich Sie darüber informieren, dass mir noch ein Pfund, acht Shilling und sechs Pence zustehen, die ich letzte Woche dem Drogisten vorstrecken musste, weil Ihr Onkel aus reinem Mutwillen den Schlüssel zur Geldkassette verschluckt hatte. (Wir hatten einen hitzigen Wortwechsel wegen seines Wunschs, im Dorf unverzollten Brandy zu kaufen.) Wenn ich bleiben soll, schreiben Sie Ihrem Onkel bitte umgehend, dass der Schlüssel zurückgegeben werden muss und die Aufgabe, ihn gewissermaßen freizulegen, ihm überlassen bleibt …
Armer Onkel Elias! Der Earl sah förmlich vor sich, wie er sich mit einem Taschenmesser in der Hand über seinen Nachttopf beugte, hinter ihm Mrs. Montford, die vermutlich drohend eine Reitgerte schwenkte. Walrafen prustete vor Lachen, ignorierte Ogilvys neugierigen Blick und griff nach einem weiteren Brief. Dieser hier stammte vom Frühlingsanfang, als sie offenbar das Haus vom Keller bis zum Dachboden auf den Kopf gestellt hatte. Ein kleiner Teil von ihm fragte sich unwillkürlich, wie das alte Gemäuer jetzt wohl aussehen mochte.
Mylord,
ist Ihnen bekannt, dass sich in der untersten Schublade der bauchigen Kommode, die in Ihrem alten Ankleidezimmer steht, sechs tote Kröten befinden? Betsy sagte mir, Sie hätten bei Ihrer Abreise nach Eton strikte Anweisungen gegeben, dass nichts in Ihren Räumen angerührt werden dürfte. Aber da das im Jahr 1809 war und wir mittlerweile 1829 schreiben, hielt ich es für das Beste, die Frage zu klären. Vielleicht darf ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass besagte Kröten jetzt nur noch aus Staub und Knochen bestehen.
Voller Anteilnahme für Ihren Verlust
Mrs. Montford
P.S.: Ihr Onkel hat mir schon wieder gekündigt. Teilen Sie mir bitte mit, ob ich bleiben oder gehen soll.
Walrafen warf den letzten Brief beiseite und klemmte seinen Nasenrücken fest zwischen Daumen und Zeigefinger. Er hätte am liebsten gelacht. Zum Kuckuck noch mal, er hätte auch gern geweint. Gehen Sie!, dachte er. Gehen Sie, Mrs. Montford! Fort mit Schaden!
Aber im Grunde wollte er doch gar nicht, dass Mrs. Montford ging, oder? Nein, verflixt, er wollte es nicht! Das Papier schien auf einmal zu grell für seine Augen zu sein. Er fühlte, dass sich Kopfschmerzen ankündigten. Die Person schaffte es immer wieder, ihn aus der Fassung zu bringen. Sie ärgerte ihn. Sie amüsierte ihn. Sie war unverschämt. Und doch manchmal beklagenswert treffsicher in ihren Bemerkungen.
Denn das war eigentlich das Problem, nicht wahr? In seinen ehrlicheren Momenten konnte er es sich ruhig eingestehen: Die Frau machte ihm Schuldgefühle, und das mit erschreckender Regelmäßigkeit seit fast drei Jahren. Ihre Briefe waren im Ton schärfer geworden, fordernder und mit jedem Monat, der verging, scharfsinniger. Er fürchtete sich davor, sie zu öffnen, las sie aber immer wieder. Im Übrigen machte er sich nie die Mühe, sie zu beantworten, was lediglich noch mehr Briefe zur Folge hatte. Er hätte sie beim ersten Anzeichen von Unverschämtheit feuern sollen.
Aber manchmal brachten ihn ihre Briefe zum Lachen, und das kam in seinem Leben selten genug vor. Und sie riefen in ihm Erinnerungen an das Heim seiner Kindheit wach. Zumindest die angenehmeren Erinnerungen an diese Zeit. Eigenartig, aber manchmal schien es fast, als wollte Mrs. Montford versuchen … ja, ihn dorthin zu locken. In einigen ihrer Briefe schwang noch etwas anderes mit als Zynismus und Tadel, etwas, das mit vertrauter Stimme leise zu ihm sprach.
Er griff nach einem weiteren Brief, der vom Mai dieses Jahres stammte und dessen Kanten bereits Eselsohren hatten, und las einen vertrauten Abschnitt.
Der Stechginster auf den Hügeln zeigt sich dieses Jahr in einer höchst bemerkenswerten Schattierung von Grün, Mylord. Ich wünschte, Sie könnten es sehen. Die Pfingstrosen machen sich sehr gut, und Jenks hat mir gesagt, dass er daran denkt, beim ummauerten Garten eine Pergola zu errichten …
Warum schrieb sie ihm von diesen Dingen? Und warum las er es immer wieder? Walrafen fragte sich nicht zum ersten Mal, ob seine Haushälterin wohl hübsch war. Er war über ihr Alter nicht im Bilde, aber ihre Briefe verrieten ihm, dass sie noch jung war. Jung und voller Vitalität. Onkel Elias hatte die hübscheren weiblichen Dienstboten schon immer lieber in einer anderen Position als auf ihren zwei Beinen gesehen. Walrafen überlegte, ob der lüsterne alte Bock auch diese in sein Bett bekommen hatte.
Ja, sicher hatte er das. Andernfalls hätte er sie schon längst ihrer Wege geschickt. Keine Angestellte würde es für die kärgliche Summe, die er Mrs. Montford zahlte, mit Onkel Elias aufnehmen. So verzweifelt konnte niemand sein. Oder etwa doch …?
Der Gedanke bereitete ihm … nun ja, er wusste nicht recht, wie ihm dabei zumute war. Ganz gewiss wünschte er nicht, dass ein Engländer – oder eine Engländerin – durch Herkunft oder Armut gezwungen war, eine Stellung zu behalten, die als unzumutbar gelten konnte. Das Hämmern in seinem Kopf verstärkte sich. O Gott, sie war seine Nemesis, diese Mrs. Montford mitsamt ihrem Genörgel! Wirklich, was kümmerte es ihn, ob der Westturm stand oder fiel? Es kümmerte ihn ja kaum, ob die Gärtner lebten oder starben.
Du lieber Gott!
Nein, so war es nicht. Er hatte nicht seine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht, für die Rechte der arbeitenden Bevölkerung zu kämpfen, um sich dann rücksichtslos über die Rechte seiner eigenen Angestellten hinwegzusetzen. Aber wenn er wie üblich nichts unternahm, würde Mrs. Montford alles Nötige veranlassen. Oh, sie würde sich über ihn ärgern und ein Eisregen frostiger Briefe würde auf sein Haupt hinabregnen, gefolgt von einem Hagelschauer von Rechnungen und Quittungen. Aber auf Cardow würde alles in Ordnung gebracht werden. Und als Buße für seine Nachlässigkeit würde Walrafen all diese Korrespondenz lesen müssen. Oder zur Zerstreuung. Er wusste selbst nicht, was von beidem zutraf. Bei dem Gedanken fragte Walrafen sich erneut, wie eine so kluge Frau zulassen konnte, dass sich Onkel Elias stöhnend und ächzend auf ihr abrackerte.
Ein stechender Schmerz bohrte sich in seine Schläfen. »Ogilvy!«, sagte er scharf. »Ziehen Sie die Vorhänge zu und lassen Sie Kaffee bringen.«
Ogilvy sah ihn überrascht an. »Ja, Mylord.« Aber noch bevor er aufstehen konnte, flog die Tür auf.
»Lord de Vendenheim«, verkündete der Butler. Im nächsten Moment trat Walrafens Freund Max ins Zimmer.
»Per amor di Dio!«, knurrte Max und streifte seine Handschuhe ab, während er hereinschlenderte. »Du bist noch nicht angezogen!«
Max de Vendenheim – schlank, dunkel, leicht gebeugte Schultern – klang immer gereizt. Und arrogant. Die Tatsache, dass Walrafen ihm rangmäßig überlegen war, hatte Max nie besonders belastet, nicht einmal zu der Zeit, als er noch als kleiner Inspektor bei der Flusspolizei in Wapping gearbeitet hatte und Walrafen schon eines der einflussreichsten Mitglieder im Oberhaus gewesen war. Wer ein Dummkopf war, wurde von Max entsprechend behandelt, egal in welchen Kreisen. In dieser Hinsicht war er durchaus für Gleichberechtigung.
Max verzog missbilligend seine große, olivbraune Hakennase und musterte Walrafen finster. »Du kommst doch mit?«
Auf der anderen Seite des Zimmers stieß Ogilvy einen unterdrückten Fluch aus. »Die Uniformparade, Sir!«
Walrafen lächelte angespannt. »Sie können wohl kaum ohne uns anfangen, alter Knabe«, sagte er und stand auf. »Aber ich gehe jetzt lieber nach oben und ziehe mich um. Weiß der Himmel, wo die Zeit geblieben ist!«
Max’ Blick fiel auf den Karteikasten, der geöffnet auf Walrafens Schreibtisch stand. Mit seinen langen, dunklen Fingern hob er den obersten Brief auf. »Ah, wieder einmal die Haushälterin«, bemerkte er wissend. »Wirklich, Giles, wann hörst du endlich auf, mit dieser Frau Katz und Maus zu spielen?«
Walrafen warf seinem Freund einen düsteren Blick zu. »Das ist meine Sache«, entgegnete er, während er sich bemühte, das Bein nicht nachzuziehen, das vom langen Sitzen steif geworden war.
Max nahm den Brief und folgte ihm. Während Walrafens Kammerdiener ihm das Halstuch abnahm und ihm aus der Jacke half, setzte sich Max in Walrafens Lieblingssessel und las das elende Schreiben laut vor.
»Was für ein bemerkenswertes Geschöpf«, stellte er fest, als er fertig war. »Ich würde diese Frau wirklich gern kennenlernen.«
Walrafen lachte schallend. »Stille Wasser sind tief, meinst du?«
Max zog seine dunklen Augenbrauen hoch. »Oh, diese Wasser hier sind nicht still«, erklärte er im Brustton der Überzeugung. »Sie brodeln vor Zorn – aber es steckt noch mehr dahinter, würde ich meinen. Ich frage mich … ja, ich frage mich, was es sein könnte.«
Walrafen beugte sich etwas näher zum Spiegel und zupfte die Falten seines frisch gelegten Halstuchs zurecht. »Mrs. Montford ist nur ein Dienstbote, Max. Eine anmaßende und überhebliche Haushälterin.«
»Du solltest sie entlassen.«
»Was, und sie einem anderen armen Teufel aufhalsen?« Walrafen lachte. »Ich könnte niemals einen Dienstboten ohne Empfehlungsschreiben entlassen – es sei denn, der oder die Betreffende hätte einen Mord oder Schlimmeres begangen. Im Übrigen, welche Schwierigkeiten macht sie mir schon?«
»Eine ganze Menge, wenn ich nach dem Ausdruck in deinen Augen urteilen kann«, sagte Max, während er sich erhob und die Tür aufriss. »Und ich wage zu bezweifeln, dass sie dir den Gefallen tun wird, jemanden zu ermorden und dich damit von deiner gegenwärtigen Einstellung Cardow gegenüber zu befreien … Wie nennst du es noch? Wohlwollendes Desinteresse? Ja, dann wärst du gezwungen, dein Heim aufzusuchen, nicht wahr?«
Walrafen schritt an ihm vorbei. »Leg den blödsinnigen Brief weg und lass uns gehen«, ermahnte er seinen Freund. »Auf den Straßen rund um Whitehall wimmelt es mittlerweile sicher schon von Menschen. Wir werden zu Fuß gehen müssen.«
»Ja, und wessen Schuld ist das?«
Walrafens Prophezeiung erwies sich als zutreffend. In der Nähe von Charing Cross waren sie bereits gezwungen, ihre Ellbogen einzusetzen, um sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Die übliche Flut schwarz gekleideter Büroangestellter und bebrillter Ladenbesitzer, die auf dem Weg zum Mittagessen aus Westminster herausströmte, war durch die zahlreichen Fahrzeuge zu einem dünnen Rinnsal geworden. Vor Max’ Büro eilten Männer in blauen Polizeiuniformen und hohen Zylindern durch die Korridore. Auf den Treppenaufgängen drängten sich Schreiber und Beamte und sogar die eine oder andere Dame mit Strohschute und Sonnenschirmchen. Über das ganze Chaos hinweg erhoben sich immer wieder Stimmen, die in letzter Minute Änderungen verlangten.
Endlich standen sie vor Max’ Tür. Aber der Raum war bereits besetzt. Ein Gentleman und eine Dame standen am Fenster und starrten auf den Tumult, der unten auf der Straße herrschte. Als die Tür aufging, drehte sich die Dame um, doch Giles wusste ohnehin, wer sie war – Cecilia, die junge Witwe seines Vaters, mit ihrem zweiten Ehemann David, Lord Delacourt.
»Guten Tag, Cecilia«, sagte Walrafen und verbeugte sich vor ihr. »Und Delacourt. Was für eine Überraschung.«
»Hallo, Giles, mein Lieber«, antwortete Cecilia. »Und Max! Wir hatten gehofft, euch hier zu erwischen.«
Cecilia schwebte auf Walrafen zu, ihre Wange bereits zum Kuss dargeboten. Und er würde sie natürlich küssen, wie er es immer tat. Aber plötzlich kam ein kleiner Junge hinter Cecilias Röcken hervorgestürzt und warf sich zwischen die beiden.
»Giles! Giles!«, rief der Junge. »Wir haben Sergeant Sisk gesehen! Er hat mir erlaubt, seinen Hut aufzusetzen! Werdet Lord de Vendenheim und du mit ihm in der Parade marschieren?«
Walrafen, dem auf einmal leichter ums Herz war, hob den Jungen in seine Arme. »Nein, aber ich werde eine sehr langweilige Rede halten, Simon«, sagte er. »Und Sisks neue Jacke hätte ich auch gern. Diese großen Messingknöpfe gefallen mir sehr gut.«
Der Junge lachte. Cecilias Mann trat vom Fenster zurück. »Cecilia und Simon wollten unbedingt dabei sein, wenn Londons neue Polizei angelobt wird«, meinte Delacourt ein wenig entschuldigend. »Ich hoffe, wir sind nicht im Weg?« Seine Worte waren an Max gerichtet, aber seine Augen ruhten auf Walrafen.
»Ganz und gar nicht«, erwiderte Max.
»Gut«, sagte Delacourt. »Wenn die Herren ihre Terminpläne und Reden zur Hand haben, dürfen wir sie vielleicht in unserer Kutsche nach Bloomsbury mitnehmen? Simon, steig auf Papas Schultern, dann trage ich dich nach unten.« Der Junge lief zu ihm, während Max die Tür aufstieß.
Cecilia lächelte und legte ihre Hand auf Walrafens Arm. »Giles, ich bin heute ja so stolz auf dich«, murmelte sie. »Ich fühle mich ganz als liebevolle Stiefmutter.«
Walrafen ließ die anderen vorgehen und starrte in ihre schönen blauen Augen. »Sei nicht albern, Cecilia«, gab er leise zurück. »Du bist nicht mehr meine Stiefmutter. Du bist Delacourts Frau. Und Simons Mutter, um Himmels willen.«
Cecilia sah ihn eigenartig an. »Dessen bin ich mir durchaus bewusst«, erwiderte sie. »Aber schließt das alle anderen Bindungen aus? Ich habe immer sehr viel für dich empfunden, Giles. Nicht wie eine Mutter natürlich. Aber … nun ja, wie eine Schwester, könnte man sagen.«
Wie eine Schwester. Rein platonisch. Das war ganz Cecilias Art. Und alles, worauf er hoffen konnte. In den Augen der Kirche war Cecilia seine Mutter und konnte daher nie etwas anderes sein – und genau das hatte sein Vater beabsichtigt, als er sie geheiratet hatte, zum Teufel mit ihm! Dann, als wollte er Giles’ Qualen noch steigern, war sein Vater früh gestorben und hatte durch seinen Tod ermöglicht, dass sich Delacourt, ein Halunke, der es nicht wert war, Cecilias Rocksaum zu küssen, in ihr Leben stehlen konnte. Zum allgemeinen Erstaunen war aus ihm ein treuer Ehemann geworden. Und das sollte er auch lieber bleiben, dachte Walrafen grimmig. Andernfalls würde er ihn töten. Was im Grunde ein Jammer wäre, da er den aufgeputzten Laffen mittlerweile recht gern hatte.
Er führte Cecilia sanft aus Max’ Büro. »Ich bin älter als du, Cecilia«, erinnerte er sie, als sie die Treppe hinuntergingen. »Als du Vater geheiratet hast, war ich dreiundzwanzig und hatte bereits einen Sitz im Unterhaus. Es klingt albern, wenn du dich weiterhin als meine Stiefmutter bezeichnest.«
Cecilia blieb mit einem leichten Lachen stehen und klopfte ihm auf die Wange. »Mein armer, armer Giles!« Sie spitzte die Lippen zu einem kleinen Schmollmund. »David und ich gehören zur Familie, ob du es willst oder nicht. Apropos Familie, erzähl mir doch, wie es Elias geht. Auf meine Briefe antwortet er einfach nicht.«
»Das Innenministerium ist kein Ort für eine Dame, Cecilia«, bemerkte Walrafen, ohne auf ihre Frage einzugehen. »Kann dein Mann dich nicht in der Curzon Street lassen, wo du hingehörst?«
Wieder lachte Cecilia. »Meine Güte, bist du aber streng, Giles! Das hier hätte ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen. Ohne deinen Einfluss und Max’ harte Arbeit hätte Peel dieses Gesetz nie durchs Parlament gebracht. Alle sagen das.«
Walrafen gab auf. Auch Cecilia schwieg nun, und bald hatten sie ihre Plätze auf der Tribüne eingenommen und sahen freudig winkend zu, wie die Männer der kürzlich gebildeten Metropolitan Police in ihren neuen Uniformen ihre Parade abhielten. In ihren weiten Jacken und hohen Hüten waren die Männer ein bewegender Anblick. Aber bald waren die langweiligen Reden gehalten und die neuen Polizeioffiziere bewundert worden, und das Winken und Jubeln nahm ein Ende. Wieder hielt Cecilia Walrafen ihre Wange hin, und er küsste sie pflichtbewusst. Er und Max lehnten das Angebot ab, in der Kutsche der Delacourts nach Mayfair zurückzufahren, und schlenderten zu Fuß die Upper Guildford Street hinunter.
»Sie ist ein seltener Typ Frau, nicht wahr?«, bemerkte Max, als Cecilia ihnen durch die Menge zuwinkte.
Walrafen sagte eine Weile nichts. Cecilia war mehr als selten. Sie war einzigartig. »Apropos seltene Frauen«, meinte er schließlich, »wo steckt deine bessere Hälfte?«
»Daheim in Gloucestershire«, erwiderte Max ein wenig trübselig. »Ihr neuestes Familienmitglied – Neffe oder Nichte oder vielleicht auch beides auf einmal – wird demnächst zur Welt kommen.«
»Und was ist mit dir, alter Freund?«, wollte Walrafen wissen. »Wirst du ihr nachreisen? Die Stadt wird bald leer sein. Die Jagdsaison, du weißt schon.«
Max drängte sich an einem lauthals schreienden Zeitungsverkäufer vorbei, als sie über den Russell Square schlenderten. »Ich denke schon«, antwortete er. »Normalerweise würden wir in Katalonien überwintern. Aber nachdem das Baby so bald kommt – nein.«
»Du könntest bei Peel in der Stadt bleiben«, schlug Walrafen vor.
Max schüttelte den Kopf. »Peel fährt auch nach Hause. Mit seinem Vater geht es zu Ende.«
»Aha!«, sagte Walrafen. »Und bald ist er Sir Robert, nehme ich an? Ein Titel statt eines geliebten Vaters. Er wird es für keinen guten Tausch halten.«
Max sah ihn neugierig an. »Hast du auch so empfunden, als dein Vater starb?«
Walrafen starrte über den offenen Platz. »Der Tod meines Vaters war für Cecilia und mich ein Schock«, antwortete er schließlich. »Er war schließlich bei bester Gesundheit.«
»Mein Freund, ich finde nicht, dass das meine Frage beantwortet.«
Walrafen warf ihm einen finsteren Blick zu. »Einmal Polizist, immer Polizist, nicht wahr?«, erwiderte er. »Nein, Max, ich habe nichts empfunden, als mein Vater starb. Wir hatten uns seit meiner Kindheit entfremdet, und trotz Cecilias Bemühungen, uns zu versöhnen, haben wir zum Zeitpunkt seines Todes kaum miteinander gesprochen. Und ich kann nicht behaupten, dass es mir leid getan hat, ihn gehen zu sehen. Hältst du jetzt weniger von mir?«
Max schockierte ihn, indem er eine Hand zwischen seine Schulterblätter legte und ihm sanft auf den Rücken klopfte. »Nein, Giles«, erwiderte er ruhig. »Das könnte ich nie. Aber ich halte es für Zeitverschwendung, allein in der Stadt zu bleiben. Das hast du doch vor, oder?«
Giles überlegte kurz. Tatsache war, dass er nicht wusste, wo er hinsollte. Oh, Cecilia hatte ihn bereits auf Delacourts Landsitz in Derbyshire eingeladen. Aber es schien unehrenhaft, die Gastfreundschaft eines Mannes anzunehmen, wenn man in Wirklichkeit seine Frau wollte. Natürlich könnte er die Jagdsaison auch bei Max und Catherine in Gloucestershire verbringen – er spürte, dass Max im Begriff war, ihn einzuladen. Doch die warme Herzlichkeit von Catherines weitläufiger Familie machte ihn immer befangen, als hätte er in irgendeinem Punkt, den er selbst nicht nennen konnte, versagt.
Damit blieb nur Cardow. Mitsamt allen Erinnerungen, die daran hingen.
»Max, ich habe zu viel zu tun«, erklärte er schließlich. »So viel muss noch erledigt werden, bevor das Parlament wieder zusammentritt. Diese neue radikale Reformbewegung findet zunehmend Anhänger, und Peel macht sich zu Recht Sorgen. Gleichheit ist ein gutes Konzept, das ich prinzipiell unterstütze, aber diese Sache könnte außer Kontrolle geraten.«
Max sah ihn seltsam an. »Mein Vater hat auch einmal eine radikale Bewegung unterstützt«, sagte er warnend. »Und alles, was es ihm brachte, war eine Kugel in den Kopf, dank Napoleon. Pass auf, was du tust, Giles, sonst werden dir deine edlen Absichten eines Tages auch eine Kugel einbringen. Und dann bin ich in der schwierigen Lage herauszufinden, wer es war – die Whigs, die Gewerkschaften, radikale Elemente oder deine eigene verdammte Partei.«
Giles zuckte die Schultern. »Irgendjemand muss sich um Englands Zukunft Gedanken machen, Max«, sagte er. »Das ist meine Arbeit, mein Lebensinhalt.«
Max lachte leise in sich hinein. »Oh, es gibt mehr im Leben als Arbeit, mein Freund. Diese Lektion habe ich endlich gelernt.« Halb ernst, halb scherzend fügte er hinzu: »Ein Vorschlag zur Güte, alter Knabe. Such dir eine Ehefrau. Ich kann es nur empfehlen, und schließlich brauchst du einen Erben – jemanden außer Elias, um Himmels willen!«
»Ach, es gibt da noch ein, zwei entfernte Cousins«, gab Giles zurück. »Irgendwo in … ich weiß nicht, Pennsylvania vielleicht? Einer von ihnen wird schon auftauchen, wenn genug Geld zu holen ist. Amerikaner sind Opportunisten bis ins Mark.«
Max lachte. »Aber gibt es denn nicht irgendein hübsches, dralles Mädchen vom Land, das in Somerset nach dir schmachtet?«, fragte er. »Im Übrigen solltest du nach Cardow fahren und diese unverschämte Haushälterin in die Schranken weisen.«
»Mrs. Montford?« Walrafen lachte. »Ich würde sie wahrscheinlich eher erwürgen.«
Max sah ihn neugierig an, ging aber weiter. »Sag mal, Giles, ist deine Mrs. Montford jung oder alt? Oder irgendetwas dazwischen?«
Walrafen hob nachlässig die Schultern. »Relativ jung, nehme ich an«, erwiderte er. »Das sind sie immer.«
»Wie meinst du das?«
»Onkel Elias stellt sie ein«, erklärte Walrafen. »Was hast du denn gedacht?«
»Aha!«, rief Max. »Sie hat also noch andere Pflichten als nur die einer Haushälterin?«
Walrafen zögerte. »Na ja, früher war es jedenfalls häufig so«, gab er zu. »Aber mein Onkel ist nicht mehr jung. Ich höre allerdings, dass er und Mrs. Montford oft hitzige Auseinandersetzungen haben.«
»Ach ja?«, bemerkte Max. »Und von wem weißt du das?«
»Von Pevsner, dem Butler«, antwortete Walrafen. »Ich glaube, Mrs. Montford hat auch ihm den Kopf zurechtgesetzt. Aber da sich Onkel Elias noch nie bei mir beschwert hat, könnte man davon ausgehen, dass irgendetwas zwischen den beiden läuft. Mein Onkel neigt nicht unbedingt zu Wohltätigkeit.«
Eine Weile herrschte Schweigen. Sie hatten bereits den Berkeley Square erreicht, als Max wieder sprach. »Was macht dein Bein heute, Giles?«, fragte er. »Du hinkst ein bisschen, kommt mir vor.«
Aber Walrafen hatte für einen Nachmittag genug von Max und seiner Neigung, seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. »Du bist für mein Bein nicht verantwortlich«, sagte er schroff. »Geh weiter, in Gottes Namen, und hören wir auf, all diesen Unsinn durchzukauen!«
Max sah ihn an, als wollte er wissen, welchen Unsinn er meinte. Das Bein? Seinen Vater? Cardow? Ach, es gab so viele Möglichkeiten! Und keine von ihnen war erfreulich. Aber als der gute Freund, der er war, enthielt sich Max jedes weiteren Kommentars.
Kapitel 2
In welchem ein sehr schlechter Handel geschlossen wird
Der Zugang zum Westturm von Cardow Castle war dem Personal seit langem untersagt. Niemand wagte sich dorthin, denn der Turm war düster und muffig und enthielt nichts außer kaputten Möbelstücken. Aber der Nordturm, von dem man auf den Bristol-Kanal und die Küste von Wales blickte, war etwas anderes. Einige der kostbarsten Besitztümer von Cardow wurden im obersten Stock gelagert, zum Teil deshalb, weil Dienstboten wie Dorfbewohner seit langer Zeit davon überzeugt waren, dass es hier spukte und sich nie in den Turm hineinwagen würden.
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts hatte die Frau des dritten Earl sich aus dem Fenster im vierten Stock gestürzt und sich unten im Burghof den Schädel zerschmettert. Seit damals hatten nicht eben wenige Diener, die nach einem langen Abend im »King’s Arms« den Hügel hinaufgewankt waren, den Geist von Lady Walrafen über die Mauerbrüstung schweben sehen. Ehen auf Cardow neigten dazu, ein tragisches Ende zu nehmen.
Nachdem Aubrey vorsichtig die Tür aufgestoßen hatte, hielt sie ihre Laterne in die Höhe und drehte sich in der Kammer im obersten Geschoss langsam um. Das Licht fiel auf runde Steinmauern, in denen sich nicht einmal ein schmaler Fensterschlitz befand. Geister sah sie nicht.
»Ojemine«, flüsterte Betsy, als die Flamme unsicher zu flackern begann. »Bestimmt gibt’s hier oben Fledermäuse, Mrs. Montford.«
Aubrey schüttelte ein plötzliches Gefühl düsterer Vorahnungen ab. »Das würde mich nicht wundern«, antwortete sie, während sie den runden Raum abschritt. »Mäuse und Spinnen vermutlich auch.«
»Ja, aber Fledermäuse, Ma’am!« Betsys Stimme bebte. »Man sagt, dass sie den Leuten das Blut aussaugen! Und ich würd’ meins ganz gern behalten.«
Aubrey wünschte sich allmählich, sie und Betsy wären unten geblieben, wo ihnen nicht das Blut in den Adern stockte. »Fledermäuse saugen kein Blut«, erklärte sie mit mehr Tapferkeit, als sie empfand. »Und falls diese Porträts hier oben sind, Betsy, möchte ich sie mir anschauen. Wie viele sind es, hast du gesagt?«
Betsy stieß einen alten Kinderwagen aus dem Weg und schreckte dabei eine Maus auf, die quiekend das Weite suchte. »Ein halbes Dutzend oder mehr, Ma’am, wenn ich mich richtig erinnere«, antwortete das Mädchen. »Aber sie sind alle zu groß, als dass wir sie tragen könnten.«
Aubrey hob den Besen hoch, den sie die steile Wendeltreppe hinaufgetragen hatte, und fegte einen dichten Schleier von Spinnweben von der Wand. Wie durch Zauberei erschien ein großes Porträt, größer als sie selbst. »Gütiger Himmel!«, hauchte sie. »Schau dir das an!«
»Ach du meine Güte!«, flüsterte Betsy. »Ob das die ist, die sich aus dem Fenster gestürzt hat?«
Sie war es nicht. Diese Dame trug ein Miederkleid mit Reifrock und Schulterschleppe, wie es vor ungefähr hundert Jahren in Mode gewesen war. »Eher die Urgroßmutter des Majors, denke ich«, erwiderte Aubrey und hängte ihre Lampe an einen Haken im Mauergebälk. »Komm, hilf mir, es zur Seite zu schieben.«
Mit vereinten Kräften schafften sie es, das große Gemälde ein Stück zu verrücken. Dahinter verbarg sich ein zweites Porträt, noch größer und prachtvoller als das erste. Das Alter war jedoch schwer zu schätzen, da die junge Dame mit einer griechischen Toga und einem Kranz kostümiert war. »Na, die kenne ich«, stellte Betsy fest. »Das war Ihre Ladyschaft, die von der Galerie gesprungen ist und sich das Genick gebrochen hat. Das Bild hing noch in der Halle, als ich hier als Küchenmädchen anfing.«
Aubrey war entsetzt. »Sie ist gesprungen?«
Betsy zuckte die Schultern. »Tja, einige sagen, sie ist gesprungen, andere, sie ist gefallen«, fuhr das Mädchen fort. »Sie war die Mutter des jetzigen Earl. Hat ihn schrecklich mitgenommen, schätze ich, all das Gerede von Selbstmord – er war damals ja noch ein Junge. Und die Kirche hat einen großen Zirkus gemacht, und der alte Lord musste ein neues Pfarrhaus bauen lassen, um den Leuten den Mund zu stopfen.«
»Wie furchtbar!«
»Mhm, war eine richtige Schande für die Familie«, nickte Betsy. »Aber die Leute sagen, es ist der Fluch von Castle Cardow, dass eine Braut hier nie glücklich werden kann.«
»Nun, die arme Dame soll ihren früheren Ehrenplatz in der Halle wieder erhalten«, verkündete Aubrey forsch. »Ziehen wir es ein Stück von der Wand, bis die Diener es holen kommen.«
Betsy folgte der Anweisung mit merklichem Zögern. »Was ist, wenn Seine Lordschaft die Bilder nicht mehr aufgehängt haben will, Ma’am?«, fragte sie, wobei sie vor Anstrengung ins Schnaufen kam. »Irgendjemand hat sie schließlich hier oben verstaut, oder? Außerdem hängt der blaugoldene Gobelin schon seit einer Ewigkeit an seinem Platz.«
Aubrey zog ein wenig unwillig die Augenbrauen hoch. »Hat irgendjemand gesagt, dass diese Bilder nicht erwünscht sind?«
Betsy klopfte sich den Staub von den Fingern und zuckte die Schultern. »Mir scheint, ich hab so was gehört, Ma’am. Aber ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.«
Aubrey gab nicht nach. »Wie auch immer, die Gobelins sind schmutzig und verschlissen und müssen abgenommen werden. Und wir können nicht gut nackte Steinwände anstarren, nicht wahr?«
Betsy sah nicht so aus, als würde ihr das etwas ausmachen. Aber plötzlich, noch während sie das Bild wegschoben, leuchtete ihr Gesicht vor Freude auf. Ein weiteres Porträt verbarg sich weiter hinten im Stapel, das Bild einer sehr jungen Dame mit Haaren, die beinahe so rot waren wie Aubreys. »Ach, gucken Sie mal, Ma’am! Das ist die letzte Lady Walrafen!«
Aubrey schnappte nach Luft. Das Porträt war schockierend modern. Die junge Dame hatte ein hübsches, volles Gesicht und schöne blaue Augen, die den Maler anzulachen schienen. Ihre Figur war üppig, beinahe rundlich, und sie trug ein hochgegürtetes Kleid, das kaum aus der Mode war. »Meine Güte, ich hatte ja keine Ahnung …«, stammelte Aubrey, die seltsamerweise peinlich berührt war. »Das heißt, niemand hat mir gegenüber je erwähnt, dass seine Lordschaft verheiratet war … ist.«
Betsy lachte. »Gott, nein, Ma’am, nicht der Lord Walrafen«, entgegnete sie. »Das war seine Stiefmutter, Lady Cecilia Markham-Sands. Sie ist in London gemalt worden, kurz bevor sie Major Lorimers älteren Bruder geheiratet hat.«