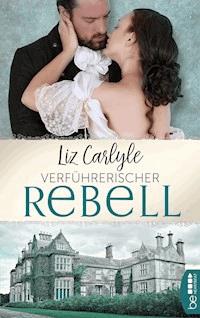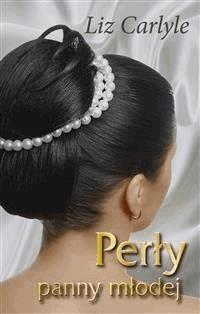4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neville Family
- Sprache: Deutsch
Nur die Flamme der Liebe entzündet ein ewiges Feuer
Xanthia ist erst vor Kurzem von Barbados nach London gekommen. Trotz ihres jungen Alters leitet sie bereits die Neville Shipping Company. Auf einem Ball trifft die selbstbewusste Frau den attraktiven Lord Nash, dem sie sofort verfällt. Allerdings weiß sie auch um seinen Ruf als unverbesserlicher Frauenheld - und sieht ihre Beziehung lediglich als eine stürmische Affäre. Doch dann beauftragen Vertreter der britischen Regierung Xanthia, Nash auszuspionieren. Und plötzlich bemerkt sie: Ihre Gefühle gehen längst viel tiefer ...
Weitere historische Liebesromane aus der Neville-Family-Reihe als eBook bei beHEARTBEAT: "Verloren in deiner Sehnsucht" und "Bezwungen von deiner Leidenschaft".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Stürmisches Spiel der Herzen
Die MacLachlan-Saga
Ein unwiderstehlicher Halunke
Ein charmanter Schuft
Ein betörender Earl
Ein geheimnisvoller Gentleman
Neville Family
Verloren in deiner Sehnsucht
Bezwungen von deiner Leidenschaft
Rutledge Family
Verbotenes Begehren
Verführerischer Rebell
Über dieses Buch
Nur die Flamme der Liebe entzündet ein ewiges Feuer
Xanthia ist erst vor Kurzem von Barbados nach London gekommen. Trotz ihres jungen Alters leitet sie bereits die Neville Shipping Company. Auf einem Ball trifft die selbstbewusste Frau den attraktiven Lord Nash, dem sie sofort verfällt. Allerdings weiß sie auch um seinen Ruf als unverbesserlicher Frauenheld – und sieht ihre Beziehung lediglich als eine stürmische Affäre. Doch dann beauftragen Vertreter der britischen Regierung Xanthia, Nash auszuspionieren. Und plötzlich bemerkt sie: Ihre Gefühle gehen längst viel tiefer …
Über die Autorin
Liz Carlyles große Leidenschaft gilt dem England des 19. Jahrhunderts, den rauschenden Bällen und den festlich gewandeten Damen. Auf ihren zahlreichen Reisen nach England hat die Autorin ihr Korsett und ihre Tanzschuhe stets im Gepäck – auf eine Einladung zu einem Ball wartet sie allerdings immer noch. Dafür kennt sie mittlerweile so ziemlich jede dunkle Gasse und jedes zweifelhafte Wirtshaus in London. Liz Carlyle lebt mit ihrem Ehemann und mehreren Katzen in North Carolina, USA.
Liz Carlyle
ENTFLAMMTVON DEINERLIEBE
Aus dem amerikanischen Englisch vonSusanne Kregeloh
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Susan Woodhouse
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Never Lie to a Lady«
Originalverlag: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York, USA
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Susanne Bartel, Nürnberg
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © hotdamnstock; © thinkstock: Steve Gorton | NataliiaKucherenko | yurok
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5779-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Eine Verabredung in Crescent Mews
Januar 1828
In der Bibliothek war es dunkel. Die schweren Samtvorhänge waren geschlossen worden, damit das flackernde Licht der Straßenlaternen nicht durch die Fenster hereinfiel. Der dicke türkische Teppich dämpfte jeden Schritt, und jedes Wispern, wenn denn eines zu hören gewesen wäre, wäre von den Tiefen des Zimmers verschluckt worden. Nur der Schein des Feuers, das im Kamin brannte, spendete ein wenig Helligkeit.
Lord Nash mochte vieles sein, aber keinesfalls naiv. Er wusste, dass die Bühne vorbereitet worden war. Mit dem Rücken zum Kamin sah er zur Tür, die in der Dunkelheit kaum zu erkennen war.
Als sie geöffnet wurde, war kaum ein Laut zu hören. Die Comtesse de Montignac trat auf ihn zu und streckte ihm ihre zartgliedrigen Hände entgegen, als begrüße sie ihren liebsten Freund. Sie trug ein Gewand aus roter Seide, das für ein Schlafzimmer weitaus geeigneter gewesen wäre, ihre üppige goldfarbene Haarmähne ergoss sich verführerisch bis zu ihrer Taille.
»Bonsoir, Mylord«, gurrte sie. Der rote Stoff schimmerte im Feuerschein bei jeder ihrer Bewegungen. »Endlich habe ich das Vergnügen, oui?«
Als er ihre ausgestreckten Hände ignorierte, ließ die Comtesse sie sinken. »Mein Besuch ist keinesfalls der Höflichkeit geschuldet«, sagte er. »Zeigt mir, weshalb ich gekommen bin.«
Ihr Lächeln wirkte jetzt fast neckisch. »Ich mag es, wenn ein Mann gleich zur Sache kommt«, schnurrte sie. Noch ehe Nash ahnte, was sie vorhatte, streifte sich die Comtesse den Seidenmantel von den Schultern. Für einen Augenblick verfing er sich an ihren Fingerspitzen, dann glitt er zu Boden.
Nash verfluchte den kleinen Stich von Lust, der ihn durchfuhr. Bei Gott, die Frau hatte einen herrlichen Körper, und sie trug nichts als einen Hauch von Negligé, das nur einem einzigen Zweck diente. Unter dem fast transparenten Stoff hoben sich ihre cremeweißen Brüste, als sie erwartungsvoll einatmete. Die Comtesse hob die Hand und berührte eine ihrer harten Brustwarzen.
»Viele Männer haben hierfür schon gut bezahlt«, sagte sie mit rauchiger Stimme, »aber bei Euch, Nash – oh, mon dieu –, da wünscht eine Frau ja fast, sich zu verschenken.«
Nash legte seine Hand unter ihre linke Brust und drückte zu – nicht hart, um ihr nicht wehzutun. Nicht sehr hart jedenfalls. Ein seltsamer Ausdruck aus Angst und Lust huschte über das Gesicht der Comtesse. »Die Dokumente«, stieß Nash zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Holt endlich die Dokumente. Und treibt keine Spielchen mit mir.«
Die Comtesse zuckte zurück und warf ihm einen dunklen Seitenblick zu, als sie einen Schritt nach hinten machte und mit den Schatten verschmolz. Nash hörte, wie eine Schublade geöffnet und wieder geschlossen wurde. Als die Comtesse wieder zu ihm trat, hielt sie einen Stapel zusammengefalteter Papiere in der Hand. Nash griff danach und faltete den ersten Bogen auseinander. Im Schein des Feuers überflog er den Text, dann nahm er sich die anderen Unterlagen vor. Es geschah rasch. »Wie viel?«, fragte er emotionslos.
»Zehntausend.«
Er zögerte.
Die Comtesse stand so dicht vor ihm, dass er den Jasminduft einatmete, der ihrem Haar entströmte. »Die Transaktion war schwierig, Mylord«, sagte sie. »Ich musste all meine weibliche List einsetzen, um Euch alles Gewünschte zu besorgen.«
»Alles, bis auf das eine, so scheint es«, murmelte Nash.
Die Comtesse errötete nicht einmal. »Ich muss Euch nicht erst sagen, Mylord, welche politischen Auswirkungen das haben könnte«, gurrte sie und strich ihm mit ihrer warmen Hand über den Arm. »Zehntausend und das Vergnügen, diese Nacht mit mir zu verbringen?«
Nash versuchte seinen Blick von den Brüsten der Frau loszureißen, die sich hoben und senkten. »Ich glaube nicht, dass Euer Gatte es schätzen würde, unter seinem eigenen Dach betrogen zu werden, madame.«
Sie lächelte und drängte sich an ihn. »Pierre ist sehr verständnisvoll, mon cher«, murmelte sie. »Und ich habe … besondere Bedürfnisse. Bedürfnisse, die ich Euch mit Freuden offenbaren werde – wenn ich Euch überreden kann, mein Bett mit mir zu teilen?«
»Das könnt Ihr nicht«, entgegnete er.
Die Comtesse zog ihre Hand zurück – um aufzugeben, wie Nash glaubte, bis er sie fest und warm an einer anderen Stelle seines Körpers spürte. Zu seinem Ärger presste sich sein hartes Glied beharrlich gegen ihre Hand. »Seid Ihr ganz sicher, mon cher?«, wisperte die Comtesse. »Ihr fühlt Euch an, als wärt Ihr schon überredet – und, Nash, ich frage mich ständig, ob Ihr tatsächlich halten könnt, was die Gerüchte versprechen.«
Er warf die Papiere zur Seite. »Ihr spielt ein gefährliches Spiel, madame.«
»Ich lebe auch ein gefährliches Leben«, entgegnete sie, während sie mit einem leisen Lächeln ihre Hand sinken ließ und einige Schritte zurücktrat.
Nash schwieg und sah sie eine Zeit lang an, beobachtete sie, wie man eine Schlange nicht aus den Augen lässt, die im Gras lauert. Die Comtesse warf ihm einen unsicheren Blick zu. »Mon dieu, nun schaut nicht so scheinheilig drein, Nash!«, fauchte sie schließlich. »Wir sind uns ähnlich, Ihr und ich. Wir gehören nicht in diese enge, beschränkte englische Welt. Das werden wir nie, das wisst Ihr. Und jetzt kommt, warum sollten wir nicht lernen, einander Vergnügen zu bereiten?«
Statt zu antworten, beugte Nash sich hinunter und hob den roten Seidenmantel vom Boden auf. »Zieht ihn wieder an, Comtesse«, forderte er sie auf. »Es gibt nur sehr wenig, was jemand einer Frau von Eurer Erfahrung noch lehren könnte.«
Wieder lächelte sie kokett. »Oui, Mylord, c’est vrai«, stimmte sie zu und nahm den roten Seidenmantel aus seiner ausgestreckten Hand.
Anschließend wickelten sie ihr Geschäft rasch ab, ohne dass die Comtesse weitere Avancen machte, abgesehen von einem gelegentlichen heißen Seitenblick – den sie aber nicht auf sein Gesicht richtete. Nash war erleichtert, als er das Haus verließ und auf die stillen Straßen Belgravias trat. Der Nebel war noch dichter geworden und wehte ihm von der Themse her mit schneidender Januarkälte entgegen. Nash stellte den Mantelkragen hoch und schlug die Richtung zur Upper Belgrave Street ein. Hinter ihm erklang zweimal die neue Kirchenglocke von St. Peter’s, der Ton erschien ihm im Nebel seltsam durchdringend.
Die breiten eleganten Straßen waren zu dieser Stunde und zu dieser Jahreszeit menschenleer. Niemand sah Nash, als er fast lautlos durch das Wegelabyrinth von Crescent Mews ging, ein altes Viertel, das von der neuen Vollkommenheit Belgravias einverleibt worden war, um sich darüber zu erheben. Ein Ort, der nicht leicht zu finden war – und deshalb perfekt für das, was Nash plante.
Ein Stück vor sich erblickte Nash einen schwachen Lichtschein, der von einer kleinen Laterne rührte, die über den Stufen hing, die in ein kleines, unauffälliges Haus führten. Als er sich dem Eingang näherte, wankte ein Mann in der bunten Uniform der Guards aus dem Gebüsch gegenüber und knöpfte sich seinen Hosenlatz zu. Sie nickten sich höflich zu, dann ging Nash weiter. Am Fuß der Treppe konnte er lärmendes Gelächter aus dem Haus hören. Er zog sich unter einen Baum zurück, der außerhalb des Lichtscheins der Laterne lag, und richtete sich auf eine längere Wartezeit ein. Schon vor einiger Zeit hatte er gelernt, sich in Geduld zu üben.
Von Zeit zu Zeit verließ ein Soldat oder ein Gentleman das Gasthaus, ging die schmale Treppe hinunter und taumelte durch die engen Gassen davon. Aber schließlich trat ein Mann heraus, der direkt auf den Baum zuging, unter dem Nash wartete. Er war dünn und lief sehr schnell. Sein fester Gang verriet, dass er nüchtern war.
»Guten Abend, Sir.«
»Guten Abend«, erwiderte Nash den Gruß. »Ist jeder betrunkene Soldat der Guards heute Nacht dort drinnen?«
Der Mann, der etwas kleiner als Nash war, lächelte leicht. »So scheint es, Mylord«, erwiderte er. »Swann sagt, Ihr wünscht, meine Dienste in Anspruch zu nehmen?«
Nash zog seine Geldbörse hervor und wies mit einem Kopfnicken zur Wilton Crescent. »Kennt Ihr die Frau, die im dritten Haus auf dieser Seite der Chester Street wohnt?«
»Nun, wer kennt sie nicht?«, antwortete der Gefragte. »Die Comtesse de Montignac.«
»Stimmt«, sagte Nash. »Ist das ihr richtiger Name?«
Der Mann grinste. »Vermutlich nicht. Aber sie hat ranghohe Freunde, und ihr Mann ist Attaché der französischen Botschaft. Was ist Euer Wunsch, Mylord?«
»Drei Mann sollen das Haus Tag und Nacht observieren«, sagte Nash mit emotionsloser Stimme. »Ich will den Namen eines jeden wissen, der kommt oder geht, vom Kaminkehrer bis zu den Dinnergästen. Sollte die Comtesse das Haus verlassen, so wünsche ich zu erfahren, wohin sie geht, wie lange sie dort verweilt und wer sie begleitet. Erstattet Swann einmal wöchentlich Bericht. Ich werde mich von nun an nicht mehr mit Euch treffen.«
Der Mann verbeugte sich. »Es wird alles arrangiert werden.« Dann zögerte er. »Darf ich ganz offen sein, Mylord?«
Nash zog kaum merklich die dunklen Augenbrauen hoch. »Gewiss doch.«
»Seid vorsichtig, Sir«, sagte der Mann leise. »Das Diplomatische Korps ist ein Schlangennest – und die Comtesse de Montignac schlängelt sich genau in seiner Mitte. Wenn der Preis stimmt, würde sie ihre eigene Mutter verraten.«
Voller Bitterkeit verzog Nash den Mund. »Das weiß ich nur allzu gut«, sagte er. »Trotzdem danke für die Warnung.«
Kapitel 1
Ein Ball in der Hanover Street
Frühling 1828
Miss Xanthia Neville zog die Möglichkeit einer Affäre in Betracht. Genau genommen erwog sie die Möglichkeit sogar recht konkret, während sie den Blick über die zahlreichen gut aussehenden und elegant gekleideten Gentlemen gleiten ließ, die ihre Partnerinnen durch die Unwägbarkeiten eines Walzers manövrierten. Cutaways und weite Röcke wirbelten im Schein von Tausenden Kerzen durcheinander. Es wurde mit Champagner angestoßen, Seitenblicke wurden geworfen und verweilten. Alle waren heiter und unbeschwert. Niemand war allein.
Nun, so ganz stimmte das natürlich nicht, denn sie war allein. Im hohen Alter von nicht ganz dreißig Jahren – ein drohender Abgrund – war Xanthia eine eingefleischte alte Jungfer. Nichtsdestotrotz trug sie heute Abend Rot; den dunkelsten und verwegensten Ton von bordeauxrotem Samt, der auf der Pall Mall zu finden gewesen war. Sie trug den Farbton, als könnte er ein subtiles Signal innerhalb der zulässigen Grenzen von Lord Sharpes Ballsaal aussenden.
Doch vielleicht machte sie sich auch nur etwas vor und hatte zu viel von Sharpes Champagner getrunken. In diesem Land hatten unverheiratete Damen keine Affären, sondern heirateten. Selbst ihr zynischer Bruder würde einen Skandal nicht tolerieren. Fakt aber blieb, dass Xanthia, die ansonsten so vortreffliche Geschäftsfrau und geschickte Verhandlerin, keine Ahnung davon hatte, wie man diese Art von Geschäft anging. Sie konnte die gewieftesten Handelsagenten austricksen, Schiffsfrachten in drei Sprachen versenden und auf fünfzig Schritt Entfernung einen unehrlichen Zahlmeister und seine gefälschte Ladeliste erkennen, aber ihr Privatleben fühlte sich an, als wäre es für sie unberechenbar.
Und genau deshalb war auch der Gedanke an eine Liebesaffäre nichts als nur eine weitere Fantasie. Etwas Unerreichbares, das einen zu hohen Preis von ihr fordern würde, auch wenn sie die Liebe in ihrem Leben schmerzlich vermisste.
Fühlte sie sich einsam? Xanthia wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie in ihrem Leben harte Entscheidungen hatte treffen müssen – und dass sie das, meistens zumindest, sehenden Auges getan hatte. Lord Sharpes Ballsaal war voll von hübschen, jungfräulichen Debütantinnen, keine von ihnen trug Rot. Ihnen standen die vielen Möglichkeiten, die das Leben bot, noch offen. Xanthia beneidete die jungen Mädchen und hätte dennoch selbst mit der Schönsten von ihnen nicht tauschen mögen.
Sie wandte sich von dem Meer attraktiver Männer und schöner Jungfrauen ab und ging auf die Terrasse, um allein zu sein. Die Absätze ihrer Schuhe klackten leise auf den Steinen, bis das Stimmengewirr hinter ihr verstummt und auch die Musik nicht mehr zu hören war. Selbst die mutigsten Paare hatten sich nicht so tief in die Dunkelheit gewagt. Vielleicht sollte auch sie wieder umdrehen – die gehobene englische Gesellschaft schien über die seltsamsten Dinge die Stirn zu runzeln –, aber irgendetwas an der stillen Nacht zog Xanthia an.
Am entferntesten Ende der Terrasse blieb sie stehen und lehnte sich gegen die Hauswand, die noch die Wärme des ungewöhnlich milden Frühlingstages gespeichert hatte. Seit vier Monaten war sie nun schon in London, aber bis jetzt hatte sie keine richtige Wärme gespürt. Sie ließ den Kopf in den Nacken sinken und schloss die Augen, während sie das Gefühl genoss und den Rest ihres Champagners trank.
»Ach, wäre ich doch die Ursache für diesen Gesichtsausdruck«, murmelte plötzlich eine tiefe, wehmütig klingende Stimme. »Selten sehe ich eine Frau so hingerissen – es sei denn, sie ist mit mir im Bett.«
Xanthia zuckte zusammen und riss die Augen auf.
Ein groß gewachsener Mann stand vor ihr. Selbst in der Dunkelheit spürte sie die Hitze seines Blickes, mit dem er sie musterte. Sie erkannte ihn wieder, denn sie hatte ihn schon zuvor bemerkt – gelangweilt zurückgelehnt in einem Sessel im Kartenzimmer sitzend. Auch war ihr nicht entgangen, dass die Blicke der Frauen ihm gefolgt waren, als er das Zimmer verlassen hatte. Er gehörte zu der Art von Mann, die die Aufmerksamkeit einer Frau erregte; nicht unbedingt, weil er gut aussah, sondern weil er etwas ausstrahlte, das weitaus sinnlicher war als bloße Schönheit.
Xanthia hob das Kinn. »Bei Sharpe herrscht heute ein schreckliches Gedränge«, erwiderte sie abweisend. »Ich dachte, meine Flucht wäre unbemerkt geblieben.«
»Vielleicht ist sie das auch.« Seine Stimme klang dunkel. »Ich vermag es nicht zu sagen, da ich mich schon vor einer Viertelstunde hierher verzogen habe.« Er schlug einen leicht verärgerten Ton an, der Xanthia unwillkürlich zum Lachen brachte.
Der Fremde trat in das Mondlicht und betrachtete ihr leeres Champagnerglas. »Sharpe hat unbestreitbar Geschmack, was Champagner angeht, nicht wahr?«, murmelte er. »Und abgesehen von Eurem faszinierenden Gesichtsausdruck, meine Liebe, frage ich mich, ob es nicht vernünftiger von Euch wäre, in den Ballsaal zurückzukehren?«
Xanthia hatte weder seinem Vorschlag noch dessen unterschwelliger Schlussfolgerung zugehört, weil sie ganz und gar in die Betrachtung seines Gesichts vertieft war. Nein, schön war er gewiss nicht. Viel eher wiesen seine Züge eine bemerkenswerte Härte auf – eine scharf geschnittene, gerade Nase, ein strenges Kinn und außergewöhnliche, etwas eng zusammenstehende Augen. Sein Haar war dunkel und viel zu lang, um noch als elegant zu gelten. Doch am verwirrendsten war die Aura von Gefahr, die ihn umgab. Es war Xanthia unerklärlich, warum sie nicht vor ihm zurückschreckte.
»Nein«, sagte sie ruhig, »nein, ich denke, ich werde bleiben.«
Er zuckte mit den breiten Schultern. »Wie Ihr wollt, meine Liebe«, sagte er. »Ihr erinnert mich an eine Katze, die die Wärme genießt. Ist Euch kalt?«
Für einen kurzen Moment schloss Xanthia die Augen und dachte an die Sonne von Barbados zurück. »Mir ist immer kalt«, entgegnete sie. »Schon seit Ewigkeiten ist mir nicht mehr warm gewesen.«
»Wie bedauerlich.« Er beugte sich näher zu ihr und bot ihr seine Hand dar. »Ich glaube, ich hatte noch gar nicht das Vergnügen, Ma’am. Genau genommen bin ich sogar davon überzeugt, dass Ihr neu in der Stadt seid.«
Sie schaute auf seine Hand hinunter, ergriff sie aber nicht. »Und Ihr kennt jeden?«
»Das ist mein Geschäft«, erwiderte er.
»Tatsächlich?« Xanthia stellte ihr Glas auf der breiten Balustrade ab. »Und welches Geschäft betreibt Ihr?«
»Das Geschäft, Leute zu kennen.«
»Ah, Ihr seid also ein Mann der Geheimnisse«, entgegnete sie ironisch. »Und vor wem versteckt Ihr Euch hier draußen, wenn ich fragen darf? Vor einem wütenden Ehemann? Einer betrogenen Frau? Oder vor der Meute von Müttern, die ihre Töchter unter die Haube bringen will und Euch deshalb so gierig betrachtet?«
Er ließ ein kleines, betrübtes Lächeln aufblitzen. »Das habt Ihr bemerkt? Ich habe es wirklich teuflisch schwer. Man scheint von mir zu erwarten, dass ich – ach, das ist nicht weiter wichtig.«
Sie sah ihn aufmerksam an. »Erwartungen«, murmelte sie. »Ja, genau das ist das Problem, nicht wahr? Den Menschen widerstrebt es, sie zu erfüllen. Von uns wird erwartet, gewisse Dinge zu tun und gewisse Entscheidungen zu treffen – aber wenn wir den Erwartungen nicht entsprechen, nun, dann hält man uns für starrsinnig. Oder exzentrisch. Oder für schwierig – die schrecklichste Umschreibung von allen. Warum ist das so, frage ich mich?«
»Ja, warum?«, murmelte er. Sein Blick hielt den ihren stetig gefangen. »Und ich, meine Liebe, ich frage mich, ob Ihr die Art Frau seid, die das Unerwartete tut? Ihr kommt mir vor, als wäret Ihr … vielleicht ein wenig anders als die anderen im Ballsaal.«
Die anderen.
Mit diesen zwei einfachen Worten schien er eine dunkle und unverrückbare Linie zwischen ihnen beiden und, nun, zwischen allen anderen gezogen zu haben. Auch er war nicht wie diese Leute. Das spürte sie. Der plötzliche Schauer eines unergründlichen Gefühls lief ihr über den Rücken. Einen Augenblick lang war es, als sähe der Mann sie nicht an, sondern betrachtete etwas tief in ihrer Seele. Sein Blick war wachsam. Abwägend. Und doch verstehend.
Aber was stellten ihre Gedanken nur für einen Unsinn an? Was tat sie hier draußen im Dunkeln mit einem vollkommen Fremden?
Er zog seine verwirrend dunklen Augenbrauen kaum merklich in die Höhe. »Ihr seid sehr still geworden, meine Liebe.«
»Ich fürchte, ich habe nichts Interessantes zu sagen.« Xanthia lehnte sich wieder gegen die Hauswand und entspannte sich. »Ich führe ein sehr zurückgezogenes Leben und besuche im Allgemeinen keine Gesellschaften.«
»So wie ich«, bekannte er und senkte die Stimme. »Und doch … sind wir beide heute hier.«
Er beugte sich so nah zu ihr, dass sie seinen Duft einatmen konnte, eine faszinierende Mischung aus Rauch und Zitrone. Sein Blick, glutvoller jetzt, hielt den ihren gefangen, und Xanthia fühlte sich plötzlich, als würde der Steinboden unter ihren Füßen zu schwanken beginnen. Selbst in der Dunkelheit schienen seine Augen zu funkeln. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte sie ein wenig atemlos. »Ihr … Ihr tragt Ambraöl, nicht wahr?«
Er neigte den Kopf. »Unter anderem.«
»Und Neroli«, sagte sie. »Aber Ambra … ist ein seltener Duft.«
Er wirkte erfreut. »Ich bin überrascht, dass Ihr ihn kennt.«
»Ich weiß ein wenig über Gewürze und Öle.«
»Tatsächlich?«, murmelte er. »Mein Parfümeur in St. James’ importiert das Öl für mich. Mögt Ihr den Duft?«
»Ich bin nicht sicher«, erwiderte sie ehrlich.
»Dann werde ich ihn morgen nicht tragen.«
»Morgen?«
»Wenn ich Euch einen Besuch abstatte«, sagte er. »Übrigens, meine Liebe, hättet Ihr etwas dagegen, mir Euren Namen zu verraten? Auch der Name Eures Gatten würde genügen, dann kann ich mich vergewissern, wann sein Club geöffnet ist und schlussfolgern, wann er höchstwahrscheinlich außer Haus sein wird.«
»Auch ich kenne Euren Namen zwar noch nicht«, entgegnete sie neckend, »aber ich sehe, dass Ihr sehr zielstrebig seid.«
»Nun, Schüchternheit bringt einen nicht weiter, nicht wahr?«, entgegnete er lächelnd.
Xanthia stieß ein bitteres Lachen aus. »Das tut sie wahrlich nicht. Für diese Einsicht musste ich viel Lehrgeld zahlen.«
Er musterte sie einen Moment lang aufmerksam. »Nein, Ihr seht nicht aus wie der schüchterne, zurückhaltende Typ«, sagte er dann nachdenklich. »Sagt mir, meine Liebe, ob Ihr so kühn seid, wie Euer rotes Kleid es vermuten lässt?«
»In gewissen Situationen schon«, gestand Xanthia und erwiderte seinen Blick. »Wenn es etwas gibt, das man unbedingt haben will, dann muss man kühn sein.«
Als er überraschend eine Hand unter ihren Ellbogen legte, war es, als ginge etwas Elektrisierendes zwischen ihnen vor. »Ihr seid eine äußerst faszinierende Frau.« Seine Stimme erklang heiser in der Dämmerung. »Und es ist sehr lange her, seit ich … nun, das letzte Mal fasziniert gewesen bin.«
»Vielleicht verstehe ich Euch«, hörte Xanthia sich sagen. »Ich wünschte, wir könnten … oh, vergesst es. Ich bin sehr dumm, vielleicht sollte ich jetzt doch gehen.«
Aber seine Hand auf ihrem Arm hielt sie zurück. »Was?«, murmelte er. »Was wünscht Ihr, meine Liebe? Wenn es in meiner Macht steht, Euer Begehren zu erfüllen, würde ich das mit größtem Vergnügen tun.«
Seine Worte ließen sie erzittern. »Nein, es ist nichts«, antwortete sie. »Ihr seid ein gefährlich charmanter Mann, Sir. Ich denke, ich sollte wieder in den Ballsaal zurückkehren.«
»Wartet«, sagte er und zog sie zu sich. »Lasst uns einen Handel abschließen, meine Liebe. Ich werde Euch meinen Namen verraten – und in welcher Art von Geschäft ich tätig bin. Und als Gegenleistung werdet Ihr –« Er hielt inne und ließ seinen Blick erneut über Xanthia gleiten.
Sie zitterte vor Anspannung. »Was?«
»Ihr werdet mich küssen«, befahl er. »Und es wird kein schwesterlicher Kuss sein, bei Gott.«
Xanthias Augen weiteten sich vor Überraschung, aber ihre Neugierde war größer. Schließlich war sie es, die dieses dumme Katz- und Mausspiel begonnen hatte. Aber noch dümmer als das war, dass sie ihn tatsächlich küssen wollte. Sie wollte seinen festen, harten Mund spüren, wie er von ihren Lippen Besitz ergriff und –
Er wartete nicht auf ihre Zustimmung. Seine Hände lagen plötzlich auf ihren Schultern und zogen sie abrupt an sich, während seine Lippen sich fest auf ihre pressten. Er gab nicht vor, sanft zu sein oder höfliche Zurückhaltung zu üben, sondern öffnete stattdessen den Mund über ihrem und strich mit der Zunge hungrig über ihre Lippen. Das Verlangen erwachte in Xanthia, und sie öffnete sich ihm, erlaubte ihm, die Tiefen ihres Mundes mit seinen langsamen, sinnlichen Stößen zu erkunden.
In seinen Armen fühlte sie sich plötzlich lebendig, fast wie losgelöst, so als hätte sie keinen eigenen Willen mehr. Sein Wunsch war der ihre; sein rasch aufflammendes Verlangen hallte in ihr wider. Es war so lange her, seit sie geküsst worden war – und noch nie hatte es sich so wie jetzt angefühlt. Sie schlang die Arme um seinen Nacken und erlaubte seinen Händen, über ihren Körper zu gleiten, ihre Haut zu streicheln. Ihre Zungen umspielten sich, als sie heftiger zu atmen begannen. Er schmeckte nach Champagner und schierer Lust. Der rauchige Duft seines Parfüms war von verwirrender Intensität, als seine Haut sich erhitzte. Xanthia war wie gefangen in seinem Wahnsinn, drängte ihren Körper fast schamlos an seinen und erlaubte seinen forschenden Händen und seinem hungrigen Mund jede Intimität eines Liebhabers.
»Großer Gott, das ist Wahnsinn«, hörte sie sich sagen, doch ihre Stimme klang wie von weit her. Körperlos.
»Ein herrlicher Wahnsinn«, murmelte er.
Seine Hand lag jetzt auf ihrer Hüfte, streichelte sie sinnlich durch den Samt ihres Kleides. Noch einige Zentimeter tiefer, dann hob er sie drängend gegen sich. An der pochenden Härte seines Begehrens oder seiner Absicht bestand kein Zweifel mehr. Xanthia stellte sich auf die Zehenspitzen, presste sich an ihn und sehnte sich danach, mehr zu riskieren.
Irgendwie war es ihm gelungen, ihren Rock hochzuschieben, sodass er nun seine Hand daruntergleiten ließ. Er streichelte die Rundung ihrer Hüften, verwöhnte sie aufreizend. Wieder und wieder. Dann, ohne den Kuss zu lösen, drängte er Xanthia gegen die Wand des Hauses und schob die Hand zwischen sie, schob sie immer tiefer und tiefer.
Xanthia schaffte es, ihren Mund von seinem zu lösen. »Wartet, ich–«
»Wir sind allein, meine Liebe«, versicherte er ihr zwischen zwei kleinen Küssen, die er auf ihr Kinn hauchte. »Ich bin mir sicher. Vertraut mir einfach.«
Seine Worte zerschmolzen in ihr. Närrisch ergab sie sich ihm; sehnte sich nach ihm mit einem Verlangen, wie sie es noch nie gespürt hatte. Das war purer Wahnsinn. Mit einem leisen Laut des sich Ergebens presste Xanthia wieder ihren Mund auf den seinen und ließ den dunkelhaarigen Fremden gewähren, der in diesem wilden, zeitlosen Moment kein Fremder mehr zu sein schien. Er kannte sie, wusste genau, wo er sie berühren musste. Sie spürte seine Handfläche warm durch den dünnen Stoff ihrer Unterhose. Ohne seinen Mund von ihrem zu lösen, stieß er ein tiefes, hungriges Stöhnen aus und streichelte sie an ihrer intimsten Stelle. Wie eine Hure ergab sich Xanthia ihm, und ihre Knie wurden schwach. Sein Streicheln wurde drängender, sie keuchte nach ihm, genoss seine herrlichen Berührungen, während ihre Lust sich steigerte und ihr Körper zu schmerzen begann.
Sie würde explodieren. Sie konnte es nicht mehr aushalten. Die Sehnsucht in ihr war jetzt tief und zitternd. Sie fühlte die Realität davongleiten, fühlte die Dunkelheit der Nacht um sie beide und bekam, plötzlich, Angst. Bei Gott, hatte sie denn den Verstand verloren?
Er presste den Mund auf ihr Ohr und saugte leicht an ihrem Ohrläppchen. »Lass es geschehen, meine Liebe«, murmelte er und zupfte leicht an ihrem Ohr. »Großer Gott, hast du eine Ahnung, wie wunderschön du gerade bist?«
»Ich – ich denke …« Xanthia zitterte noch immer. »Oh, bitte, ich denke … wir müssen aufhören.«
Er stöhnte wie unter Schmerzen auf, aber seine Hände hielten inne.
»Aufhören«, sagte sie zu sich wie zu ihm.
Leicht ließ er seine Stirn gegen die ihre sinken. »Müssen wir das, meine Liebe?« Seine Worte kamen schwerfällig über seine Lippen. »Komm, lass uns von hier fortgehen. Verbring die Nacht in meinem Bett. Ich verspreche, dir bis zum Morgen Lust zu bereiten. Wir können alles tun, was deine Fantasie dir eingibt.«
Als sie den Kopf schüttelte, strich ihr Haar über das Mauerwerk. »Ich traue mich nicht«, gestand sie. »Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Du … du musst mich für eine Art Hure halten.«
Er war dabei, ihre Röcke glatt zu streichen. Seine Berührungen waren sanft. »Nein. Ich denke nur, dass du eine sinnliche Frau mit einem Brunnen ungestillter Bedürfnisse bist«, sagte er leise und küsste sie auf die Wange. »Und dass du mich diesen bedauerlichen Umstand beheben lassen solltest.«
Sie lachte kurz und hektisch auf. »Oh, lieber Gott, ich muss verrückt sein«, murmelte sie. »Ich habe es wirklich in Betracht gezogen – und ich weiß nicht einmal, wer du bist!«
Seine Augen schimmerten noch immer vor Verlangen, als er zurücktrat und sich überraschend formell vor ihr verbeugte. »Ich werde Nash genannt«, sagte er ruhig. »Spieler und professioneller Genussmensch. Zu Euren Diensten, Ma’am.«
Professioneller Genussmensch?
Die erschreckende Leichtfertigkeit dessen, was sie gerade getan hatte, wurde Xanthia schnell bewusst. Noch immer war sie nicht wieder zu Atem gekommen. Als sie ihren Mund öffnete, um etwas zu erwidern, kam kein Ton über ihre Lippen. Dann tat sie das Dümmste und das Peinlichste, was eine Frau tun konnte: Sie wandte sich ab und lief davon.
Sie floh über die Terrasse, ihre Gedanken waren erfüllt von Panik. Aber nichts Ungewöhnliches passierte. Keine Schritte folgten. Kein Rufen erklang. Der Lichtstrahl, der aus dem Ballsaal fiel, war nur noch wenige Meter entfernt. Kurz bevor Xanthia die Tür erreichte, war sie so geistesgegenwärtig, stehen zu bleiben, ihr Haar zu ordnen und ihr Kleid zu richten. Noch immer kein Laut. Er war ihr nicht gefolgt, Gott sei Dank.
Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Xanthias Atem ging noch immer keuchend, als sie die Hand gegen den Fensterrahmen legte und darum kämpfte, dass ihre Beine, die sich weich wie Butter anfühlten, sie wieder tragen würden, um anmutig weiterzugehen. Nun, sie hatte etwas Skandalöses tun wollen, und das hatte sie nun ganz gewiss getan. Sie hatte einem fremden Mann gestattet, sie bis zum Wahnsinn zu küssen – und fast noch weitaus mehr als das. Jetzt, ohne die Nähe seines warmen Körpers, fror sie mehr denn je und fühlte sich zittrig wie noch nie zuvor.
Wütend auf sich selbst straffte Xanthia die Schultern und betrat mit einem künstlichen Lächeln auf dem Gesicht den Ballsaal. Lieber Gott, was war sie doch für eine Närrin! Ein wenig zu viel Champagner zu trinken und sich in rührseligen Fantasien zu ergehen war das eine, sich so schamlos mit einem Fremden aufzuführen, das andere – oder, wie im Falle von Mr. Nash, einem höchst ungewöhnlichen Fremden. Aber was für eine Faszination er auch auf sie ausübte, es gab nichts Metaphysisches zwischen ihnen. Schon gar nicht hatte er in ihre Augen gesehen und ihr dabei in die Seele geschaut, um Himmels willen! Wie hatte sie nur so etwas denken können? Die lange Zeit der Enthaltsamkeit musste ihren Verstand vernebelt haben.
Nun, für sie blieb nichts zu tun, als zu Gott zu beten, dass dieser Nash ein Gentleman war. Oh, Xanthia fürchtete nicht, dass man über sie klatschte und tratschte, aber da war noch ihr Bruder Kieran, an den sie denken musste. Er hatte gerade erst sein Leben in den Griff bekommen. Außerdem gab es noch Lord und Lady Sharpe, ihre Verwandten, die sie liebte, und deren Tochter Louisa, die heute in die Gesellschaft eingeführt wurde. Xanthias ungebührliches Benehmen konnte sich negativ auf sie alle auswirken.
Mit Anstrengung gelang es ihr, einigen Leuten, die sie kannte, zuzunicken, während sie sich einen Weg durch die Menge bahnte. Sie befürchtete, wie eine benutzte Hure auszusehen, doch niemand, den sie passierte, zog auch nur eine Augenbraue hoch. Ihre Panik legte sich langsam, doch die Erinnerung an die Berührungen des Mannes wollte nicht verblassen. Lieber Himmel, sie musste ihren Bruder finden und ihn bitten, sie nach Hause zu bringen, ehe sie noch etwas unverzeihlich Dummes tat – etwa nach Mr. Nash zu suchen und ihm ihr Strumpfband zuzuwerfen.
Mit noch immer zitternder Hand hielt Xanthia einen vorbeigehenden Diener an, um ihn nach Kierans Verbleib zu fragen. Der in seiner blauen Livree prächtig anzusehende Mann verbeugte sich. »Lord Rothewell ist im Kartenzimmer, Ma’am.«
Xanthia lächelte höflich. »Sagt ihm bitte, dass ich jetzt gern gehen würde.«
Zwar wollte sie ihren Bruder nicht beim Kartenspielen stören, doch die andere Alternative war, hierzubleiben und zu riskieren, Mr. Nash noch einmal zu begegnen. Plötzlich, inmitten all der Verwirrung, traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag. Mr. Nash kannte ihren Namen nicht. Sie war davongelaufen, ehe sie ihn ihm genannt hatte, und er war ihr nicht gefolgt. Es war, als hätte er plötzlich das Interesse an ihr verloren.
Und vielleicht hatte sie mit diesem Gedanken ja recht. Vielleicht war sie ihm im Küssen nicht erfahren genug gewesen? Der Gedanke war einerseits niederschmetternd, andererseits war es vielleicht so das Beste. Mr. Nash kannte ihren Namen nicht und sie ja auch kaum den seinen. Es war so gut wie ausgeschlossen, dass sie sich jemals wiedersahen, denn sie bewegte sich nicht in der Gesellschaft – genau genommen hatte sie kaum die Zeit dazu –, und Mr. Nash hatte die uneingeschränkte Arroganz eines Mannes ausgestrahlt, der seinen Rang unter den oberen Zehntausend kannte. Und wenn Xanthia mit ihrer Vermutung nicht irrte, dann war dieser Rang ein sehr hoher. Ein Gefühl der Erleichterung durchströmte sie, und sie gewann ihre Fassung zurück.
In der Eingangshalle war Lady Sharpe dabei, sich von ihrer Schwägerin zu verabschieden. Mrs. Ambrose küsste Xanthia überschwänglich auf beide Wangen. »Xanthia, meine Liebe, Ihr müsst wirklich häufiger ausgehen«, sagte sie. »Ihr seht ja ganz blass aus.«
»Wie freundlich von Euch, Euch Sorgen um mich zu machen«, entgegnete Xanthia höflich. »Habt Ihr vielleicht Kieran gesehen?«
Mrs. Ambroses Lächeln nahm einen säuerlichen Zug an. »Ich habe ihn im Kartenzimmer zurückgelassen«, antwortete sie. »Er hat wieder eine seiner Launen.«
Lady Sharpe lachte laut auf, sobald ihre Schwägerin gegangen war. »Was ist sie doch für eine Katze, Zee«, wisperte sie, während sie einen Kuss auf Xanthias Wange hauchte. »Und wie geschmeichelt bin ich, dass meine zurückgezogen lebende Verwandtschaft tatsächlich geruht hat, zu meinem kleinen Ball zu erscheinen.«
»Oh, Pamela, wir konnten doch unmöglich Louisas Einführung in die Gesellschaft verpassen.« Xanthia beugte sich vor, um sie zu umarmen. Genau in diesem Moment schwankte Lady Sharpe leicht und fiel fast unmerklich gegen sie.
Beunruhigt legte Xanthia den Arm unter den Ellbogen ihrer Cousine. »Pamela?« Dann sagte sie zu einem der Diener gewandt: »Einen Stuhl, wenn ich bitten darf! Und Lady Sharpes Zofe. Holt sie sofort her.«
Augenblicklich wurde ein Stuhl gebracht, und Lady Sharpe ließ sich dankbar darauf nieder. »Das Gedränge und die Aufregung«, erklärte sie, während Xanthia ihren Fächer öffnete und sich vor sie kniete. »Oh, danke! Die Luft ist sehr belebend. Ich habe mich wohl ein wenig zu sehr angestrengt, aber bitte, sag Sharpe nichts davon.«
In diesem Moment tauchte Xanthias Bruder auf. »Pamela?«, sagte er erschrocken. »Du siehst höchst unwohl aus.«
Lady Sharpe errötete leicht. »Es ist nur die Hitze«, beteuerte sie. »Und vielleicht mein Alter, Kieran. Aber stell mir jetzt bitte keine weiteren Fragen, oder ich schwöre, ich werde sie dir beantworten und dich damit in große Verlegenheit bringen.«
Kieran besaß den Anstand zu erröten und schickte sofort nach seiner Kutsche. Sobald Lady Sharpes Zofe herbeigeeilt war, erhob sich Xanthia. »Mir gefällt deine Blässe nicht, Pamela«, sagte sie und zögerte, ihre Cousine zurückzulassen. »Aber jetzt höre ich mich schon so an wie Mrs. Ambrose, nicht wahr?«
Lady Sharpe schaute verlegen auf. »Nicht ganz ohne Grund«, stieß sie hervor. »Es tut mir leid, dass ich dir einen Schreck eingejagt habe.«
»Das hast du tatsächlich.« Xanthia beugte sich zu ihr und drückte ihre Hand. »Und deshalb wirst du mich morgen wiedersehen. Sagen wir zum Tee, meine Liebe, so gegen drei Uhr?«
Kapitel 2
Eine Auseinandersetzung in der Wapping High Street
Bei Anbruch der Dämmerung war die für das Frühjahr ungewöhnliche Wärme wieder der Trostlosigkeit dunkler Wolken gewichen. Das schlechte Wetter wuchs sich unbarmherzig zu etwas aus, was sich wie sieben Tage Regenwetter anfühlte. In einen Morgenrock aus cremefarbener Tussahseide stand Nash in grimmiger Stimmung am Fenster seines Schlafzimmers und starrte auf die Park Lane hinunter. Dabei nippte er hin und wieder an seinem Morgenkaffee, obwohl der Morgen schon seit Längerem vorüber war.
Nachdem Nash Lord und Lady Sharpe mit einem Dutzend brennender, unbeantworteter Fragen verlassen hatte, war er zu White’s gegangen, hatte die Stunden nach Mitternacht beim Würfelspiel verbracht – keines seiner üblichen Laster – und anschließend seiner Geliebten einen Besuch abgestattet, die in der Henrietta Street wohnte. Sowohl dieser Besuch als auch das Würfelspiel hatten ihn eher unbefriedigt zurückgelassen. Oh, er hatte Sir Henry Dunnan beim Glücksspiel eine beträchtliche Summe abgenommen, ohne besonders aufmerksam zu sein, und Lisette hatte in einem hauchdünnen Negligé aus Frankreich einfach hinreißend ausgesehen – ein Anblick, der nur von dem Gedanken getrübt worden war, wie viel ihn dieses Kleidungsstück gekostet hatte und wie sehr es in letzter Zeit zu Lisettes Gewohnheit geworden war, zu schmollen und eingeschnappt zu sein, wenn er nicht ständig um sie herumscharwenzelte.
Auch gestern Nacht hatte sie geschmollt, doch das konnte er ihr kaum verübeln, denn seine Laune war nicht die beste gewesen. Ihr Intermezzo hatte mit Tränen, Blut und drei zerbrochenen Weingläsern geendet. Nash schaute auf seine verletzte Hand und streckte sie versuchsweise. Die Wunde öffnete sich nicht. Dieses Mal war er der Nadel des Chirurgen gerade noch entkommen. Vielleicht war es ja an der Zeit, Lisette endlich den Laufpass zu geben. Doch seine Gedanken waren ganz woanders, auch wenn es ihm nicht gefiel, das zuzugeben. Nicht einmal vor sich selbst.
Nachdem sich der Schleier von Lust und Champagner gehoben hatte, war Nash klar geworden, dass er gestern Nacht etwas äußerst Dummes angestellt hatte – und etwas völlig Unnötiges noch dazu. Wie viel Zeit würde es ihn wohl kosten, den Namen der Frau in Rot herauszufinden und, noch wichtiger, ihre Verhältnisse? Eine halbe Stunde schlug er sich schon mit dem Gedanken herum, genau das zu tun. Aber er hatte es noch nicht in Angriff genommen, und jetzt war er zutiefst wütend – auf sich und vielleicht auch etwas auf sie.
Nichtsdestotrotz gelang es ihm nicht, der Erinnerung an das zu entkommen, was diese Frau und er gestern Abend auf der Terrasse getan hatten. Und welchen Preis würde er gegebenenfalls für diese wenigen Augenblicke köstlicher Versuchung bezahlen müssen? Warum hatte er sich von ihr so stark angezogen gefühlt? Es widerfuhr ihm nur äußerst selten, dass er seine Vorsicht so bereitwillig vergaß. Doch in seinen Armen war sie die Verkörperung wilder weiblicher Leidenschaft gewesen, eine Frau, die unleugbar nach all den Vergnügungen hungerte, nach denen sich auch sein Körper sehnte.
Und doch war sie wie ein unerfahrenes Schulmädchen voller Panik davongelaufen. Im Licht des Tages war es gerade dieser Widerspruch, der ihn so sehr beschäftigte.
Nun, er wollte verdammt sein, würde er sich zurücklehnen und auf den Ärger warten, der sich eventuell zusammenbraute. Während Nash die Regentropfen beobachtete, die einander die Fensterscheiben hinunterjagten, traf er eine Entscheidung. Wenn irgendwo Unheil lauerte, würde er es aufspüren, bevor es ihn entdeckte. Das Element der Überraschung war aus seiner Sicht ein stark unterschätzter Vorteil.
In diesem Moment eilte sein Kammerdiener geschäftig ins Zimmer. »Guten Morgen, Mylord!« Gibbons ging geradewegs auf das Ankleidezimmer zu. »Ich habe Euer Hemd in kaltem Wasser eingeweicht. Ich denke, der Blutfleck wird sich herauswaschen. Soll ich den Stresemann herauslegen? Oder werdet Ihr ausreiten?«
»Ja, falls der Regen nachlässt«, erwiderte Nash. »Ich habe heute Vormittag eine dringliche Angelegenheit zu erledigen.«
»Und eine unangenehme noch dazu, wie es sich anhört.« Gibbons wagte sich für Nashs Vorstellung zu weit vor. »Darf ich zu hoffen wagen, dass Ihr vorhabt, mit Miss Lyle zu brechen?«
Nash lächelte leicht. »Man wird das Künstlertemperament mit der Zeit leid«, murmelte er. »Habt Ihr überhaupt eine Ahnung, Gibbons, was diese Frau mich bereits gekostet hat?«
»Ein Vermögen. Sagt jedenfalls Mr. Swann.«
»Ah, Mr. Swann!« Nash ließ den Rest seines Kaffees in der Tasse kreisen, wobei er sich fragte, ob das Schicksal tatsächlich aus dem Kaffeesatz herauszulesen sei. Er machte sich nichts aus der englischen Sitte des Teetrinkens. »Sagt, Gibbons, tratschen alle meine Angestellten über mich? Oder tut das nur Ihr und Swann?«
»Eigentlich alle«, erwiderte Gibbons. Er war auf die Rollleiter hinaufgestiegen und machte sich am obersten Regal des Ankleidezimmers zu schaffen. »Leider Gottes führen wir ein sehr ruhiges Leben, Mylord, deshalb müssen wir uns, was die Aufregung betrifft, an Euch halten.«
»Manchmal denke ich, Gibbons, ein ruhiges Leben könnte auch mir gefallen«, sagte Nash nachdenklich. »Oder vielleicht auch nur ein maßvolleres? Vielleicht so eins, wie mein Stiefbruder es führt? Über genügend Geld zu verfügen, um angenehm leben zu können und ohne dass es einen belastet, dazu eine Karriere im Dienste der Nation. Wie wäre das, Gibbons, was meint Ihr?«
»Ich habe keine Ahnung, Sir.« Mit leisem Grummeln hievte Gibbons eine große Hutschachtel vom Regal. »Aber falls Ihr vorhabt, Euer Leben gegen das Eures Bruders zu tauschen, dann informiert uns bitte vierzehn Tage vorher darüber.«
»Was? Könnt Ihr Euch etwa nicht vorstellen, im Dienste eines prominenten Mitglieds des Unterhauses zu stehen?«
»Ihr könntet Euch meinen Dienst dann nicht mehr leisten, Sir«, erwiderte Gibbons.
Natürlich hatte er recht. Im Moment verfügte Nash über jeden Luxus, den das Leben zu bieten hatte. Jeder seiner Wünsche wurde von jemandem vorausgesehen, angefangen bei seinem Stiefelknecht über seinen französischen Koch bis hin zu Swann, seiner rechten Hand in allen geschäftlichen und außergeschäftlichen Dingen. Sie alle mussten mit einem Gehalt entlohnt werden, das ihren Lebensunterhalt deckte.
Zudem waren da noch sein Butler, sein Bankier, sein Stiefelmacher und sein Weinhändler. Sein Herrenausstatter und sein Gemüsehändler. Im Geiste fügte Nash dieser Liste noch seine Stiefmutter und seine beiden Stiefschwestern hinzu, darüber hinaus alle Bediensteten auf allen seinen Besitzungen. Seinen Stiefbruder Tony. Seine beiden Großtanten in Cumbria. Und die Bergleute in jenem Kohlebergwerk in Cornwall, das er beim Kartenspiel von Talbot gewonnen hatte und das in seiner Einfachheit fast mittelalterlich anmutete. Mit jedem Namen verband sich für ihn eine neue Pflicht, denn das bedeutete es, der Marquess of Nash zu sein. Es war ein abscheuliches Joch, das ihm um den Hals gelegt worden war, bei Gott. Und er fragte sich, ob es nicht bald noch schwerer werden würde.
»Ich vermute, Ihr werdet heute die Kutsche brauchen, Mylord.« Gibbons stand jetzt neben ihm und starrte ebenfalls in die nebeltrübe Aussicht, aus der eines Tages vielleicht wieder der Hyde Park auftauchen würde. »Es würde mir nicht gefallen, solltet Ihr Euch eine Lungenentzündung zuziehen.«
»Nun gut«, sagte Nash missmutig. Er wünschte sich, einen Namen zu tragen, der zu der ungestillten Lust passte, unter der sein Körper litt. Es war alles andere als anonym, in einer Kutsche, die ein Wappen auf dem Schlag trug, durch London zu fahren. Aber die Kutsche würde es heute wohl sein müssen. Sie war nur ein weiteres der vielen Vorrechte, die ihm aufgrund seines Titels zustanden.
Im Grunde war seine Situation fast lächerlich. Er war nicht dafür geboren worden, diesen Rang zu bekleiden. Er war lediglich der zweite Sohn eines zweiten Sohnes und hatte keinerlei Perspektive gehabt, einmal abgesehen von einer strapaziösen militärischen Karriere, einem kalten Grab und, höchstwahrscheinlich, einem türkischen Messer in seinem Rücken.
Das wäre das Leben gewesen, für das er geboren und erzogen worden war und worauf seine Mutter immer beharrt hatte. Und seltsamerweise war es das Leben gewesen, das er sich gewünscht hatte. Seine Kindheit war abenteuerlich gewesen, er war in Europa umhergereist – zumindest hatte er die damalige Zeit für abenteuerlich gehalten. Er hatte nicht verstanden, dass sie nur von einem politischen Pulverfass zum nächsten geflohen waren, bis Napoleons Flamme und Zorn den ganzen Kontinent verschlungen hatten.
Sein Bruder Petar hatte kurz davorgestanden, in die Armee Zar Alexanders I. einzutreten – und damit den unsterblichen Neid seiner jüngeren Geschwister auf sich zu ziehen –, als aus dem weit entfernten Hampshire die überraschende Nachricht St. Petersburg erreicht hatte. Ihre englischen Verwandten hätten keinen günstigeren Zeitpunkt zum Sterben wählen können, mochten sie in Frieden ruhen.
Doch leider war Gevatter Tod noch nicht fertig mit seinem Werk gewesen. Die folgenden Jahre waren hart gewesen, und nachdem alle blutigen Schlachten geschlagen und alle Totenlieder gesungen worden waren, war Nash das, was zu sein er sich weder erwartet noch gewünscht hatte.
Die Tür knarzte in ihren Angeln und holte Nash wieder zurück in die Gegenwart. Er wandte sich um und erblickte seinen Stiefbruder in der Tür. »Ah, da bist du ja, Stefan«, sagte er. »Hast du noch eine Tasse übrig? Ich schwöre, ich bin nass bis auf die Unterhosen.«
»Was für ein anschauliches Bild du da heraufbeschwörst, Tony.« Nash winkte Gibbons herbei, der bereits eine weitere Tasse in der Hand hielt. »Draußen sieht es verdammt scheußlich aus. Warum bist du hier?«
Der ehrenwerte Anthony Hayden-Worth lächelte freundlich und setzte sich in den bequemsten Sessel, der dem Tisch mitsamt Kaffeeservice am nächsten stand. »Kann ein netter Bursche nicht einfach nur seinen Bruder besuchen, um zu sehen, wie es ihm geht?«, fragte Tony und füllte seine leere Tasse.
Nash stieß sich vom Fenster ab und gesellte sich zu seinem Bruder. »Natürlich kann er das«, sagte er, »aber falls du irgendetwas brauchst, Tony –?«
Ein unergründlicher Ausdruck glitt über das Gesicht seines Stiefbruders. »Bei mir ist alles in Ordnung«, sagte er. »Trotzdem danke.«
»Jenny ist wohlauf?«, fragte Nash.
Tony zuckte mit einer Schulter. »Sie ist letzte Woche zurück nach Brierwood gefahren«, bemerkte er. »Scheint eine Vorliebe für diesen Ort entwickelt zu haben. Vielleicht vermisst sie ja auch Mamma und die Mädchen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen?«
»Sei nicht albern, Tony«, entgegnete Nash. »Brierwood ist auch Jennys Zuhause. Ich möchte, dass sie dort glücklich ist.«
»Oh, Jenny ist glücklich genug, solange ihre Rechnungen bezahlt werden.« Tonys Lächeln erlosch. »Ich vermute, sie will auch nach Frankreich reisen, während sie in Hampshire ist, und dort ein paar weitere Rechnungen produzieren.«
»Ihr Vater hat ihr dieses Mal kein Geld mehr zukommen lassen?«
Tony schüttelte den Kopf. »Ach was, wo denkst du hin. Sie ist eine verwöhnte Prinzessin, unsere Jenny. Ihr Papa droht es zwar immer wieder an, den Geldhahn abzustellen, aber über kurz oder lang flattert immer wieder ein fetter Wechsel herbei.«
»Vielleicht wäre es besser, er würde mal Ernst machen«, meinte Nash.
»Warum?«, fragte Tony gereizt. »Damit letzten Endes du ihre Rechnungen bezahlst und ich weiterhin bei dir in der Kreide stehe? Vielen Dank, nein.«
Nash setzte sich und schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein, wobei er sich bemühte, seinen Ärger im Zaum zu halten. »Ich habe mich nie in deine Ehe eingemischt, Tony«, sagte er schließlich, »und ich habe auch nicht vor, jetzt damit zu beginnen.«
Tony lächelte, und die angespannte Stimmung verflog. »Genau genommen, alter Mann, bin ich nur hergekommen, um zu hören, wie es dir letzte Nacht ergangen ist«, sagte er. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du bei White’s warst?«
Nash nahm das Friedensangebot an. »Ich bin endlich mit Lord Hastley einig geworden«, sagte er und rührte langsam seinen Kaffee um. »Er hat zugestimmt, sich von dieser Zuchtstute zu trennen – zum richtigen Preis selbstverständlich.«
Auf Tonys Gesicht breitete sich ein Grinsen aus. »Meinen Glückwunsch, Stefan! Wie, zum Teufel, hast du das angestellt?«
Nash lächelte schief. »Es war ein Akt reiner Verzweiflung, das versichere ich dir«, sagte er. »Ich habe ihn letzte Nacht auf Sharpes Ball überrumpelt.«
»Großer Gott, du warst auf einem Debütantinnenball? Dann musst du in der Tat verzweifelt gewesen sein.«
»Das war ich«, stimmte Nash zu.
Tony runzelte die Stirn, als er seinen Stiefbruder über den Tisch hinweg ansah. »Pass auf, was du bei solchen Veranstaltungen tust, Stefan«, warnte er, »oder eine von diesen gerissenen, ehestiftenden Müttern wird dich noch in eine Lage bringen, aus der auch dein Geld dich nicht freikaufen kann.«
Seine Worte jagten Nash einen Schauder über den Rücken, doch äußerlich blieb er unbewegt. »Reichtum kann einem Mann aus nahezu jeder Lage heraushelfen«, sagte er und hoffte, damit recht zu haben. »Und dann gibt es da immer noch meinen schlechten Ruf, auf den ich zurückgreifen kann, nicht wahr? Aber wie dem auch sei, ich habe Hastley in Sharpes Kartenzimmer getroffen. Der arme Teufel steckt tief in der Kreide, denn er muss eine Hochzeit finanzieren. Er war ziemlich froh über mein Geld.«
»Sind wir das nicht alle?«, erwiderte Tony lachend.
Bedächtig legte Nash seinen Kaffeelöffel aus der Hand. »Du hast Anspruch auf einen Teil der Einkünfte des Besitzes, Tony«, sagte er und wählte seine Worte sorgsam. »Vater hat das so geregelt. Ich kann es nicht rückgängig machen, selbst wenn ich es wollte – was ich nicht tue.«
Tony lächelte wieder und wechselte zu seinem Lieblingsthema, der Politik und den wachsenden Spannungen zwischen Wellington und Lord Eldon. Nash beschäftigte sich nicht oft damit, aber er wusste, dass der Konflikt Tony sehr beschäftigte. Höflich murmelte er einige Bemerkungen und nickte an den richtigen Stellen.
»Eines sage ich dir, Stefan, diese verdammte katholische Frage wird noch jemandem den Kopf kosten«, schloss Tony endlich seine Ausführungen. »Bestenfalls begeht der Premierminister langsamen politischen Selbstmord.«
»Und Ärger in der Familie ist niemals gut«, fügte Nash ironisch hinzu.
Tony lachte erneut. »Ach, übrigens, alter Bursche, das erinnert mich an etwas«, sagte er. »Mama feiert nächsten Monat ihren fünfzigsten Geburtstag.«
»Ich weiß«, sagte Nash. »Das habe ich nicht vergessen.«
»Ich glaube, ich werde ein Fest geben«, meinte Tony. »Ein größeres als ihre üblichen Dinnerpartys zum Geburtstag. Vielleicht mit einem Ball und einigen Hausgästen, die eine Woche in Brierwood bleiben werden, wenn du nichts dagegen hast.«
»Natürlich nicht«, erwiderte Nash. »Jenny wird sich über die Abwechslung freuen, nicht wahr? Ich habe gehört, dass Frauen so etwas Spaß macht.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob es Jennys Vorstellung von Abwechslung entspricht, eine Hausgesellschaft für Mamas Freunde zu organisieren«, entgegnete Tony. »Wirst du auch kommen, Stefan? Immerhin ist es dein Haus – und Mama würde sich sehr freuen.«
Um Nashs Mund lag ein kaum zu bemerkender angespannter Zug. »Wir werden sehen«, sagte er schließlich. »Was sind deine Pläne für den Tag, Tony? Werde ich dich heute Abend bei White’s sehen?«
»Ich denke nicht«, erwiderte sein Stiefbruder. »Ich habe nach dem Dinner noch eine Verabredung. Wir wollen ein wenig am Test and Corporation Act herumnörgeln, aber wenn du mich fragst, vergeuden wir damit nur unsere Zeit. Und anschließend findet ein Treffen statt, um die Strategie für die Zwischenabstimmung festzulegen.«
»Warum nimmst du dein Abendessen dann nicht hier ein?«
»Gern, wenn du mir nachsiehst, dass ich gleich danach fortmuss«, sagte Tony. »Wie es aussieht, werden sich die verdammten Diskussionen bis in die Nacht hinziehen.«
»Aber dein Sitz im Unterhaus ist doch sicher? Du bist doch wiedergewählt worden, was musst du also noch tun?«
Tony schob den Stuhl zurück und erhob sich. »Das ist das Wesen englischer Politik, Stefan. Wahlen kosten nicht einfach nur Unmengen an Geld, sie erfordern auch Engagement. Eine Hand wäscht die andere und dieser ganze Blödsinn. Und schlechte Bezirke kosten nun einmal sehr viel Geld. Du hast Glück, im Oberhaus zu sitzen, wo man sich nicht mit den Meinungen des gemeinen Volkes auseinandersetzen muss – oder mit dessen Fäusten.«
Nash lächelte und trank langsam seinen Kaffee. »Eigentlich denke ich nie über so etwas nach, Tony«, sagte er und starrte seinen Stiefbruder über den Rand der Tasse hinweg an. »Ich bin zu sehr damit beschäftigt, die Vorrechte meiner gehobenen Klasse auszuleben – und deren Laster, versteht sich.«
Sein Stiefbruder schaute finster auf ihn hinunter. »Und genau diese Art zu reden schadet deinem Ruf, Stefan«, tadelte er ihn. »Ich bitte dich, darauf zu achten – denk zumindest an Mama.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand meine Stiefmutter für meinen Charakter verantwortlich machen würde, Tony«, entgegnete Nash. »Ich mag Edwina, und sie mag mich, aber sie hat mich nicht großgezogen – leider.«
Mit welchem Argument auch immer sein Bruder gekontert hätte, Gibbons kam ihm zuvor, indem er vom Ankleidezimmer zum Fenster ging. »Ein Wunder, Mylord«, verkündete er und schaute auf die Straße hinunter. »Der Regen hat aufgehört. Ich denke, Ihr könnt nun unbeschadet hinausgehen.«
Aber Nash würde nicht einfach nur hinausgehen, er würde vielmehr in die Offensive gehen. »Wunderbar, Gibbons«, sagte er. »Veranlasst, dass mein Einspänner vorgefahren wird, und bringt mir meinen dunkelgrauen Cut.«
In Wapping klarte der Himmel erst am Nachmittag auf. Xanthia stand am Fenster ihres Büros, schaute über das obere Hafenbecken zu den St. Savior’s Docks und versuchte sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Der Londoner Regen hatte wenig dazu beigetragen, den Schiffsverkehr auf der Themse zu beruhigen, denn die Art der Geschäftigkeit wurde von Männern vorangetrieben, die jedem Wetter trotzten.
Die Londoner Docklands stellten noch immer eine ständige Faszination für Xanthia dar. Selbst jetzt, gut vier Monate nach ihrer Ankunft in London, flößte ihr das East End mit seiner Industrie und dem Handel Respekt ein. Für Xanthia war Wapping England. An ihre Kindheit in Lincolnshire hatte sie keine Erinnerung mehr. Genau genommen waren ihre Erinnerungen nie über die Zeit auf den Westindischen Inseln hinausgegangen, bis sie und Kieran vor fünf Jahren London besucht hatten, um ein zweites Büro für Neville Shipping zu eröffnen.
Aber in dem Moment, in dem ihr Schrankkoffer aus dem Schiff gehievt und auf den Kai dieser hektischen Stadt gestellt worden war, hatte Xanthia sich sofort gefühlt, als gehöre sie hierher. Nicht auf das Land oder nach Mayfair, wo ihr Haus stand, sondern hierher, inmitten von all diesem Schmutz und Gestank und der pulsierenden Aktivität. Wenn die Themse Londons Hauptschlagader war, dann war Wapping ganz gewiss dessen Herz.
An sechs Tagen der Woche brachte Kierans Kutsche Xanthia vom luxuriösen Berkeley Square den Strand und die Fleet Street entlang in diese andere Welt. Es war die der Arbeiter, der Mastenbauer und Fassbinder, der Kahnführer und Fährmänner. Der Ort, an dem schwarz gekleidete Zollbeamte mit tintenfleckigen Fingern sich neben Stadträten und Bankiers drängten. An dem die Großhändler des East Ends von ihren luxuriösen Stadthäusern am Wellclose Square heruntergeschlendert kamen, um zu beobachten, wie ihr Glück in die Hafenbecken segelte.
Entlang dieses Teils der Themse waren die Sprachen, die Läden und sogar die Kirchen ebenso englisch wie ausländisch. Die Schweden und Norweger stachen besonders hervor. Die Chinesen und die Afrikaner hatten fremd klingende Musik und exotische Nahrungsmittel eingeführt, und Franzosen und Italiener waren in Wapping genauso zu Hause wie in Cherbourg oder Genua. Es war ein wunderbarer Schmelztiegel der gesamten Menschheit.
Die Bürotür wurde geöffnet und ließ einen weiteren kühlen Luftzug in das Zimmer. Xanthia wandte sich vom Fenster ab und sah Gareth Lloyd, ihren Teilhaber, hereinkommen. Sofort ging er zu seinem Schreibtisch in der Ecke, um den grünen Ordner, den er mitgebracht hatte, dort abzulegen. »Die Belle Weather läuft ein«, sagte er. »Sie passiert gerade Limehouse Reach.«
Xanthia sah ihn überrascht an. »Was für eine unglaublich schnelle Fahrt!« Außerordentlich erfreut verließ sie ihren Platz am Fenster und trat an ihren eigenen Schreibtisch, um die Zeitpläne zu studieren. »Es ist doch alles glatt verlaufen? Ist schon jemand an Land gegangen?«
»Der Bootsmann. Er sagt, Captain Stretton habe eine zusätzliche Ladung Elfenbein auf der Fahrt um das Kap an Bord genommen.« Lloyd fuhr sich mit der Hand durch das dichte goldblonde Haar. »Unglücklicherweise sind wohl einige Zitrusfrüchte verdorben. Schwarzer Schimmelbefall. Ein Drittel soll verloren sein.«
Das war beklagenswert, kam aber nicht ganz unerwartet. Xanthia setzte sich auf ihren Stuhl und begann sich geistesabwesend die Arme zu reiben.
Lloyd ging zum Kamin und kniete sich hin. »Du frierst schon wieder.« Er sagte es, ohne sie anzusehen, und stocherte in den Kohlen herum. »Ich werde das Feuer anfachen.«
»Danke.«
Sie sah ihm schweigend zu. Als die Flammen wieder höher schlugen, trat Lloyd zu der großen Karte, die eine Wand des Büros fast ganz bedeckte, und betrachtete die blutroten Linien, in denen gelbe Nadeln steckten, von denen jede eines der Neville-Schiffe auf See darstellte. Die roten Linien waren ihre bevorzugten Handelsrouten. Lloyd hätte sie wahrscheinlich im Schlaf mit seiner Fingerspitze nachfahren können, so genau kannte er sie.
Gareth Lloyd war zu Neville Shipping gekommen, noch bevor ihr älterer Bruder vor zwölf Jahren gestorben war. Luke hatte ihn als Laufburschen für das Kontor eingestellt, aber Lloyd hatte schon bald großes Talent für Finanzen gezeigt, und die Westindischen Inseln wurden nicht gerade von fähigen Mitarbeitern überschwemmt. Jene, die die gefährliche Überfahrt riskierten, kamen auf die Inseln, um ihr eigenes Eisen zu schmieden, nicht das anderer. Und nur einige wenige von ihnen hatten Erfolg damit – wie zum Beispiel Kieran. Der Handel mit Zucker war ein lukratives Geschäft, oft sogar lukrativer als das Betreiben einer Schifffahrtslinie.
Gareth Lloyd jedoch hatte weiterhin schwer für Neville Shipping und somit im Dienste eines anderen gearbeitet. Nach Lukes Tod hatte sich die Reederei unter der Leitung einer Reihe von Geschäftsführern dahingequält, von denen jeder unehrlicher gewesen war als sein Vorgänger. Kieran hatte dem Geschäft, das ihr Bruder aufgebaut hatte, nie etwas abgewinnen können und sich stattdessen den Rücken auf den Plantagen und in den Mühlen krumm gearbeitet, die den Großteil des Familienvermögens sicherten. Xanthia hingegen hatte Luke regelmäßig und auf Schritt und Tritt begleitet, wenn er in das Büro der Reederei gegangen war. Für ihn war es die beste Lösung gewesen, um seine kleine Schwester zu beschäftigen und Schwierigkeiten zu vermeiden, da es keine weiblichen Verwandten gab, die auf sie hätten aufpassen können.
Xanthia wusste nicht mehr, wann genau sie aufgehört hatte im Büro zu spielen und ernsthaft begonnen hatte zu arbeiten. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann einer der Männer zum ersten Mal mit einem Problem zu ihr gekommen war, das gelöst, oder mit einer Entscheidung, die getroffen werden musste. Wann sie den ersten unfähigen Geschäftsführer entlassen und den Unglauben auf dessen Gesicht gesehen hatte. Aber an irgendeinem Punkt hatten selbst die Bankiers, die Händler und die Kapitäne aufgehört ihr den Kopf zu tätscheln und stattdessen angefangen zu akzeptieren, dass Xanthia eine Größe war, mit der sie zu rechnen hatten.
Mit der Zeit war die Geschäftsführung von Neville Shipping an Xanthia übergegangen und Gareth Lloyd hatte sich um den Handelsverkehr gekümmert. Kieran hatte nicht allzu sehr dagegen protestiert. Sie lebten auf Barbados; und man tat, was man tun musste mit den Ressourcen, die zur Verfügung standen. Darüber hinaus waren Xanthia und Gareth gut – verdammt gut – in dem, was sie taten. Im Verhandeln und strategischem Planen. Im Investieren und Absichern. Im Schicken von Schiffen, Geld und Waren um die halbe Welt.
Lloyd versetzte die Nadel, um den Standort der Belle Weather zu markieren, dann lehnte er sich mit der Schulter gegen den Kaminsims und warf Xanthia einen Blick zu, der ruhig, doch unergründlich war. »Du bist gestern Abend bei Lord Sharpe gewesen?«, fragte er schließlich.
»Widerstrebend, ja.« Xanthia legte den Stift aus der Hand.
»Ein Ball in Mayfair zum Höhepunkt der Saison, besucht von den Größen der Gesellschaft«, murmelte er. »Waren alle versammelt, von denen eine Frau träumen kann?«
»Einige Frauen vielleicht.« Xanthia faltete den Plan zusammen, in dem sie etwas nachgesehen hatte, und stand auf.
Gareth ging zu ihr und legte eine Hand neben sie auf den Schreibtisch. Die Spannung im Zimmer war greifbar. »Du weißt, dass du nicht zwei Leben führen kannst, Xanthia, nicht wahr?«, sagte er kühl. »Du kannst nicht Ballschönheit und Geschäftsfrau zugleich sein. Wir sind hier in England. Die Gesellschaft wird dich so nicht akzeptieren.«
»Dann soll die Gesellschaft eben verdammt sein«, entgegnete sie. Es war nicht das erste Mal in diesen letzten vier Monaten, dass dieses Thema zur Sprache kam. »Wenn meine Entscheidungen dir nicht passen, dann hättest du in Bridgetown bleiben sollen, Gareth.«
»Um was zu tun?«, gab er zurück.
Xanthia sah ihn anklagend an. »Du hattest dort Perspektiven, Gareth. Sehr gute sogar. Hancock’s hat dir eine ganze Menge mehr geboten, als Neville’s dir zahlt – selbst in Anbetracht deines kleinen Miteigentümeranteils. Hältst du mich etwa für so dumm, das nicht zu wissen? Warum also bist du immer noch hier? Das ist die Frage, die ich mir stelle.«
»Verdammt, Xanthia, du weißt, warum ich hier bin.« Er packte sie an den Schultern, bevor sie ihn wegschieben konnte, und presste seinen Mund rau auf ihren. Fordernd.
Einen Moment lang ließ sie es geschehen, lehnte sich an ihn, gab der Anspannung und der Einsamkeit nach. Er war fest und warm. Gegen ihren Willen erwachte in ihr die Erinnerung an eine lang vergangene Leidenschaft. Gareth spürte ihre Kapitulation und vertiefte den Kuss, erhob damit seinen Anspruch auf sie – so dachte er.
Aber er würde sie niemals besitzen. Was immer auch gewesen war, es war vergangen, und sie traute sich nicht, es wieder zu entfachen. Sie brauchte ihn – brauchte seine Freundschaft, sein Wissen –, aber nein, das hier, das brauchte sie nicht. Verlangen war nichts ohne Liebe. Xanthia stemmte die Hände gegen seine Schultern und zwang ihn mit überraschender Kraft zurück.
Er hob den Kopf, sein wilder heißer Blick hielt ihren fest.
»Ich sollte dich bewusstlos schlagen.« Xanthias Stimme zitterte.
Die leidenschaftliche Flamme erlosch. »Dann tu es, meine Liebe«, sagte er. »Wenn es dir hilft, dich besser damit zu fühlen, dass du eine Frau bist – und die Bedürfnisse einer Frau hast.«
Erbost zog sie ihren Arm zurück. Gareths Blick forderte sie heraus. Ließ sie frösteln. Xanthia besaß die Geistesgegenwart, die Hand sinken zu lassen und sie flach gegen die Rückenlehne ihres Stuhles zu pressen, damit Gareth nicht sehen konnte, wie sehr sie zitterte.
»Geh, Gareth«, sagte sie, ohne ihn anzusehen. »Ich bin es leid. Nimm dir das Gehalt, das dir für das kommende Vierteljahr zusteht und geh. Du bist entlassen.«