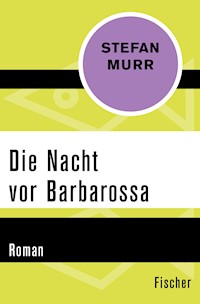4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In einem Spannungsbogen, der von 1900 bis 1945 reicht, erzählt Stefan Murr die Geschichte eines Österreichers tschechischer Nationalität, die Geschichte seines Lebenskonflikts und seines tragischen Todes. In den elementaren Umbrüchen des Jahrhunderts wird er zunächst Offizier der deutschen Abwehr im besetzten Prag, doch er lernt zu sehen und zu erkennen: Er schließt sich dem Widerstand gegen Hitler an und wird zum wichtigsten Spion der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges. Ein dramatisches und packendes Schicksal mit authentischem Hintergrund. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Ähnliche
Stefan Murr
Bis aller Glanz erlosch
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorbemerkung
Am 20. April 1945, drei Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht, starb auf den Wällen der sogenannten »Kleinen Festung« Theresienstadt durch eine illegale und wahrscheinlich intrigante Hinrichtung der angeblich niederländische Major Pieter Toman. Die Hintergründe und Einzelheiten dieses Mordes sind bis heute nicht aufgeklärt. Hinter dem niederländischen Namen verbarg sich jedoch ein anderer Mann: Paul Thümmel, ein Duzfreund Himmlers, Träger des goldenen Ehrenzeichens der NSDAP, Günstling des Führers und Vertrauter des Admirals Wilhelm Canaris, des legendären Chefs der deutschen Abwehr. In den Agentenunterlagen der British Special Operations Executive (SOE), des Secret Intelligence Service (SIS) und des heimattschechischen Widerstandes im damaligen deutschen Protektorat Böhmen und Mähren wurde er geführt unter der Kodebezeichnung A/54. Dieser Mann war einer der fähigsten Agenten der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs. Er hatte mächtige Gönner, aber übermächtige Feinde. Die führenden Männer auf beiden Seiten rangen um sein Wissen respektive sein Schweigen. Angeregt durch sein dramatisches Schicksal, habe ich die in deutscher, englischer und französischer Sprache über ihn erschienene Literatur studiert und ihn in freier Nachgestaltung wirklicher Ereignisse, aber unter anderem Namen und mit einer abgewandelten Persönlichkeit zum Protagonisten dieser Erzählung gemacht, die gleichzeitig die Entwicklung der heutigen Tschechoslowakei vom ausgehenden österreichischen Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs umfaßt.
Der Verfasser
1 Eine Beichte im Trentino
Steil aus der engen, tiefen und steinigen Schlucht aufragend, wo sich die Gebirgsbäche Ruffré und Verdés vereinigen, steht das Kloster auf seinem furchteinflößenden Felsenkegel. Es reckt sich nur bis zu den Rändern der schmalen Schlucht hinauf. Man blickt aus jeder der schießschartenähnlichen Fensteröffnungen nicht über weites Land und freundliche Dörfer, sondern auf die abschüssigen, von verwitterten und zerzausten Fichten bestandenen Abstürze der schroffen Klamm. Das Kloster ist klein. Es hat niemals in seiner Geschichte mehr als ein Dutzend Mönche beherbergt. Und seine Geschichte ist lang. Es türmt seine aus den verschiedensten Epochen stammenden Gebäudeteile aufeinander und untereinander, bis es ganz oben, noch über einer aus dem neunten Jahrhundert herrührenden romanischen Kapelle, die mit ihrer Apsis tief in den Fels hineingetrieben ist, mit einem klobigen, sechseckigen Trakt endet, dessen tief heruntergezogenes, fast flaches Ziegeldach sich über einen düsteren Wehrgang stülpt. Von diesem Wehrgang aus gehen die Zellen der Brüder ab.
In einer von ihnen lag am 23. Februar 1987 ein alter Mann im Sterben, und er wußte es. Es war nachmittags gegen fünf, und in der kargen und engen Zelle wurde es bereits dämmerig. Der alte Mann hatte sich immer gewünscht, schmerzlos und im hellen Licht des Tages sterben zu dürfen. Beides schien ihm der Herr in seinem unerforschlichen Ratschluß zu versagen. Er litt Schmerzen, denn vielleicht hatte er noch nicht genug gebüßt. Und es wurde dunkel, denn vielleicht war es der Wille des Herrn, daß er auch die Schatten der Vergangenheit, die die nahezu vierzig Jahre der Abgeschiedenheit in dem Kloster des heiligen Romedius begleitet hatten, mit hinübernahm in sein ewiges Reich. Der Mann starb ohne ärztliche Hilfe. Die schmale Straße nach Sanzeno, die unter den steilen Abstürzen der Schlucht hindurch neben dem zu eisigen Kaskaden gefrorenen Bach auf der Talsohle dahinkriecht, bis sie beginnt, sich an dem Felskegel zum Klostereingang emporzuwinden, war an den drei Stellen, wo dies jedes Jahr geschieht, von Lawinen verschüttet, so daß es vom sonnigen Nonnstal aus keine Möglichkeit gab, das Kloster zu erreichen. Der Mann starb ohne ärztliche Hilfe, aber er starb nicht ohne geistlichen Beistand. Er hatte nach dem Prior um die Sterbesakramente geschickt, mit der Bitte, ihm die Beichte abzunehmen. Der alte Mann starb fromm. Aber fromm war er nicht immer gewesen. Wichtig erschien ihm, daß er es jetzt war.
Von weit unten her aus dem verwinkelten Bau hörte er die Schritte des Priors über die endlosen, steilen eichenen Treppenläufe nahen. Der alte Mann hatte noch sehr gute Ohren. Deutlich vernahm er deshalb die gedämpften Schritte des zweiten Mannes, der hinter Pater Renatus nach oben unter das Wehrdach gestiegen kam und sich Mühe gab, den Laut seiner Sandalen zu unterdrücken. Das war Bruder Mamertus, der das Kruzifix trug, die heiligen Sterbesakramente und die Stola. Der Mann auf seiner eisernen Bettstelle in der unwirtlichen Zelle versuchte ein Lächeln. Es machte ihm nichts aus, daß Bruder Mamertus mit den Sterbesakramenten kam. Er ersehnte es jetzt sogar. Der Tod würde ihm nicht nur gnädig das Ende seiner Schmerzen gewähren, sondern auch das Ende des Denkens, der Erinnerungen, der Reue, der Sühne und der Erniedrigung. Denn der sterbende Mann glaubte jetzt daran, daß dort drüben die Reuigen zur Gnade kamen, wie es in der Schrift steht.
Als Pater Renatus die schwere Eichenholztür nach innen stieß und die Petroleumlampe mit ihrem grünen Glassturz über den Kopf hob, erhellte ihr Licht den Raum und gleichzeitig das Gesicht des Priors. Auch Pater Renatus war ein alter Mann, und seine Züge glichen der rissigen Erde eines ausgetrockneten Ackers. Seine Augen waren hell und sehr ehrlich. Er lächelte nicht und versuchte auch nicht, den sterbenden Bruder im Herrn zu trösten. Er trat in die Zelle, setzte die Lampe auf das an der Bohlenwand befestigte Klappbrett, das als Tischchen diente, kam zur Lagerstatt und strich dem Sterbenden über das schweißnasse Haar. Der alte Mann verlangte zuerst nach der Beichte. Der Prior bat den Bruder Mamertus, obwohl es kalt war, draußen unter dem tiefgezogenen Wehrdach zu warten. Als die beiden alten Männer in der Zelle allein waren, raffte der Prior die Soutane um die Schenkel und ließ sich auf dem rohen Eichenholzhocker nieder, der neben dem Bett stand.
»Wie lange ist die Zeit, die du in diesen Mauern verbracht hast und die jetzt zu Ende geht?« fragte er und faltete die Hände vor dem Leib wie für ein längeres Gespräch. »Du warst schon da, als ich hierher zum heiligen Romedius kam. Laß mich rechnen, es müssen also mehr als dreißig Jahre sein. Eine lange Spanne.«
»Es sind genau fünfunddreißig Jahre und fünf Monate, Padre Priore«, sagte der alte Mann. »Aber seit ich zum ersten Mal hier war, sind es einundvierzig Jahre und neun Monate. Damals war Pater Remigius der Prior. Das Kloster war vollgestopft mit verzweifelten Flüchtlingen und Deserteuren. Und ich war behängt mit den Patronengurten für ein Maschinengewehr, mit Handgranaten am Koppel, und auf dem Kopf trug ich den Stahlhelm der deutschen Waffen-SS.« Der alte Mann nahm eine kaum spürbare Überraschung, ein fast unmerkliches Zurückzucken seines Gegenübers wahr. Es entstand ein Schweigen, währenddessen sie den frierenden Bruder Mamertus draußen in dem dunkel werdenden Wehrgang hin- und herschlurfen hörten.
»Und damals sind also Dinge geschehen, für die du jetzt die Absolution erbittest«, sagte der Prior.
»Nicht damals«, antwortete der alte Mann. »Vorher sind Dinge geschehen, die noch heute mein Gewissen belasten. Am Ende meines Lebens. Und ich will sie beichten.«
Der Prior nahm das Kruzifix, das er um den Hals trug, deutete das Kreuzeszeichen auf Stirn und Brust von Bruder Justus an und sagte: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes: Der Herr schenke dir seine Huld. Und nun sprich, mein Sohn, Gott wird dich hören.«
Der alte Mann nickte und sagte: »In dem Bord über meinem Kopf steht das ›Breviarum Romanum‹, siehst du es?« Der Prior nickte. »Dann hol es herunter.«
Der Prior erhob sich nicht ohne Mühe, griff nach oben und entnahm dem Wandbord das Brevier.
»Schlag es auf«, sagte Bruder Justus. »An der Stelle, wo dir etwas entgegenfällt.«
Der Prior tat dem Frater den Willen. Das, was ihm entgegenfiel, war eine schon ziemlich verblichene Fotografie, ungefähr in dem Format, das auch das Brevier hatte. Der Prior mußte sie nah an den Lichtkegel der Lampe halten, um zu erkennen, was das Bild darstellte. Erst nach einer Weile begriff er. Auf der Fotografie waren elf Männer in Uniform zu sehen. Neun von ihnen standen in einer Reihe, die sich aus der vorderen rechten Ecke nach links rückwärts zog. Diese Männer trugen mit silbrigen Totenköpfen verzierte Schirmmützen, blickten provozierend in das Objektiv der Kamera und hielten ihre Karabiner in der traditionellen Präsentierhaltung des preußischen Heeres senkrecht vor dem Körper. An ihrem rechten Flügel war ein zehnter Mann zu sehen, der kein Gewehr trug. Am linken Bildrand, schon fast im Hintergrund, bildete der elfte, frontal zur Kamera, den Abschluß der Reihe, ein Offizier, wie an der silbernen Mützenkordel und dem ebenfalls silbrig glänzenden, runden Koppelschloß vor seinem Leib zu erkennen war. Diese elf Männer standen vor einer schmucklosen, weiß getünchten und von einem Stacheldrahtgeflecht gekrönten Mauer, hinter der auf der linken Seite des Fotos ein häßliches Gebäude aufragte. Ein Eckfenster war geöffnet, und wenn man genau hinsah, meinte man, eine Frau zu erkennen, die sich auf das Sims lehnte. In dieser Hinsicht konnte man sich immerhin täuschen. Nicht täuschen konnte man sich allerdings in dem durch und durch verworfenen Gesichtsausdruck der meisten dieser SS-Männer, in den mit Tinte dunkel über ihren Köpfen aufgetragenen arabischen Ziffern eins bis elf von rechts vorne nach links hinten und in der mit der gleichen Tinte und von der gleichen Hand an den unteren Bildrand gesetzten Schrift: Das Erschießungskommando von Theresienstadt.
Als Pater Renatus nach einiger Zeit begriffen hatte, was das alles bedeutete, ließ er die Hand mit der Fotografie sinken, starrte Bruder Justus an und murmelte: »Was sind das für Männer, Bruder? Wie heißen sie? Und was haben sie getan?«
»Ich habe diese Männer vorher und nachher nie wieder gesehen«, sagte Bruder Justus. »Von diesen elf Männern kenne ich nur einen einzigen. Seinen Namen findest du auf der Rückseite der Fotografie unter Nummer vier.«
Der Prior drehte die Fotografie um und entzifferte auf ihrer Rückseite nicht ohne Mühe unter Nummer vier den Namen Rudolf von Alpacher. Er murmelte diese beiden Worte vor sich hin und sah den Mönch an.
»Das bin ich«, sagte der Frater.
»Unglückseliger Mensch«, murmelte der Prior. »Du wirst doch damit nichts zu tun gehabt haben, mit der Judenvernichtung im Hitlerreich?«
»Nein, nein«, sagte der Frater. »Ich kann dich beruhigen. Damit hatte ich nichts zu tun. Jedenfalls nicht mehr als Millionen andere, die sich nicht dagegen aufgelehnt haben, als sie es erfuhren.«
Der Prior atmete erleichtert auf. »Aber was hat es dann mit dieser Fotografie auf sich, Bruder Justus?«
»Hör mir zu«, sagte der Mönch. »Ich will es dir erzählen. Es war, glaube ich, im Spätherbst des Jahres 1949. Ich hatte damals einen Hauswartsposten in der Leopoldvorstadt von Wien, als es eines Abends bei mir läutete. Ich drückte den Türöffner und ließ einen Mann ein, den ich nicht kannte. Er stolperte zu mir herunter in das Souterrain, warf sich in einen Korbstuhl und sagte, daß er Andreas Kobler heiße. ›Nie gehört‹, sagte ich, ›ich habe dich auch noch nie im Leben gesehen.‹ ›Glaube ich dir, Alpacher‹, sagte der Bursche. ›Dafür kenne ich dich und auch deinen Namen.‹ Dann zog er das Foto aus der Brusttasche, das du in der Hand hältst, Padre Priore, zeigte es mir und sagte, er sei die eigentliche Nummer vier, aber auf diesem Foto sei nun einmal nicht er, sondern ich. Und das sei für ihn gut und für mich schlecht. Ich hatte damals neben meiner Hauswartsstelle angefangen, sozusagen im dritten Hinterhof einen selbständigen Handel mit Fahrradersatzteilen und Fahrradreifen aufzubauen, wie man das halt gemacht hat damals, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das begann allmählich wirklich, ein paar Schillinge zusätzlich abzuwerfen. Mir ging es damals gar nicht so schlecht, Padre, und es sah so aus, als ob es mir nach und nach noch besser gehen sollte. Da kam dieser Kerl, warf sich in meinen Sessel und verlangte von mir, ich solle ihn an meinem Geschäft mit fünfzig Prozent beteiligen. Mit allem, was er mir anderenfalls androhte, hatte er natürlich vollständig recht. Mit Hilfe dieser Fotografie konnte er mich um meine soeben gegründete Existenz und um meine Freiheit bringen. Verfahren, Verhöre, Auslieferung an die Tschechen, die Russen, die Israelis, Todesurteil, langjährige Freiheitsstrafen … Du mußt wissen, das Theresienstädter Erschießungskommando bestand durchwegs aus Freiwilligen. Mit einem Wort: Er hatte die Vernichtung meiner zivilen Existenz in der Hand. Er drohte mir an, noch andere Beweismittel gegen mich aufzudecken, wenn ich nicht auf seine Vorschläge einginge.«
Der alte Mann schwieg. Auch der Prior schwieg. Draußen auf dem Wehrgang hörte man Bruder Mamertus hin- und herschlurfen und die Arme um den Leib schlagen, um sich warm zu machen.
»Und woher hast du dann diese Fotografie, die in Koblers Händen eine so gefährliche Waffe gegen dich gewesen wäre?« fragte der Prior. Bruder Justus antwortete zunächst auf diese Frage noch nicht, sondern sagte: »Ob ich mich an den 20. April 1945 erinnern könne, an den letzten Geburtstag unseres Führers auf dem Exekutionsglacis der ›Kleinen Festung‹ Theresienstadt. Dort hätte ich im Morgengrauen dieses 20. April einen Mann hingerichtet. Ich erinnerte mich ganz genau. Wir hätten alle diesen Mann exekutiert, sagte ich, wir alle neun, vier kniend und fünf stehend. Ich erinnere mich auch heute noch genau. Der Mann war an einen Pfahl gefesselt, man hatte ihm die Augen verbunden. Er zeigte jedoch eine höchst verwunderliche Heiterkeit. Der Mann reckte und dehnte sich an seinem Pfahl fast behaglich, als der Oberscharführer, der das Kommando hatte, befahl: ›Legt an …‹ – ›Ihr könnt mich doch gar nicht mehr meinen‹, sagte der Mann am Pfahl. ›Gebt nicht so an, ihr Nieten. Bist du auch dabei, Jöckel, du Flasche?‹ Das ›Gebt Feuer‹ des Oberscharführers ließ den Mann verstummen. Sie hatten ihm ein kragenloses weißes Hemd übergezogen. Auf das Hemd war an der Stelle, unter der das Herz saß, ein schwarzer Kreis genäht. In diesen schwarzen Kreis ließen wir Kimme und Korn einschwenken und drückten ab, als das Kommando kam. Die Salve krachte und hallte von dem Gemäuer des Wallgrabens wider, in dem sich die Erschießungsecke befand. Der Graben war voll von dem scharf riechenden Pulverqualm. Ich sah den Mann, der vor ein paar Sekunden noch gelacht hatte, mit vornübergekipptem Oberkörper an seinem Pfahl hängen, und sein Kopf baumelte ein- oder zweimal hin und her. Ich wußte das alles noch und sagte zu Kobler, daß es ein rechtmäßiges Urteil gewesen sei und eine rechtmäßige Vollstreckung. Man hätte mir das bei meiner Abkommandierung gesagt. Der Mann sei ein Hochverräter und Defätist gewesen und hätte sein Urteil verdient. Kobler lachte. ›Das glaubst auch nur du‹, sagte er zu mir. ›Wo waren denn an diesem Morgen die Vertreter der Anklage und des Gerichtsherrn, wie das vorgeschrieben ist? Wo war der Pfarrer, der Arzt? Das war doch alles Staffage.‹ Der Mann sei ein Prominenter gewesen, den sie seit Monaten hier gefangenhielten und jeden Morgen zum Schein vor den Sandhaufen stellten, damit er endlich rede. Von dem hätten allerhöchste Stellen Aussagen von allergrößter Wichtigkeit gebraucht. Sie hätten ihn dem Obersturmführer Jöckel übergeben, von dem bekannt war, daß er alle Aussagen bekam, die man brauchte. Und der hätte sich ebendieses Spielchen einfallen lassen. Sie hätten seit Wochen in ihren Karabinern Platzpatronen gehabt. ›Aber ich habe doch den Rückstoß gespürt‹, sagte ich entsetzt, und ich hätte keine Platzpatrone abgefeuert. Ich hätte schließlich lange genug scharf geschossen, um mich nicht zu irren. Ich hätte den Karabiner Nummer vier aus genau demselben Gewehrständer entnommen wie die anderen acht. Kobler zuckte nur mit den Achseln. Wie dann die scharfe Patrone in die Kammer des Gewehrs Nummer vier gekommen sei, schrie ich ihn an. Kobler zuckte wieder mit den Achseln und lachte. Sie hätten sich dann später noch darüber unterhalten: Kommt da einer, kommandiert von der Waffen-SS mit Orden und Nahkampfspange, und schießt ihnen den Kerl über den Haufen, von dem sie noch Aussagen gebraucht hätten. Bleimantelgeschoß mit abgefeilter Spitze dazu. Und dann wird ihm noch übel, dem Anfänger von der Ostfront, nach dem, was er angerichtet hat. Ob es nicht doch besser wäre, wenn ich auf seine Vorschläge einginge?«
Die Stimme des alten Mannes war schwächer geworden. Er hatte nicht mehr sehr viel Kraft und brauchte eine Pause. Der Prior spürte, wie diese Beichte den Bruder von Grund auf aufwühlte. Doch er wußte noch längst nicht alles.
»Und wie bist du zu dieser Fotografie gekommen?« wiederholte er nach einer Weile seine Frage von vorhin.
»Ich habe sie ihm weggenommen«, sagte Bruder Justus. »Er wollte dann meine Räume sehen, meine Vorräte, mein Lager. Das alles befand sich in dem geräumigen Heizungskeller. Darin stand ein enormer Kessel für Koksfeuerung, und an den Wänden hingen neben anderen Werkzeugen diese riesigen Übersetzungszangen, die man zum Öffnen und Schließen der Flansche an den Rohrleitungen braucht. Ich schwöre dir, Padre, daß es kein Vorsatz war. Als ich den Mann vor mir und die größte der Zangen, einen Meter zwanzig lang und drei Kilo schwer, in Griffweite neben mir sah, habe ich sie von der Wand genommen und den Mann erschlagen. Er war auf der Stelle tot. Ich habe die Fotografie an mich genommen, die Leiche unter dem Koks vergraben und sie dann Stück für Stück in der Kesselfeuerung verbrannt. Es hat nie jemand nach ihm gefragt.«
Bruder Justus schwieg erschöpft. Die Lippen des Priors bewegten sich in stillem, teilnehmendem Gebet. »Der Herr sei dir gnädig«, murmelte er immer wieder.
Nach einiger Zeit begann der Sterbende noch einmal zu sprechen. »Ich habe damit nichts weiter getan als das, was dieser Mann in zahllosen Fällen anderen angetan haben muß, Padre. Ich habe es nicht aus Sadismus und nicht aus Mordlust getan wie er, sondern aus Angst. Ich habe gesündigt, aber ich habe gebüßt.«
»Der Herr ist gnädig«, wiederholte der Prior. »Und Seine Güte wäret ewiglich.«
Er wußte sehr wohl, daß Bruder Justus in den langen Jahrzehnten, die er hier in San Romedio zugebracht hatte, niemals an sich selber gedacht hatte. Niemals war er den seichten Verlockungen erlegen, die Pilgertum und Tourismus den Mönchen boten. Die kleinen Zerstreuungen und Verdienstquellen, die Führungen, Ansichtskartenvertrieb, Andenken- und Devotionalienverkauf mit sich brachten, hatte er zurückgewiesen. Statt dessen hatte er jede Gelegenheit ergriffen, zu helfen und zu arbeiten, mit einer Art von Fanatismus, die dem Prior erst jetzt verständlich wurde, als er die Geschichte dieses Mannes hörte.
Allmächtiger, gnädiger Gott, der Du uns durch den heiligen Romedius gelehrt hast, den Gütern der Welt zu entsagen, um ein Leben in Einsamkeit und Gebet zu führen, sende auch mir den Heiligen Geist und gib, daß auch ich meine irdischen Wünsche den ewigen Gütern unterordne, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Prior wußte, daß Bruder Justus dieses Gebet der Bruderschaft zum heiligen Romedius ernst genommen hatte. Er hatte es in die Tat umgesetzt, wo immer Mitmenschen Hilfe brauchten. Wo eine Wöchnerin oder ein Neugeborenes starben, ein Alter dahinsiechte, Bergsteiger in Not oder Arme in Bedrängnis waren, überall dort war Bruder Justus aufgetaucht, ohne gerufen worden zu sein, und hatte geholfen. Die Bruderschaft des heiligen Romedius hatte sich, einer alten Legende zufolge, einstmals dem Schutze der letzten Braunbären in den Bergen von Trient verschrieben. Noch immer lebte Charlie, einer von ihnen, verwöhnt und fröhlich in dem Zwinger unterhalb des Haupthauses. Bruder Justus hatte dem Prior einmal gesagt, er wisse wohl, daß der Bär als Sinnbild des Schweigens, der Einsamkeit und der Geduld gelte. Heute erst erfuhr der Prior, warum der Frater wirklich nach San Romedio gekommen war.
»Und wie bist du überhaupt auf diese Fotografie gelangt?« fragte er, nachdem ihm das alles durch den Kopf gegangen war.
»Es ist der letzte und wichtigste Teil dessen, was ich dir zu sagen habe«, fuhr der alte Mann in seinem Bericht fort. »Es gibt keinen Zweifel, daß ich der Mann bin, über dessen Kopf die arabische Vier eingetragen ist. Ich bin unter diesen elf auch ein Außenseiter. Ich bin, wie du selbst sehen kannst, der einzige, der nicht so frech und provozierend in die Kamera schaut wie die anderen. Ich bin auch der einzige, der die Feldmütze eines Frontsoldaten auf dem Kopf hat und nicht die Schirmmütze mit dem Totenkopf an der Stirn. Auch ist mein Gewehrgriff falsch, denn ich habe diesen Präsentiergriff niemals gelernt. Ich kann mich nicht erinnern, daß dieses Foto aufgenommen worden ist. Aber es ist gewiß, daß ich darauf zu sehen bin. Wie ich in die Reihe dieser Mordbanditen gelangt bin, Padre Priore, ich will es dir erzählen: Ich war damals mit dreiundzwanzig Jahren Scharführer der Waffen-SS und Offiziersanwärter. In Rußland war ich verwundet worden, hier, Padre, zum Beweis …«
Der alte Mann streifte mühsam den Kuttenärmel über das linke Handgelenk hinauf, und der Prior erblickte im Lichtkegel der Petroleumlampe eine halbmondförmige, bläulich unterlaufene Narbe, die sich über den Unterarm zog.
»Ich glaube es dir«, sagte der Prior und schob den Ärmel des alten Mannes behutsam wieder nach unten. »Fahr fort, Bruder Justus.« »Ich war also verwundet worden und nur noch tauglich für den Garnisondienst in der Heimat. Der Ersatztruppenteil meiner Einheit lag in der Kaserne der alten österreichisch-ungarischen Garnison in Leitmeritz, nicht weit von Theresienstadt, wo sich dies alles – und noch mehr, Padre – ereignet hat.«
Der Prior nickte und hörte weiter zu.
»Dort war ich mit Aufgaben beschäftigt«, erzählte der alte Mann, »die mich weder ausfüllten noch befriedigten. Zur damaligen Zeit, mußt du wissen, wurden in größerem Umfang Austausche vorgenommen zwischen kriegsverwendungsfähigem Personal der sogenannten Totenkopfverbände, die die Konzentrationslager bewachten, und nicht mehr kriegsverwendungsfähigem Personal der Waffen-SS, also vor allem Verwundeten und Kranken. Es war am 18. April 1945, als ich zu dem Kommandeur meines Bataillons befohlen wurde. Mir wurde eröffnet, daß ich im Zuge eines solchen Austausches mit dem darauffolgenden Tage versetzt sei zu dem Wachbataillon des jüdischen Siedlungsgebietes Theresienstadt, wo ich mich bei dem Kommandanten, dem SS-Sturmbannführer Karl Rahm, zu melden hätte. Es sei ein vielseitiger Dienst, wurde mir gesagt, es gebe viele Freiheiten, es gebe Prominente und interessante Persönlichkeiten. Und vor allem gebe die Kommandierung Gelegenheit, alle Gerüchte zu zerstreuen, die über Vernichtungslager im Umlauf seien. Ich würde selbst sehen, es gebe in Theresienstadt weder Gasduschen noch Krematorien, das seien alles böswillige Verleumdungen und defätistische Greuelmärchen. Ich packte also meine Siebensachen und meldete mich, zusammen mit sechs anderen, am 19. April in der Kommandantur des Siedlungsgebiets bei dem genannten Rahm. Der hielt mich, als die anderen abtraten, zurück und sagte mir, daß sein Kamerad, der SS-Obersturmführer Jöckel auf der sogenannten ›Kleinen Festung‹ jenseits der Eger, einen Ersatzmann angefordert habe für die Exekution eines verurteilten Hochverräters am kommenden Morgen um sieben Uhr früh. Der Mann sei Offizier und dürfe deshalb nicht gehenkt werden. Ich versuchte natürlich Ausflüchte zu machen, ich hätte an so etwas noch nie teilgenommen, keine Erfahrung, sei verwundet. Aber Rahm schnitt alle Ausreden ab. Ob ich nicht wüßte – der SS-Mann habe zu gehorchen, hier wie anderswo. ›Meine Ehre heißt Treue‹, so stehe es auf dem Koppelschloß, und Treue sei auch Gehorsam gegenüber dem Führer. Außerdem hätte ich Kriegserfahrung und sei hart im Nehmen. Genau der richtige Mann für den Kameraden Jöckel. Mir blieb, jung wie ich war, nichts anderes übrig, als ›Jawohl‹ zu sagen und mich am nächsten Morgen eine Viertelstunde vor dem Exekutionszeitpunkt in den düsteren Kasematten der ›Kleinen Festung‹ bei dem Mann namens Jöckel zu melden. Dieser wies mich flüchtig ein und nannte mir die Nummer des Karabiners, den ich beim Heraustreten zu entnehmen hätte. Es war die Nummer vier. Ich hätte auf das entsprechende Kommando den mittleren Platz in der stehenden Reihe einzunehmen, in den Kreis auf der Brust des Delinquenten zu zielen und wie die anderen auf das Kommando ›Gebt Feuer‹ des Oberscharführers am rechten Flügel abzudrücken, exakt, denn es sei unwürdig, die Delinquenten leiden zu lassen. Es geschah alles wie befohlen. Gesprochen wurde nicht. Wie die anderen hießen, weiß ich nicht. Wir marschierten aus der Kasematte durch eine finstere Torwölbung in der Wallanlage, in drei Reihen zu je dreien, der Oberscharführer am rechten Flügel, der Obersturmführer hinterher. Wir marschierten im Gleichschritt, das hörte sich in der Morgenstille martialisch an. An dem Exekutionsplatz angelangt, stellten wir uns zuerst in einer Reihe auf, und da muß wohl die Fotografie entstanden sein. Erinnern kann ich mich daran nicht. Danach geschah dann alles, wie ich es dir schon geschildert habe.«
Der Prior hatte in der Erregung, in die ihn die Geschichte versetzt hatte, nicht sehr darauf geachtet, daß Stimme und Bewegungen des alten Mannes viel schwächer geworden waren. »Und du hattest auch danach keine Gelegenheit, der Wahrheit auf den Grund zu kommen?« fragte er, lauter und eifriger, als er es vielleicht selbst gewollt hatte.
Der alte Mann bewegte müde den Kopf hin und her. »Von dem stechenden Gestank des Pulverdampfs, von dem Anblick der zusammengesackten Gestalt an dem Pfahl, dem Toten, der noch wenige Sekunden vorher seine Peiniger verspottet hatte, wurde mir übel. Ich erbrach mich an Ort und Stelle. Zwei Männer brachten mich in eine provisorische Revierstube. Von dort wurde ich in Rahms Kübelwagen wieder ins Ghetto zurückgefahren. Auf dem kerzengeraden Damm über das Überschwemmungsgebiet kam mir ein Auto entgegen, in dem mein Vater saß, der damals ein hoher Reichsbeamter in Prag war, zusammen mit einer fremden Frau. Wie das alles wirklich zusammenhing, habe ich erst in den sechziger Jahren erfahren, als mein Vater mich hier auf dem Klosterfelsen zum ersten und einzigen Mal besuchte. Ins Ghetto zurückgekehrt, erholte ich mich und hatte nur einen Wunsch: Raus hier, nur fort … und zurück zur kämpfenden Truppe. Von dem Erlebnis dieses Morgens am 20. April 1945 wurde niemals wieder gesprochen. Als ich zurück zu meiner Einheit in die Kaserne nach Leitmeritz kam, brauchte ich um meine Versetzung zur Fronttruppe gar nicht mehr selbst einzukommen. Das war alles schon von anderen geregelt. Ich erhielt ein Himmelfahrtskommando an der oberitalienischen Front, das wahrscheinlich keiner von uns überlebt hätte, wenn nicht am 2. Mai Schluß gewesen wäre. Wir sollten die Mauer des Stausees von Santa Giustina sprengen, sobald die feindlichen Linien den See im Rücken hätten, und damit das ganze Trentino unter Wassermassen begraben. Aber die Kapitulation der Italienfront erlebte ich zusammen mit sechzehn anderen hier in diesem Kloster. In einem der Stollen, die von der Kapelle aus in den Fels getrieben sind, du kennst sie ja, Padre. Hier lernte ich den Orden kennen, sein Gebet und seine Ziele. An all das erinnerte ich mich, als ich Andreas Kobler erschlagen und verbrannt hatte, und ich wußte, daß ich nun Buße tun mußte. Zwar hatte es niemand direkt beobachtet. Aber einer hatte es doch gesehen, und der meldete sich mächtig in meiner Brust.«
»Von Kobler hast du die Wahrheit erfahren?« sagte der Prior.
Der alte Mann tat sich jetzt schon sehr schwer mit dem Reden. »Die Wahrheit … ja …«, murmelte er. »Aber noch etwas anderes, das für mich viel wichtiger war.« Der alte Mann hob den Kopf, und seine Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern.
»Bei der Exekution des Delinquenten auf den Wällen der ›Kleinen Festung‹ war ich nicht der Täter, Padre Priore, sondern nur das Werkzeug. Das erkannte ich, als ich das, was Kobler mir gesagt hatte, mit meinen eigenen Erinnerungen ergänzte. Mächtige Gruppen wollten, daß dieser Mann lebte und aussagte. Andere mächtige Personen wünschten seinen Tod. Diese haben sich mit einer satanischen Intrige durchgesetzt, und ich war ihr Werkzeug. Welche Personen das waren, und was für Gründe sie hatten, ob das politische Gründe waren, persönliche oder was sonst, ist für mich im dunkeln geblieben. Die Art meiner Einschleusung in das Erschießungskommando des Obersturmführers Jöckel und die Art meiner Beteiligung an dem Tod des Mannes, der an diesem Morgen selbst nicht an sein bevorstehendes Ende geglaubt hatte, die Art und Weise, mich dort wieder abzuschieben und auf ein Himmelfahrtskommando zu schicken, mußte von langer Hand und von hoher Stelle vorbereitet worden sein. Und von Leuten, die Macht und Erfahrung auf diesem Gebiet besaßen.«
Der alte Mann brach ab. Der Prior sagte: »Nach allem, was du erzählt hast, hätte es doch viel näher gelegen, dich wegen Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz zum Mord selbst zu exekutieren und dich auf diese Weise aus der Welt zu schaffen.«
»Du hast die Denkweise und den diabolischen Ungeist jener Zeit noch gut in Erinnerung, Padre. Ja … du hast recht. Daß ich am Leben blieb und dir heute dies alles berichten kann, verdanke ich der Wirksamkeit von Einflüssen, die mir ebenfalls verborgen geblieben sind und der Tatsache, daß die Italienfront kapitulierte, bevor … die Staumauer … die Staumauer …« Die Sprache des alten Mannes war sehr schwach geworden. Er hielt inne, wie um seine letzten Kräfte zu sammeln. »Das ist alles, was ich dir zu sagen habe, Padre Priore.«
Der Prior erkannte den nahen Tod, und er antwortete mit der Absolution: »Gott, der allmächtige Vater, hat durch Seinen Sohn die Versöhnung und den Frieden gewährt. Durch den Dienst der Kirche schenke jetzt ich dir Versöhnung und Frieden im Namen des Herrn und spreche dich los von deinen Sünden. Gehe hin in Frieden und sündige nicht mehr.«
»Ich werde nicht mehr viel Zeit dazu haben«, sagte der alte Mann mühsam, aber zufrieden. »Und das ist sehr gut so, Padre Priore.«
Der Prior erhob sich und rief Frater Mamertus von dem eisigen Wehrgang herein in die Zelle. Der Frater wußte, was seines Amtes war. Er zupfte seinem Prior die goldbestickte Stola zurecht, bis sie faltenlos über beiden Schultern lag. Er schraubte den kreuzgekrönten Verschluß des Weihgefäßes auf und goß einige Tropfen des Öls in die linke Hand des Priors. Der beugte sich über das Bett, tauchte die Kuppe des rechten Daumens in das Öl. Er befeuchtete damit die Stirn und die Innenflächen beider Hände des alten Mannes und sagte, während er über dessen Gesicht das Zeichen des Kreuzes schlug: »Durch diese Salbung und Seine unendliche Barmherzigkeit vergebe dir der Herr deine Sünden. Amen.«
Er richtete sich auf, verweilte einige Augenblicke so, nahm dann die Stola ab und gab sie an Frater Mamertus zurück. Er ließ sich wieder neben dem Bett des Sterbenden nieder und nahm die Hände des alten Mannes zwischen die seinen.
»Nach Angehörigen, Hinterbliebenen des Mannes, den du erschossen hast, soll nach ihnen nach deinem Heimgang geforscht und gesucht werden?«
Leicht, aber unmißverständlich nickte der alte Mann mit dem Kopf.
»Und der Name des Gerichteten, Frater Justus, weißt du, wie er hieß? Sein Leben? Seine Herkunft? Seine Geschichte?«
Wieder nickte der Sterbende, und der Prior näherte das Ohr seinem Mund. Aber der alte Mann löste eine seiner Hände aus denen des Priors und deutete die Bewegung des Schreibens an. Der Prior erhob sich eilig, verließ den Raum und befahl dem Bruder Mamertus, bei dem alten Mann zu verweilen, bis er wiederkomme. Dann eilte er mit geraffter Soutane und klappernden Sandalen die zahllosen Treppen nach unten, um von dort Stift und Papier zu holen, damit der alte Mann, der kaum noch sprechen konnte, Gelegenheit bekäme, den Namen des Mannes, den er damals erschossen hatte, niederzuschreiben. Die beiden zurückbleibenden Männer hörten seine Schritte in den Tiefen der hoch aufgetürmten Klosteranlage verklingen.
2 Ein Arrangement
Der Mann, dessen Geheimnis Pater Renatus zu enthüllen hoffte, war am 5. April 1897 geboren worden. Bereits dies geschah auf eine rätselhafte und vor der Öffentlichkeit verborgen gehaltene Weise, und zwar in der nordböhmischen, damals österreichischen Provinzstadt Pardubitz.
Als die Schwester Hebamme mit Schüssel und Tüchern aus dem Entbindungszimmer geeilt kam und ihr vorwurfsvoll das unwillige erste Krähen des Kindes folgte, begegnete ihr irgendwo in den düsteren, kaum erleuchteten Korridoren des alten Baus die Mutter Oberin.
»Sie haben gewartet, Mutter?« sagte die Schwester Hebamme und blieb vor der Oberin stehen.
»Natürlich«, sagte die Oberin, damals eine adlige Dame mit dem frommen Ordensnamen Mutter Lisawetha. »Tausend Kronen sind eine Menge Geld. Und dafür wollen sie nur wissen, ob es ein Knabe ist oder ein Mädchen.«
»Es ist ein Knabe«, sagte die Schwester Hebamme. »Ein Knabe«, wiederholte sie. »Er ist gesund, genau wie die Mutter, und wiegt fast sechs Pfund. Wer sind ›sie‹?«
Die Mutter Oberin, eine rundliche Person, sah verständnislos die Schwester Hebamme an, deren hartes und unbewegtes Gesicht in dem Schein einer entfernten Petroleumlampe etwas von einer hölzernen Statue hatte. »Ach so«, sagte sie dann, als ihr der Bezug der Frage klar wurde. »Sie meinen die Auftraggeber? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt zum Telefon gehen und an eine bestimmte Nummer durchgeben, daß es ein gesunder Knabe ist. Dann werde ich schon erfahren, wer das wissen will.«
Diese Erwartung der Mutter Oberin erwies sich indessen als Irrtum.
Eilig schlurfte sie durch den steingepflasterten Flur davon in Richtung Küche, die jetzt, zu später Nachtstunde, dunkel und verlassen dalag. Dort hing der Fernsprechapparat an der Wand. Die Mutter Oberin hakte das Hörrohr aus, bog die federnde Sprechmuschel auf Mundhöhe herab und nannte dem Amt die Nummer. Dann wartete sie. Man hörte, wie das Amtsfräulein umstöpselte. Zum Erstaunen der Mutter Oberin meldete sich das Wirtshaus des Dorfes Seschemitz. Dem Wirt übermittelte die Mutter Oberin die gewünschte Nachricht, und anschließend fragte sie ihn, wer denn so interessiert an der Gesundheit des Knabens sei. Aber auch der Wirt hatte eine hübsche Summe in Kronen der k.k. Währung erhalten, und zwar dafür, daß er auf diese Frage schwieg. Er hängte den Hörer wieder ein.
Während in der dunklen Klosterküche die Mutter Oberin verdutzt auf den Sprechtrichter starrte und dann ebenfalls einhängte, erhob sich in der Herrgottsecke des Gasthauses der riesige Leibjäger des Fürsten Cherček in seiner olivgrünen Livree, ließ ein Geldstück auf die Ahornplatte des Tisches klirren, stülpte den Dreispitz auf und verließ den Raum ohne ein Wort. Draußen band er seinen Braunen, dessen Satteldecke an der Ecke das fürstlich Cherčeksche Wappen trug, vom Pfosten, schwang sich auf das Pferd und trabte in die Dunkelheit davon.
Nach etwa einer halben Stunde nicht allzu hastigen Rittes trat aus der Schwärze der Aprilnacht der klobige Umriß des Schlosses hervor. Nur wenige Fenster waren erleuchtet. Das Schloß war nicht groß und in barockem Stil errichtet. Zwei Rundtürme mit Schieferhauben bildeten die Frontecken. Dazwischen erstreckte sich ein repräsentativer Wohntrakt, den eine wappengeschmückte, etwas zu bombastische Durchfahrt durchbrach. Durch diese trabte der Reiter auf einen weitläufigen Hof, der seitlich und rückwärtig von weit weniger herrschaftlichen Ökonomiegebäuden umschlossen war. Genau gegenüber der Durchfahrt, durch die der Leibjäger hereingeritten war, ging es durch ein kleineres und unauffälliges Tor wieder hinaus in die Dunkelheit. Dort lagen die ungezählten Hektar der fürstlich Cherčekschen Besitzungen, Wald, Weiden, Äcker, Gewässer, Vorwerke, Kies- und Tongruben und was sonst noch alles zum Eigentum eines Standesherrn der sogenannten ersten Wiener Gesellschaft aus den böhmischen Reichs- und Kernlanden gehörte.
Auf dem Schloßhof hielt der Reiter den Braunen an und rutschte aus dem Sattel. Er fluchte auf die feuchten Schwaden, die der schwere, böige Frühjahrswind ihm nachgepeitscht hatte, wegen seines schmerzenden Kreuzes und wegen der späten Nachtstunde. Auf dem Hof brannten nur wenige Laternen. Fast gleichzeitig tauchten aus der Dunkelheit zwei Männer auf. Einer in hellen Hemdsärmeln und wollener Weste, der dem Leibjäger die Zügel des schnaubenden Gaules abnahm und das Tier hinüber zu den Ställen führte. Der andere in der schwarzen Livree und den Kniehosen der fürstlichen Kammerdiener. »Wenn die sich verrechnet hätten mit dem Balg, wäre das noch eine Nacht in dem Posbichil seinem Wanzenloch geworden«, maulte der Leibjäger. »Ist der Herr noch auf?«
Der Bedienstete nickte. »Der gnädige Herr wartet. Du sollst sofort in die Bibliothek kommen.«
Der Zugang zu den Wohnräumen der Herrschaft befand sich in der Bogenwölbung der Tordurchfahrt. Von dort aus ging es durch einen langen Flur, in dem eng nebeneinander die eingedunkelten Ölporträts zahlreicher Cherček-Ahnen auf den Besucher herabblickten, manche hager, asketisch und pflichtenstreng, andere in rosiger Bonhomie, genießerisch und lebensfroh. Unter den Blicken dieser Herren hindurch schritten die beiden Livrierten den Korridor entlang. Es roch ein wenig nach Moder, nach dem Brennstoff der Petroleumlampen und nach dem Holzrauch des Kamins in der Bibliothek, deren Tür der Lakai nun aufzog, um den Leibjäger eintreten zu lassen.
Die beiden Männer, die in eine Schachpartie vertieft, vor dem Kamin saßen, waren äußerlich sehr verschieden. Fürst Johann Stanislav Cherček zu Maleschau und Kuttenberg hatte ein länglich-ovales Gesicht mit dunklen, großen Augen, eingefaßt von einem gepflegten, in dezentes Grau übergehenden Vollbart. Das sehr kurz geschorene Haupthaar setzte tief an auf dem hohen, wohlgeformten Schädel, der kleine, elegante Ohren sehen ließ. Der Fürst trug einen goldfarbenen Schlafrock mit weinrotem Revers, dazu ein taubenblaues Plastron. Sein Gegenüber war wesentlich jünger, noch keine dreißig, vom asketischen Typ des ebenso intelligenten wie ehrgeizigen tschechischen Intellektuellen mit scharfgeschnittenen hageren Zügen, stark vorspringender, dünner Nase und einer beginnenden, auffallend hohen Stirnglatze. Die Kopfhaut leuchtete weißlich aus einem Kranz anliegender tiefschwarzer Haare. Dieser Mann trug einen gewöhnlichen mittelgrauen Straßenanzug, dazu einen weißgestärkten Eckenkragen. Ein schwarzgeränderter Kneifer, dessen Kordel in einem Knopfloch des Revers endete, schien unmittelbar auf den hohen slawischen Backenknochen aufzusitzen.
Beide Männer sahen zur gleichen Sekunde hoch, als der Leibjäger nach kurzem Klopfen die Bibliothek betrat, in der Nähe der Tür stehenblieb und den Dreispitz abnahm. Zu Respekt vor dem Herrn erzogen und daran gewöhnt, erst zu reden, wenn er angesprochen wurde, schwieg der Bedienstete, während die beiden Herren vor dem Feuer gespannt darauf warteten, was er zu sagen hatte. Nach einer kleinen Weile fragte der Fürst ungeduldig: »Nun?«
»Der Knabe ist gesund«, meldete der Leibjäger.
Der Mann im grauen Straßenanzug blieb unbewegt, Fürst Cherček nickte. »Es ist gut, François«, sagte er. »Leg uns noch ein bisserl das Feuer nach, dann kannst du schlafen gehen. Und sag es auch Adam. Wir brauchen nichts mehr.«
Der Bedienstete legte seinen Hut beiseite und tat, wie der Fürst ihm geheißen hatte. Erst jetzt schien Fürst Johann Stanislav den böigen Wind zu bemerken, der sich an den hohen Fenstern brach und die Scheiben in unregelmäßigen Abständen leise klirren ließ. Als der Leibjäger den Raum verließ, erhob sich der Fürst. Der Besucher zog mit dem Bauern, mit dem er schon lange hatte ziehen wollen, richtete sich dann im Sitzen gerade auf und sah seinem Gastgeber zu, wie er die schweren Samtgardinen sorgfältig schloß. Auf das Feuer im Kamin hatte das eine beruhigende Wirkung.
Während sich der Kammerdiener und der Leibjäger auf dem Wege zum Gesindetrakt darüber unterhielten, welche Bedeutung die Gesundheit eines neugeborenen Knaben für die Herren wohl haben mochte, ging es in der Bibliothek um weit mehr. Es ging nicht nur um die Gesundheit des Knaben, sondern es ging um diesen Knaben selbst. Fürst Johann Stanislav wandte sich zu seinem Besucher um, schob die Hände tief in die Taschen des goldfarbenen Schlafrocks und sagte: »Es ist also ein Knabe, Česlav. Die Bedingung ist eingetreten. Sagen Sie mir jetzt, worüber Sie in diesem Falle mit mir sprechen wollten.«
Der Tscheche, der ebenfalls den Nachnamen Cherček trug, mit dem Fürsten aber in keiner Weise verwandt war, ließ sich nicht lange bitten, das offenbar schon vorher begonnene Gespräch fortzusetzen. Er sagte: »Eure Durchlaucht sind weit über die Grenzen der Monarchie hinaus bekannt als ein Ehrenmann von hohen Graden. Durchlaucht wissen, daß ich beweisen kann, nicht der Vater dieses Knaben zu sein.«
Der Fürst nickte. »Sie haben mir das bereits gesagt, Česlav. Sprechen Sie weiter.«
»Durchlaucht wissen auch, daß Růženka beschwört, daß der Erzeuger dieses Kindes nur Eure Durchlaucht sein können.«
Der Mann in dem grauen Straßenanzug hatte zuletzt undeutlich gesprochen, vor Erregung Silben verschluckt. Schließlich war er ein Angestellter – wenn auch ein hoher – des Mannes, dem er mit kalter Stirn diese Eröffnungen machte. Zwar war er gebildet, kultiviert, stammte aus alter Familie, aber das alles änderte nichts. Er war ein Tscheche, ein Angehöriger der Domestikennation, der auch François, der Leibjäger, und Adam, der Kammerdiener, entstammten, die der Fürst huldvoll zu duzen beliebte. Und seine Muttersprache war die Dienstmädchensprache, über die sich die juwelengeschmückten Standesdamen in Wien offen mokierten. Jedesmal, wenn er mit Fürst Johann Stanislav zu diskutieren hatte, mußte er mühsam alles Selbstbewußtsein zusammenkratzen und sich selbst daran erinnern, daß er, Česlav Cherček, der bevollmächtigte technische und kaufmännische Prinzipal der fürstlich Cherčekschen Maschinenfabrik war, daß er beherrschte, wovon der Fürst nichts verstand, daß er leistete, was der Fürst nicht zu erbringen vermochte. Und daß er hinter dem Fürsten gestanden war, als Johann Stanislav sich vor einigen Jahren bei der waffentechnischen Heeresverwaltung um die Entwicklung des neuen Maschinengewehrs für die kaiserlich königliche Armee beworben hatte. Nur seine Sachkunde und seine Energie hatten es ermöglicht, den Auftrag zu übernehmen. Der Fürst war von ihm abhängig, nicht er von dem Fürsten. Und dennoch, zum Teufel, hatte seine Stimme geschwankt. Hatte er das wirklich nötig? »Ihre Frau würde das also beschwören, Česlav?« sagte der Fürst vom Fenster aus, an dem er noch immer stand.
»Ja«, sagte der Tscheche, der seine Stimme wieder unter Kontrolle gebracht hatte. »Aber das ist rein theoretisch, denn weder Růženka noch ich glauben, daß Eure Durchlaucht die Vaterschaft an diesem Kinde bestreiten wollen. Auch nicht unter dem Gesichtspunkt, daß es nun ein Knabe ist.«
Eine kleine Weile schwieg der Fürst, ehe er antwortete: »Sie packen mich sozusagen am Portepee, Česlav.«
»Wo soll ich Eure Durchlaucht sonst packen?« sagte der Tscheche. »Eure Durchlaucht sind doch ein Ehrenmann. Und das muß auch zugunsten von solchen gelten, die das nicht sind, sonst ist es nichts wert, das werden Durchlaucht zugeben.«
Der Fürst näherte sich jetzt dem Feuer und blieb vor seinem Werkdirektor stehen. »Ich gebe es zu, Česlav. Und ich bekenne mich auch zu der Vaterschaft, wenn Růženka bereit ist zu schwören. Es tut mir leid, daß Sie es erfahren mußten und daß ich Ihre Frau in diese Lage gebracht habe. Aber ich sehe auch ein, daß das alles an den Tatsachen nichts mehr ändert. Was wollen Sie nun? Satisfaktion? Geld?«
»In Eurer Durchlaucht allerhöchsten Gesellschaftskreisen wäre das Kind wahrscheinlich abgetrieben worden, oder es verschwände unter einem anderen Namen in einer bürgerlichen Familie oder einem Kloster. Oder aber es wäre ein Anlaß für einen Zweikampf. Das alles geht in diesem Falle nicht. Ich bin als bürgerlicher tschechischer Ingenieur im Angestelltenverhältnis Eurer Durchlaucht nicht einmal satisfaktionsfähig.«
»Also, was dann?« fragte der Fürst, setzte sich seinem Besucher wieder gegenüber und schlug die Beine übereinander. Doch der Fabrikdirektor schwieg eine ganze Weile. Und schließlich sprach der Fürst zu Česlav Cherčeks Erleichterung alles das selbst aus, was zu sagen dem Tschechen außerordentlich schwergefallen wäre. »Ich will einmal in Ihre Haut schlüpfen, Česlav. Wir beide sind hier ganz allein und niemand hört uns zu. Durchlaucht, würde ich sagen, wenn ich Sie wäre, Durchlaucht haben mir das Verhältnis mit Růženka doch schon eingestanden, als ich um sie warb. Es bestand schon, ehe ich in die Firma kam und als Růženka noch bei Eurer Durchlaucht Kontoristin war. Es hat mich besonders bedrückt, würde ich sagen, daß es mit der Heirat nicht geendet hat. Und das hat mich von Eurer Durchlaucht auch sehr enttäuscht.«
»Das würde ich alles niemals wagen«, murmelte Česlav Cherček.
»Aber wenn Sie es wagen würden, würden Sie noch viel mehr sagen«, fuhr der Fürst fort. »Ich verstehe Eure Durchlaucht sogar, würden Sie sagen. Růženka ist ungebändigt und naturhaft. Und wenn man eine ultramoralisch-katholische Fürstin zur Frau hat, die sich des Nachts, wenn sie zu Bett geht, anzieht anstatt aus und die jede Liebesnacht ihrem Monsignore beichtet, dann wird man, wie Sie mit sechsundvierzig Jahren, durchaus einer Frau wie meiner Frau hörig.«
Der Mann auf der anderen Seite des Schachbretts machte erschrocken eine abwehrende Handbewegung und setzte zu einer Erwiderung an.
»Sagen Sie nichts«, fuhr Fürst Johann Stanislav fort. »Ich weiß, daß ich das alles einmal ausgeplaudert habe, als wir beide betrunken waren.«
»Ich habe das vergessen, Eure Durchlaucht.«
»Nichts haben Sie vergessen, Česlav. Und wenn Sie es wirklich vergessen hätten, dann wäre es Ihnen jetzt, als Růženka schwanger wurde, wieder eingefallen.«
Nur verschwommen registrierte Česlav Cherček, was es für ihn bedeutete, daß Fürst Johann Stanislav, als ob sich Schleusen geöffnet hätten, alles das selbst sagte, was ihm, Česlav, zu sagen ungeheuer schwergefallen wäre.
Noch ehe er jedoch daraus einen Nutzen ziehen konnte, sprach Fürst Cherček in verändertem Tonfall weiter: »Da haben wir die Situation also, Česlav. Eine Abtreibung haben Sie mit der Ihnen eigenen Intelligenz fürsorglich verhindert. Das Kind irgendwo unterzuschieben geht nicht, das haben Sie eben selbst gesagt, denn Růženka will es behalten. Und ein Zweikampf würde keinem von uns weiterhelfen. Was soll also geschehen?«
Der Augenblick war da, in dem Česlav Cherček gezwungen war, seinem Brotherrn die Pläne zu eröffnen, die er für den Fall gefaßt hatte, daß das Kind wirklich ein Knabe werden würde. Und der Fürst hatte es ihm sogar fast leichtgemacht, damit anzufangen.
»Eure Durchlaucht«, sagte er, »kämen in eine sehr ungünstige Lage, wenn jemals bekannt würde, daß Růženkas Kind das Kind Eurer Durchlaucht ist.«
Der Fürst hatte sich nachdenklich eine Zigarre vorbereitet und sie in Brand gesetzt. Jetzt winkte er mit der Hand, in der er sie hielt, ab. Man hätte meinen können, er wolle nur die Rauchwolke auseinanderwedeln. »Das weiß ich, Česlav. Also kommen Sie schon zur Sache.«
Doch der Tscheche ließ sich nicht beirren und fuhr da fort, wo er vor der Bemerkung Johann Stanislavs aufgehört hatte: »Eine Liaison mit einer Tänzerin oder Soubrette oder einem Mädchen aus noch niedrigerem Stand würden der Hochadel und Seine Kaiserliche Majestät Eurer Durchlaucht ja noch nachsehen und Ihre Durchlaucht, die Fürstin, auch. Aber biologische Folgen mit der Frau des Angestellten Eurer Durchlaucht, noch dazu einer Jüdin tschechischer Nationalität …« Česlav Cherček verstummte. »… wären der gesellschaftliche Ruin für mich, wollen Sie sagen«, beendete der Fürst den Satz seines Fabrikdirektors. Česlav nickte und suchte in seinem Jackett nach der Zigarrentasche. Der Fürst hielt ihm seine eigene hin, und Česlav bediente sich.
Als die Zigarre brannte, sagte er: »Es gibt für Eure Durchlaucht nur eine Möglichkeit: Ich legitimiere dieses Kind in meiner eigenen Familie als ehelich. Dafür, daß nichts Gegenteiliges bekannt wird, könnte ich garantieren. In der Familie der Mutter würde das Kind liebevoll umsorgt und exzellent erzogen. Eure Durchlaucht bräuchten für die Erziehung nicht eine einzige Krone aufzuwenden, das würde alles im Hause Česlav Cherček geschehen. Auch kümmern bräuchten Eure Durchlaucht sich nicht, und Ihre Durchlaucht, die Fürstin, wird nicht ein einziges Sterbenswort erfahren.«
Cherček brach ab und widmete sein Augenmerk der Glut seiner Zigarre, während der Fürst ihn eine lange Weile hindurch nachdenklich ansah. Als der Tscheche aufschaute, begegneten sich die Blicke der beiden Männer.
»Ich verstehe nur eines nicht«, sagte der Fürst schließlich und wechselte die Stellung seiner unter dem Schlafrock übergeschlagenen Beine. »Nicht eine einzige Krone, sagten Sie doch eben. Aber irgend etwas muß soviel selbstlose Fürsorge doch kosten. Sie können doch rechnen, wenn ich mich nicht bisher in Ihnen getäuscht habe. Worauf zielen Sie also ab, Česlav?«
Česlav Cherček wog genau Tonlage und Druckstärke ab, als er dem Fürsten antwortete, und es gelang ihm auch, locker, fast beiläufig zu sagen: »Nichts weiter als eine Unterschrift Eurer Durchlaucht.«
Fürst Cherček hob nun, aufmerksam geworden, den Kopf. »Also eine Erpressung«, sagte er nicht ohne eine gewisse Schärfe. »An was für eine Unterschrift haben Sie gedacht, Česlav?«
Die Antwort auf diese Frage hatte Česlav Cherček sich schon seit langem zurechtgelegt. »An die Unterschrift Eurer Durchlaucht unter ein Testament.« Als Fürst Cherček eine lange Weile weder sich bewegte, noch etwas sagte, sondern Česlav nur durch den Rauch seiner Zigarre hindurch anstarrte, fuhr der Tscheche fort: »Eure Durchlaucht sind der alleinige Eigentümer der riesigen Cherčekschen Liegenschaften in Schlesien und Böhmen, aber auch der von dem Herrn Vater Eurer Durchlaucht gegründeten Maschinenfabrik in Pardubitz. Eure Durchlaucht haben keine direkten ehelichen Erben und haben auch keine solchen zu erwarten. An die entfernten Verwandten, die Krone und die Kirche, gehen nach Eurer Durchlaucht Ableben das bare Vermögen, der Grundbesitz des Wiener Palais und die Liegenschaften.«
Česlav Cherček brach ab, und der Fürst nickte. Mit einer leichten Bewegung des Unterarms, wobei der Ellbogen weiter auf der Seitenlehne des Sessels ruhte, gab er seinem Gegenüber zu verstehen: Fahren Sie fort, ich höre. Der Tscheche ließ sich dazu nicht zweimal auffordern.
»Die Fabrik ist ein relativ geringfügiger Teil von Eurer Durchlaucht Vermögen. Durchlaucht können natürlich nicht die technische Kenntnis und den Hang zum Detail aufbringen, die erforderlich sind, um diese Unternehmung auf Dauer erfolgreich zu machen.« Der Fürst nickte wieder und sagte: »Deswegen habe ich Sie engagiert, Česlav, und Ihnen scheint es zu gelingen. Sie glauben, daß der nächste Krieg bestimmt kommt und daß allein Ihre Entwicklung des Maschinengewehrs …«
»Nicht allein, Eure Durchlaucht«, sagte der Tscheche. »Aber auch.«
Der Fürst legte seine Zigarre in den Aschenbecher, erhob sich, warf einen neuen Kloben in das Feuer und schob ihn mit einer langstieligen Zange nachdenklich in den Flammen zurecht. Dann nahm er die Zigarre wieder hoch, blieb stehen und sah auf seinen Besucher herab. »Und jetzt, meinen Sie, böte es sich geradezu an, Sie dadurch für Ihre Leistung zu entschädigen, daß Sie nicht nur ein überaus hohes Gehalt beziehen, sondern daß die Fabrik, die Sie in meinem Auftrag leiten, mit meinem Tode auch auf Ihre Familie übergeht.«
»Auf den Knaben …«, sagte Česlav.
Der Fürst machte eine abfällige Handbewegung. »Lassen Sie uns seriös bleiben, Česlav. Gleichzeitig auf Ihre Familie und meinen Sohn, wollen Sie sagen.«
»Durchlaucht können unmöglich etwas dagegen einzuwenden haben.«
Der Fürst schwieg und schüttelte, als er das alles noch einmal überdacht hatte, wie in Erstaunen den Kopf. »Schon weil ich gar nichts anderes tun kann«, sagte er schließlich. »Und gerade das ist es, was mir an Ihrem Plan nicht gefällt. Es ist doch eine Erpressung.«
»Wenn Sie so wollen, ist jedes Geschäft, bei dem das Interesse der einen Seite größer ist als das der anderen, eine Erpressung«, sagte Česlav. »Wenn es nur das wäre, könnte ich Eurer Durchlaucht Selbstachtung beruhigen.«
Es entstand ein langes Schweigen zwischen den beiden Männern, währenddessen die Flammen im Kamin sich des frischen Buchenklobens bemächtigten und ihn hell flackernd aufleuchten ließen.
»Es ist aber nicht nur dies, Česlav«, sagte Johann Stanislav endlich. »Ich kenne Sie nämlich zu gut, als daß ich Ihnen zutrauen würde, wegen einer schmutzigen kleinen Fabrik eine schmutzige kleine Familienintrige zu inszenieren. Sie sind ein fanatischer Idealist, und Sie denken weit über ihre eigene Person hinaus. In Ihrer Vorstellung wird dieser Boden, auf dem wir hier stehen, in zwanzig Jahren Ausland sein. Und die Fabrik, die Sie mit Ihrem Fleiß und Ihrer Intelligenz hochgebracht haben, wird ihre Maschinengewehre nicht mehr für Seine Apostolische Majestät in Wien, sondern für eine selbständige tschechische Republik in Prag produzieren. Ihr Plan mit Růženkas Kind ist gescheit, Česlav. Bewundernswert gescheit sogar. Aber er ist nicht selbstlos, wie Sie es mir einreden wollen, sondern er ist politisch. Růženkas Kind ist in Ihrem Konzept nichts weiter als eine Garantie, daß diese Fabrik, wenn der Tag der Freiheit für euch kommt, nicht österreichischmonarchistisches Eigentum ist, als welches sie beschlagnahmt werden würde, sondern tschechisches und damit von der Enteignung unberührt bliebe. Aber Ihre Rechnung wird nicht aufgehen, Česlav. Noch hat der Kaiser Macht, noch hat er fähige und ihm treu ergebene Minister, die die gottgewollte Monarchie zusammenhalten werden.«
Ein kaum merkliches Lächeln überzog bei diesen Worten Česlav Cherčeks Gesicht. Hätte der Fürst es gesehen, wäre ihm die Ironie nicht verborgen geblieben. Doch der war, während er sprach, zum Fenster gegangen. »Ich kann von Eurer Durchlaucht nicht erwarten, die Dinge so zu sehen wie ich«, sagte der Tscheche und erhob sich nun ebenfalls. »In unseren Augen ist der Boden, auf dem wir stehen, das Zentrum der auseinanderstrebenden Kräfte im Kaisertum. Es kann auf Dauer nicht gutgehen, wenn eine alte Kulturnation wie wir Tschechen, die so viel zur Blüte des Heiligen Römischen Reiches beigetragen hat, immer mehr zum Dienstboten-, Arbeiter- und Krummstiefelvolk degradiert wird und gleichzeitig das wirtschaftliche, militärische Übergewicht des Deutschtums ins Unermeßliche steigt. Schwarzenberg und Taaffe waren zwar Seiner Majestät treu ergeben, aber fähig waren sie nicht. Es ist ein Vorzeichen für den Lebensweg dieses Knaben, daß er gerade an dem Tag zur Welt gekommen ist, an dem die Sprachenverordnung des Grafen Badeni in Kraft getreten ist. Warum toben denn die Deutschen? Weil sie von jetzt an Tschechisch lernen müssen, wenn ein Tscheche in seiner Muttersprache vor die Behörden geht, während wir Tschechen die Sprache unserer deutschen Herrschaft schon seit Jahrhunderten sprechen müssen. Der Zwiespalt wird wachsen. Was hier geschehen ist, wird wie Sprengstoff wirken, auch wenn Eure Durchlaucht es nicht sehen wollen. Jawohl, Eure Durchlaucht haben recht. Mein Blick reicht in die Zukunft. Die Höllenmaschine tickt. Ihre Explosion ist abzuwarten. Auch ein neuer Windischgrätz kann nicht mehr alles zusammenkartätschen.«
Die beiden Männer standen sich jetzt im Zimmer gegenüber, aufrecht, wie zum Kampf bereit. Nach einer Weile sagte der Fürst mit ruhiger Stimme vom Fenster her, wo er stehengeblieben war: »Das Schlimme daran ist, Česlav, daß Sie mich im Zweifel darüber lassen, ob Sie nur auf die Explosion warten – oder ob Sie daran mitarbeiten, die Lunte anzuzünden. Das schlimme ist, daß ich nicht mehr weiß, ob Sie mir gegenüber persönlich loyal sind oder nicht.«
»Wenn Eure Durchlaucht das noch einmal überdenken wollen«, sagte der Tscheche, »dann werden Eure Durchlaucht zu dem Ergebnis kommen, daß ich in meiner und meiner Frau Lage schwerlich loyaler sein kann, als ich es Durchlaucht gegenüber bin.«
Der Fürst wandte sich um, zog die Gardine etwas zur Seite und sah durch die regennassen Scheiben hinaus in die mondlose Frühlingsnacht. Das Feuer knackte, die glühenden Scheite sackten funkensprühend in sich zusammen.
Nach einer langen Pause sagte Česlav vom Kamin her: »Eure Durchlaucht lehnen also ab?«
Fürst Cherček ließ die Gardine wieder vor das Fenster fallen, drehte sich um und sagte: »Nein, Česlav, ich lehne nicht ab. Ich nehme an. Und ich muß Ihnen auch noch dankbar sein.«
»Das brauchen Eure Durchlaucht nicht. Durchlaucht haben mir eine Position verschafft, wie sie nur wenige meiner Landsleute innehaben. Die Dankbarkeit ist auf meiner Seite. Die meisten Talente bei den Tschechen liegen brach.«
»Ich sagte schon, daß Ihr Plan bewunderungswürdig und weitblickend ist«, sagte der Fürst und näherte sich wieder dem Feuer, wo er vor seinem Besucher stehenblieb. »Ich befürchte nur, Sie könnten sich irren.«
»Wie meinen Durchlaucht das?« kam die Gegenfrage.
»Nun, sehen Sie mal, Sie können mit allem Fanatismus und mit sorgfältigster Erziehung das Blut nicht ändern. Meine Familie hat ein starkes Blut, sie ist seit Jahrhunderten an die Herrschaft gewöhnt. Feldmarschälle, Obersthofmeister, Minister, Landeshauptleute. So ein Blut schlägt durch, glauben Sie nicht? Glauben Sie nicht, daß der Knabe aus Ihrem Konzept ausbrechen könnte?«
»Das lassen Eure Durchlaucht nur meine Sorge sein. Auch Růčenka hat starkes Blut und dazu den subtilen Intellekt ihrer israelitischen Vorfahren. Lassen Durchlaucht das nur ruhig meine Sorge sein.«
Česlav Cherček, von seinem Sieg noch wie benommen, schien es nicht im entferntesten für möglich zu halten, daß der Partner des soeben getroffenen Arrangements noch einen Pfeil im Köcher haben könnte. Er glaubte deshalb zunächst, nicht recht zu hören, als Johann Stanislav sagte: »Daß ich auf Ihre Vorschläge eingehe, muß für Sie ein Glücksfall sein, Česlav, mit dem Sie sehr zufrieden sein können, nicht wahr? Sie konnten ja nicht wissen, wie stark ich den Familienstolz und den Hochmut des Adels hervorkehren würde. Oder auch nur die ordinäre Intransigenz des Durchschnitts. Nun, Sie haben einen Erfolg errungen, das ist wahr. Nur konnten Sie vorher nicht wissen, daß ich durchschauen würde, daß der Zweck Ihrer Aktion weit mehr ein politischer als ein privater ist.«
»Wie können Eure Durchlaucht …«
Fürst Cherček unterbrach den Tschechen fast begütigend: »Sehen Sie, Česlav, Sie wissen so gut wie ich, daß es in einem so explosiven Konflikt wie hier auch eine aufmerksame Evidenz gibt. Dieses Büro gibt laufend Berichte an den Ministerpräsidenten in Wien, und diese Berichte bekomme ich natürlich zu sehen. Darin erscheint nicht selten auch Ihr Name. In den Berichten wird gewarnt vor dem Erstarken einer Strömung, die wir in Wien die jungtschechische nennen. Wir kennen ihre strikte Abwendung von dem österreichischen Staatsgedanken und ihren demokratisch-sozialen Radikalismus. Wir wissen natürlich auch, daß sich in Ihren Reihen ein Geheimbund zu formieren beginnt, dessen Namen Sie der italienischen Maffia entlehnt haben, die einst angeblich als die Befreierin der Unterdrückten in Sizilien auftrat … Kommen Sie«, fügte er unvermittelt ein, »lassen Sie uns wieder Platz nehmen, da plaudert sich’s leichter.« Nachdem er neues Holz auf die Glut des Feuers geschichtet hatte und beide Männer sich wieder niedergelassen hatten, fuhr Johann Stanislav fort: »Meine Interessen in dieser Sache haben Sie eben sehr anschaulich geschildert. Natürlich haben auch Sie selbst an diesem Arrangement ein großes Interesse. Und zwar in vier Punkten. Einmal darin, daß Růženka dieses Kind haben will, weil sie, wenigstens bisher, von ihrem eigenen Gatten keines bekommen konnte. Zweitens wären die Folgen für Ihre eigene gesellschaftliche Position und Ihre Anstellung gar nicht abzusehen, wenn herauskäme, daß in Ihre Ehe eingebrochen worden ist und auf welche Weise. Drittens hätten Sie, wenn ich mich weigern sollte, in Ihrer politischen Herzenssache eine Schlacht verloren, was Sie Einfluß und Macht kosten würde. Und schließlich muß Růženka ja das Kloster auch wieder verlassen, die Geburt muß bekanntgegeben, die Taufe ausgerichtet werden. Wenn Sie also schon Ihr Hauptziel erreichen, werden Sie verstehen, daß auch ich Bedingungen stellen muß. Zudem ich annehme, daß Sie die Zuwendung unwiderruflich formuliert haben wollen.«
»Allerdings«, sagte Česlav nach einer Weile, vergaß sogar die gewohnte Titulierung, und seine Stimme klang weniger frisch als noch vor wenigen Minuten. »Und welche Bedingungen wären das?«
»Nun«, sagte der Fürst. »Sie werden einsehen, daß ich Ihnen nicht mit meiner bedingungslosen Zustimmung einen Offizier für Ihre antimonarchistischen und separatistischen Bestrebungen liefern kann. Für meine Zustimmung verlange ich Ihr Eingehen auf vier Bedingungen. Erstens: Die Vereinbarung schließt aus, daß jemals von irgend jemand die Behauptung erhoben werden kann, daß ich der leibliche Vater dieses Knaben sei. Zweitens: Der Knabe wird auf einer erstklassigen Anstalt zweisprachig gebildet. Drittens: Das Kind erhält einen tschechischen und einen deutschen Vornamen, und viertens wird ein großzügiges Verkehrsrecht zwischen mir und dem Knaben eingehalten, zum Beispiel, daß er sich während der Ferien bei mir in Wien aufhält.«
Als Fürst Johann Stanislav schwieg, dachte Česlav Cherček eine Weile nach und fand dann zu dem gewohnten Tonfall und seiner gewohnten Ausdrucksweise zurück: »Eure Durchlaucht haben bedacht, daß die Punkte zwei und vier weder formulierbar noch einklagbar sind.«
»Gewiß«, erwiderte der Fürst. »Aber ich kann Sie, solange die Machtverhältnisse sich nicht ändern, jederzeit entlassen. Und davon, daß die Machtverhältnisse sich nicht ändern, bin ich überzeugt. Denn sonst müßte ich Ihre Vorschläge als Vorbereitung zum Hochverrat rundweg ablehnen.«
Česlav Cherček antwortete: »Eure Durchlaucht sind Oberst der Reserve der k.k. Armee. Damit unterliegen Eure Durchlaucht auch dem Ehrenkodex der Armee. Das läßt nur zwei Möglichkeiten offen: Entweder niemand außer Eurer Durchlaucht, Růženka, dem Notar und mir erfährt von dieser Sache, oder Eure Durchlaucht müßten zur Pistole greifen.«
»Nun«, sagte der Fürst, »wenn ich dazu gezwungen würde, wäre das auch für Sie, Ihre Familie und Ihre Pläne nicht gut, Česlav. Deshalb bin ich bereit, ein Arrangement über die erste Möglichkeit mit Ihnen zu treffen. Nehmen Sie an?«
»Ich erbitte mir Bedenkzeit, Eure Durchlaucht.«
»Und bis wann?«
»Bis morgen abend, Eure Durchlaucht. Wenn ich akzeptiere, werde ich am Abend um acht Uhr mit dem Notar hier auf Schloß Seschemitz sein.«
Der Fürst nickte. »Schön, Česlav, dann könnte Ihre Frau übermorgen das Kloster verlassen, die Geburt könnte bekanntgegeben und alles übrige in die Wege geleitet werden. Wollen wir jetzt die Partie zu Ende spielen?«
»Die Partie ist zu Ende«, sagte der Tscheche, erstaunlicherweise ohne die geringste Süffisanz. »Eure Durchlaucht haben nicht darauf geachtet, daß Durchlaucht schachmatt sind.«
Es war inzwischen spät geworden. Still und, bis auf die Bibliothek, auch dunkel lag das Schloß da, als die beiden Männer ihr Gespräch beendeten und sich zur Ruhe begaben. Fürst Cherček in das Obergeschoß, wo sich seine Schlafräume befanden, sein Gast zu ebener Erde in den Westtrakt, wo er immer wohnte, wenn er auf dem Schloß war. Česlav Cherček hielt einen Leuchter mit drei brennenden Kerzen in der Hand, während er durch die dunklen Korridore schritt.